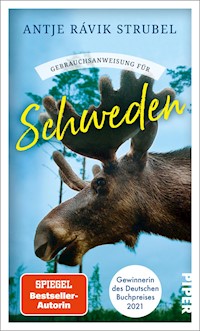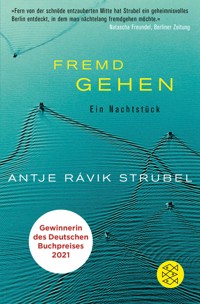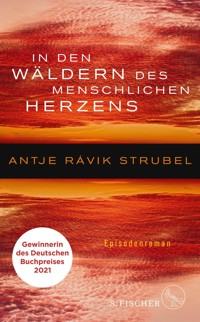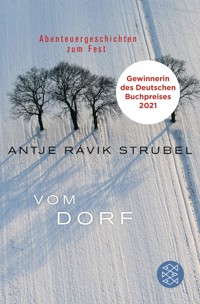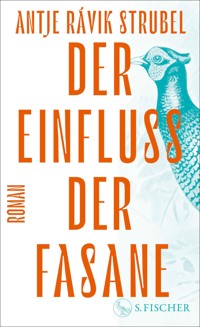
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman der Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel: Federleicht und messerscharf An einem frühen Morgen steht Hella Karl am Briefkasten und liest die Meldung, die sie aus der Bahn werfen wird: Der Star der Berliner Theaterszene und Gravitationszentrum der Kulturwelt hat sich das Leben genommen. Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Zeitung, ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und glaubt, alles im Griff zu haben. Doch sie hat einen folgenreichen Artikel über den gefeierten Mann verfasst – und jetzt wird sie für seinen Tod verantwortlich gemacht. Ist er an sich selbst gescheitert, oder hat Hella Karl ihn in den Tod geschrieben? »Der Einfluss der Fasane« erzählt heiter und packend von einer, die die Kontrolle verliert. Von den Erregungsdynamiken, die sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr steuern lassen. Ein leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, das Ringen um Worte und über das Unheil von medialen Diskursen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Antje Rávik Strubel
Der Einfluss der Fasane
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte einer Demontage: Messerscharf und federleicht
Hella Karl leitet das Feuilleton einer großen Berliner Tageszeitung. Aufgestiegen aus kleinen Verhältnissen hat sie sich ihre Position als respektierte Journalistin hart erarbeitet. Als der Intendant eines der erfolgreichsten Theater der Hauptstadt Selbstmord begeht, ahnt sie, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden wird: In einem Artikel hatte sie seinen Führungsstil als tyrannisch beschrieben, seine Methoden als frauenfeindlich. Dabei ist Hella Karl keine Verfechterin feministischer Positionen, im Gegenteil. Das Schillern mächtiger Männer zieht sie an. Doch die Erregung lässt sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr stoppen. Und während Hella Karl um ihren Ruf kämpft, gerät auch ihr Privatleben aus den Fugen. Ihr Geliebter verweigert sich dem Leben, das Hella in der Phantasie mit ihm führt.
»Der Einfluss der Fasane« erzählt heiter und packend von einer, die die Kontrolle verliert. Und von gesellschaftlichen Erregungsdynamiken, die sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr steuern lassen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Antje Rávik Strubel veröffentlichte u.a. die Romane »Unter Schnee« (2001), »Fremd Gehen. Ein Nachtstück« (2002), »Tupolew 134« (2004) sowie den Episodenroman »In den Wäldern des menschlichen Herzens« (2016). Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, ihr Roman »Kältere Schichten der Luft« (2007) war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und wurde mit dem Rheingau-Literatur-Preis sowie dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet, der Roman »Sturz der Tage in die Nacht« (2011) stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Antje Rávik Strubel wurde mit einem Stipendium in die Villa Aurora in Los Angeles eingeladen sowie als Writer in residence 2012 an das Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2019 erhielt sie den Preis der Literaturhäuser. Ihr Roman »Blaue Frau« wurde mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Im Juli 2022 erschien der Essayband »Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss«. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen u.a. Joan Didion, Lena Andersson, Lucia Berlin und Virginia Woolf. Antje Rávik Strubel lebt in Potsdam. (www.antjestrubel.de)
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Klass — Büro für Gestaltung, Hamburg
Coverabbildung: Archivist / Alamy Stock Photo / Mauritius Images
ISBN 978-3-10-491651-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Es ist mit der Wahrheit wie mit der Sonne: Ihr Wert hängt für uns einzig und allein von der richtigen Distanz ab.
Hjalmar Söderberg
Eins
Im fernen Australien nimmt sich der Ehemann einer berühmten deutschen Opernsängerin vor der herrlichen Kulisse der Sydney Opera das Leben. Aber das ist nicht das Ereignis. Das Ereignis am Morgen des 7. Mai ist folgendes: Ein Mann tötet sich, und der Tod errichtet einen soliden Schatten. Der Schatten des Mannes ist größer als zu Lebzeiten. Er ist so groß, dass er auf die weiß glänzenden Kacheln des Opernhauses fällt, auf das multiethnische Sinfonieorchester und die Casta Diva der gefeierten Sopranistin, die er alle zum Verschwinden bringt.
Hella Karl erfuhr davon aus der Zeitung. Das Blatt landete wie immer pünktlich gegen halb fünf im Briefkasten. An diesem Morgen war sie schon auf. Sie hatte schlecht geschlafen und war nach einem Toilettengang nicht ins Bett zurückgekehrt. Aus einem der Küchenfenster sah sie den gelben Ford Fiesta des Zeitungsboten wegfahren, knotete den Gürtel des Morgenrocks zu und trat vor die Tür. So erhielt sie eher, als es sonst der Fall gewesen wäre, Kenntnis von diesem überraschenden Todesfall.
Die Luft war ungewöhnlich mild. Im Osten war der wolkenlose Himmel schon hell, und in weniger als einer Stunde würden die ersten Strahlen der Sonne die Baumkronen treffen. Von fern war das Anfahren einer S-Bahn zu hören. Dann, als ginge ein Schauer durch die Luft, setzten die Vögel ein. Ein ohrenbetäubendes Gezwitscher. Es kam aus den Hecken und Bäumen der umliegenden Gärten, aus den Wiesen im Park und dem schläfrigen Schilfgürtel am Ufer; eine Explosion kreischender Stimmen. Sie trat einen Schritt zurück. Das Gartentor war kühl vom Tau.
Hella Karl, in aller Frühe im Morgenrock auf den Beinen, erfasste die Tragweite der Nachricht in einem blitzartigen Aufleuchten des Geistes, der sich daraufhin sofort wieder zu jener gewohnten Unrast verdüsterte, die durch ein Gefühlsgemenge von Überforderung und Langeweile verursacht wurde.
Sie schloss das Tor und las die knappe Meldung noch einmal. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Normalerweise hätte sie von einem solchen Ereignis nicht erst aus der Zeitung erfahren, zumal aus ihrer eigenen. Normalerweise hätte man sie angerufen, sobald diese Meldung über den Ticker gekommen wäre. Auch an ihrem freien Tag. Vielleicht wollte man sie schonen. Wahrscheinlicher war, dass jemand es verschlampt hatte. Nicht irgendjemand, sondern eine der Praktikantinnen, die ihr die Geschäftsführung aufzwang, altkluge, nichtssagende Mädchen mit langen, wie glattgebügelten Haaren, deren Eifer nicht der Sache, sondern der Karriere diente. Spätestens vor Redaktionsschluss hätte Hella Karl informiert sein müssen. Es ging nicht um irgendeinen Toten. Es ging um den Mann, dem sie den Tod gewünscht hatte.
Nicht laut. Nicht öffentlich. Ausgesprochen hatte sie das jedenfalls nie. Aber wenn sie in sich hineinhorchte, und angesichts dieser unerwarteten Meldung horchte sie für einen Moment sehr aufmerksam, musste sie zugeben, dass sie jüngst von diesem Wunsch befeuert worden war. Er sollte zur Hölle gehen. Vor die Hunde, über den Jordan. Abdanken. Abkratzen. Ins Gras beißen. Das Zeitliche segnen. Den Löffel abgeben, die Radieschen von unten betrachten. Kurz –
Sie holte Luft.
Verbal konnte sie weit ausholen. Ihre Impulse lagen dicht unter der Oberfläche. Auch ihre Träume waren zuweilen so direkt mit den Tagesereignissen verbunden, dass am nächsten Morgen manches Problem gelöst schien, was, wie sie annahm, auf einen gesunden psychischen Stoffwechsel zurückzuführen war. Ich mache aus meinem Herzen keine Schlangengrube, sagte sie gern, gespannt, ob ihr Gegenüber sie über die falsche Verwendung der Redensart belehren würde; einer ihrer Charaktertests, bei dem in der Regel ältere Männer durchfielen. Was sie damit meinte, war: Sie konnte bis auf den Grund ihres Inneren sehen.
An diesem Morgen sah sie dort das Bild des Toten. Deutlich stieg es zu ihr auf. So war er ihr vor nicht allzu langer Zeit an der Schloßbrücke begegnet. Derselbe schlecht sitzende, zerknitterte Anzug, dasselbe grobporige Gesicht mit den dicken Tränensäcken, dieselbe abscheuliche durchgeistigte Attitüde. Sie hatte sich hinter einer der Siegesgöttinnen verborgen und die Arme aufs Geländer gestützt, als wolle sie die Aussicht auf die Spree betrachten, die träge und grau unter den ersten Lichtern des Abends durch ihr Betonbett floss, und gehofft, er würde sie von hinten nicht erkennen. Aber diesen Gefallen tat er ihr nicht. Er trat neben sie. Er legte die Hände aufs Geländer, unnötig nah, wobei sein Blick sie mit einem ironischen Lächeln streifte.
»Ich hatte noch nie Ehrfurcht vor der Presse. Auch wenn die räudige Meute diesmal Ihre hübsche Visage trägt.«
Er sagte das im gleichen Tonfall, den er auch vor langer Zeit, als er noch völlig unbekannt gewesen war, auf einem Podium zu Ehren eines hochgeschätzten, betagten Theaterkritikers schon an den Tag gelegt hatte. Damals hatte er gesagt: »Ich habe keine Ehrfurcht vor den Alten. Ich will Macht.«
Auf der zugigen Schloßbrücke hatte sie ihm entgegnet: »Man muss Ihre Aufrichtigkeit einfach bewundern.«
Natürlich war das Gegenteil der Fall.
Aber so war sie, Hella Renata Karl. In Wirklichkeit wünschte sie niemandem den Tod. Sie ließ sich aber auch von niemandem unterbuttern.
Ein Typ für Morgenmäntel war sie nicht. In der dunklen Kühle des Schlafzimmers hatte sie fröstelnd nach dem Morgenmantel ihres Mannes gegriffen, der zu dieser frühen Stunde noch schlief. Sie hatte eine unklare Unruhe nicht mehr schlafen lassen. Ein Anflug von Düsterkeit hatte sie aus dem Zimmer getrieben, in dem es kühler war als in der schon frühlingswarmen Luft des Gartens. Als sie jetzt über den schmalen Weg zurück zum Haus ging, hob sie den Morgenrock ein wenig an, damit er nicht über den Kies schleifte.
Vor ihr lag das alte Steinhaus, verwunschen in der morgendlichen Stille. Die Front war mit Weinranken bewachsen. Die Fenster der großen Veranda im Erdgeschoss zeigten nach Süden, zum See. Hinter dem Haus, von der Straße nicht einsehbar, lag eine überdachte Terrasse mit verwitterten Terrakottafliesen. Das kleine Anwesen mit Walmdach, das aus den 1930er Jahren stammte, war in diesen Zeiten viel wert. Im hinteren Teil des Gartens wuchsen wilde Brombeeren.
Das Radio des Nachbarn, das sonst im Dauermodus lief, war so früh am Morgen noch nicht eingeschaltet. Normalerweise hätte es nach einer solchen Meldung nicht lange gedauert, bis auf irgendeinem Sender Kai Hochwerth zu hören gewesen wäre. Bei einer Tragödie wie dieser wäre Hochwerth sofort um einen Kommentar gebeten worden. Auch ungebeten hätte er sich geäußert, weshalb ihr sein Schweigen im Laufe des Morgens nur umso bewusster wurde. Öffentlich Stellung zu beziehen, gehörte für jemanden wie Hochwerth zum Berufsethos. Nicht, dass ihr seine Stimme an diesem Vormittag fehlte. Es wäre nur aufschlussreich gewesen zu erfahren, wie er sich zu einem solchen Vorfall geäußert hätte.
Er hätte nicht über die Verzweiflung des Täters, sondern über die geistige Armseligkeit und das Pathos der Tat gesprochen. Er hätte die Tat ins Lächerliche gezogen. Das Ganze war eine Zumutung, hätte er gesagt. Hella Karl konnte ihn fast durch die Johannisbeersträucher hindurch hören. Ein massiger, von Wein und Bluthochdruck unablässig gepushter toter Körper hinter den Kulissen einer weltberühmten Oper; eine Zumutung für Künstler und Publikum! Und erst die Kosten. Was allein die Überführung der Leiche vom anderen Ende der Welt kostete! Die Ehefrau, die ihre Tournee abbrechen musste, hätte Kai Hochwerth nicht erwähnt. Aber er hätte sich, davon war Hella überzeugt, daran ergötzt, dass die deutsche Kulturszene einen fetten neuen Skandal hatte.
Der Mensch muss den Mund aufmachen, hatte Hochwerth einmal zu ihr gesagt, wenn er im Leben vorankommen will; eine Maxime, der auch sie treu war. Hochwerth war dieser Maxime schon gefolgt, bevor er Intendant einer großen Kultureinrichtung in der deutschen Hauptstadt geworden war und sich noch mit Kleinstadthonoratioren und den knappen Budgets von Landestheatern herumgeschlagen hatte. Er machte den Mund auf. Das tat er auch, wenn die Angelegenheit nur indirekt mit ihm zu tun hatte. Die Angelegenheit am Morgen des 7. Mai betraf ihn direkt.
Aber Kai Hochwerth konnte den Mund nicht mehr aufmachen. Man äußert sich nicht nachträglich zu seinem eigenen Todesfall.
Eine Weinranke hatte sich gelöst und baumelte vom Gebälk über der Haustür. Hella unterdrückte den Impuls, sie abzureißen. Dann hätten sich weitere Ranken gelöst, die wiederum andere mit sich gerissen hätten, und ein Trommelhagel aus Putzbröckchen und vertrockneten Trauben wäre auf sie niedergegangen. Der Wein reifte nie aus. Die Trauben blieben sauer. Im Frühsommer krochen Wespen in die Blüten, um den klebrigen Saft herauszulutschen, und webten das Haus in ein endloses, eintöniges Gesumme. Die ersten Früchte im Spätsommer fraßen die Vögel, die im Vorbeiflug an die Fensterscheiben kackten, ein violetter ätzender Dünnschiss, der schwer abging und sich, wenn er die Rahmen traf, ins Holz fraß. Sie hatte ihren Mann gebeten, die Weinranken entfernen zu lassen, die noch von den Vorbesitzern stammten. Aber T hatte plötzlich diesen Flitz für alte Gemäuer entwickelt. Er fing an, von der Romantik restaurierter Ruinen zu schwärmen, etwas, das ihr völlig abging. Als ihr Streit eskalierte, hatte sie ihn erst nostalgisch und später reaktionär genannt, und er hatte sich zu der Behauptung verstiegen, das Haus überhaupt nur wegen der Weinranken gekauft zu haben.
In Flur und Küche war es still. Sie füllte Kaffeepulver in die Espressokanne auf dem Herd und stellte die Kochplatte an. T wachte ohne Wecker nie so früh auf. Den Wecker hatte er heute nicht gestellt. Es war ihr freier Tag und damit in gewisser Weise auch seiner. Dass er angefangen hatte, seine Tage nach ihr auszurichten, war eine Folge ihrer Arbeit. So durfte es nicht weitergehen, das wusste sie. Das hatte sie schon oft beschlossen. Sein Unmut war vorhersehbar. Und käme es schlimm, dann stünde sie, wie schon einmal, vor Scherben.
Der Tag versprach heiter und warm zu werden. Ihn im Paddelboot auf dem Wasser zu verbringen, kam nun allerdings nicht mehr in Frage.
Auf dem Tisch lag die Zeitung. Sie las die Meldung noch einmal. Es handelte sich nur um eine kleine Notiz, eine dpa-Nachricht in der linken unteren Spalte. Sie musste erst kurz vor Redaktionsschluss hereingekommen sein, ein paar unscheinbare Zeilen, leicht zu übersehen, aber im Netz war die Nachricht sicher schon viral gegangen.
Wenn man es sich recht überlegte, dachte Hella, und weil der Kaffee noch nicht durchgesprudelt war, gab sie sich dieser Überlegung hin, hatte sie einen seltsamen Beruf gewählt. Es war ein Beruf, in dem man immer zu spät kam. Man war nie zur rechten Zeit zur Stelle. Und diese Verspätung war uneinholbar, auch wenn sich einige aus ihrer Branche darin überboten, so früh wie möglich zu spät zu kommen. Ihr Tun blieb trotzdem nachträglich. Friseure, Piloten, Ingenieure, Bäcker; sie alle gestalteten das Geschehen. Sie brachten es hervor. Selbst Ärzte hatten es besser. Sie waren wenigstens manchmal so rechtzeitig vor Ort, dass sie das Geschehen noch beeinflussen konnten. Bei Journalisten war das anders. Mit ihren Berichten konnten sie nichts ausrichten, sie richteten nach. Was das deutsche Wort Nachricht auch gar nicht zu verbergen suchte, im Gegensatz zum Englischen. Im Englischen wurde wie immer geschönt. Die news verliehen den Journalisten den Anschein von Gegenwärtigkeit. Einfluss erlangten sie dennoch nur im Nachhinein. Und ein Leben ließ sich nicht nachträglich retten. In diesem Fall, dachte Hella und kehrte in die Gegenwart zurück, hätte sie an der Rettung allerdings nicht dringend beteiligt sein wollen.
Sie goss den Kaffee in den kalksteinfarbenen Keramikbecher, den sie gern benutzte. Auf der Vorderseite des Bechers war ein Wort wie ein Siegel in den Ton geprägt. Själsö. Eine leichte Vertiefung in der Glasur, über die sie mit der Fingerspitze strich. Själsö bedeutete Seeleninsel oder Insel der Seele. Jeden Morgen fühlte sie sich davon ermuntert und getröstet. Nicht, dass sie jemals auf den Gedanken gekommen wäre, Trost zu brauchen. Bevor sie den Becher während eines Sommerurlaubs in Schweden gekauft hatte, hatte Trost nicht zu ihrem aktiven Wortschatz gehört. Ihr Empfindungsvermögen, darauf war sie stolz, war breit aufgestellt. Ihm fehlte nur diese eine Facette. Niemand hatte sie je trösten müssen. Und um ihrerseits in die Verlegenheit zu kommen, Trost zu spenden, waren ihre weitverzweigten Bekanntschaften nicht eng genug.
Doch morgens, wenn sie den Kaffee in ihr Arbeitszimmer trug, war sie auf merkwürdige Weise getröstet. Irgendwie grundsätzlich mit dem Leben versöhnt. Själsö. Insel der Seele. So war es auch heute.
Hella schloss die Tür zum Flur und setzte sich an ihren Schreibtisch.
Der Zauber der Worte.
Deshalb war sie Journalistin geworden. Deshalb saß sie jeden Morgen hier oder im Büro und verfasste Texte, die manchmal tatsächlich einen Unterschied machten. Im Nachhinein. Eine Leserin hatte ihr das vor wenigen Monaten wieder ins Gedächtnis gerufen. Es kam nur noch selten vor, dass sich jemand in die Redaktion verirrte. Von denen, die die Zeitung lasen, war nur indirekt zu erfahren. In der Rubrik Leserbriefe oder online, nie persönlich. Mit dem gedruckten Wort schien auch das Bedürfnis nach der dreidimensionalen Welt langsam zu verschwinden. Den meisten Leuten reichte der digitale Kommentar, denn schlechte Laune ließ sich anonym am besten entladen. Dieser Frau allerdings schien es ein Bedürfnis zu sein, persönlich vorbeizukommen.
Die Sekretärin hatte sie ins Empfangszimmer geführt; gut gekleidet, mittleres Alter, Hella erkannte sie sofort. Persönlich war sie ihr nie begegnet, doch das Gesicht war oft in den Medien gewesen, in sich gekehrt, verschlossen, gefasst. Hinter der Glastür sah sie grau und versteinert aus. Erst als Hella hineinging und auf sie zutrat, wechselte der Gesichtsausdruck, die Frau streckte die Hände aus, und ein Leuchten trat in ihre Augen.
»Sie sind mir doch nicht böse? Verzeihen Sie, dass ich so hereinschneie.«
Hella entzog sich ihrem dünnen, aber festen Griff.
»Ich musste mich einfach persönlich bei Ihnen – Ich wollte Ihnen sagen –« Die Frau brach ihre überstürzte Rede ab und strich das teure Kleid glatt.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Tun?«, rief die Frau. »Sie haben schon alles getan! Sie haben so viel für uns getan. Mehr, als die Anwälte für teures Geld je tun würden.«
Hella lächelte.
»Mein Mann und ich – Es geht ihm inzwischen viel besser. Nachdem erst alles so schlimm gekommen ist. Alle waren sie hinter ihm her. Sie erinnern sich? Wir waren so erleichtert, dass er keine Haftstrafe absitzen musste. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das wäre für uns alle –« Die Frau sah zu Boden, und dann schien sie den Blick wie eine schwere Last von weit unten wieder heraufzuholen. »Das wäre eine Katastrophe gewesen«, sagte sie leise.
»So weit ist es nicht gekommen.«
»Nein. Zum Glück nicht. Was wäre dann aus uns geworden?«
Sie hatte zwei Kinder, fiel Hella plötzlich ein. Sie wohnte in einer dieser Villen am Wannsee, auf einem weitläufigen, gepflegten Grundstück mit Wasserzugang, womit sie quasi zur Nachbarschaft gehörte, wenn auch in einer völlig anderen Liga.
»Dafür sollten Sie sich beim Richter bedanken.«
»Ja, natürlich. Daran hatte ich gedacht.«
»Das Urteil ist Sache des Gerichts.«
Die Frau nickte, dann hob sie den Kopf. »Üble Verleumdung schafft kein Gericht der Welt aus der Welt«, flüsterte sie mit einer silbrig verhauchten Stimme, und Hella wurde von einem Anflug der Bewunderung für die ausgesuchte Wortwahl vom eigentlichen Sachverhalt abgelenkt. »Ein Freispruch allein hätte den Schaden nicht begrenzt.« Die Frau holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und tupfte sich die Mundwinkel ab, in denen sich kleine Spuckebläschen gebildet hatten. »Die Jagd auf ihn. Das war wie früher die Stasi.«
»Ich erinnere mich, dass wir über den Fall Ihres Mannes berichtet haben«, sagte Hella diplomatisch. »Die Sache hat sich ziemlich hingezogen.«
»Sie haben nicht nur über ihn berichtet, liebe Frau Karl. Sie haben seine Haut gerettet.« Die Frau fixierte sie. In ihren graublauen Augen war das Zimmer zu sehen, die Topfpflanzen, der Fensterrahmen. »Unsere Haut. Unser aller Haut!«
»Wenn unser Job tatsächlich so glorreich wäre, gäbe es viel mehr Denkmäler für Journalisten.«
»Unterschätzen Sie Ihren Einfluss nicht! Sie waren ein sicherer Fels in der Brandung der aufgepeitschten Masse!«
Hella musste erneut lächeln. In ihrer Verletztheit, die sie wahrscheinlich vor sich selbst verbarg, machte die Frau einen sonderbaren Eindruck. Vielleicht lag es an ihrer Art, sich auszudrücken. Leute in ihren Sphären pflegten einen etwas anderen Sprachgebrauch, einen Gesprächsstil, in dessen Verästelungen Hella nie wirklich vorgedrungen war. Eilig durchforstete sie ihr Gedächtnis auf der Suche nach irgendeiner zusätzlichen Information über sie, über ihren Beruf, ihre Karriere, fand aber nichts. Sie hatte sich nie besonders für die Ehefrau dieses Mannes interessiert. Da war immer nur er gewesen, die Anschuldigungen, die Entschuldigungen, die Schuld.
»Sie lachen.« Bedächtig schob die Frau das Taschentuch zurück in ihre Handtasche. »Sie waren die Einzige, die meinem Mann beigestanden hat.«
»Das freut mich«, sagte Hella anstandshalber. »Der Mob-Mentalität der sozialen Netzwerke müssen wir uns mit deutlicher Entschiedenheit entgegenstellen.«
Unvermutet kam Hella die Frage in den Sinn, wie dieses blasse Wesen an so einen Mann hatte geraten können. Ihn umgab der schillernde Sog von Reichtum und Einfluss. Er war weltgewandt, selbstsicher, jovial. Noch vor Gericht war er zu Scherzen aufgelegt gewesen. Auch war er weitaus attraktiver als sie. Gegensätzlicher als diese beiden konnte man kaum sein. Allerdings, überlegte Hella weiter, wäre es nicht das erste Mal, dass die Frau das Geld mit in die Ehe brachte und der Mann entschied, wie es ausgegeben wurde.
»Ich stehe tief in Ihrer Schuld«, sagte die Frau. »Sollten Sie einmal irgendetwas brauchen, liebe Frau Karl, rufen Sie mich bitte jederzeit an.«
Damit hatte sie das Empfangszimmer verlassen, nicht ohne eine extravagante, auf Büttenpapier gedruckte Visitenkarte auf den Besuchertisch zu legen. Adeltrud Mantau, so hatte sie geheißen. Eine Extravaganz, hatte Hella gedacht, die schon im Namen festgeschrieben war.
Die ersten Strahlen der Morgensonne fielen durch das Fenster. Im Haus war es still. Kein Knarren, keine Schritte, kein Wasserhahn rauschte. T war noch nicht aufgestanden. Also kehrte Hella Karl noch einmal zurück zum Mantau-Prozess, der nun schon eine Weile her war.
Sie hatte sich damals um Objektivität bemüht. Mit dem Ehemann ihrer Besucherin hatte sie ein langes Interview geführt, doppelseitig, das hatte sie bei der Geschäftsleitung durchgeboxt. Laut seiner Aussagen waren die sexuellen Handlungen einvernehmlich und die luxuriösen Geschenke nur kleine, in der Geschäftswelt übliche Aufmerksamkeiten gewesen. Das stand für diesen Mann außer Zweifel. Und Hella hatte sich eingestehen müssen, dass er ihr sympathisch war. Mit seiner einnehmenden Art und seinem eleganten Äußeren hatte er Übergriffigkeiten irgendwelcher Art gar nicht nötig. Auch konnte ihm niemand das Gegenteil beweisen. Die Frauen waren schließlich mitgegangen; getrieben vielleicht von der gleichen Geilheit wie er. Nur weil ihnen im Nachhinein nicht alles passte, was geschehen war, wurden sie nicht gleich Opfer eines Verbrechens. Da musste zumindest auch über Begehren und Enttäuschung geredet werden. Aber das Anprangern von Männern hatte in letzter Zeit so an Fahrt aufgenommen, dass man den Eindruck haben konnte, überall, wo eine Frau auftauchte, war ihr schon ein Gewalttäter auf der Spur. Kein Wunder, dass die Männer Angst bekamen. Manchmal, hatte Hella Karl das Gefühl, verstand sie die Männer besser als die Frauen.
Ihre Fragen hatte sie neutral formuliert, die Antworten sachlich wiedergegeben, wortwörtlich zitiert. Und doch schien einigen ihrer Formulierungen ein Geruch des Zweifels anzuhaften; Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anklage. Und nachdem diese Formulierungen von der Verteidigung aufgegriffen und schließlich sogar vom Richter in der Urteilsverkündung in leichter Abwandlung ebenfalls gebraucht worden waren, war der Geruch ungewollt an die Luft und in die Gemüter derer gedrungen, die es sich zugutehielten, gegen den Einfluss der Medien immun zu sein. Und letztendlich, auch darüber war sich Hella im Klaren, beeinflussten Worte zuweilen sogar die, die sich gegen sie sträubten. Das war ihr Zauber und ihr Fluch.
Tot, dachte Hella und wandte den Blick vom Fenster ihres Arbeitszimmers ab, hieß dennoch tot. Daran ließ sich nicht rütteln. Aus ihrem Inneren stieg ein Echo ihres Ärgers auf. Wie immer man zu Kai Hochwerth stehen mochte; er und das Leben gingen seit dem 7. Mai getrennte Wege. Das war nicht rückgängig zu machen. Alles andere war postmodern. Pipifax, wie sie gern dazu sagte, Hirnfick, wenn sie es darauf anlegte, ihr Gegenüber zu brüskieren, meistens die austauschbaren Praktikantinnen.
Die aufgehende Sonne traf die Weinranken am Haus. Ein flackerndes goldgrünes Licht erfüllte das Zimmer, was, wie sie zugeben musste, hübsch aussah. Langsam trank sie ihren Kaffee aus. Dann faltete sie die Zeitung zusammen und legte sie zu den anderen auf den Stapel an der Wand.
Ihren Mann fand sie in der Küche beim Eierbraten. Das Radio lief. Verkehrsmeldungen. Bundesliga. Es roch nach Rasierwasser und Speck, obwohl ein Fenster offen stand.
Seine Schönheit traf sie wie ein Schlag. Im Morgenlicht sah er noch charismatischer aus. Die klaren Züge. Sein kräftiger Rücken mit den stabilen Schultern. Die schmale Taille über einem straffen Po. Sie gab sich der Betrachtung eine Weile hin. Er war der anziehendste Mann, mit dem sie je zusammen gewesen war. Dort am Herd, schlaksig, schlank und braungebrannt, wie er mit ruhigen Bewegungen die Eier briet, war er unwiderstehlich. Er war so sexy in seiner verschlafenen Versunkenheit, dass sie ihn wollte. Auf dem Küchenboden. Jetzt.
»Gut geschlafen?«
Er lächelte. Sein schwarzes Haar war nass vom Duschen. Die Freizeithosen und das gestreifte Leinenhemd verrieten, dass er vorhatte, sich dem Garten zu widmen.
»Nimmst du es heute mit der Wildnis auf?«
»Bestes Draußenwetter«, murmelte er.
Sie legte ihm die Hand in den Nacken und fuhr ihm kräftig durch die Haare am Hinterkopf. Er schloss die Augen. Beiläufig erwähnte sie die Weinranke.
»Ich muss in die Redaktion«, fügte sie hinzu.
»Wollten wir nicht mit dem Boot raus?«
»Ja.«
»Ja und?«
»Es gibt einen Toten. Vom Theater, weißt du. Hochwerth.«
»Wir verlernen noch, wie das geht mit dem Paddeln.«
»Das war wirklich nicht vorauszusehen. Er hat –« Sie unterbrach sich. »Suizid«, sagte sie dann. »Das wird Wellen schlagen. Ich habe noch nicht mal gewagt, mein Handy einzuschalten.«
»Es gefällt mir nicht, dass du es nachts wieder am Bett hast.« Mit einem Pfannenheber, den er aus der Spülmaschine holte, widmete er sich wieder den Eiern. »Die hochfrequente Strahlung ist nicht gut. Sie ist schlecht für dich.«
»Allein der Tod ist schlecht für mich.«
Da hörte er schon nicht mehr zu.
Sie nahm ihre Jacke von der Garderobe im Flur, wo sein Handy lag, das er, sobald er nach Hause kam, in eine dort befindliche Schale legte, öffnete die Tür und trat zum zweiten Mal an diesem denkwürdigen Morgen hinaus in die warme, durchsonnte Frühlingsluft.
T, wie sie ihn in Gedanken nannte. T. Das war der erste Buchstabe seines Vornamens. In Büchern schrieben sie das so, wenn sie den Namen nicht preisgeben wollten, wenn die Person nicht erkannt werden sollte. Heute mit T gefrühstückt. Spiegeleier. Letzter Kuss von T, bevor ich das Haus verließ. T verschnitt die Weinranken, während ich im Liegestuhl im Garten lag und las. Meistens handelte es sich um Enthüllungsbücher oder Autobiographien, in denen die Identität einer Person geheim bleiben musste und so erst recht zum Gegenstand des Interesses wurde. Und im Grunde wusste jeder, wer dieser geheimnisvolle T oder B oder X war. Jeder, der es wissen wollte. Bei ihr hatte der erste Buchstabe des Vornamens einen anderen Grund. Wenn Hella gedanklich mit T hantierte, fand sie sich selbst ein bisschen geheimnisvoll.
Hätte T ihr an diesem Morgen zugehört, hätte er sie nicht so einfach gehen lassen. Er hätte die Eier aus der Pfanne auf den Teller geschoben, die Schultern im Leinenhemd leicht angezogen und sie vorwurfsvoll angeschaut.
Warum sie nicht einfach ihren Job machen könne wie alle anderen, hätte er in seiner typischen, die Konsonanten vernuschelnden Aussprache gesagt. In einem weichen Bereich wie der Kultur müsse sie nicht herumtoben wie eine wütende Hyäne. Das Zähnefletschen solle sie den Politikredakteuren überlassen. Den Kriegsberichterstattern. Den Sportreportern. Ob ihre Gesundheit nicht schon genug unter der vielen Arbeit leide. Außerdem verlange ihr das eine unnatürliche Härte ab. Elefantenhaut. Dickes Fell. Was am Ende auch ihrer Weiblichkeit schade.
»Mach dir um meine Weiblichkeit keine Sorgen«, hätte sie ihrem Mann geantwortet, mit der gebotenen ironischen Sinnlichkeit, wenn er sie an diesem Morgen wahrgenommen und alles das gesagt hätte. Dinge, die mit ihrer inneren Unruhe schlecht zu vereinbaren waren. Die sie jetzt nicht gebrauchen konnte, dachte Hella Karl, während sie den Cinquecento über das Kopfsteinpflaster den Anstieg hinauf auf die zweispurige Straße durch den Grunewald steuerte und Lippenstift auftrug, wobei sie kurz vom Gas ging.
Die Einmischung ihres Mannes irritierte sie fast immer. An diesem Vormittag hätte sie massiv gestört.
Sie brauchte einen klaren Kopf. Ein Nachruf musste geschrieben werden. Einen Nachruf wie diesen konnte sie nicht Heiko Sellim überlassen oder einem der Theaterkritiker. Sie musste ihn selbst verfassen. Da durfte nichts aus dem Ruder laufen, zumal sie die Verantwortung für die Kulturseiten trug. Und wenn sie ehrlich war, und Ehrlichkeit gehörte zu ihrem Beruf, war die Berichterstattung im Fall von Kai Hochwerth nicht durchgängig geglückt.
Die Sonne kam direkt von vorn. Sie klappte die Blende herunter. In Gedanken versuchte sie, ein gerechtes Bild von Kai Hochwerth zu skizzieren. Scheidungskind. Aufgewachsen im Neubauviertel einer Kleinstadt. Einfache Verhältnisse. Brandlöcher im Sofa, Alkis vor dem Kiosk, geborstene Stromkabel, morgendliche Randale. Vater Schlosser. Mutter mit Ambitionen, aber ohne die Mittel. Geldnot. Ehrgeiz. Abendschule. Das alles unterschied sich nicht so sehr von ihrem eigenen Hintergrund, dachte Hella, wobei der Vergleich einen unerfreulichen Schatten auf ihre Hirnhaut warf.
Eine Ampel war rot, wodurch sie etwas Zeit gewann. Das Handy auf dem Beifahrersitz war immer noch aus. Normalerweise verkoppelte sie es sofort mit der Freisprechanlage. Jetzt lag es da, schwarz und stumm und glänzend. Und je länger es dort so lag, umso größer wurde ihr Widerwille, es einzuschalten. Diese Regung war ihr neu.
Ihr Smartphone war die Nabelschnur zur Welt. Das mochte etwas hochgegriffen sein, kam der Sachlage aber recht nah. Hella Karl konnte sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Textnachrichten und Tweets bedienten ein tiefes menschliches Bedürfnis, das andere mit Zigaretten oder Drogen stillten. Und das war, Strahlung hin oder her, in jedem Fall gesünder. Allerdings, davon war sie überzeugt, markierte das Gerät das Ende einer Ära. Klicks und Likes waren der Ruin der Debattenkultur in dieser satten Republik.
Das enge Verhältnis zu ihrem Smartphone war auch ein Zeichen ihres Einzelgängertums. Denn das war sie, Hella Renata Karl. Ein Solitär. Solitär aus Leidenschaft. Mit dem für Einzelgänger typischen Verlangen nach Menschen. Die Menschen durften ihr nur nicht zu nahekommen. Nähe ließ sie ausschließlich über Körperlichkeit und Berührungen zu, und da wurden die Dinge schnell kompliziert, wenn man in einer Beziehung steckte.
Ihrem Handy jedenfalls hatte sie nie den geringsten Widerwillen entgegengebracht. Schöne Grüße an T.
Doch nicht das Neue an der Regung war es, das eine leise Besorgnis in ihr weckte. Die Besorgnis, begriff Hella Karl, kam von woanders her.
Sie kam von früher, aus der Zeit nach dem Abitur. Damals hatte sie ihren ersten festen Freund gehabt. Für ein knappes, aber intensives Jahr voller Motorradtouren in die nähere Umgebung und einmal sogar bis hinauf nach Norwegen. Er war ein ehrgeiziger, hübscher Junge gewesen, bessergestellt, im Bett angenehm forsch, aber sensibel. Bis er eines Tages nicht mehr ans Telefon gegangen war. Zuerst hatte er auf das Telefonklingeln nicht mehr reagiert, später auch nicht auf das Klingeln an der Tür. An manchen Tagen konnte er die Wohnung nicht verlassen, schließlich ging er überhaupt nicht mehr raus. Er schaffte es nicht, nicht einmal zum Supermarkt an der Ecke. Sein dunkler Widerwille schlug ihr oft schon vor der Haustür entgegen, draußen auf dem Gehweg, wo sein Chopper stand, Ledersitz und Lack verklebt vom Lindenblütensaft. Eines Tages behauptete er, gewaltsam in seiner Wohnung festgehalten zu werden, überwacht von den Menschen im gläsernen Fahrstuhl, der an der Außenwand des Mietshauses neben seinem Schlafzimmerfenster auf- und abfuhr. Schließlich hatte er sich in einem klaren Moment selbst in die Psychiatrie eingewiesen, wo er bald nicht wiederzuerkennen war, das Gesicht fahl und aufgedunsen. Jeder Besuch bei ihm hatte sie in eine wattierte, weltferne Wüste geführt, die von den bunten Wachsstiftzeichnungen an den Wänden noch grauer wurde und sie so deprimierte, dass sie ihre Willenskraft erst nach Tagen wiederfand. Und die brauchte sie, denn sie steckte mitten im Volontariat bei einer Zeitschrift, die einen nicht gerade freundlichen Umgangston pflegte.
Jemanden wie sie, die als Schlüsselkind mit der Dynamik der Straße aufgewachsen war, kostete so viel Antriebslosigkeit eine übermenschliche Energie.
Die Krankheit damals hatte sich schleichend entwickelt und war dann schockhaft ausgebrochen. An einem ganz normalen Tag. Die Zeichen waren alle da gewesen, dachte Hella Karl. Wie so oft. Und wie so oft wurden sie ignoriert oder nicht wahrgenommen. Und wenn das Resultat nicht mehr zu übersehen war, fiel man aus allen Wolken. Genau das, wurde ihr bewusst, konnte sie zum Aufhänger ihres Artikels machen: Die Sonne ging über