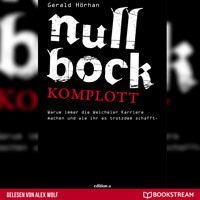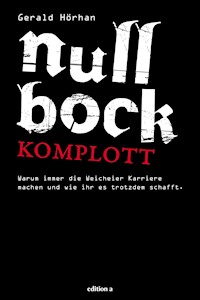13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Bisher reichte vielen das typische Mittelstandsleben – wenn auch langweilig und monoton, dafür abgesichert und komfortabel – völlig aus. Doch nicht nur die Coronakrise, zunehmende Inflation und steigende Energiekosten zeigen: Im Hamsterrad lebt es sich nicht mehr bequem! Finanzielle Freiheit ist keine Option mehr, sondern unabdingbare Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Gerald Hörhan zeigt dir in diesem Buch, wie auch du endlich vermögend wirst. Seine Strategie: Werde zum Einzimmer-Millionär! Mithilfe »kleiner Löcher« – also kleiner Ein- und Zweizimmerwohnungen – schuf sich der Investmentpunk ein Immobilienportfolio, das ihm ein überaus angenehmes Leben fernab des Hamsterrads ermöglicht. Wie du diese Strategie anwenden kannst, erklärt dir Gerald anschaulich anhand vieler seiner eigenen Erfahrungen. Für die Umsetzung musst du auch keinen Abschluss einer Eliteuni aufweisen oder etwas von höherer Mathematik verstehen – Fleiß und Ehrgeiz bringen dich ans Ziel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gerald Hörhan
Der Einzimmer Millionär
Wie du gar nicht verhindern kannst, Reich zu werden
Gerald Hörhan
Der Einzimmer Millionär
Wie du gar nicht verhindern kannst, Reich zu werden
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis: Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe, 4. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers beziehungsweise des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Redaktion: Christine Rechberger
Redaktionelle Mitarbeit: Nils Frenzel
Korrektorat: Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer, München
Coverfoto: © Burak Cayci (Agentur Kocak GmbH)
Satz: Zerosoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-531-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-016-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi 978-3-96092-017-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Time to wake up: Die ruhigen Zeiten sind vorbei
Teil I: Das Ende der Überflusswirtschaft: Wieso du Vermögen aufbauen musst
Von der Mangelwirtschaft zur Überflusswirtschaft der Zentralbanken
Die Party ist vorbei: Das Ende der Überflusswirtschaft
Die Enteignung der Mittelschicht in drei Teilen: piano, lungo, fortissimo nero
Die Party der Überflusswirtschaft ist für die meisten Menschen vorbei. Aber für manche geht die Party erst richtig los
Teil II: Wie werde ich vermögend?
Die Grundregeln des Vermögensaufbaus
Wie baue ich mein Portfolio auf?
Teil III: Die Einzimmer-Millionär-Strategie
Die klassischen Vorteile von Immobilien
Die Immobilienmythen
Wieso kleine Löcher
LZR: Lage, Zustand und Rendite, das magische Dreieck eines Immobilieninvestors
Als Immobilienkäufer erlebt man lustige Dinge: Verhandlungen beim Immobilienkauf
Ohne Geld spielt keine Musik: Die richtige Finanzierung
Das Immobiliensteuerparadies Deutschland und Österreich
Die Trendwende am Immobilienmarkt: Droht die Apokalypse? Oder ist es Time for Schnappi?
Die nächsten Schritte: Dein Weg zum (Multi)Millionär
Time to wake up: Die ruhigen Zeiten sind vorbei
Als ich am 29. Dezember 2019 die Emirates-Maschine nach Australien bestieg, war die Welt noch (fast) in Ordnung. Seit der Finanzkrise hatten wir, getrieben durch billiges Zentralbankgeld, einen gewaltigen Wirtschaftsboom erlebt, Geld floss im Überfluss, die Aktien- und Immobilienmärkte waren auf Höchstständen. Noch ahnte die Welt nichts von der bald alles bestimmenden Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise und der starken Inflation.
Ich ließ mir noch ein bisschen Champagner nachschenken, genoss den Kaviarservice und dachte über das vergangene Geschäftsjahr nach, während ich auf den Ozean blickte. Ich hatte ein unglaublich erfolgreiches Jahr hinter mir und wollte mir über Silvester einen kleinen Urlaub in Down Under gönnen. Aber etwas lag in der Luft. Bereits in den Wochen vor meinem Abflug aus Wien rissen Pressemeldungen über völlig außer Kontrolle geratene Buschfeuer in Australien nicht ab. Facebook, Twitter & Co. waren voller Videos von Kängurus auf der Flucht, andere zeigten Menschen, die fast verdurstete Tiere mit Wasser aus PET-Flaschen retteten. Statt nach Sydney, flog ich deshalb nach Melbourne, weil sich um die Stadt Sydney ein bis zu 125 Meter hoher Feuerring gebildet hatte – die Stadt war zeitweise auf dem Landweg von der Außenwelt abgeschnitten.
In Melbourne schlug mir beim Verlassen des Flugzeugs die australische Hitze entgegen – ein regelrechter Hitzeschwall. Trotzdem sind für mich 36 Grad australische Außentemperatur im Dezember angenehmer als die eisige Kälte im verschneiten Wien. Ich verbrachte einige entspannte Tage allein in Melbourne, ehe ich am Nachmittag einen Freund vom Flughafen abholte. Meinen Vormittag hätte sich kein Werbeprospekt besser ausdenken können: wunderbarer Sandstrand und ein hervorragendes Lachsfrühstück mit Blick auf das Meer. Die australische Sonne schien, der blaue Himmel über mir war wolkenlos und ich war bester Laune. Ich schlenderte also zu meinem Auto, das ich einen knappen Kilometer vom Strand entfernt geparkt hatte, um zum Airport aufzubrechen.
Aber während ich die Straße entlangging, sah ich plötzlich große, dunkle Nebelschwaden, die wie ein Tsunami über die Büsche schwappten. Ich zuckte zusammen. Woher kam auf einmal dieser Rauch? Ich bahnte mir einen Weg durch den beißenden Nebel, stieg halb blind in mein Auto, drehte den Zündschlüssel um und fuhr Richtung Flughafen. Trotz geschlossener Fenster roch es, als hätte jemand ein Lagerfeuer auf den Ledersitzen angezündet. Eingehüllt in eine schwarze, übelriechende Rauchwolke sammelte ich meinen Freund am Flughafen ein. Auf der Rückfahrt ins Hotel fuhren wir erneut durch die dichte Nebelwand. Obwohl es früher Nachmittag war, drang kaum ein einzelner Sonnenstrahl durch die Rauchschwaden und wir hatten nur ein paar Meter Sicht. Das ganze Szenario wirkte völlig surreal, nicht von dieser Welt, als wären wir in einem Horrorfilm, dachte ich mir und lenkte den Wagen mit 40 Stundenkilometern über die australische Autobahn.
Ich hatte mir vor meiner Reise die aktuellen Karten der Luftverschmutzungen von Australien angesehen, aber in Melbourne war kein Feuer gemeldet worden. Nur um Sydney herum und in der Nähe von New South Wales sowie im Landesinneren bei Canberra. Die Rauchschwaden mussten also tatsächlich von dort aus herübergezogen sein – irre, das sind mal eben verdammte 900 Kilometer. Damit hieß es an unserem ersten gemeinsamen Urlaubstag in Melbourne im Hotel: Please stay in your room. The air is not healthy. Klare Ansage. Am Abend schaute ich mir online bei geschlossenen Fenstern wieder die Lage in der Region an. Hierbleiben war für mich keine Option. Aber wohin? Es ging nur in eine Richtung: Richtung Westen, bloß weg vom Rauch. Kurzentschlossen saßen wir am nächsten Tag im Auto und fuhren los. Wieder dichter, dunkler Nebel voller Ruß, als würde jemand Millionen von Autoreifen abfackeln. Wir waren nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen waren, ihr Glück westlich von Melbourne zu suchen. Die Straßen waren voller Autos, das Ganze wirkte wie eine völlig absurde Mischung aus Spontan-Evakuierung aus einem Kriegsgebiet und einer Zombie-Apokalypse. Nach gut fünf Stunden Fahrt und 300 nervigen Kilometern erreichten wir die Apollo Bay, einen im Südwesten gelegenen Küstenort im Staat Victoria. Hier war es deutlich angenehmer. Trotzdem fuhren wir nach zwei Tagen wieder zurück, die Rauchschwaden hatten sich offenbar aus Melbourne verzogen. Doch dort angekommen, erlebten wir jetzt ein weiteres surreales Spektakel. Vor dem Hafen ankerten plötzlich gigantische Kriegsschiffe der australischen Marine. Schon das zweite Mal, dass ich mich wie in einem Hollywood-Film fühlte: Abertausende inneraustralische Touristen waren Hals über Kopf, getrieben von den lodernden Bränden im Landesinneren, in Richtung Küste geflohen. Irgendwie war klar, dass für kleine australische Küstenorte wie beispielsweise Malacoota im Osten des Kontinents, solche Fluchtbewegungen denselben Effekt hatten, als würde man mal eben alle Einwohner von Wien ins beschauliche Bad Ischl verfrachten. Keine so gute Idee. Die kleinen Orte hatten weder ausreichend Lebensmittel noch Wasser für die heranströmenden Menschen, sodass die australische Armee die Bewohner tatsächlich mit Kriegsschiffen evakuieren und nach Melbourne bringen musste. Wahnsinn. Beim Anblick der Kriegsschiffe wurde mir schlagartig klar, dass ich gerade Zeuge einer groß angelegten Evakuierungsaktion war. Ist das tatsächlich noch die Welt, wie wir sie kennen? Militärische Rettungseinsätze im Inland – ist das etwas, woran wir uns gewöhnen müssen?
Die Fernsehkameras hielten ohne Gnade drauf und zeigten Mütter, die in verbrannten Lumpen um das knappe Wasser bettelten, das inzwischen bis zu 50 Australische Dollar kostete – für eine einzelne beschissene PET-Flasche.
Die Geschäfte, die noch offen hatten, und korrupte Straßenhändler schlugen unbarmherzig Profit aus der Katastrophe. Auch wenn die australische Regierung mit hohen Strafen für ein solches »Price Gouging« drohte, es blieb bei leeren Drohungen. Simple Ökonomie: Die Wasserknappheit führte zu einem dramatischen Anstieg des Preises – Notlage hin oder her, das war die harte Realität.
Diejenigen, die das Geld haben, kaufen sich Wasser. Und diejenigen, die es nicht bezahlen können, bekommen eben keins.
30. Dezember 2020: Wieder bestieg ich eine Emirates-Maschine, diesmal mit dem Ziel Dubai. In den 12 Monaten seit meiner Australienreise hatte sich die Welt komplett verändert. Österreich und Deutschland waren im Corona-Lockdown. Die meisten Menschen saßen in ihren Wohnungen, viele mit Kindern auf engstem Raum, draußen war es bitterkalt. Der Flughafen war wie eine Geisterstadt, aber der Emirates-Flieger gut besetzt. First- und Business-Class komplett ausgebucht, nur in der Economy-Class gähnende Leere. Offensichtlich waren viele Geschäftsreisende dabei, zum Teil mit ihren Kindern. Ein Flugzeug voller Unternehmer. Beim Austrian-Airlines-Abendflug auf die Malediven, den einige Freunde von mir gebucht hatten, eine ähnliche Situation. Auch hier Unternehmer auf Geschäftsreise mit ihren Kindern, wohl um ihnen bereits ihr Business zu zeigen. In Dubai war die Welt eine völlig andere als in Wien. Ja, es gab Maskenpflicht, aber Restaurants waren offen, es gab sogar Partys unter freiem Himmel (mit Abstandsregeln), und mit der entsprechenden Vorsicht war es möglich, ein einigermaßen normales Leben zu führen, was in Wien oder Frankfurt gänzlich unmöglich war. Am Ende war es tatsächlich eine Geschäftsreise, da ich in Dubai so viele Meetings hatte wie die letzten sechs Monate davor nicht, und gute Geschäfte einfädeln konnte; sehr viele Unternehmer aus der ganzen Welt hatten offensichtlich Dubai als Destination gewählt. Die richtig Risikofreudigen waren im Flugzeug nach Cancún und dann in Tulum anzutreffen, die Lufthansa – mit staatlichen Rettungsgeldern versorgt – hatte gerade die Route neu eröffnet. Ich bin mir sicher, dass in Tulum gute Geschäfte gemacht worden waren, ein Teilnehmer meiner Dealmaking Masterclass hatte sich gleich ein Hotel in Mexico gekauft.
Klarerweise ist das Covid-Ansteckungsrisiko in der First Class mit viel Abstand oder am Restauranttisch unter freiem Himmel deutlich geringer als in den (engen) eigenen vier Wänden oder im überfüllten Supermarkt. Wohlgemerkt, etwas Kleingeld und die richtige Struktur sind für solche Annehmlichkeiten notwendig. Hotelzimmer in Dubai waren ausgebucht, für diejenigen, die noch frei waren, bezahlte man 500 US-Dollar Minimum, für bessere Hotels 1000 US-Dollar – pro Nacht! Auf den Malediven galten solche Preise noch als Schnäppchen. Und als Angestellter konnte man ohne Zustimmung des Chefs wohl keine Dienstreise machen, war man trotzdem unterwegs und steckte sich mit dem Corona-Virus an, was dann einen längeren Krankenstand und Quarantäne mit sich brachte, konnte man vom Arbeitgeber gekündigt werden.
10. Februar 2021: Gestärkt und voller Energie und Tatendrang war ich nach fünf Wochen Dubai wieder im kalten Wien angekommen. Zurück im Büro hatte ich alle notwendigen Dinge erledigt, einige Videokurse gedreht, Livechats gemacht und Beteiligungsmöglichkeiten geprüft. Als Nächstes ging es nach Frankfurt am Main, meine (fast) zweite Heimat, um meinem liebsten Hobby zu frönen, nämlich Immobilien zu kaufen und mein Portfolio zu optimieren. Ich wollte mir im neuen Jahr wieder einen Marktüberblick verschaffen und zusätzlich zwei Sanierungsmaßnahmen kontrollieren.
Der Airbus A320 der Austrian Airlines war fast wie ein Privatflieger, ganze 15 Fluggäste waren an Bord. In Frankfurt traf ich einen alten Bekannten von mir, den ich schon seit Jahren gut kenne. Er hat eine wilde Vergangenheit, war von der Schule geflogen, hatte auf einem Kreuzfahrtschiff und auf einer Bohrinsel gearbeitet und war jetzt Chefkellner eines Frankfurter Gourmet-Restaurants – dort hatte ich ihn auch kennengelernt. Er war gut vernetzt, geschäftstüchtig und wusste immer, was am Immobilienmarkt abging, wer gerade kaufen wollte und wer verkaufen; er hatte mir auch schon gute Immobilien vermittelt und den einen oder anderen Mieter gebracht. Wir trafen uns an der Frankfurter Oper und machten einen Spaziergang entlang der leergefegten Bankers Alley1 und danach durch das noble Frankfurter Westend. Es war kalt, aber alle Restaurants und Lokale waren ja geschlossen. Ich fragte meinen Bekannten, wie es bei ihm laufe und was er jetzt im Lockdown mache; immerhin war er ja faktisch arbeitslos. Er sagte, es gehe ihm blendend, er würde lange schlafen, Bücher lesen und relaxen. Nur die Partys und sozialen Kontakte im Restaurant würden ihm fehlen. Ich war erstaunt über seine Lockerheit, immerhin hatte sich sein Einkommen drastisch reduziert, von üppigem Trinkgeld von mehreren Tausend Euro im Monat war keine Rede mehr. Er sagte: »Ich habe 22 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet, von denen kann ich gut leben. Und Corona geht auch wieder vorüber. Ich werde jetzt mal ein paar Monate nach Mexico fliegen und zurückkommen, wenn der ganze Spuk vorüber ist und man wieder Geld verdienen kann.« Ich fragte ihn, was seine Arbeitskollegen machten. »Den meisten geht es ziemlich scheiße. Die haben immer das ganze Geld versoffen und (Konsum)Schulden gemacht, anstatt Immobilien oder Gold zu kaufen. Jetzt sitzen sie eingesperrt zu Hause ohne Kohle und warten auf Hilfe von Vater Staat. Die sind einfach nur dumm, jetzt bezahlen sie den Preis dafür.« Wir plauderten noch ein wenig über den Immobilienmarkt, die Preise waren trotz Corona verdammt hoch, und zum Abschluss unseres Spaziergangs sagte er noch: »Wir sehen uns, wenn in Frankfurt wieder die Sonne scheint. Ich vertschüsse mich jetzt mal in die Wärme.« Und augenzwinkernd ergänzte er: »First-Class und 5-Sterne-Hotels wie du kann ich mir zwar nicht leisten, aber in der Economy-Class habe ich im Moment bestimmt mehr Platz als du vorne im Flieger. Und ein kleines Airbnb-Apartment tut es ja auch, vielleicht kaufe ich mir sogar eines.«
Ich wusste schon mit 13 Jahren, dass das typische Mittelstandsleben nichts für mich ist – in der Früh zeitig aufstehen, im Winter Schnee schippen, im Auto mit Nähmaschinenmotor im Stau stehen und zur Arbeit zu fahren, die keinen Spaß macht, Zettel von A nach B schieben und dem Chef in den Arsch kriechen, am Abend dasselbe wieder retour, einkaufen, putzen, kochen, und dann im Eigenheim auf Pump in der Pampa erschöpft zusammensinken und sagen »Endlich Feierabend«. Keine Kohle, keine Freiheit. Fünf Tage dienen für zwei Tage Wochenende, zehneinhalb Monate schuften für sechs Wochen Urlaub, warten auf den Ruhestand, wo die Kohle hinten und vorne nicht reicht, und dann der Sensenmann. No fucking way, dachte ich mir damals, das kann nicht alles sein, was das Leben zu bieten hat, dafür stehe ich sicher nicht jeden Tag um 6 Uhr in der Früh auf. Deshalb habe ich mich schon sehr früh entschieden, Gas zu geben, fleißig zu sein, Performance zu liefern; dadurch war ich in der Lage, meine Unternehmensgruppe und mein Immobilienportfolio mit mittlerweile 225 Wohneinheiten aufzubauen, sodass ich schon mit Ende 30 nicht mehr arbeiten musste.2
Das typische Mittelstandsleben – wie auch in meinem ersten Buch Investmentpunk: Warum ihr schuftet und wir reich werden beschrieben – war zwar langweilig und monoton und definitiv nichts für mich, aber es war zumindest abgesichert und einigermaßen bequem. Vielen Menschen reichte das. Zumindest bis zum Februar 2020.
Corona war nur der Anfang von turbulenten Zeiten. Der Beinahe-Zusammenbruch des Gesundheitssystems, Lockdown, Krieg in Europa, Wetterextreme, Inflation, volatile Finanzmärkte, Energieknappheit, völlig verrückte Politik, der Beinahe-Staatsstreich in den USA, der Beinahe-Kollaps des britischen Finanzsystems, die Liste lässt sich fortsetzen … Ich hätte mir, das muss ich fairerweise zugeben, Ende 2019 auch nicht vorstellen können, dass ich live auf CNN erleben würde, wie in 1500 Kilometern Entfernung ein Atomkraftwerk beschossen wird3 und ich mir Gedanken über eine rasche Flucht an sichere Orte machen muss. Dass ich mir würde überlegen müssen, wie ich im Falle eines überlasteten Gesundheitssystems rasch zu medizinischer Behandlung käme, zum Beispiel mit Corona, oder dass ich mir Gedanken darüber machen müsste, im Falle von Gas- und Stromrationierungen das Land zu verlassen. Immerhin habe ich die Option dazu, die meisten Menschen haben sie nicht.
Wake up Guys! Das langweilige, aber sichere und komfortable Mittelstandsleben ist Geschichte. Das Hamsterrad wird turbulent und ungemütlich. Bis Anfang 2020 konnte eine Mittelstandsfamilie davon ausgehen, dass sie Bewegungs- und Reisefreiheit, Mobilität, ein großes Angebot an Nahrungsmitteln, ein ordentliches Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, eine zumindest ausreichende Gesundheitsversorgung und eine Basis-Altersabsicherung hat, und zwar 365 Tage im Jahr. Diese Zeiten sind definitiv vorüber und werden so schnell auch nicht wiederkommen. Das typische Mittelstandsleben mag noch eine ganze Zeit lang gut gehen, aber plötzlich kommt eine Extremsituation, dann ist es aus und vorbei. Öffnet eure Augen, sonst kommt ihr schneller unter die Räder, als ihr euch das vorstellen könnt.
Viel Kohle zu haben, vermögend und finanziell frei zu sein ist keine Option mehr, sondern eine absolut notwendige Voraussetzung, wenn du auch zukünftig bequem und sicher leben willst, und zwar jeden Tag des Jahres.
In diesem Buch möchte ich dir zwei Dinge zeigen: 1. Wohin die Reise geht und welche Trends und Entwicklungen dazu führen, dass das Leben, das du gewohnt bist, Geschichte ist, und 2. eine Strategie, mit der du strukturiert Vermögen und finanzielle Freiheit aufbauen kannst, so wie ich und viele meiner Fans und Follower es getan haben, ebenso wie viele andere vermögende Menschen auf der ganzen Welt. Die Strategie des »Einzimmer-Millionärs«, mit – wie ich sie nenne – kleinen Löchern, also kleinen Einzimmer- und Zweizimmer-Apartments. Für diese Strategie benötigst du keinen Harvard-Abschluss oder Doktor der Mathematik, auch ein Schulabbrecher kann sie umsetzen. Voraussetzung ist nur, dass du nicht faul und dumm bist, sondern fleißig und bauernschlau.
Die Entscheidung, welchen Weg du gehst, liegt an dir. Du entscheidest, ob du jede noch so dumme Regel befolgen musst oder ob du in Freiheit leben kannst. Du entscheidest, ob du den Gürtel enger schnallen und dich warm anziehen musst oder ob du ein komfortables Leben führen kannst. Du entscheidest, ob du in der nächsten Krise auf Vater Staat hoffst oder ob du gechillt in die Wärme fliegst.
Eines muss dir auch klar sein: Reich und vermögend zu werden und vor allem zu bleiben ist kein Zuckerschlecken. Es bedeutet harte Arbeit und Disziplin. Wenn du dir vor allem Raum zur Selbstfindung, zum Beispiel im Rahmen eines Sabbaticals, und eine ausgeglichene Work-Life-Balance wünschst, kannst du das Buch gleich wieder weglegen, dir ein Lastenfahrrad auf Pump kaufen und das Armutsgelübde ablegen. Dasselbe gilt, wenn du weiterhin an Verschwörungstheorien glauben willst oder wenn du der Meinung bist, dass alle Menschen denselben Wohlstand haben sollten und sie sich dafür nur anstellen und die Hand für staatliche Wohltaten aufhalten müssten. Ich möchte keine dieser persönlichen Einstellungen werten, aber damit wirst du sicher nicht vermögend und (finanziell) frei. Ich kann dir aus eigener Erfahrung nur eines sagen: Ich habe beides erlebt – keine Kohle zu haben und viel Kohle zu haben. Und das Leben mit viel Kohle und Assets ist einfach viel, viel geiler.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn ich dich motivieren kann, dein Leben und deine finanzielle Situation in die eigene Hand zu nehmen und ebenfalls ein »Einzimmer-Millionär« zu werden.
Teil I
Das Ende der Überflusswirtschaft: Wieso du Vermögen aufbauen musst
Von der Mangelwirtschaft zur Überflusswirtschaft der Zentralbanken
Die meisten von euch kennen nur eines: Überfluss und Überflusswirtschaft. Aber das war nicht immer so und es ist nicht gottgegeben, dass es so bleibt. In diesem Kapitel möchte ich für euch kurz die Geschichte Revue passieren lassen, um euch ein Verständnis für die derzeitige Lage und die Zukunftsaussichten zu geben.
Der Beginn der 1980er-Jahre: Die Fahrt mit dem TukTuk-Mercedes-Taxi
Ich erinnere mich noch an meine Jugend Mitte der 1980er-Jahre. Meine Eltern hatten damals ein Vierteltelefon, also einen Telefonanschluss, den sie mit drei anderen Haushalten teilten. Telefonierte ein anderer Haushalt, konnten meine Eltern nicht telefonieren. Meine Mutter wollte ein Taxi bestellen und ärgerte sich tierisch, weil die Telefonleitung nicht frei wurde (meine Eltern hatten nur ein Auto, einen VW Golf L, mit dem mein Vater zur Arbeit fuhr). Als das Taxi nach 45 Minuten kam – ich war damals schon an Autos interessiert –, fragte ich den Taxifahrer über seinen Mercedes aus. Es war ein 200D mit 55 PS, 125 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit. Der Taxifahrer erzählte, dass er auf das Auto zwei Jahre hatte warten müssen. Und dass er Mühe hatte, mit drei Personen und Gepäck einen Hügel hochzukommen, vor allem im Winter. Der Taxifahrer erzählte auch, dass er in einer Wohnung mit Bassena lebte. Urlaub gab es auf Balkonien und alle drei Jahre in Caorle mit dem 55-PS-TukTuk.
Heute klingen solche Erzählungen lustig und unterhaltsam, aber damals war das alles bittere Realität. Bis Anfang der 1980er-Jahre lebte selbst die westliche Welt in einer Mangelwirtschaft.1 Die meisten Haushalte hatten maximal ein klappriges Auto, für das die Familien jahrelang sparten und auf das sie auch jahrelang warten mussten, ein voller Telefonanschluss war noch Luxus. Viele Wohnungen waren klein, das WC war am Gang, es gab einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit zwei Programmen. Flugreisen konnten sich nur wohlhabende Menschen leisten – ich erinnere mich noch, dass mein Vater vier Jahre für unsere Reise in die USA zu unseren Verwandten sparen musste, für ein Discount-Economy-Ticket mit zweimal umsteigen. Um internationale Wirtschaftszeitungen, englischsprachige Wirtschaftsbücher oder Markenklamotten zu bekommen, musste ich immer mit einem lauten, ruckeligen ÖAF Gräf & Stift-Bus nach Wien fahren, es gab sie nur in ausgewählten Geschäften zu sündhaft teuren Preisen.2 Es gab zwar einige Supermärkte, aber das Angebot war im Vergleich zu heute bescheiden, spezielles Obst gab es nur in der Saison, an der Fleischtheke gab es ein paar Tagesangebote und das war’s. Restaurantbesuche gab es nur zu besonderen Anlässen.
Die Oberschicht, an der ich mich orientierte, führte schon damals ein anderes Leben, aber dieses Leben war einer kleinen Minderheit vorbehalten. Ich kann mich noch erinnern, dass mir mein Vater eine schallende Ohrfeige verpasste, als ich ihn fragte, wieso sich manche Menschen ein Auto leisten können, das 220 Stundenkilometer schaffte, während wir nur einen Golf L mit 60 PS zu Hause stehen hatten – ohne Klimaanlage natürlich –, in dem man bei Hitze auf den Plastiksitzen klebte.
Der Boom beginnt
Januar 1980: Ronald Reagan wird als 40. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Er hatte die Wahl mit dem Slogan »Make America Great Again«3 gewonnen – wie sich doch die Geschichte manchmal wiederholt. Er versprach Wachstum, Deregulierung, niedrige Steuern. Zunächst in den USA, danach in Europa und in anderen Teilen der Welt begann eine einzigartige wirtschaftliche Boom-Phase, die mit einigen Unterbrechungen bis 2020 andauern sollte. Plötzlich war so etwas wie Mobilität, Reisen, Restaurantbesuche, Designerklamotten, Delikatessen, komfortable Wohnungen, Zugang zu Information et cetera nicht nur einer kleinen Oberschicht vorbehalten, sondern erreichte weite Teile der Bevölkerung. Zwei Autos pro Familie, ein fast unbegrenztes Warenangebot im Supermarkt, moderne Wohnungen, Restaurantbesuche und so weiter waren auch für eine Mittelstandsfamilie im Hamsterrad plötzlich erschwinglich. Sogar der Taxifahrer konnte sich mit Ryanair für 49 Euro einen Kurztrip nach Mallorca leisten. Dazu kamen Leasing- und Finanzierungsangebote der Finanzindustrie, welche die Steigerung des Lebensstandards beschleunigten. Mit Einführung des Internets, internetfähiger Handys und fast kostenloser Telefonie waren auch Information und Unterhaltung für alle Menschen verfügbar. Gleichzeitig gab es gewaltige Fortschritte im Gesundheitswesen, das in den meisten europäischen Ländern nahezu kostenfrei war, und der Sozialstaat garantierte auch in schwierigen Situationen ausreichende Absicherung. Über Krieg und Atomwaffen konnte man noch in den Geschichtsbüchern nachlesen, dafür gab es Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen in Europa. Das Leben im Hamsterrad war zwar langweilig, aber bequem, und vor allem eines, es war abgesichert.
Die Notenbanken als Wunderheiler
16. September 2008: Ich wollte gerade einen größeren Bargeldbetrag abheben, aber vor der Bank war eine lange Menschenschlange. Lehmann Brothers war am Tag zuvor pleitegegangen und die (Finanz)Welt stand am Abgrund. Ich telefonierte mit meinem Banker und er sagte mir, dass ich maximal 5000 Euro am Tag abheben könne, mehr ginge derzeit einfach nicht. Am Nachmittag führte ich einige Gespräche mit New York. Die Lage war extrem angespannt. AIG, die weltweit größte Versicherung, war praktisch insolvent, und mehrere Großbanken drohten zu kippen. Selbst in der reichen Schweiz war die Lage prekär, die größte Bank des Landes, die UBS, benötigte Staatshilfe. Für kurze Zeit sah es aus, als wäre die Welt dem Armageddon nahe.
Die Antwort auf die Krise lieferte Henry »Hank« Paulson, der ehemalige Goldman-Sachs-CEO und Finanzminister der USA. Er verlangte vom US-Kongress 1000 Milliarden Dollar, eine damals unvorstellbar große Summe. Er bekam 700 Milliarden Dollar4, aber das reichte am Ende, um die Banken zu retten und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Die Rettungspakete für die Banken und für die Wirtschaft waren der Beginn einer gewaltigen Gelddruckorgie der Zentralbanken in der gesamten westlichen Welt. Gleichzeitig senkten die Notenbanken in den USA, Europa und Japan die Zinsen auf (nahe) null, um die Erholung der Wirtschaft und der Finanzmärkte zu beschleunigen.
Das Prinzip war relativ einfach:
Die Staaten gaben enorme Summen für die Belebung der Wirtschaft, die Rettung der Banken und die Finanzierung des Sozialstaats aus.
Diese Ausgaben mussten sie finanzieren und nahmen dazu Schulden auf, indem sie Schuldverschreibungen begaben, sogenannte Staatsanleihen, und zwar in gewaltigem Ausmaß.5 Diese Staatsanleihen wurden wie andere Anleihen auch am internationalen Markt gehandelt. Jeder, der eine solche Anleihe kaufte, konnte davon ausgehen, dass er das eingesetzte Kapital minimal verzinst innerhalb einer bestimmten Frist zurückbekam. Minimal verzinst deshalb, da die Notenbanken den Leitzins auf praktisch null gesetzt hatten, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Aus Sicht des Staates war das unglaublich praktisch. Er konnte nahezu unbegrenzt Schulden machen und musste kaum Zinsen zahlen. Durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken war Geld unglaublich billig geworden. Geld oder – aus Sicht des Staates – Schulden kosteten praktisch nichts. Es gab nur ein Problem: Die Schuldverschreibungen des Staates, also die Staatsanleihen, musste auch jemand kaufen. Sonst war das Kapital schlicht nicht da. Firmen oder private Anleger kauften diese Anleihen jedoch nicht, da sie sich nicht mit 0,5 Prozent oder 1 Prozent Zinsen oder sogar Negativzinsen abspeisen lassen wollten. Wer sollte also die Staatsanleihen kaufen? Wem machte es nichts aus, wenn er für das eingesetzte Kapital keine oder kaum Zinsen bekam?
Richtig. Den Zentralbanken machte es nichts aus. Sie konnten als Einzige ohne Limit Staatsanleihen kaufen, und es machte auch nichts, dass sie dafür keine Zinsen bekamen. Der Kreis war geschlossen. Staat verschuldet sich und gibt Staatsanleihen zum Nulltarif, Zentralbank kauft Staatsanleihen zum Nulltarif. Alle sind glücklich.*
*Zur Verteidigung der Notenbanken sei hier angeführt, dass ohne die sogenannte »unkonventionelle Geldpolitik« und das zum Teil radikale Eingreifen der Notenbanken (Mario Draghi: »Whatever it takes«) es nicht nur dramatische Verwerfungen der Weltwirtschaft gegeben hätte, sondern es auch wahrscheinlich den Euro als Währung heute nicht mehr geben würde. Gleiches gilt für Sonderprogramme im Zuge der Pandemie (zum Beispiel das PEPP: Pandemic Emergency Purchase Program). Es war also im Nachhinein betrachtet – zumindest kurzfristig – wahrscheinlich richtig, wie die Zentralbanken gehandelt haben, aber: there’s always a flip side of the coin – alles hat seinen Preis. Und der kommt jetzt.
Denn: Diese Art der Zentralbank-finanzierten Wirtschaft führte bisher in der Geschichte stets zu Inflation, drastischer Geldentwertung und zur Verarmung weiter Teile der Bevölkerung. Aber diesmal war es anders. Der Grund dafür: Es gab zum ersten Mal in der Geschichte eine richtige Überflusswirtschaft.
In Wahrheit ist das alles nicht neu. Staatsfinanzierung aus der Notenpresse gibt es seit Hunderten von Jahren. Früher führten Könige Kriege, konnten ihre Schulden nicht in Goldtalern bezahlen, vermischten Gold mit Eisen oder Blei, hatten plötzlich doppelt so viele »Goldtaler« und bezahlten damit ihre Schulden. Das Problem: Es gab eine Mangelwirtschaft und die Anzahl der Häuser, Kühe, Pferde und Kleider erhöhte sich nicht, während sich die Anzahl der »Goldtaler« verdoppelte. Folglich gab es doppelt so viele Taler beim selben Warenangebot und die Preise verdoppelten sich, also Inflation oder Geldentwertung.6 Auch wenn die Mechanismen über die Zeit deutlich komplexer wurden, änderte sich am Grundprinzip wenig.
In der Überflusswirtschaft der 2010er-Jahre war die Situation jedoch eine komplett andere. Die Notenbanken druckten Geld7, vermehrten die Anzahl der Dollars, Euros, Pfunde, Yen et cetera im Umlauf. Der Staat, die Unternehmen und die Konsumenten hatten mehr Geld in der Tasche und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen stieg.8 Allerdings: Aufgrund des gewaltigen technologischen Fortschritts hatten wir eine Überflusswirtschaft, und wenn mehr Autos, Flugreisen, Kleidung oder sonstige Waren nachgefragt wurden, wurden einfach mehr Autos, Flugzeuge, Kleidung et cetera produziert. Durch die Globalisierung der Wirtschaft gab es auch einen deutlich stärkeren Wettbewerb und die Produktionskosten konnten massiv gesenkt werden, sodass die größere Nachfrage nicht zu höheren Preisen, sondern zu einer höheren Produktion und somit zu Wirtschaftswachstum führte.
Die Nullzinspolitik beschleunigte diesen Effekt noch. Geld kostete praktisch nichts mehr, sodass Staaten, Unternehmen und Privathaushalte sich fast zum Nulltarif verschulden konnten und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen und somit das Wirtschaftswachstum zusätzlich befeuerten.9 Durch die Strafzinsen, welche die Banken auf Geld, das sie bei der Zentralbank hinterlegten, zahlen mussten, war auch der Anreiz für die Banken da, die Kreditvergabe zu erhöhen und somit die hohe Verschuldung zu ermöglichen.
Die Notenbanken waren zu den Wunderheilern der Wirtschaft geworden. Sie konnten praktisch uneingeschränkt Geld drucken, es über die Banken und die Staatshaushalte in Umlauf bringen10 und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln, und das ohne nennenswerte Inflation11: die Quadratur des Kreises. Viele Ökonomen sprachen schon von einer neuen Ära, der Ära des Helikoptergeldes.
Die Nebenwirkungen der Gelddruckmedizin
Ganz ohne Nebenwirkungen funktionierte der Wunderheilungsprozess der Zentralbanken allerdings nicht. Es gab durchaus starke Inflation, und zwar primär in zwei Bereichen:
1. Bei nicht beliebig vermehrbaren Gütern und Dienstleistungen, zum Beispiel IT- oder Handwerksdienstleistungen (das Angebot an Arbeitskräften war naturgemäß beschränkt und ließ sich nicht in kurzer Zeit vermehren), ebenso bei Luxusgütern12, die per definitionem beschränkt sind – sonst wären sie ja nicht mehr exklusiv. Hier gab es eine deutliche Inflation, oftmals um die 10 Prozent pro Jahr, manchmal auch darüber. Völlig logisch: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Ferraris13 oder Luxushotels an der Croisette in Cannes; steigt die Nachfrage aufgrund des größeren Geldumlaufs, steigen einfach die Preise.
2. Bei Vermögenswerten, insbesondere bei Assets, die nur begrenzt vermehrbar sind, beispielsweise guten Immobilien, guten Aktien und Unternehmensbeteiligungen, Kunstwerken, Oldtimern et cetera, gab es die sogenannte Asset-Inflation, die auch bei circa 10 bis 12 Prozent p. a. lag.
Die exzessive Vermehrung der Geldmenge, kombiniert mit Nullzinspolitik14, führte zu einem drastischen Anstieg sämtlicher Vermögenspreise in der Periode 2010 bis 2020. Der S&P 500-Index verdreifachte sich15, der NASDAQ vervierfachte sich, der DAX stieg um das Zweieinhalbfache. Immobilienpreise weltweit stiegen je nach Lage um 100, 200 oder 300 Prozent. Der Goldpreis verdoppelte sich, andere Edelmetalle stiegen teilweise noch mehr. Anleihenpreise explodierten durch den Zinsverfall.16 Die Kryptowelt wurde neu erschaffen, Bitcoin stieg von nahezu null auf fast 20 000 US-Dollar.
Der Preisboom bei sämtlichen Vermögenswerten wurde durch das Wunderheilmittel der Notenbanken in mehrfacher Weise getrieben. Die großen Geldmengen flossen folglich nicht nur in den Konsum von Waren und Dienstleistungen, sondern auch zu einem signifikanten Teil in Vermögensanlagen, sowohl zum Zweck der Vermögensbildung, aber noch mehr zum Zweck der Finanzspekulation. Und die Finanzspekulation wurde durch die Nullzinspolitik erst richtig befeuert, wie mit einer Rakete im A****. Steigende Assetpreise und Geld zum Nulltarif sind ein wilder und hochprofitabler Cocktail, solange die Party läuft.
Geld verdienen ist ganz einfach
München, 23. Februar 2019: Ich treffe eine Bekannte von mir auf einen Kaffee; sie arbeitete als Juristin im bayrischen Staatsdienst. Von Finanzen und Wirtschaft hat sie nicht wirklich eine Ahnung, aber auf Empfehlung einer ihrer Freundinnen, die Immobilienmaklerin war, hatte sie im Jahr 2015 eine Wohnung in München gekauft. Stolz erzählte sie mir, dass sie die Wohnung soeben ihrer Nachbarin verkauft hat, mit über 150 000 Euro Gewinn. Mehr als das Doppelte ihres Jahresgehalts! »Geld verdienen ist ganz einfach«, sagte sie.
Damals hatte die Dame recht. Egal, ob Immobilien, Aktien, Anleihen, Beteiligungen, Kryptowährungen, Edelmetalle, Oldtimer, Kunst oder Uhren … In den Jahren 2010 bis 2020 galt lediglich: Dabei sein ist alles. Selbst Menschen ohne nennenswerte Investmenterfahrung konnten auf ihre Vermögensanlagen 8 bis 10 Prozent pro Jahr erzielen; bei 2 Prozent Inflation wurden sie somit um 6 bis 8 Prozent pro Jahr wohlhabender, also eine Vermögensverdoppelung in zehn Jahren. Wer etwas Ahnung von Investments hatte, konnte locker 15 bis 20 Prozent p. a. auf sein eingesetztes Kapital verdienen und musste noch nicht einmal besonders gut darin sein. Profis wie ich oder viele meiner Freunde erzielten auf ihre Investitionen 30 Prozent und mehr pro Jahr, bei einigen meiner Immobiliendeals konnte ich mein eingesetztes Eigenkapital in zehn Jahren verzehnfachen.
Ein Beispiel:
Ich kaufte eine Einzimmerwohnung in Stuttgart West in der Vogelsangstraße im Jahr 2010 für 60 000 Euro. Nettomiete 350 Euro pro Monat oder 4200 Euro pro Jahr, 7 Prozent Mietrendite. 55 000 Euro Kredit, 12 000 Euro Eigenkapital17, 4,5 Prozent Kreditzinsen, 2,5 Prozent Anfangstilgung.
Die Miete zahlt den Kredit ab (4200 Euro Nettomiete, 3850 Euro Kreditrate).
Nach zehn Jahren war die Wohnung 180 000 Euro wert18, die Miete hatte sich auf 450 Euro pro Monat erhöht. Nach zehn Jahren lag der Kredit noch bei circa 38 500 Euro. Somit hatte ich nach Abzug der Schulden einen Vermögenswert von 141 500 Euro.19 Aus 12 000 Euro Eigenkapital wurden 141 500 Euro, abzüglich der Reparaturen und Instandhaltungskosten bleiben 120 000 Euro. Das Zehnfache des eingesetzten Eigenkapitals. Geil oder? Mehr dazu später im Buch.
Wer im Zeitraum 2010 bis 2020 an den Finanz- und Immobilienmärkten kein Geld verdiente, war entweder strohdumm, extrem faul, stockbesoffen oder einfach nicht dabei.
Das Grand Finale der Nullzins- und Niedriginflationsphase
20. April 2020: Ich hatte gerade während des Lockdowns einen YouTube-Livechat, als ich meinen Augen nicht traute. Der Ölpreis20 war auf minus 40 Dollar gefallen. In anderen Worten: Du bekamst Geld, wenn du Öl gekauft hast. Wie verrückt war das bitte? Meine Fans waren aufgewühlt. Vor gut einem Monat, am 16. März 2020, hatte ich einen »Farewell Lunch« mit ein paar Freunden im Wiener »DO & CO« Restaurant. Am selben Tag begann der erste Corona-Lockdown. Die Welt stand still, in New York, in Frankfurt, in Tokio und in Sydney. Fabriken mussten ganz oder teilweise schließen, Restaurants waren geschlossen, die Wirtschaft war in einer Schockstarre. Die Finanzmärkte reagierten heftig, die Börsen kollabierten. Die Welt stand wieder vor einem Armageddon.
Aber diesmal zögerten die Zentralbanken und Regierungen nicht lange und beschlossen beispiellose Rettungspakete. Sowohl in den USA als auch in Europa summierten sie sich jeweils auf mehr als 3000 Milliarden. Wie wurde das ganze finanziert? Wieder durch die Notenbanken, die Bilanzsumme der Fed erhöhte sich im Jahr 2020 von 4000 auf 7000 Milliarden, bei der EZB war es ähnlich.21 In den USA gab es zum ersten Mal Helikoptergeld, der Staat überwies direkt Geld an alle seine Bürger.
Die Reaktion der Finanzmärkte fiel heftig aus. Trotz Corona-Lockdown und tiefer Rezession erreichten die Börsen neue Höchststände, die Immobilienmärkte in fast allen westlichen Ländern und auch in vielen Emerging Markets boomten und erreichten weltweit astronomische Niveaus, Bitcoin stieg im Herbst 2021 bis auf 67 000 US-Dollar. Es gab zwar keine regulären Partys, dafür gab es die Corona-Party an den Finanzmärkten …
Die Party wird exzessiv: Der Höhepunkt naht
Offenbach, 27. September 2021: Ich hatte einen Besichtigungstermin für ein Mehrfamilienhaus in Offenbach ausgemacht. Das Objekt war in der Nähe des Hafens, wo ich ein paar Jahre zuvor ein ertragreiches 20-Parteien-Haus gekauft hatte, ich kannte die Gegend gut. Der Angebotspreis war schon sehr sportlich, aber ich hoffte darauf, ihn herunterhandeln zu können. Ich hatte dem Makler vorab einen Kontoauszug und eine Finanzierungsbestätigung geschickt, um mein Interesse zu untermauern, und meine Bank hatte mir sehr attraktive Konditionen, unter 1 Prozent Zins auf 10 Jahre, fix angeboten. Als ich mich gerade vom Frankfurter Hof auf den Weg machen wollte, klingelte mein Handy und der Makler war dran: »Herr Hörhan, es tut mir leid, aber ich muss den Termin absagen. Das Haus ist schon verkauft, der Käufer hat eine Kaufzusage ohne Besichtigung gemacht und 150 000 Euro über dem Angebotspreis bezahlt. Sie werden verstehen …« Ich dachte mir nur: crazy times. Das ist nicht normal.
Am Abend traf ich im Frankfurter Hof noch einen Fan von mir zum Abendessen. Er erzählte mir von einer neuen Kryptowährung, in die ich unbedingt investieren müsse. Sie würde die Welt verändern und der Kurs würde sich noch verhundertfachen. Er hatte vor drei Monaten 10 000 Euro investiert und mittlerweile sei sein Investment über 100 000 Euro wert. »Immobilien sind doch langweilig, Gerald, du verzehnfachst dein Geld in zehn Jahren, ich in drei Monaten«, sagte er. »Wer ist jetzt der Investmentpunk?«
Ich schüttelte nur mehr den Kopf. Die (Finanz)Welt ist auf Koks und Crack, dachte ich mir.
Die gewaltigen Gelddruckorgien und mehr als zehn Jahre Nullzinspolitik entfalteten ihre volle Wirkung. Immobilien zum 35- und 40-Fachen der Jahresmiete, Anleihen mit Negativzins, Aktien zum 50-fachen KGV – falls es überhaupt ein KGV gab und die Firma keine Verluste machte –, Meme Stocks22, Beteiligungen zum 15-fachen adjusted forward EBITDA23, Shitcoins24 mit Milliardenkapitalisierung, Start-ups ohne Geschäftsmodell mit 10 Millionen Euro Bewertung …
Ich kannte Großimmobilienbesitzer in Chemnitz und Görlitz, die mit 200 000 Euro Eigenkapital 50 oder 100 Wohnungen kauften – mehr dazu später im Buch. Immobilienspekulanten kauften zu immer verrückteren Preisen, um jemanden zu finden, der zu einem noch verrückteren Preis kaufte. Bei einer Mastermind auf Mallorca traf ich Menschen, die fast ihr ganzes Erspartes – manchmal auch mehr – in obskure Kryptowährungen investierten, und mir war während des Gesprächs nach drei Minuten klar, dass die Initiatoren das Geld abschöpfen wollten. Es war einfach verrückt. Jegliche Rationalität war verloren gegangen. Bilanzen und Cashflow spielten keine Rolle mehr. Risiko wurde völlig falsch bewertet.
Und wie bei jeder exzessiven Party gibt es auch hier ein Ende. Spätestens am 16. März 2022 hieß es: »Time to say Goodbye«.
Die Party ist vorbei: Das Ende der Überflusswirtschaft
Ibiza, 26. Juli 2022: Ich hatte mich gerade mit einigen Freunden im Restaurant »Tatel« im »Hard Rock Hotel« getroffen. Wir hatten freien Blick aufs Meer, es gab Hummer und Schampus, die Stimmung war ausgelassen. Das Motto für den Abend war »Ibiza Rocks«. Plötzlich klingelte mein Handy, der Typ, der mir noch vor weniger als einem Jahr von der neuen Super-Duper-Kryptowährung erzählt hatte, war am Telefon. Ob ich ihm Geld leihen könne, er brauche dringend 50 000 Euro. Mit der Aussage »hundertfach« hatte er damals schon recht gehabt, aber im umgekehrten Sinn, nämlich hundertprozentigen Verlust. Ich fragte ihn, wofür er das Geld brauche. Er sagte, er müsse sein Leben finanzieren, da das Staking der Kryptowährung nicht mehr funktioniere, das war noch die höfliche Ausrede. Ich fragte ihn noch, ob er an die Steuern gedacht habe, die er zahlen müsse. Er schien ahnungslos, und ich lehnte ab. Zum Abschluss sagte ich ihm noch: »Geh was arbeiten und such dir einen Berater für Insolvenzrecht. Die Party ist vorbei. Außer für wahre Investmentpunks, denn für die beginnen jetzt die Schnappi-Times. Und – wer ist nun der echte Investmentpunk?«