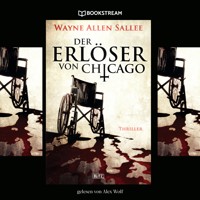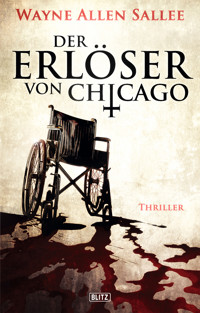
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller um einen Serienkiller, wie Sie ihn bisher noch nicht gelesen haben! Chicago und seine verkommenen Bürger sind nirgendwo kaputter beschrieben worden. Ich habe noch kein Buch mit einem so breiten und schillernden Aufgebot des Grotesken gesehen. Ed Bryant in Locus
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wayne Allen Sallee
DER ERLÖSER VON CHICAGO
Bereits in dieser Reihe erschienen:
978-3-95719-302-5 Stefan Melneczuk, Marterpfahl
978-3-95719-300-1 Frank W. Haubold, Die Kinder der Schattenstadt
978-3-95719-301-8 Martin Barkawitz, Kehrwieder
Wayne Allen Sallee
DER ERLÖSERVON CHICAGO
Aus dem Amerikanischen von
eBook © 2014 by BLITZ-Verlag
Originaltitel: Holy Terror
erschienen 2012 bei Crossroad Press
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
All rights reserved
Print ISBN: 978-3-89840-020-6 E-Book ISBN: 978-3-95719-306-3
Vorwort
In der Geschichte, die ihr gleich lesen werdet, wimmelt es von Geistern. Ich habe Chicago auf nicht mehr als vier Häuserblocks heruntergebrochen, von denen im Laufe der letzten fünfundzwanzig Jahre kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Wo früher Obdachlose bettelten, geht man heute ins Theater, doch der Winter fällt immer wieder so herbe aus, dass er zum Prüfstein derer wird, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden, ob in Windy City, Deutschland oder anderswo auf der Welt.
Haltet euch warm!
Wayne Allen Sallee
Danksagung
Ich widme dieses Buch den Überlebenden in dieser Stadt, die gelernt haben, sich so gut wie möglich mit dem Wahnsinn hier zu arrangieren, jeder auf seine eigene Weise. Ich widme es weiterhin all denjenigen, die sich von einem Tag zum nächsten hangeln und dabei ums Überleben kämpfen, es schaffen oder auf der Strecke bleiben.
Darüber hinaus danke ich Greg und Darcie Loudon sowie ihren Kindern Ava, Quinn und Luc. Wenn sie der Geschichten ihres Vaters über den verrückten Typen auf seinen Bildern überdrüssig werden, nehmen sie vielleicht eines meiner Bücher zur Hand und fangen an, sie zu begreifen – wenn vielleicht auch nicht die Tatsache, dass ihr alter Herr mir als bester Freund bis zum bitteren Ende beigestanden hat.
Ich möchte Jörg Kaegelmann dafür danken, dass er sich dazu bereit erklärt hat, diesen Roman zu veröffentlichen. Andreas Schiffmann hat sich gehörig ins Zeug gelegt, um meine vom Schicksal geschlagenen Charaktere auch auf Deutsch authentisch wirken zu lassen, und zwar vom gesprochenen Wort bis hin zu ihren Gefühlen. Ohne ihn würdet ihr das Folgende bestimmt nicht mit Freude lesen. Hoffentlich zieht auch ihr etwas daraus.
Samstag, 18. März 1989:Flüchtige Momente der Erleuchtung
von Wayne Allen Sallee
Ich war Geschichte. Achtzehn Minuten lang weilte ich nicht mehr auf dieser Welt. Mein Unterbewusstsein hielt Ausschau nach dem Gesichtslosen, um ihm mit den Worten Hey, mein Bus ist da! zu winken. Leider wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich war nicht bei Sinnen, mein Gehirn an drei Stellen gequetscht und mein Unterarm gebrochen. Beide Knochen hatten sich durch den Stoff meiner zwei Pullis und die gefütterte Winterjacke gebohrt.
So weit zur Vorgeschichte dieses Buchs. Falls ihr mehr über den Unfall erfahren wollt, könnt ihr auch anderswo darüber lesen. Dieses Vorwort soll jedoch für sich selbst stehen und betrifft die folgenden Seiten, nicht meine Genesung. Ich will erklären, weshalb dieses Buch ursprünglich 1992 herauskam und im Winter 1988/89 spielt. Vor über zwanzig Jahren kam mir die Idee, und der Erlöser begleitet mich jetzt schon sehr, sehr lange.
Im Jahr nach der Erstveröffentlichung, die mit der zweiten World Horror Convention in Nashville zusammenfiel, baten mich Autogrammjäger, die um meinen Hintergrund wussten, häufig darum, meinen Doktor ungefähr mittig auf Seite 243 zu platzieren beziehungsweise ein Sternchen wie in der abgetippten Fassung des Manuskripts. Das wäre dann die Szene gewesen, in der sich zwei Cops in einem einstöckigen Haus (Two Flats nennt man die hier) auf Mohawk Street mit einer alten Frau unterhalten, während im Hintergrund zum hundertsten Mal Barney Miller über die Mattscheibe flimmert.
Jene Seite war einen vollen Monat in meine Smith-Corona gespannt und am Ende von einer dicken Staubschicht überzogen. Wegen der Kontusionen musste mein linker Arm über Wochen hinweg ruhen und konnte nicht operiert werden, bis die tägliche Kernspin den Ärzten zeigte, dass ich nicht verbluten, platzen oder sonst etwas tun würde, was sie befürchteten. Weiterhin wissen die meisten von euch vielleicht, dass ich mit rechtsseitiger Kinderlähmung geboren wurde und deshalb die andere Hand nicht gebrauchen kann, ganz zu schweigen von meinem rechten Auge. Das Zimmer im Holy Cross Hospital teilte ich mir damals abwechselnd mit betrunkenen Autofahrern, zugedröhnten Müttern mit einem Dutzend Kindern und einem toten Litauer, dessen Leiche niemand abholen wollte. Ich war wie eine Marionette, deren Fäden man gekappt hatte, musste gefüttert und gewaschen werden und bekam wie die ganz armen Schweine die Schnabeltasse vorgehalten und hinterher das Kinn abgetupft, wenn ich mich bekleckert hatte. Ihr wollt nicht wirklich wissen, wie ich es schaffte, zielgenau in den Plastiksack zu pinkeln, aber ich erinnere mich noch lebhaft daran, dass ich Mut aus diesem Geschick schöpfte.
Nach 291 Tagen, als man mir den letzten von sieben Gipsverbänden abnahm und somit endlich wieder Freiheit schenkte, konnte ich zumindest mit der Hand zucken. Meine Lebens- und Liebeslinien waren ausradiert, die Hände glatt wie die einer Schaufensterpuppe, passenderweise mit steifen Fingern. Noch Monate später konnte ich Daumen und Zeigefinger nicht krümmen, wohingegen die anderen drei wie Krallen verkrampft blieben. Entweder richtete ich in dieser Haltung also eine gedachte Pistole auf jemanden, oder ich machte dem Allmächtigen Vorwürfe, weil ich noch lebte. Als mir an jenem 18. März 1989 schwarz vor Augen wurde, sah ich ausgerechnet David Janssen als Doktor Kimble, der mir bedeutete, ich solle stehen bleiben, weil meine Zeit noch nicht abgelaufen sei. Andererseits ergab die Erscheinung des guten Richard durchaus Sinn; immerhin war er stets auf der Jagd nach dem Einarmigen, der seine Frau auf dem Gewissen hatte. Selbst heute noch tippe ich nur mit einem Finger und habe Rücken- und Nackenschmerzen, weil ich fast ein Jahr lang mit dem schweren Gips herumlaufen musste. Die verbogene Metallplatte, die sie mir in den Schädel geschraubt hatten, bewahre ich gemeinsam mit den Röntgenaufnahmen der Fraktur, die ich heimlich habe mitgehen lassen, in einer Schachtel auf. Knapp eine Stunde habe ich gebraucht, um diese Worte einzuhacken, alldieweil ich den Winter verfluche, der gerade auf seinem Höhepunkt vor der Tür tobt und dafür sorgt, dass ich Klauen wie ein Werwolf bekomme und meiner Entschlossenheit stumm mit einem breiten, schmerzverzerrten Grinsen Ausdruck verleihen muss.
Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre habe ich eine Menge Menschen getroffen, denen ich zu Dank verpflichtet bin, besonders Yvonne Navarro und Janet Winkler. Die beiden nahmen eine lange Auszeit von ihrer eigenen Schreib- beziehungsweise Lehrtätigkeit, um Passagen des Buches anhand meiner im Rausch des Demerols altmodisch auf Kassette aufgenommenen Worte zu transkribieren. Peggy Nadramia und Peter Gilmore von der Zeitschrift Grue wiesen eine Kurzgeschichte mit der Empfehlung ab, sie zu meinem Debütroman auszuarbeiten. Jeff VanderMeer ermöglichte mir den Vorabdruck der ersten Kapitel in Jabberwocky, Mark V. Zeising in House Monkey. Dennis Etchison, Joe R. Lansdale und Steve Rasnic Tem erteilten mir weitere Ratschläge, nicht zu vergessen der nunmehr verstorbene Karl Edward Wagner sowie J. N. Williamson, der mich dazu ermutigte, einen ersten Roman zu schreiben, als ich kaum mehr als eine Handvoll Kurzgeschichten veröffentlicht hatte. In der Entstehungsphase lasen Elizabeth Massie, Jeff Johnston, Joan Van der Putten, Kathleen Jurgens, Robert Bayou Bob Petitt und Sid Williams gegen, um sicherzugehen, dass ich nicht von meinem Thema abweiche.
Hier und heute bin ich besonders Brian Hodge zu Dank verpflichtet, der sich das Ding vor Jahren einverleibt und ein Vorwort zur Jubiläumsausgabe geschrieben hat. Wer von euch noch nicht mit seinem literarischen Schaffen vertraut ist, hat gehörigen Nachholbedarf.
Die sechs Blocks im Zentrum Chicagos, die ich auf den folgenden Seiten beschreibe, existieren in dieser Form längst nicht mehr. Statt der Gebäude, in denen Obdachlose Zuflucht fanden, prägen jetzt Eigentumswohnungen das Bild, und wo eigentlich meine fiktive Bar Nolan Void beziehungsweise St. Sixtus stehen sollten, liegen Grundstücke brach. Parkhäuser ersetzen den Busbahnhof, in dem sich der Erlöser vorübergehend versteckt hat, und verdammt, selbst Dudley’s, wo man die besten Hotdogs verdrücken konnte, ist passé. Wo ich mir das Behindertenheim Marclinn gedacht habe, also zwischen dem Fine Arts Theater und einem Fastfood-Tempel, ragt nun zum Teil ein hässliches Bauskelett in die Höhe, das wahrscheinlich irgendwann von CBS bezogen wird.
In diesem Einband, irgendwann zur Jahreswende 1988/89, habe ich all jene Orte bewahrt. Gut zwanzig Jahre später ist es wieder eisig kalt, als zahlten sie mir jenen herben Winter heim – die Geister, die ich rief.
Euer Zauberlehrling
Wayne Allen Sallee
Burbank, Illinois, 17. Februar 2008
Wenn eine Prognose nur den Anfang darstellt
von Brian Hodge
Könnte man Romane beziehungsweise das Buch selbst als Medium interaktiver gestalten, und zwar auf eine dem Künstlerischen angemessene Weise, so würden die folgenden Seiten sofort verblassen, sobald ihr sie gelesen habt. Nicht dass sie es nicht wert wären, erhalten zu bleiben, sondern weil es eines der zentralen Themen widerspiegeln würde: Es handelt sich um einen Roman über Unsichtbare.
Es geht nicht um die allseits aus Filmen bekannten Phänomene scheinbar körperloser Anzüge, die wie von selbst durch die Gegend zuckeln, auch nicht um wie durch Zauberei erscheinende Fußspuren in nassem Sand oder auf trockenen Fußböden. Nein, diese Unsichtbaren wurden von nahezu ihrem gesamten Umfeld zu ebensolchen gemacht.
Falls ihr nicht gerade aus dem winzigsten Kaff kommt und dort niemals herausgekommen seid, habt ihr solche Menschen gewiss schon einmal gesehen – und vorgegeben, es nicht zu tun. Vermutlich wart ihr einer der zahllosen Fußgänger, denen sie einen Pappbecher vorhielten in der Hoffnung auf einen Geldschein oder wenigstens ein paar Münzen. Vielleicht saßen sie in einem Rollstuhl oder auch nicht und humpelten stattdessen. Gut möglich ebenfalls, dass sie sich mit jemandem unterhielten, den nur sie selbst sahen. Was auch sein kann, ist, dass sie es gar nicht offensichtlich hervorkehrten, euch aber trotzdem mit einem Gefühl vor den Kopf stießen, dass etwas nicht ganz koscher ist.
Im gleichen Augenblick wurden sie unsichtbar, und zwar auf endgültigere Weise als all die anderen gewöhnlichen Begegnungen, deren Blicken wir in den Straßen einer Stadt schlicht ausweichen. Ihr seid einen Schritt schneller vorbeigegangen, als seien sie genau das – nicht da.
Ich verurteile niemanden dafür und muss beschämt zugeben, dass ich mich selbst schon so verhalten habe. Gleichfalls sehe ich mich zu der Frage gezwungen, warum genau wir es tun, wiewohl ich über die Gründe nur spekulieren kann. Es ist ja nicht so, als würden Institute Umfragen zu diesem Thema durchführen. Vordergründig hat es wohl mit unserer Abneigung gegenüber Fremden zu tun, die etwas von uns wollen. Damit meine ich jeden beliebigen Fremden, wobei allein schon die Ahnung genügt, er könne einen wie auch immer belangen. Mit einer ersten unverbindlichen Bitte mag er den Fuß in die Tür bekommen: ein paar Cent zuerst, und im nächsten Augenblick einen Teil deiner Seele. Also lieber vorsichtig sein.
Konfrontiert man uns hingegen mit ganz offensichtlich kaputten Existenzen, so geht dies tiefer unter die Haut. Wir sehen, dass etwas im Argen liegt, und hassen es, nichts dagegen unternehmen zu können. Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, das uns überkommt, wenn wir auf Leid stoßen, das zu lindern wir nicht in der Lage sind. Wenn Physik oder Biologie uns einen Streich spielen, führt uns dies das Chaos als grundlegende Wahrheit vor Augen, und beklemmender, als der Natur dabei Böswilligkeit zu unterstellen, ist allein die Einsicht, dass wir in ihr überhaupt keine Sonderstellung genießen. Das Leben macht nicht vor Einzelschicksalen Halt.
Dinge zerfasern. Zentren brechen auseinander. Niemand von uns ist immun dagegen, und daran erinnert zu werden, sorgt für Beunruhigung. Lieber also die Zeichen ignorieren.
Ich weiß nicht, wann Wayne Allen Sallee die Heuchelei aufgab, angeblich nichts zu sehen, falls er überhaupt jemals Scheuklappen getragen hat. Vermutlich nicht. Liest man sein Buch, erhärtet sich der Gedanke, die meisten Charaktere, sowohl Haupt- als auch Nebenfiguren, beruhen auf Menschen, denen er selbst begegnet ist und mit denen er lange Gespräche geführt hat, wobei er jeden Einzelnen persönlich getroffen und aus nächster Nähe gesehen hat, ohne auch nur einmal wegzuschauen.
Die Ausdrücke, die er zu ihrer Beschreibung verwendet, mögen überraschen: Behinderte. Krüppel. Der Roman entstand und erschien in einer Zeit, als furchtbare Euphemismen wie anders begabt, körperlichherausgefordert oder beeinträchtigt, die ohnehin nichts an der Realität zu ändern vermögen, noch nicht zum Medienwortschatz gehörten. Für eine Neuauflage hätte Sallee seine Ausdrucksweise überarbeiten können – aber aus welchem Grund? Nichts in diesem Bereich hat sich geändert, und Schriftsteller dürfen sich der Sprache bedienen, die ihnen am aufrichtigsten vorkommt.
Eine Zeit lang war ich mir nicht sicher, inwieweit ich mich hier diesbezüglich auslassen sollte. Diesen wichtigen Faktor darf man weder unter den Tisch kehren noch bloß am Rande ansprechen. Das Hauptaugenmerk muss andererseits auch nicht darauf liegen: Wayne Allen Sallee weiß sehr gut, wovon er spricht, wenn es um Behinderung und Krankheit geht. Durch eine Hirnblutung beim Entbinden schlägt er sich ein Leben lang mit Auswirkungen einer Zerebralparese herum. Kurz nachdem ich ihn vor knapp zwanzig Jahren kennenlernte, wurde er obendrein angefahren und gegen einen Bus der Chicago Transit Authority geschleudert. Ich könnte eine beliebige Handvoll anderer Bekannter herauspicken, doch alle zusammen haben nicht so viele Operationen oder Therapien über sich ergehen lassen müssen oder so viel Pein durchlitten wie er. Mit einigem Abstand, aber auch aus unmittelbarer Nähe heraus habe ich beobachtet, wie er all dies mit Galgenhumor und verbissener Beharrlichkeit durchsteht, ohne je Selbstmitleid oder Zorn das Heft zu überlassen. Vielmehr wandelt er alles Negative um und lenkt es in kreative Bahnen. Seine Arbeit umfasst wie die eines jeden Schriftstellers, den die richtigen Beweggründe antreiben, eine gewisse Bandbreite. Ob ihn nun ein Schrei, ein ausgestreckter Mittelfinger oder eine Obduktion motiviert haben: Alle seine Geschichten zeichnen sich durch eine besondere Vorliebe für Horror aus, welcher er auf ungeahnt tiefgründige Weise Rechnung trägt.
Sein Einstand wurde ganz offensichtlich frei von der Leber weg geschrieben. Das ist bei vielen Romanen der Fall, doch nur wenige fallen dabei so gut aus. Die Protagonisten – Kriegsgefangene in zum Schlachtfeld umfunktionierten Körpern, um den O-Ton zu bemühen – legen größtenteils körperliche Gebrechen an den Tag und leben auf der Straße, nehmen jedoch nicht die exaltierte Rolle (sie rollen höchstens selbst) von Vorbildern ein, die mit dem stoischen Gleichmut eines Heiligen hinnehmen, was immer ihnen widerfährt. Genauso wenig handelt es sich um Karikaturen aus der Feder eines Schreibers, der ihre Welt nie mit eigenen Augen betrachtet hat. Stattdessen sind sie liebenswert, fehlbar und tapfer, als Menschen gelegentlich sogar albern, wenn sie ihren Weg humorvoll bestreiten, dann wieder verbittert oder traurig, immerzu aber fest entschlossen und bisweilen nicht ohne Anmut, da sie stets aufeinander achtgeben. Niemand außer ihnen wäre besser darauf geeicht, zumal sie zusammenhalten müssen, umso fester im beschriebenen Szenario.
Auf die behinderten Obdachlosen Chicagos hat es nämlich der Erlöser abgesehen, ein Serienmörder, wie ihr ihn noch nicht kennt. Seine Vorgehensweise ist so einzigartig wie die Quelle seiner Motivation: Gott. Zweifellos lässt er sich von irgendetwas leiten, doch was dies angeht, liegt die Interpretation in eurem Ermessen. Genauso stimmig klingt die Erklärung von Vic Tremble, dem guten Gewissen im Buch: Er entwirft einen alternativen Himmel, in dem die Götter der Qual und Glückseligkeit walten.
Als ich Waynes Debüt 1992 zum ersten Mal las, hatte ich noch nie etwas von Amma beziehungsweise Mata Amritanandamayi gehört, die als Art heilige Mutter mittlerweile rund dreißig Millionen Menschen umarmt haben soll. Was ich von Leuten erfuhr, die ihr auf diese Weise begegnet sind, nachdem sie selbst, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, jahrelang von niemandem berührt worden waren, hat mich teilweise zu Tränen gerührt. Erst beim Wiederlesen neulich dachte ich an sie. Ich finde, man kann kaum schöner Ja zum Leben sagen als Amma mit ihrer simplen Botschaft von Liebe und vorbehaltloser Akzeptanz. Sie nimmt ihr Gegenüber einfach als die Person wahr, die gerade auf sie zukommt. Die Mission des Erlösers stellt jedoch das genaue Gegenteil dar: Er ist nicht feindselig, sondern mordet aus Mitleid in einer grotesk pervertierten Form.
Am gleichen Tag, als ich das Buch wieder zur Hand nahm, stieß ich auf der Website von ABC News auf einen Artikel über den Chinesen Huang Chuancai, der an der seltenen Erbkrankheit Neurofibromatose leidet. In seinem Gesicht wuchern Tumoren von ungefähr fünfzig Pfund. Mehrere Fotos begleiteten den Bericht und unterstrichen die Schwere der Erkrankung so eindringlich, wie es die nüchternen Fakten allein nicht vermochten. Stellt euch einen gewichtigen Hautbalg vor, den man über einen Schädel mit nur noch vagen menschlichen Zügen gestülpt hat. Seine Hände hingegen waren unbescholten wie die eines Pianisten oder Cellisten wie Yo-Yo Ma. Selbst ein Mann, dessen Entstellung für mich auf der Welt ohnegleichen war, bezeugte so etwas wie Schönheit, falls man willens war, sie zu entdecken.
Manche taten es. Die meisten Kommentare waren wohlwollender Natur, wenngleich sich wenige Kleingeister zu dummen Witzen hinreißen ließen. Die überwiegend warmen Worte zeugten von Mitgefühl; man wünschte Huang viel Glück bei der Behandlung, was er wohl selbst nie zu lesen bekam. Andererseits möchte ich gern glauben, dass zumindest ein Teil davon bis zu ihm vorgedrungen ist. An eine Bemerkung erinnere ich mich besonders gut, vielleicht nicht einmal aus naheliegenden Gründen. Darin hieß es, Menschen wie Huang stellten unsere Herzen auf die Probe, indem sie offenbarten, ob wir kalt oder gutmütig sind. Der Gedanke an eine Prüfung ließ mich nicht los, weil er voraussetzt, dass jemand uns selbige auferlegt – jemand, der bewertet. Entweder wir bestehen oder fallen durch. Vor allem aber muss jemand als Testgegenstand auserkoren worden sein, ob zufällig oder nicht. Damit wären wir wieder bei Biologie und Physik oder den Göttern der Qual und Glückseligkeit.
Seid ihr wahlweise einfühlsam oder hartherzig, in jedem Fall aber mutig genug, um euch auszumalen, wie man sich in einer solchen Rolle vorkommt, so lest weiter. Ihr werdet in jemandes Fußstapfen treten, der den Weg sehr gut kennt.
Brian Hodge
Veitstanz, der erste und der letzte
Chicago, Near North Side, Freitag, 1. Dezember 1958
Sie kicherten schon eine ganze Weile in der letzten Bank. Für Frühreife wie sie gab es wichtigere Dinge zu besprechen, etwa die Frage, ob man sich ohne Knochen in der Hand an der Nase kratzen kann, als ihre Nacherzählungen des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, aus denen Schwester Kara Veronica gerade vorlas. Dann brach das Feuer aus, in dem fünfundneunzig Kinder und drei Nonnen ums Leben kamen. Es war 14:37 Uhr.
Die Hausaufgabe vom Vortag für die sechste Klasse lautete: Denke dir selbst eine Geschichte über Nächstenliebe aus und schreibe dreihundert Wörter dazu. Die drei Jungen in der hinteren Reihe hatten sich die erste nur angehört, weil Frankie Haid, der unter ihnen saß, sie verfasst hatte. Der kleine Schwarzhaarige besaß ein pummeliges Gesicht, dem man den Babyspeck noch ansah, und zugekniffene, blaue Augen, die wie horizontale Daumenabdrücke in den Höhlen ruhten. Vor allem aber verstand er es, sich mit Worten auszudrücken, und umso besser, wenn es darum ging, Bibelverse zu verunglimpfen.
Der Aufsatz zeigte Frankie einmal mehr von seiner besten Seite und war fein säuberlich auf hellbraunem Kanzleipapier abgefasst worden. Die Kringel des kleinen e und des kleinen a berührten allesamt die punktierte waldgrüne Linie, die jeweils zwischen den durchgezogenen verlief. Schon im vorangegangenen Jahr hatte die Schule aufgehört, weitere Bestände dieses Papiers zu kaufen, doch die Nonnen von St. Vitus dachten nicht an die Anschaffung von neuem, solange das alte nicht aufgebraucht war.
Jim McCoppin und Freddy Gorshin hatten nie Zweifel am Talent ihres Freundes gehabt und klopften ihm sprichwörtlich auf die Schulter, während der Pinguin Haids kleines Meisterstück zum Besten gab. Der Wohltäter darin half einem Jungen, der unter seinen Nachbarn als Satansbraten verschrien und jetzt mit seinem Fahrrad auf die Fresse gefallen war. Während er ausgestreckt dagelegen hatte, war allerdings ein anderer Halbstarker mit dessen Plattenkiste voller Singles von Brunnenvergiftern – so nannte sie der Pinguin – wie Eddie Cochran, Elvis Presley und Chuck Berry abgehauen.
Die gute Frau bemerkte, Frankie habe zwar zu salopp formuliert, jedoch erneut bewiesen, dass er christliche Meilensteine schlüssig in einen aktuellen Kontext setzen könne.
„Mit anderen Worten“, gackerte McCoppin neben seinem Kumpel, als die Schwester mit ihrem Gelaber fertig war, „der gleiche Quark wie immer.“ Dies sollte die letzte Weisheit bleiben, die er über das Leben verzapfte; drei Tage später starb er auf der Verbrennungsstation des Lutheran Deaconess Hospital.
Freddy Gorshin zog eine Grimasse. „Oh, der kleine Francis ist Pinguins Liebling. Wette, du gibst einen Spitzenmessdiener ab. Machst doch alles, um Schwester Hängetitte zu gefallen!“ Der blonde Junge, der seit Februar, als die Daily News Bilder von Charles Starkweather über den Äther laufen ließen, das Haarwasser seines Vaters benutzte, diskreditierte Haid mit einer schlaffen Handbewegung als Weichei. Als dieser daraufhin den Bezug zu knochenlosen Fingern herstellte, begann erwähnte wissenschaftliche Diskussion der drei, die wenige Minuten dauerte, bevor die Hölle losbrach.
Veronica hatte begonnen, die Arbeit von Billy Giraffenhals Dulcette zu lesen, während Frankie den Blick gelangweilt und ohne Interesse über die Lernkarten des oberhalb der Tafel angebrachten Alphabets schweifen ließ. A wie Apfel, B wie Buch … Freddy sann unterdessen über seine Idee nach und drückte sich mit dem Finger gegen die Nase.
Als der Feueralarm losging, verbargen fast alle ihre Freude hinter einer unschuldigen Maske. Mit etwas Glück dauerte die Brandschutzübung länger als bis halb vier, wenn es wieder läuten würde, und dann wäre der Tag gelaufen. Drei Dutzend Stühle wurden beinahe gleichzeitig nach hinten gerückt und schrappten dabei lautstark über das rotbraune Schachbrettmuster des ungewachsten Fußbodens. Haid verlor seine Freunde sofort aus den Augen, während Veronica mit der von Altersflecken marmorierten Hand fuchtelte, damit sich alle ordentlich in einer Reihe aufstellten. Frankie hörte amüsiert zu, wie die Himmelsbraut etwas von angemessener Disziplin in katholischen Grundschulen verzapfte, von wegen ihre braven Englein würden nie so ausfallend werden wie die Rabauken in öffentlichen Einrichtungen wie Wells oder Peabody. „Immer schön zwei und zwei. Hopp, hopp!“, sagte sie und klatschte dabei. „Wäre doch gelacht, wenn wir es den Spritzenrittern nicht zeigten, was?“
Haid starrte verdrossen aus dem Fenster auf das verlassene Basketballfeld im Humboldt Park gegenüber der California Avenue. Drei Mal blätterte der Wind die weggeworfene Zeitung um, die auf dem Beton lag, bis die Nonne endlich die Tür von Saal 217 öffnete. Auf dem Flur herrschte reger Betrieb, gleichwohl gesittet dank der Erwachsenenautorität der Schwestern Vesna und Beatrix. Das Quietschen der Ledersohlen echote durch den Gang, was Frankie an Ratten im Kanal erinnerte.
„In einer Reihe, wie wir es geübt haben.“ Veronica schaute verkrampft drein. „Billy, du hältst deinen Klassenkameraden zusammen mit Phillip Morror die Flügeltür auf. Hurtig, Jungs!“ Für Haid sahen die beiden Arschkriecher urkomisch aus, wie sie zum anderen Ende des Flurs dackelten. Sie zogen die Tür auf wie die Diener im Blackstone Hotel. Unter der zweiten stiegen Rauchschwaden auf wie ein Atemhauch im Winter.
„Okay, Kinder. Nur artig weitergehen!“, blaffte Veronica, als unten urplötzlich Schreie losbrachen. Haids Augen irrten umher und blieben an der Alarmglocke über seinem Kopf hängen, die ihm wie eine rote Riesentarantel vorkam. Die Sirene, die er in der Ferne hörte, kam irgendwo von draußen aus der LeMoyne Street. Feuerwehrautos! In diesem Augenblick begriff er, dass es sich nicht um eine Übung handelte.
Mit Vernunft war ihnen jetzt nicht mehr beizukommen. Haid sah zu, wie die Adern am Hals des Pinguins hervortraten, da sie sich, wie er vermutete, darum bemühte, nicht in Panik auszubrechen. Einen Augenblick später hatte er sie aus den Augen verloren, als die zweite Tür aufflog und ein Drittel der Schüler in graubraunen Qualm gehüllt wurde. Er hörte jemanden das Vaterunser flüstern. Doch nicht etwa er selbst?
Wer in einer scheu gemachten Herde noch atmen kann, lässt den Verstand fahren und wirft sich gegen Türen, die eigentlich nach innen aufgehen. Rund sechshundert Menschen kamen 1903 bei einem Brand im Iroquois Theater auf der Randolph Street ums Leben, weil sich die Ausgänge der drängenden Massen wegen nicht öffnen ließen, doch auch vierundfünfzig Jahre danach hatte die Stadt noch immer keine neue Brandschutzverordnung erlassen.
Vor Haid spielte sich alles wie in der Fernsehwerbung für Prell Shampoo ab, das in Zeitlupe aus der Flasche tropfte. Ein Junge neben ihm fing an, wie ein Hund zu winseln. Ein anderer namens Mahl hatte seinen Schließmuskel nicht mehr unter Kontrolle. Klumpig braun lief es ihm an den Hosenbeinen seiner marineblauen Schuluniform hinunter. Veronica sah jetzt aus wie Frankensteins Braut und schien am Boden festgewachsen zu sein, während ihre Schützlinge um sie herumstolperten, entweder mit wie zur Kreuzigung ausgestreckten oder vor ihren Mondgesichtern zum Schutz übereinandergelegten Armen. Sie stießen gegen Spinde oder Wasserspender und standen sich gegenseitig im Weg, derweil der Rauch und die allgemeine Konfusion sekündlich zunahmen.
Seltsamerweise fiel Haid gerade jetzt ein, was Veronica ihnen just eine Woche zuvor über Frankreich vorgelesen hatte. Vor allem dort hatte man in den Gemeinden ungefähr Ende des 13. Jahrhunderts begonnen, den Johannistag traditionell mit rauschhaften Tänzen zu feiern. Diese dauerten, bis die Gläubigen erschöpft zu Boden fielen und ekstatisch zuckten, was man mit dem sogenannten Veitstanz beziehungsweise Chorea Sancti Viti gleichsetzte, der eigentlich auf ein Krankheitsbild zurückging. Jedenfalls sahen nun alle aus, als ergingen sie sich gerade darin, bloß dass es krasser ablief. Die Kinder mochten streng katholisch erzogen worden sein, doch dies bedeutete nicht, dass sie sich genauso verhielten wie die französischen Bauern von einst. Janet Mandeen erbrach sich über den Schließfächern zu ihrer Rechten; sie hatte ihr Mittagessen, Fischstäbchen und grünen Wackelpudding zum Nachtisch, anscheinend noch nicht verdaut, und nun klebte die ganze Schweinerei dick am Holz sowie an den Metallteilen der Tür. Neben ihr heulten einige so heftig, dass ihnen der Rotz wie milchige Seifenblasen aus der Nase quoll.
Frankie brach selbst in Tränen aus. Das hasste er, weil er sich dabei wie ein Baby vorkam. Er erinnerte sich daran, wie Mom das Gestänge seines Gitterbetts hochgezogen und ihm den Kissenbezug locker um das Gesicht gewickelt hatte, damit er nicht laut wurde, wenn sie den Postboten hereinließ. Indem er sich ihrer entsann, dieser Schlampe Doreen Madsen Haid, vergaß er die Panik, die in ihm aufwallte, also konzentrierte er sich darauf. So abgrundtief hasste er sie, obwohl sie verstorben war. Während sein Vater für Thillens mit dem Geldtransporter durch die Stadt gefahren war, hatte sie es entweder mit dem Briefträger und dem Jungspund getrieben, der für Ricky’s Sandwiches ausfuhr, oder mit sonst irgendeinem Typen. Nachdem sie aufgeflogen war, hatte Dad sich von ihr getrennt, woraufhin Frankie mit ihr im Two Flat seines Onkels Vince in der Potomac Street hausen musste. Von dort aus war es nicht weit bis hierher in die Crystal Street, wo er die Schulbank drückte. Haid hatte sie derart verabscheut, dass es ihm überhaupt nicht nahegegangen war, als sie mit ihrem Chevrolet Biscayne in eine Straßenbahn auf der Division gebrettert war. Obwohl Onkel Vince Janssen Frankie manchmal dazu zwang, Dinge zu tun, die ihm wirklich sehr unangenehm waren, nannte er ihn jetzt seinen Vater. Er versuchte sich gerade vorzustellen, wie sein neuer Dad grinste, wenn er ein Bad einließ und ihn anständig einseifte, da lief er schon durch die Doppeltür. Die Stopper aus Gummi klemmten noch darunter, und Haid trat einen los, sodass ein Flügel zufiel. Ein mit Buntstift auf Bastelpapier gemaltes Winterbild klebte in einer Ecke der Bleiglasscheibe. Darauf machte Frosty der Schneemann gehörigen Terz wie in Garfield Goose, der Fernsehshow mit Frazier Thomas. Wer auch immer das Gekritzel verbrochen hatte, war die Bäume im Hintergrund mit Orange angegangen, weshalb es so aussah, als liefe Frosty vor dem Sonnenlicht davon. Eine der senkrechten Kanten des Papiers hatte sich zu kräuseln begonnen wie die L&Ms von Frankies Mutter. Sie hatte sich nie die Mühe gemacht, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, wenn sie mit ihm schimpfte.
Dulcettes Umrisse im Qualm lenkten ihn von seiner seligen Gebärerin ab. Sein begriffsstutziger Klassenkamerad hatte die Standardkrawatte aufgedröselt, die zur Uniform der Katholikenschule gehörte, und sich das gestärkte Standardhemd über sein Standardgesicht gezogen. Die Stirn glänzte vor Schweiß. Haid hielt Dulcette für ziemlich dämlich, derart den Helden spielen zu wollen. Wie ein Wachmann hatte er sich genau dorthin gepflanzt, wo der Rauch am dichtesten stand. Wen wollte er damit beeindrucken? Vielleicht legte er es darauf an, als Märtyrer in die Geschichte einzugehen wie Veit, der Namenspatron der Schule und Schutzheilige der Jugendlichen und Epileptiker. Tolle Kombination übrigens. Frankie sah Onkel Milty beim Abendgebet auf Knien. Sein linker Fuß stand fest auf der ersten von sechs Stufen bis zum Absatz. Sechs weitere, und sie waren im Erdgeschoss, also so gut wie gerettet, doch dann kreischte Dulcette. Der Grund dafür? Eine Flamme war am Geländer heraufgezüngelt, und der Ärmel seiner Jacke hatte Feuer gefangen. Nur wenige Zoll von Haid entfernt gab er ein leises Wimmern von sich, während er die Augen trotz des Rauchs aufriss, bis man sie für Kuchenringe zum Backen halten konnte. Frankie war so fasziniert von den orangeroten Flammen, die am Arm seines Mitschülers nagten wie eine eifrigere Version des Blob in seiner ganzen Farbenpracht, dass er nur am Rande mitbekam, wie es denjenigen hinter ihm vor Entsetzen die Sprache verschlug. Seine Aufmerksamkeit galt allein Billy Dulcette mit seinem langen Hals, dessen Vater bei Buler’s arbeitete und wahrscheinlich gerade über die Washtenaw Avenue preschte. Das war ein richtig cooler Dad, weil er allen Kumpels seines Sohnemanns Geld zusteckte, damit sie Archie-, Casper- und Flash-Comics vom Kiosk direkt neben dem Getränkeladen abgreifen konnten. Billy Dulcette war eigentlich gar nicht so übel und – Hey Gott, hörst du mir zu? – bewegte seinen Unterkiefer gerade schmerzhaft langsam gegen den Uhrzeigersinn, als bemühte er sich geduldig um die größte Kaugummiblase in der Geschichte aller Chicagoer Grundschulen. Verdammt, Dulcette, hör auf den Pinguin, die senile alte Schachtel, die gerade wie blöde Kyrie Eleisons und Stoßgebete an ihren Herrn austeilt! Gleich sollte sie ihren ersten Toten aus der Nähe sehen, denn Haid wusste, noch ehe die fünfte oder sechste Feuerzunge den Schopf des Trottels mit dem richtig duften Vater erreichte, dass er hinfällig war.
Haid stand dicht genug neben ihm, um es zu riechen, als Dulcette mit einem lauten Knall lichterloh in Flammen aufging. Seine sauber nach hinten gekämmten Haare verwandelten sich in eine unruhige Schlangenmähne. Einige Strähnen fielen einfach ab wie beim Friseur, andere sahen aus wie die rot sprühenden Dochte von Feuerwerkskörpern. Der Junge bewegte sich schließlich und vollzog eine unheimlich elegante Drehung, als der Pulk an ihm vorbeiströmte wie Blut aus einem Hämatom, das jeden Moment zu platzen drohte.
Frankie war nicht schnell genug; die hibbelige Menge aufgebrachter Kids bedrängte ihn von mehreren Seiten. Auf dem Weg hinunter gaben seine Knie schon auf der zweiten Stufe nach. Er geriet aus dem Gleichgewicht und streckte die Arme aus, wobei er jemanden mit seiner Rechten gegen den Brustkorb schlug. Die Finger links hingegen glitten über das glühend heiße Geländer, und er war überrascht, sich selbst schreien zu hören, als der untere Querstab eine Verbindung mit dem Fleisch seiner Handinnenfläche einging.
Er drehte den Kopf nach links und sah Pat Carlson, einen stocksteifen Hänfling, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, irgendwann einmal wie Sal Mineo aus … denn sie wissen nicht, was sie tun auszusehen. Jetzt stürzte er in die wandelnde Fackel Dulcette und kreischte dumpf. Mehrere Schüler waren über Frankie gestolpert, der mittlerweile kniete. Er fühlte sich matt wie im Sommer bei Tante Dot nach dem Schwimmen, wenn er zu lange unter Wasser geblieben war. Alles tat ihm weh, doch der Gedanke daran, dass es kaum schlimmer werden konnte, tröstete ihn. Dann trat jemand auf sein Bein, und er fühlte den Schmerz eindringlicher, als er es knirschen hörte.
Gebrochen. Sterben. Tod. Er biss sich auf die Lippe, die ganz trocken war vom Rauch und sofort aufplatzte. Nun musste er einen kühlen Kopf bewahren oder er würde draufgehen. Fäuste hämmerten gegen Spinde. Die Kinder, die ihn überrannt hatten, erreichten das Erdgeschoss. Ganz kurz blendete er das Geräusch zugunsten von jemandes Stimme aus, dann öffnete er den Mund wie beim Gähnen, weil das Geländer nach außen kippte und sich gefährlich weit zum Absatz hin neigte. Haid schrie lauter. Tränen brannten heiß in seinem Gesicht, als die Haut von drei Fingern abriss. Das L-förmige Geländer stürzte genau an der Stelle in die Wand gegenüber, wo eine geisterhafte Hand einen Abdruck hinterlassen hatte. Vage machte er das rote Stoppschild im Qualm aus, dessen Anweisung zum Innehalten ihm ähnlich gespenstisch vorkam. Die Mauer bröckelte an mehreren Stellen, Dunkelrot und Grau bespritzten die Hand, als das zum Projektil gewordene Metall zwei der größeren Jungen die Schädel zertrümmerte.
Frankie klammerte sich, so gut er konnte, an den Betonstufen fest. Seinen Körper, der in Schüben mit jeder Faser bebte, spürte er nicht mehr. Seine taube Linke zuckte, als noch jemand nach vorne kippte und auf seinem Unterarm liegen blieb. Er krallte sich geradezu an die Trittfläche, fuhr dabei mit seinen verkohlten Fingern über einen geschmolzenen Kaugummi. Am Rande seines vom Staub verengten Blickfeldes sah er Dulcette und Carlson, die eins geworden waren, sowie ein Dutzend weitere Gesichter wie gerahmt vom Gittermuster des Geländers, das nun auf sie niederstürzte. Der erste und gleichzeitig letzte Veitstanz war in vollem Gange.
Der Treppenabsatz brach nicht am Stück weg. Die Decke stand ebenfalls längst in Flammen und gab jetzt nach. Haid fiel ins Leere und hatte eine irre Vision von Gevatter Tod, der ihm etwas vorsang: All of my love, all of my kissin’, you don’t know what you’ve been missin’, oh boy …
Er landete auf seinem Hintern zwischen all den Leibern und dem Schutt, dem dampfenden Geländer und den zertrümmerten Schließfächern, halb bewusstlos in der ersten Reihe eines Buddy-Holly-Gigs im Jenseits. Nach unbestimmter Zeit öffnete er die Augen. Seine Lider waren so schwer, als hätte jemand Gewichte angehängt. Einen Moment lang nahm er alles wie zersplittert wahr, als habe ihm jemand die Netzhaut mit einer Nadel perforiert. Das Geländer und die abgerissene Tür eines Spinds klemmten seine Unterschenkel ein. Sein erster Gedanke: Ich bin ein Krüppel.
Neben ihm lag reglos ein blondes Mädchen. Haid schaute sie an und fand es nicht richtig, wie vorwurfsvoll ihre entseelten Augen ihn anstarrten. Sie schien ihm die Schuld für irgendetwas zuzuschieben. Die Sirenen, die Alarmglocke und das leise Stöhnen der Überlebenden, alles klang dumpf, da bemerkte Frankie die Nässe in seinen Ohren. Der Anblick des Mädchens hypnotisierte ihn. Ihr weißes Blüschen war fast ganz verbrannt; sie trug eine Goldkette um den Hals, deren Jesusanhänger auf ihrer kaum ausgeprägten Brust lag. Die Warzen sahen aus wie rohe Peperoni, und er fragte sich, wie viel Haut er selbst gelassen hatte. Als sie vor ein paar Jahren im Sommer aus Shelbyville, wo Tante Emma wohnte, zurück nach Hause gefahren waren, hatte er auf dem Weg ein Werbeplakat für Burma Shave gesehen. Die Slogans für diesen Rasierschaum reimten sich stets. Er hat zu lang ins Feuer geschaut, und jetzt fehlt Francis Haid die Haut. Als er das Mädel erneut anschaute, begriff er, was nicht stimmte: Das Feuer hatte ihre Lider fast komplett weggefressen. Haid stierte in das wunderbar klare und doch blinde Blau ihrer Pupillen. Im Weiß drum herum störten nur einige Staubpartikel, während er dem geschweiften Verlauf bis zu den Wulsten folgte, die den Übergang von den Augenhöhlen zum Stirnbein beschrieben. Er wiederholte dies mehrmals, bis ihm Blut aus den Ohren über die Wangen lief.
Dann wurde er zum zweiten Mal ohnmächtig.
*
Ein gedämpftes Weinen weckte ihn. Stilles Gebet. Das Loch in der Decke klaffte in der Form eines Vs und ließ Gips rieseln, der alles wie feine Hagelkörner bedeckte. Eine Menge unterschiedlicher Berührungen spürte er, hartes Metall und anschmiegsame Körper. Das lidlose Mädchen mit dem Zeichen des Heilands auf der Brust – Witz gemacht, totgelacht – lag immer noch links neben ihm vor den ersten Schließschränken. Als er den Kopf drehte, war ihm, als hacke jemand mit einem Pickel in sein Brustbein. Er kämpfte gegen eine neuerliche Ohnmacht an.
Einer der umgeworfenen Spinde war aufgesprungen. Die Tür schwang leicht hin und her wie der Arm seines Ziehvaters aus der Badewanne, wenn sie gemeinsam ihre Freitagabendwaschungunter Männern vollzogen. Ein Junge hatte mit Temperafarben in Druckbuchstaben ein Ich liebe die katholische Kirche verewigt, doch das letzte Wort war von einem älteren Semester mit schwarzem Filzstift durch Fotze ersetzt worden. Jetzt nicht mehr, ergänzte Frankie im Geiste, als ihm eine blutige Hand gegen das Auge fiel. Er wollte sich ein Lachen abringen und stellte dabei fest, dass mehrere seiner Zähne wackelten. Der Gips regnete ihm jetzt ins Gesicht. Ganz weit weg vernahm er wieder Sirenengeheul, Bremsen und dann Rufe. Von oben segelte ein Stück Pappe herab; er fragte sich, ob dort noch jemand am Leben war. Das Schild gemahnte in Blau mit weißer Schrift: Bitte waschen Sie sich die Hände, bevor Sie zur Arbeit zurückkehren. Reinlichkeit kommt gleich nac Genau hier hatte das Feuer ironischerweise einen Schlussstrich gezogen. Die Mahnung des Hausmeisters landete auf Haids Arm, ohne dass er es spürte.
Nun näherten sich Fußschritte. Als ihn die Neugier wieder packte, nahm er alle Kraft zusammen, um einen weiteren Blick auf das Mädchen zu werfen, doch die Tote war fort. Er hatte sich schlicht und ergreifend nur eingebildet, dass sie dalag. Dann hörte er jemanden seufzen, und diesmal war er es nicht selbst. Er schaute in die Richtung, aus der es zu kommen schien, vorbei an dem Leichnam aus seiner Phantasie. „Vater ist da.“
„Onkel Vince?“ War das wirklich sein Dad? Nein, es klang nicht nach ihm. Es war ein Feuerwehrmann, es … Frankie versuchte, seine Augen auf den Kerl zu fixieren, der sich gerade über einen verbrannten Jungen beugte. „Vater ist da, um dich mit nach Hause zu nehmen.“
Es war zwar nicht sein Dad, doch jetzt wusste er, dass er am Leben bleiben würde. Sie alle würden gerettet werden. Der Mann hob das Kind hoch, dessen Haut völlig zerfetzt war. Der Knabe sah aus wie ein schmutziger Wollteppich und atmete noch! Der Feuerwehrmann war stämmig und mit Blut besudelt, seine Brust komischerweise unbefleckt. Irgendetwas daran glühte, aber das lag an Haids Schock; zumindest redete er sich das ein.
„Komm zu Gott“, fuhr der Mann fort.
Der Schmerz wurde heftiger. Haid schnitt eine Fratze, als er versuchte, sich daran zu erinnern, wie sehr er seine Mutter hasste und wie toll er sich vorgekommen war, nachdem er zum ersten Mal das Wort Möse auf dem Schulhof geäußert hatte. Der Mann hatte einen weißen Bart, sauber gestutzt wie der von Mitch Miller. Vater schaute sich seine Show jeden Freitagabend im Fernsehen an. Frankie gesellte sich zumeist erst später hinzu, wenn er heimkam. Bald würde es läuten.
„Der Gerechte muss viel leiden“, zitierte der Bärtige, während er den Kleinen an seine Brust drückte, „aber der Herr hilft ihm aus allem. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass deren nicht eins zerbrochen wird.“ Dann malte er das Kreuzzeichen mit dem Kopf nach und fing an, den Jungen regelrecht zu zerquetschen. Haid wollte aufschreien, doch stattdessen verschluckte er sich am Blut, das ihm den Rachen hinunterlief. Der Kerl schob sich den Leib in seinen gottverdammten Brustkorb! Haid kam sich vor wie in Creature Features und hätte am liebsten losgeheult, doch die Tränen wollten nicht fließen. Weg war der Junge, genauso wie das Mädchen, Gorshin und der Pinguin. Oh, um Himmels willen …
Frankie konnte nicht schreien, weil der Mann mit knackenden Knien aufgestanden war und nun auf ihn zukam. „Nein!“, krächzte er angestrengt.
„Du sollst keine anderen Köter neben mir haben“, flüsterte der Mann völlig zusammenhanglos.
Hatte Haid richtig gehört? Er schauderte, so wie das Gesicht seines Gegenübers bebte.
„Komm zu Gott.“ Die Hand fühlte sich warm an wie die seines Vaters, wenn er ihm die Schenkel in der Badewanne massierte. Jetzt juckte es im Schritt. Er bekam eine Erektion, also weshalb fürchtete er sich? Langsam wurde er hochgehoben wie ein Säugling zum Aufstoßen. Jetzt berührten Haids Schultern die warme, trockene Brust des Mannes. „Gott will, dass du heimkehrst, Sohn. Er steckt hier drin.“
Frankie zwang sich nach einem letzten Ruck zur Entspannung. Der Feuerwehrmann würde schon dafür sorgen, dass es ihm wieder gut ging. Er schaute hinunter, während er mit der Wange am Brustkorb des Mannes ruhte. Der graue Parka roch frisch gewaschen. Eine rote Träne tropfte auf seine Backe und schließlich auf das Oberteil des Mannes, um sofort zu verdampfen. Dabei zischte es, als drücke man eine Kerzenflamme zwischen den Fingern aus. Fort war die blutige Träne, verschwunden wie der verbrannte Knabe und das Mädchen ohne Lider. Verschwunden zu Gott.
Die Schreie, die er jetzt hörte, konnte er wieder nicht mit Bestimmtheit irgendjemandem zuordnen. Leute stürmten auf ihn zu. Sie würden ihn retten, denn er war noch nicht bereit, mit Gott zu gehen. Warum spielte dieser Typ sich zum Wohltäter auf und tötete die überlebenden Kinder? Welches Recht hatte er dazu, ein solches Spiel …
„Ruhe sanft auf dem Acker des Herrn“, wisperte dieser, als könne er Haids Gedanken lesen.
„Wer bist du?“ Beim Sprechen quoll Blut aus Frankies Mund.
„Ich versuchte, dich heimzubringen, wie Gott es mir aufgetragen hat. Da weinte Jesus.“ Der Lärm, den die Männer von der Feuerwache LeMoyne Street machten, wurde lauter. Frankies vermeintlicher Retter drehte sich nun zu ihnen um. „Ich ging gerade vorbei und bemerkte das Feuer“, erklärte er lapidar. Dann wandte er sich Haid zu und fügte leise an: „Ich wurde auserwählt, genauso wie du eines Tages.“
„Wir bräuchten mehr barmherzige Samariter wie Sie“, erwiderte ein Feuerwehrmann, woraufhin der im Parka lächelte.
Niemand achtete weiter auf ihn, weshalb er einfach so davongehen konnte. Vielleicht war es gut so, dachte er. Weil sie ihn gestört hatten, konnte er den Knaben nicht von seinen wahren Schmerzen erlösen und ihm das Paradies zeigen. Dennoch hatte er ihn lange genug gehalten, um Gottes Macht in ihm zu entfesseln. Ihm selbst war vor langer Zeit das Gleiche geschehen, als ein anderer, ebenfalls namenloser Samariter ihn nur noch flach atmend aus der Ruine des Theaters geborgen hatte. Ja, es war gut, dass er dem Kleinen Gottes Macht vermitteln konnte, eine hehre Tat.
Da weinte Jesus.
Haid weinte jetzt kein Blut mehr, und die richtigen Feuerwehrmänner begriffen nicht, warum einige seiner Brandwunden bereits mit rosiger Haut überzogen waren. Geheilt. Am Bein hatte er sich einen offenen Bruch zugezogen, doch das Fleisch unter seinem verbrannten Hemd war frisch und unversehrt.
Gott möchte, dass du sein Werk verrichtest, Sohn.
Frankie wurde zum letzten Mal an diesem Tag ohnmächtig.
*
Jahre später hockte Francis Madsen Haid vor einem Fernseher im Massie’s, einer Bar auf dem Augusta Boulevard. Neben ihm saßen Dennis Cassady und andere Versager, die von ihrem Leben in der Tretmühle frustriert waren. Während er an seinem Gezapften nippte, wurden die Geiseln im Iran befreit. Plötzlich lief am unteren Bildschirmrand eine interessante Schlagzeile vorbei. Viele der Gäste mussten laut und Wort für Wort mitlesen, wie sie es auch bei Unwetterwarnungen taten.
Die Nachricht betraf einen Vierzigjährigen aus Bucktown, der ein Geständnis über den Brand von 1958 in der katholischen Grundschule St. Vitus in der Crystal Street zwischen California und Washtenaw abgelegt hatte. Jeffrey DiMusi hieß er und war in jenem Winter bereits vorher von einer der Nonnen gerügt worden, weil er im Treppenhaus geraucht hatte. Beim zweiten Mal hatte er seine Kippe am gleichen Ort hastig weggeschnippt, um nicht wieder erwischt zu werden. DiMusi sollte sich in der folgenden Nacht im Cook County Hospital selbst das Leben nehmen, doch bis dahin verbrachte Haid lange Stunden damit, sich an das Feuer und seinen Sturz zu erinnern. Wieder sah er Gott durch die Flammen kommen, um ihn auf den Arm zu nehmen, zu trösten und davon zu überzeugen zu suchen, mit ihm nach Hause zu kommen. Davon abgesehen wusste er kaum noch etwas.
Der Zärtlichkeit des Mannes entsann er sich, aber nicht mehr der Ehrfurcht, die ihn überkommen hatte.
Gottesfurcht.
Teil I
Chicago, South Loop, Winter 1988
This tired city was somebody’s dream
Billboard horizons as black as they seem
Four level highways across the land
We’re building a home for the family of man
And it’s so hard whatever we are coming to
Yes, it’s so hard with so little time
And so much to do
Time’s running out for the family of man
Kapitel 1
„Mann, hast du nicht Schiss, dass dir ’ne fette Made in den Rachen kriecht? Wie kannst du einfach so hier reinkommen?“ Reginald Givens schenkte Mike Surfer einen bösen Blick, während er zusah, wie sein Freund Speichel vom Plastik wischte. Die Miene hatte sein Bewährungshelfer auch sehr gut gekannt.
„Erstens bin ich schon gut zwanzig Minuten hier.“ Surfers Stimme klang nicht so herb wie die des Jüngeren, der vor ihm saß, und hier, das war die Hard Times Lounge zwischen Randolph und Canal Street. Hoffentlich hatte er laut genug gesprochen, dachte er, damit Chet, der Mann hinter der Theke, ihm endlich eins seiner lausig gezapften Biere brachte. „Zweitens dauert es nicht lang. Siehst du? Schon wieder eingesteckt. Oh, da kommt er ja. Gib Chet deine Bestellung, Reggie, ich hab heute meine Monatsrente kassiert.“
„Schon scheiße, dass du hier nur Old Style vom Fass saufen kannst.“ Givens besaß nach wie vor das lose Mundwerk, wegen dem er damals im Joliet hatte einsitzen müssen, als er kaum alt genug gewesen war, um sich aufrecht auf einem Barhocker zu halten, geschweige denn Alkohol zu trinken.
„Sei still!“ Surfer klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch. „Kostet dich immerhin nichts.“ Er hob zwei Finger und nickte seitlich in Richtung seines zu kurz geratenen Freundes.
„Ja, ich weiß, aber gehst du nicht besser aufs Klo, um das Ding da sauber zu machen?“
Givens gab keine Ruhe deswegen. Beide waren schwarz, und beide saßen im Rollstuhl. Drei Jahre nach seinem letzten Aufenthalt in der Besserungsanstalt hatte sich jemand Reginald Givens vorgeknöpft. Schließlich war er auf den Schienen der Kinzie Bridge gelandet, wo die Bahn nach Ravenswood, die überall anhielt, ihm das rechte Bein sauber über dem Knie amputiert hatte. Michael Surles, der sich selbst Mike Surfer nannte, weil er sich so behände durch die Straßen des Geschäftsviertels und der West Side manövrierte, war wasserköpfig und ein Syphilis-Baby, wie es etwa auch Crack-Kinder gibt, weshalb er Zeit seines Lebens – er war jetzt siebenundvierzig – einen Shunt am Hals tragen musste. Über eben dieses Plastikrohr regte Givens sich gerade auf.
Beim Hydrocephalus, wie es die Medizin nennt, kommt es zur Stauung der Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit im Kopf. Surfers Shunt war im Grunde genommen ein Schlauch, der aussah wie ein billiges Halsband aus einer Science-Fiction-Serie der Sechzigerjahre und über einen Klettverschluss in eine per Luftröhrenschnitt unmittelbar unter seinem Adamsapfel eingesetzte Kanüle führte. Mit diesem Gebrechen ließ es sich leben, doch Surfers Halsmuskeln waren schwach, und wegen der vorstehenden Stirn war er gezwungen, nach unten zu schauen. Gerade Letzteres kam ihm gelegen, wenn er in den Spiegel schaute und sich für eine schwarze, coolere Version von Romandetektiv Steve Carella hielt. Surfer lebte wie Givens in einem Heim, dem Rainey Marclinn auf der Randolph Street. Wilma Jerrickson, eine Mitbewohnerin, gab ihm regelmäßig Krimis von Ed McBain und Elmore Leonard zu lesen.
„Trink einfach“, sagte er nun mit einem Bärtchen aus Bierschaum über seinem eigenen grauen, „und sei froh, dass du dich nur damit placken musst.“ Dabei trat er Givens unter dem Tisch leicht gegen den Beinstumpf.
„Um dir draußen in die Eier zu treten, wenn du mir dumm kommen willst, reicht es, Mann.“
„Entspann dich …“
Eine Weile schwiegen die beiden und tranken. Der Name Hard Times Lounge führte ein wenig in die Irre, denn abgesehen von einzelnen Verrückten von der Pennermeile Halsted Street zwei Blocks weiter westlich hinter der Überführung des Kennedy Expressway rekrutierte sich die Kundschaft überwiegend aus Angestellten des Geschäftsbezirks River Plaza, wo auch Sozial- und Behindertenhilfe ihre Büros unterhielten. So war die Kneipe zum Treffpunkt für Rollis und Krückengänger geworden. Barkeeper Chet bediente sie, selbst wenn sie ihren Monatsscheck noch nicht eingestrichen hatten; zahlen konnten sie später, sobald sie flüssig waren.
„Wird scheißkalt, der Winter“, bemerkte Givens. „Das Bein pocht schon wie doof, obwohl es erst November ist.“
Irgendwo im Schatten ging jemand zur Seeburg-Jukebox und wählte Luckenbach, Texas.
„Waylon und der gute alte Willie“, schwelgte Reggie.
*
Nachdem sie auf dem Wacker Drive über den Fluss gefahren waren, trennten sie sich. So penetrant Reginald auch der Kälte wegen quengelte, blieb er im Herzen ein Gauner. Es war erst zwei Uhr nachmittags, also noch zwei Stunden lang hell. Surfer einigte sich mit seinem Freund auf eine baldige Runde Kümmelblättchen. Der Gewinn würde Givens einen satten Bonus zu seinem Invalidengeld garantieren. Er winkte ihm hinterher. „Halt die Ohren steif, Mann.“