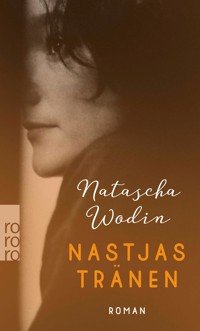17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterhaft und mit großer Dringlichkeit erzählt Natascha Wodin vom Fremdsein im eigenen Leben und schenkt ihren Figuren eine Heimat in der Literatur. «Hat sie Muscheln am Strand gesammelt, den schreienden Möwen nachgeschaut und im Sand gelegen?» In der Titelgeschichte von Natascha Wodins neuem Buch zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol am Asowschen Meer, an dem ihre Mutter aufwuchs, bis hin zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. In einer anderen Geschichte beobachtet sie ihre Nachbarin, die in ihrem baufälligen Haus buchstäblich verfault, und andernorts, auf Sri Lanka, begegnet sie extremem sozialen Elend und einer bedrohlichen, alles verschlingenden Natur. Zurück in Deutschland, geht es um das Schicksal eines Unbekannten, der als psychisch kranker Patient entmündigt in einer Klinik im Fichtelgebirge lebt. Dorthin, «in die dunkelsten deutschen Wälder», schickt die Erzählerin ihm eine Nachricht, und es entwickelt sich eine Brieffreundschaft, dann eine Liebe, deren Anker die verbindende, rettende Kraft der Musik ist. Natascha Wodin führt uns auf die Nachtseite des Lebens, zu den Außenseitern, den Einsamen, den Verwundeten. «Ihr Schreiben ist ein Joint Venture aus gewaltigem Schmerz und ungeheurer Kraft, von Verletzung, Lebenswillen, Angst und Wut und Dazugehörigkeitsverlangen.» Arnold Stadler «Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt.» Jury des Joseph-Breitbach-Preises
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Natascha Wodin
Der Fluss und das Meer
Erzählungen
Über dieses Buch
Meisterhaft und mit großer Dringlichkeit erzählt Natascha Wodin vom Fremdsein im eigenen Leben und schenkt ihren Figuren eine Heimat in der Literatur.
«Hat sie Muscheln am Strand gesammelt, den schreienden Möwen nachgeschaut und im Sand gelegen?» In der Titelgeschichte von Natascha Wodins neuem Buch zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol am Asowschen Meer, an dem ihre Mutter aufwuchs, bis hin zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. In einer anderen Geschichte beobachtet sie ihre Nachbarin, die in ihrem baufälligen Haus buchstäblich verfault, und andernorts, auf Sri Lanka, begegnet sie extremem sozialen Elend und einer bedrohlichen, alles verschlingenden Natur. Zurück in Deutschland, geht es um das Schicksal eines Unbekannten, der als psychisch kranker Patient entmündigt in einer Klinik im Fichtelgebirge lebt. Dorthin, «in die dunkelsten deutschen Wälder», schickt die Erzählerin ihm eine Nachricht, und es entwickelt sich eine Brieffreundschaft, dann eine Liebe, deren Anker die verbindende, rettende Kraft der Musik ist.
Natascha Wodin führt uns auf die Nachtseite des Lebens, zu den Außenseitern, den Einsamen, den Verwundeten. «Ihr Schreiben ist ein Joint Venture aus gewaltigem Schmerz und ungeheurer Kraft, von Verletzung, Lebenswillen, Angst und Wut und Dazugehörigkeitsverlangen.» Arnold Stadler
«Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt.» Jury des Joseph-Breitbach-Preises
Vita
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt (1983) folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister, Sie kam aus Mariupol und Nastjas Tränen. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Alfred-Döblin-Preis, dem Preis der Leipziger Buchmesse 2017 und dem Joseph-Breitbach-Preis 2022. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Impressum
Die Erzählungen Das Singen der Fische und Notturno erschienen zuerst in dem Erzählungsband Das Singen der Fische 2001 im Verlag Das Wunderhorn. Die Erzählung Notturno erschien zuerst 2011 in der Zeitschrift Sinn und Form, und die Erzählung Der Fluss und das Meer erschien zuerst 2023 als Abdruck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Alle vier Erzählungen hat die Autorin für diese Ausgabe zum Teil stark überarbeitet.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Das Zitat von Ingeborg Bachmann auf Seite 185 wurde dem Band »Das Buch Franza. Das Todesarten«-Projekt in Einzelausgaben entnommen, Piper Verlag 1998, S. 186
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung korkeng/Adobe Stock
ISBN 978-3-644-01785-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Schönheit wird die Welt erretten.
Fjodor Dostojewski
Der Fluss und das Meer
Als Kind wohnte ich einige Jahre an dem kleinen fränkischen Fluss namens Regnitz. Dort standen die vier neuen Wohnblocks, in die man uns 1951 gebracht hatte, aus einem Lager für Displaced Persons, ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkriegs zu Millionen nach Deutschland verschleppt worden waren und für die es nun keine Verwendung mehr gab.
Eine meiner eindringlichsten Erinnerungen an diese Zeit ist die Überschwemmung, zu der es dort einmal gekommen war. Nachdem es tagelang ohne Unterlass geregnet hatte, begann die Regnitz sich langsam zu dehnen und über die Ränder ihres schmalen Bettes zu ergießen. In den Flussauen breiteten sich immer mehr und immer größere Pfützen aus – zur Begeisterung von uns Kindern, den multiethnischen, gettoisierten Nachkommen der einstigen Arbeitssklaven. Wenn der Regen für kurze Zeit aufhörte und die Sonne herauskam, durften wir barfuß nach draußen und sprangen johlend vor Glück durch die sommerlich warmen Wasserlachen, die sich bald zu einem kleinen See zusammengeschlossen hatten. Nach und nach verwandelte sich das beschauliche Flüsschen, aus dem wir sonst das Gießwasser für unsere Gemüsebeete hinter den Blocks schöpften, in einen gewaltigen, reißenden Strom, der, braun und dröhnend, mit unheimlicher Geschwindigkeit durch die Landschaft raste und tote Hühner und entwurzelte Bäume mit sich trug. Gebannt, aus sicherer Entfernung beobachteten wir das schaurig-schöne Spektakel, aber eines Morgens, als wir aufwachten und aus dem Fenster schauten, stand das Wasser in unserem Hof. Über Nacht hatte es sich unmerklich an uns herangeschlichen, genauso flach und harmlos wie vor Kurzem in den Flussauen stand es jetzt zwischen unseren Häusern und leckte leise an den Schwellen unserer Haustüren.
Von da an wagte ich es nicht mehr, nachts zu schlafen. Ich lag wach, lauschte in das nicht nachlassende Geräusch des Regens, ich sah das Wasser im dunklen Hof steigen, ich sah, wie es unsere Fenster erreichte und die Scheiben eindrückte, wie es durch unsere Schlafzimmertür brach. Ich wusste, dass die Regnitz kam, um meine Mutter zu holen. Schon so lange sprach sie davon, dass sie nicht mehr leben konnte, dass sie in die Regnitz gehen wollte. Sie sagte es fast jeden Tag. Jetzt kam die Regnitz zu ihr, sie kam, um sie mitzunehmen, aus ihrem Bett zu heben, während sie schlief, und endlich von dem Leben zu erlösen, das sie nicht mehr ertragen konnte.
Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit nach dieser Überschwemmung verging, vielleicht waren es zwei Jahre, vielleicht weniger, die Regnitz hatte sich längst wieder in das kleine, gemütliche Flüsschen zurückverwandelt, das sie immer gewesen war, bis meine Mutter eines Tages aus der Wohnung ging und nicht wiederkam. Man fand ihre Leiche am Rand einer Sandbank, auf der wir Kinder uns im Sommer immer getummelt hatten. Die Strömung hatte sie an diese kleine Insel gespült, nicht weit entfernt von der Stelle, an der sie ihren Mantel am Ufer abgelegt hatte.
Sie war an einem Meer geboren und aufgewachsen, aber sie muss Nichtschwimmerin gewesen sein. Ein Mensch, der schwimmen kann, ist vermutlich nicht in der Lage, sich zum Ertrinken in einem ruhigen, harmlosen Fluss zu zwingen. Aber vielleicht war sie gar nicht ertrunken, vielleicht war ihr schwaches Herz schon vorher stehen geblieben, nachdem sie in einer Oktobernacht des Jahres 1956 ihren Mantel ausgezogen hatte und in die schwarze, kalte Strömung hineingegangen war.
Das Meer, von dem sie kam, war das flachste Meer der Welt. So flach, dass es möglich schien, es bis ans andere Ende zu durchwaten, bis hinüber zur anderen Seite, nach Kertsch, wo man sich endlich in die wilden Wellen des Schwarzen Meeres hätte werfen können, die Wellen jenes Meeres, über das man meine Eltern im Jahr 1944 auf einem deutschen Kriegsschiff mit geraubter Menschenfracht zuerst nach Rumänien, dann nach Deutschland brachte. Allein aus Mariupol, der Heimatstadt meiner Mutter, verschleppten die deutschen Nazis im Lauf des Krieges 60000 Menschen zur Zwangsarbeit nach Deutschland, etwa ein Viertel der gesamten damaligen Bewohnerschaft.
Es muss sich noch um das vorrevolutionäre, multikulturelle Mariupol handeln, das ein unbekannter russischer Autor so beschreibt: «Hinter dem Fenster des Hotels Palmyra fiel nasser Schnee. Hundert Schritte weiter das Meer, von dem ich nicht zu sagen wage, dass es rauschte. Es gluckste, röchelte, das flache, unbedeutende, langweilige Meer. Ans Wasser angeschmiegt das unscheinbare Städtchen Mariupol mit seinen sechs russisch-orthodoxen Kirchen, seinem polnischen Kościół und seiner jüdischen Synagoge. Mit seinem stinkenden Hafen, seinen Lagerschuppen, mit dem löchrigen Zelt eines Wanderzirkus am Strand, mit seinen griechischen Tavernen und der einsamen, matten Laterne vor dem Eingang des erwähnten Hotels.»
Hat meine Mutter das flache, langweilige, unbedeutende Meer geliebt, hat sie darin gebadet? War es das ideale Meer für eine Nichtschwimmerin, ein Planschbecken, ein Meer für Kinder, für Familienurlaube an den weiten, hellen Sandstränden in der sommerlichen Hitze des Südens, mit einer Wassertemperatur von über dreißig Grad? Hat sie Muscheln am Strand gesammelt, den schreienden Möwen nachgeschaut und im Sand gelegen? Ich suche ihr Bild dort und kann es nicht finden. Vielleicht auch deshalb, weil ich sie nie in einem Badeanzug gesehen habe, sie war mir nicht vorstellbar in so einem Kleidungsstück, und wahrscheinlich hatte sie so etwas auch nie besessen. Ihre Lebenszeit in Mariupol war nicht gemacht für Badefreuden. Sie war in das nachrevolutionäre Chaos hineingeboren, in den Bürgerkrieg, in den Terror, in die Enteignungen, Säuberungen, Verhaftungen, in die biblische Hungersnot, die während der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der Ukraine ausbrach. Die Menschen wankten wie betrunken durch die Straßen und fielen irgendwann um, am Abend wurden die Leichen aufgesammelt und auf Pferdefuhrwerke geworfen.
Früher nannten die Mariupoler das Asowsche Meer ihre Nährmutter. Das seichte Wasser hatte gekocht, wenn die riesigen Stör- und Zanderschwärme vorbeizogen. Nun war alles leer gefischt, es blieben nur noch die mageren Meergrundeln, die die Menschen zu fangen versuchten, indem sie Kissenbezüge ins kniehohe Wasser hielten. Nachdem es auch keine Meergrundeln mehr gab, wurde alles gegessen. Tapetenkleister, Schuhsohlen, Hunde, Katzen, Menschenleichen.
Auch damals schon existierte Asowstal, das größte Stahlwerk der Welt, zwanzig Kilometer lang, dreißig Meter tief. Ein Vorzeigemonster frühkommunistischer Industrialisierung, das fast ein Jahrhundert sein ungefiltertes Gift in die Welt schleuderte, auf einer Strecke von zwanzig Kilometern rauchte die Hölle. Die schönen hellen Sandstrände hatte es in Mariupol vielleicht nie gegeben. Ein deutscher Autor, der vor ein paar Jahren zu einem deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen nach Mariupol gefahren war, musste wieder umkehren, er bekam keine Luft. Auch das Asowsche Meer kann schon lange kaum noch atmen, seit vielen Jahren stirbt es eines langsamen Todes, erstickt an Zink und Ammoniak, an den Pestiziden der Landwirtschaft, am Dreck des Hafens, am Schweröl leckender, sinkender Tanker.
Wie muss ich mir dieses Meer heute vorstellen? Was würden seine Wellen mir erzählen, wenn sie sprechen könnten und ich sie hörte? Sie haben die dreifache Zerstörung Mariupols miterlebt. Zum ersten Mal durch Revolution und Bürgerkrieg, zum zweiten Mal durch die deutsche Wehrmacht, zum dritten Mal jetzt, in diesem Sommer, durch die Bomben eines wahnsinnigen russischen Hegemons. Es ist wie ein dritter Mordversuch an meiner Mutter. Sie kennt das vom Krieg verheerte Mariupol: die Steinhaufen der zertrümmerten Häuser in den Straßen, die leise brennenden Möbel in den Häusern mit den abgerissenen Fassaden, das ständige Sirenengeheul. Kein Trinkwasser, kein Strom, keine Nahrungsmittel. Es werden wieder Katzen und Hunde gegessen. Die verwaisten, ausgehungerten Hunde fressen unterdessen die Menschenleichen an, die in den Straßen liegen. Zum Glück muss sie das alles nicht noch einmal erleben. Die Geschichte wiederholt sich, sie bewegt sich nicht linear, sondern dreht sich im Kreis.
Ich habe mir erzählen lassen, dass die Stadt bis heute durchdrungen ist von einem penetranten, nicht mehr weichenden Verwesungsgeruch. Wegen der ständigen Luftangriffe konnten viele Tote nicht bestattet werden, ihre Körper zersetzten sich langsam an der Luft. Die Stadt soll verseucht sein von diesem Geruch wie für die Ewigkeit. Mariupol – ein Segensname wie ein Fluch. Eine Stadt, deren Namen bis vor Kurzem niemand kannte und die jetzt Weltruhm erlangt hat als Mater dolorosa der überfallenen Ukraine.
Zwischen 1960 und 1992 wurde in Deutschland der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut, in den auch der Teil der Regnitz integriert wurde, in dem meine Mutter einst ihr Leben gelassen hat. In meiner Vorstellung fließen seitdem Tag für Tag ein paar Tropfen der fränkischen Regnitz ins Asowsche Meer. Ganz allmählich kehrt meine Mutter mit dem Wasser der Donau zurück in ihre alte Welt, die Tropfen der Regnitz erreichen über Ungarn, Bulgarien, Rumänien das Schwarze Meer, passieren die Meerenge von Kertsch und gehen ein ins Asowsche Meer, in dem meine Mutter vielleicht einmal gebadet hat und dessen Wellen immer noch ans Ufer von Mariupol schlagen.
Nachbarinnen
Ich weiß nicht, Frau Meisinger, ob Sie sich noch an mich erinnern. Es ist lange her, dass wir Haus an Haus wohnten, über ein halbes Jahrhundert, und ich bin nicht sicher, ob Sie mich, die junge Frau, die Ihnen damals von ihrem Balkon nebenan so oft böse Worte zuwarf, überhaupt jemals wahrgenommen haben. Sie haben nie auf meine Anwürfe reagiert, auch nicht auf die Anfeindungen anderer Nachbarn. Vielleicht sahen Sie uns alle gar nicht mehr, vielleicht gab es keine Brücke mehr zwischen Ihnen und der Außenwelt.
Sie wohnten hinter den Wucherungen Ihres Grundstücks in einer Art Laube, einem gemauerten Häuschen mit zwei winzigen Fenstern und einem Schornstein, aus dem im Winter Rauch aufstieg. Eigentlich waren Sie eine reiche Frau, aber das wussten Sie vielleicht gar nicht. Ihnen gehörte ein ziemlich großes Grundstück in einem exklusiven Villenvorort der bayerischen Landeshauptstadt, an ihren südlichen Ausläufern, eine Stunde entfernt von den Skipisten und den Seen. Sie blockierten mit Ihrer elenden Existenz hinter einem morschen Holzzaun Bauland von höchstem Wohn- und Freizeitwert. Sie waren ein Irrtum, ein Skandal in dieser Gegend, die Anwesenheit einer Realität, für deren Abwesenheit man hier ein Vermögen bezahlt hatte.
Wir, ein junges Ehepaar, waren wahrscheinlich die einzigen Mieter in der Straße, jung und besitzlos, vor Kurzem eingezogen ins Dachgeschoss einer kleinen, ockerfarbenen Villa, deren Fenster mit prachtvollen Geranien und Petunien geschmückt waren. Unten auf der Terrasse stand eine Hollywoodschaukel, in der Mitte des Gartens, der hinter dem Zaun in einen Wald überging, ein kleiner Holzpavillon, der nie benutzt wurde und dessen Zweck sich mir nie erschloss. Herr und Frau Stoiber, ein kinderloses Ehepaar, betrieben, bevor sie Rentner wurden, ein großes Blumengeschäft im Stadtzentrum, jetzt hatten sie die Patronage über zwei junge Leute übernommen, die für billige Miete unter ihrem schützenden Dach wohnen durften, in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. Frau Stoiber zeigte mir, wie man Leberknödel zubereitet und wie ich die weißen Hemden meines Mannes stärken und bügeln musste. Er gehörte zur ersten Generation von Programmierern in Deutschland und arbeitete in einer Niederlassung von IBM, ich war Stenotypistin im Büro einer Garnfabrik. An den Wochenenden durften wir abends bei unseren Wirtsleuten fernsehen, in einem großen Wohnzimmer mit Perserteppichen und einer moosgrünen Polstergarnitur, auf der auch Seppl einen festen Platz hatte, ein roter Langhaardackel, der Frau Stoibers Ersatzkind war und ständig versuchte, mich mit seinen kleinen, scharfen Zähnen ins Bein zu zwicken. Auf dem Couchtisch stand eine Kristallschale mit Salzletten, die Männer tranken Weißbier, für uns Frauen mixte Frau Stoiber zwei Blondies, Bluna mit Eierlikör, mein Lieblingsgetränk, das wir durch einen Strohhalm schlürften, während wir uns am Schwarz-Weiß-Fernseher einen Krimi ansahen. Ich fieberte immer Edgar-Wallace-Filmen mit Joachim Fuchsberger und Karin Baal entgegen.
Harald, der neben mir auf dem Sofa saß, hatte ich nicht aus Liebe geheiratet, sondern weil er der einzige deutsche Mann war, der mich heiraten wollte. Durch ihn hatte ich endlich doch noch das Unerreichbare erreicht, sogar mehr als das. Ich wäre mit dem bescheidensten Lebensplatz zufrieden gewesen, hätte dieser Platz sich nur in der deutschen Welt befunden. Nun war ich durch meine Heirat im Alter von neunzehn Jahren über Nacht aus einem Nachkriegslager für slawische Untermenschen, ehemalige Zwangsarbeiter der Nazis, zu denen meine Eltern gehört hatten, in einem vornehmen Münchner Vorort gelandet, mitten im gehobenen, wohlhabenden deutschen Bürgertum, dem mir fernsten aller Sterne. Bis vor Kurzem noch war ich die Russenlusch, jetzt hatte ich die deutsche Staatsbürgerschaft und trug Haralds deutschen Namen. Immer wenn ich wegen meines verdächtigen Vornamens gefragt wurde, ob ich Russin sei, log ich und sagte, ich sei nach einer adeligen russischen Großtante benannt, die im alten St. Petersburg gelebt habe. In meinem Kleiderschrank hingen bayerische Dirndl, Faltenröcke aus Trevira und ein Abendkleid für meine Opernbesuche mit Harald. Zum ersten Mal seit meiner Geburt wusste in meiner deutschen Umgebung niemand, wer ich war und woher ich kam, zum ersten Mal war ich eine wie alle.
Mein neues Leben hatte nur einen einzigen kleinen Fehler, und der waren Sie, Frau Meisinger. Ausgerechnet an Ihr Grundstück grenzte das erste deutsche Haus, in dem ich wohnen durfte, an einem Ort, an dem nichts weniger zu erwarten gewesen war als jemand wie Sie. Sie sahen noch schlimmer aus als der menschliche Nachkriegsabfall, aus dem ich hervorgegangen war, Sie waren eine Steigerung dessen, was ich gerade hinter mir gelassen hatte, was ich mit aller Kraft vergessen, streichen, aus der Wirklichkeit tilgen wollte. Sie waren der tägliche Anblick des Abschaums, den ich gerade von mir abgestreift hatte, Sie waren das Gespenst meiner Vergangenheit, das mir auf die andere Seite der Welt gefolgt war, Sie waren mein veröffentlichtes Geheimnis, das ich in ständiger Angst vor Entlarvung verbarg. Sie waren ein tägliches Ärgernis für alle und insbesondere für mich.
In den letzten Wochen vor Ihrem Ende, Frau Meisinger, hatte man Ihnen Ihr Alter nicht mehr angesehen. In meinen damaligen Augen, den Augen der Jugend, waren Sie von Anfang an eine steinalte Frau gewesen, aber mit meinem heutigen Blick auf Sie erkenne ich, dass Sie wahrscheinlich nicht einmal fünfzig waren, als Sie starben. Man erzählte sich von Ihnen, dass Sie einst eine ausgesprochen schöne und gepflegte junge Frau gewesen seien, die hin und wieder kam, um ihre Erbtante zu besuchen, der das erbärmliche, damals noch zwischen Wiesen und Feldern stehende Häuschen gehörte, das erst nach und nach in die unaufhaltsamen Ausdehnungen der Großstadt geraten war. Sie seien immer elegant gekleidet gewesen, sagte man, schlank wie ein Reh, aber etwas Sonderbares hätten Sie schon damals an sich gehabt, etwas, das Sie von den anderen unterschied. Ihre Tante, eine wortkarge, verschlossene Frau, habe nie etwas über Sie erzählt, aber es sei bekannt gewesen, dass Sie weder verheiratet noch verlobt waren, und allein das verwunderte bei einer so attraktiven jungen Frau wie Ihnen. Niemand wusste, wovon Sie lebten, wie Sie das Geld für all die extravaganten Sachen verdienten, die Sie trugen, die feschen Blusen und die feinen Ledertaschen.
Irgendwann, so erzählte Frau Stoiber, hätten Sie die Besuche bei Ihrer Tante eingestellt, lange Zeit habe Sie niemand mehr gesehen. Erst nach dem Tod der Tante seien Sie eines Tages wiederaufgetaucht und hätten bald darauf die schäbige Behausung auf dem Nachbargrundstück bezogen. Schon zu dieser Zeit seien Sie bereits eine ganz andere gewesen, noch nicht so heruntergekommen wie heute, aber man habe schon deutlich gesehen, dass Sie nichts mehr auf sich hielten, dass Sie eine Asoziale geworden waren. Nach und nach seien Sie immer unansehnlicher geworden und nicht mehr auf die Straße hinausgegangen, unter die normalen Leute, und schließlich hätten Sie sogar aufgehört, sich anzuziehen, nur noch im Nachthemd würden Sie jetzt dort drüben herumstreichen und den Abfall vor die Tür werfen, sodass die Ratten kämen und die ganze Gegend schon verpestet sei von dem Gestank. Seit Jahren würden Sie dort drüben hausen wie ein Vieh, sagte Frau Stoiber, so etwas wie Sie hätte man unter Hitler vergast.
Ich kann Sie nicht mehr danach fragen, Frau Meisinger, was Ihnen im Leben zugestoßen ist, aber im Grunde muss einem ja nichts Besonderes zustoßen, um an der Welt zu verzweifeln. Ich weiß nicht einmal, ob Sie wirklich eine Verzweifelte waren, vielleicht wollten Sie nur einfach nichts mehr mit den anderen zu tun haben, Ungeheuern in der Art Ihrer Nachbarn, und wären die nicht gewesen, wären Sie mit Ihrem aufgegebenen Leben vielleicht nicht einmal unglücklich gewesen, einem Leben ohne Hoffnungen, die die Quelle aller Enttäuschungen sind. Sie waren wahrscheinlich eine bereits endgültig Ent-täuschte, Sie hatten alle Verluste schon hinter sich, Ihnen gehörte nur noch das erbärmliche Häuschen, das Ihrem verwilderten Körper Zuflucht bot und nur den Fehler hatte, dass es an einer falschen Stelle stand.
Ich sehe Sie noch heute deutlich vor mir, von keiner anderen Stelle aus konnte man in Ihr Grundstück besser hineinsehen als von meinem Balkon im Nachbarhaus, über den morschen, vermoosten Holzzaun, hinter dem der Wildwuchs herrschte. Alte, knorrige Obstbäume, die kaum noch Früchte trugen, Buschwerk, Gestrüpp und andere, unkenntlich gewordene Gewächse hatten sich zu einem urwaldähnlichen Dickicht verschlungen, dessen Wucherungen haltlos in die Nachbargärten drängten, in denen die Ränder des frisch gemähten Teppichrasens mit Nagelscheren begradigt wurden. Büsche und Bäume warfen ihr Laub auf das gehegte Territorium der anderen ab, erdrückten mit ihren Schatten die Frühlingstulpen und Krokusse, wilde Triebe krochen in die akkurat geschnittenen Hecken, fraßen sich hinaus auf den Bürgersteig, wo sie den Asphalt aufbrachen, und im Herbst, wenn die Bäume sich zu schütteln begannen in den ersten stürmischen Nächten, ertrank die halbe Straße im Laub aus Ihrem Garten. Der Wind wehte es auf die soeben gerechten Rasenflächen, vor die Haustüren an der soeben gefegten Straße. Sie fegten nie, Frau Meisinger, Ihnen war das Laub, das vor Ihrem Gartentor verfaulte, schnurzegal.
Sie waren eine Verschwindende, aber genauso wie Ihr Garten verschwanden Sie durch Ausdehnung, durch eine zunehmende, immer maßloser werdende Körperfülle, die alles an Ihnen zum Verschwinden brachte, was man gemeinhin ein menschliches Wesen nannte. Die haltlose Ausdehnung Ihres Körpers verwandelte Sie in ein Unwesen, das ein Abbild Ihres Ungartens war. Sie haben für Ihr Verschwinden nicht das Abnehmen, sondern das Zunehmen gewählt – in einer Zeit magersüchtiger Schönheitsideale war das zweifellos die effektivere und radikalere Form des Verschwindens.
Oft sah man, wie Sie in einem zerlumpten Nachthemd, das offenbar Ihr letztes Ihren Körper noch umfassendes Kleidungsstück war, in Ihrem Garten umhergingen, mit einem Stock in der Hand, mit dem Sie das Gestrüpp vor sich zerteilten wie mit einer Machete. Über Ihre nackten Beine kroch ein grauer, flechtenartiger Schorf, von Ihrem Gesicht sah man nichts mehr, es war versteckt in sich selbst, in einer Masse formlosen, aufgeschwemmten Fleisches. Sie erinnerten an ein großes, schwerfälliges Tier, das sich mit einem bösen Knurren durch die Wildnis schob, manchmal entfuhr Ihnen dabei eine Silbe der menschlichen Sprache, die Silbe eines Fluchs, einer vulgären Verwünschung. Nur Ihr Haar, Frau Meisinger, pflegten Sie noch, üppiges, blaubeerfarbenes Haar, das immer frisch gewaschen glänzte und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Es musste das Haar der Frau sein, die Sie einmal gewesen waren, ein Rest dieser Frau, den Sie nicht aufgaben. Zwischen Ihrem Haar und dem Rest Ihres Körpers lagen Welten, die nur Sie kannten, Frau Meisinger. Eine Kindheit zwischen zwei Weltkriegen, in der Armut und Labilität der ersten deutschen Republik, eine Jugend während der Hitler-Diktatur, fast sechs Jahre Krieg und danach, als das Land in Trümmern lag, das große kollektive Schweigen, das, je länger es dauerte, desto unheilvoller wurde und bis in die Zeit reichte, von der hier die Rede ist. Vielleicht waren Sie ein Kind dieses Schweigens, vielleicht war es in Ihnen zum Monster angewachsen, vielleicht drückte Ihr viel zu schwerer, über seine Grenzen hinausgewucherter Körper dieses angestaute, tödliche Schweigen aus, vielleicht waren Sie sein Symptom. Ihr schönes Vergangenheitshaar hatte sich in die Gegenwart verirrt und betonte nur den schockierenden Rest Ihres Körpers.
Ihr erbarmungswürdiges Pendant, das Ihnen nicht von der Seite wich, war ein verfilzter, irgendwann wahrscheinlich weißfelliger Hund mit eitrig zerfressenen Augen, in denen eine abgöttische Liebe zu Ihnen stand. Dieser Hund hieß ausgerechnet Bello, aber so abwegig dieser Name in seiner italienischen Bedeutung auch klang, so zutreffend war er im Deutschen. Bello bellte, er bellte und jaulte ganze Nächte hindurch, wenn Sie ihn nicht bei sich im Haus schlafen ließen, sondern in den Garten verbannten. Durch Bello wurden Sie, Frau Meisinger, zu einer zusätzlichen Bedrohung für mich. Ich litt seit jeher an einer quälenden Lärmempfindlichkeit, wahrscheinlich eine Folge des immer lauten, nie zur Ruhe kommenden Lagerlebens, in dem man immer von Geräuschen bedrängt war. Schon als Kind konnte ich deshalb oft nicht schlafen, und wenn Bello jetzt in den Nächten stundenlang bellte, fühlte ich mich aus der vornehmen Stille meiner neuen Umwelt zurückversetzt in meine schlaflosen Kindernächte in den Baracken. Ich wälzte mich im Bett und dachte mit Grauen daran, dass ich um halb sieben Uhr morgens aufstehen und in das Büro der Garnfabrik fahren musste, wo ich mehrmals am Tag zum Diktat gerufen wurde. Meine Lärmangst ging einher mit einem starken Schlafbedürfnis, ich war zu nichts zu gebrauchen, wenn ich nicht ausgeschlafen hatte, ich litt an Übelkeit und Kopfschmerzen und fühlte mich den ganzen Tag an der Grenze zu einem Kollaps. Mehr und mehr begann mich der Gedanke zu beherrschen, dass Sie mein neues Leben zerstören würden, Frau Meisinger, ich würde meine Funktionsfähigkeit zunehmend einbüßen, nicht mehr zur Arbeit ins Büro fahren, die Hausarbeit nicht mehr bewältigen können und mich schließlich als unbrauchbares, störendes Rädchen im Getriebe erweisen, als Fehler im System. Der aufsässige Gedanke hielt mich, nachdem er sich einmal in meinen Kopf gebohrt hatte, immer öfter auch in den Nächten wach, in denen Bello nicht bellte, weil er im Haus schlafen durfte, aber selbst wenn dieser Hund durch Zauberei aus der Welt verschwunden wäre, hätte ich meinen durch ihn hervorgerufenen Angstgedanken wahrscheinlich nicht mehr loswerden können. Der Gedanke hatte sich verselbstständigt, hatte begonnen, ein Eigenleben in mir zu führen, er versuchte alles, um mich in das finstere Abseits zurückzustoßen, aus dem ich kam. Sie waren nicht nur das Gespenst meiner Vergangenheit, Frau Meisinger, sondern auch das Gespenst meiner Zukunft, irgendwann würde ich so werden wie Sie, ich war jetzt schon wie Sie, war nie etwas anderes gewesen. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und mir bestand darin, dass Sie nichts mehr verbargen, dass man von Ihnen auf den ersten Blick alles sah, während von mir nur noch niemand wusste, dass mein Name Rumpelstilzchen war.