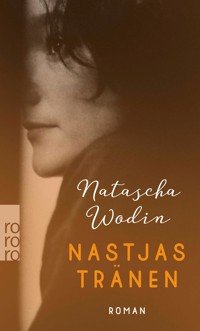9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe» – Natascha Wodins Mutter sagte diesen Satz immer wieder und nahm doch, was sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter zehn und wusste nicht viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso lebten sie in einem der Lager für «Displaced Persons», woher kam die Mutter, und was hatte sie erlebt? Erst Jahrzehnte später öffnet sich die Blackbox ihrer Herkunft, erst ein bisschen, dann immer mehr. «Sie kam aus Mariupol» ist das außergewöhnliche Buch einer Spurensuche. Natascha Wodin geht dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die aus der Hafenstadt Mariupol stammte und mit ihrem Mann 1943 als «Ostarbeiterin» nach Deutschland verschleppt wurde. Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend intensiv vom Anhängsel des Holocaust, einer Fußnote der Geschichte: der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Ihre Mutter, die als junges Mädchen den Untergang ihrer Adelsfamilie im stalinistischen Terror miterlebte, bevor sie mit ungewissem Ziel ein deutsches Schiff bestieg, tritt wie durch ein spätes Wunder aus der Anonymität heraus, bekommt ein Gesicht, das unvergesslich ist. «Meine arme, kleine, verrückt gewordene Mutter», kann Natascha Wodin nun zärtlich sagen, und auch für uns Leser wird begreifbar, was verlorenging. Dass es dieses bewegende, dunkel-leuchtende Zeugnis eines Schicksals gibt, das für Millionen anderer steht, ist ein literarisches Ereignis. «Das erinnert nicht von ungefähr an die Verfahrensweise, mit der W. G. Sebald, der große deutsche Gedächtniskünstler, verlorene Lebensläufe der Vergessenheit entriss.» (Sigrid Löffler in ihrer Laudatio auf Natascha Wodin bei der Verleihung des Alfred-Döblin-Preises 2015)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol
Über dieses Buch
«Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe» – Natascha Wodins Mutter sagte diesen Satz immer wieder und nahm doch, was sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter zehn und wusste nicht viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso lebten sie in einem der Lager für «Displaced Persons», woher kam die Mutter, und was hatte sie erlebt? Erst Jahrzehnte später öffnet sich die Blackbox ihrer Herkunft, erst ein bisschen, dann immer mehr.
«Sie kam aus Mariupol» ist das außergewöhnliche Buch einer Spurensuche. Natascha Wodin geht dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die aus der Hafenstadt Mariupol stammte und mit ihrem Mann 1943 als «Ostarbeiterin» nach Deutschland verschleppt wurde. Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend intensiv vom Anhängsel des Holocaust, einer Fußnote der Geschichte: der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Ihre Mutter, die als junges Mädchen den Untergang ihrer Adelsfamilie im stalinistischen Terror miterlebte, bevor sie mit ungewissem Ziel ein deutsches Schiff bestieg, tritt wie durch ein spätes Wunder aus der Anonymität heraus, bekommt ein Gesicht, das unvergesslich ist. «Meine arme, kleine, verrückt gewordene Mutter», kann Natascha Wodin nun zärtlich sagen, und auch für uns Leser wird begreifbar, was verlorenging. Dass es dieses bewegende, dunkel-leuchtende Zeugnis eines Schicksals gibt, das für Millionen anderer steht, ist ein literarisches Ereignis.
«Das erinnert nicht von ungefähr an die Verfahrensweise, mit der W. G. Sebald, der große deutsche Gedächtniskünstler, verlorene Lebensläufe der Vergessenheit entriss.» (Sigrid Löffler in ihrer Laudatio auf Natascha Wodin bei der Verleihung des Alfred-Döblin-Preises 2015)
Vita
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Nach dem Abschluss einer Sprachenschule übersetzte sie aus dem Russischen und lebte zeitweise in Moskau. Auf ihr Romandebüt «Die gläserne Stadt», das 1983 erschien, folgten etliche Veröffentlichungen, darunter der Roman «Nachtgeschwister» und «Irgendwo in diesem Dunkel», das jüngste Buch der Autorin, das da ansetzt, wo «Sie kam aus Mariupol» aufhört.
Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für «Sie kam aus Mariupol» wurde ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der August-Graf-von-Platen-Preis verliehen. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V., dem Berliner Senat, der Stiftung Alfred-Döblin-Preis und der Robert-Bosch-Stiftung für die Förderung der Arbeit an diesem Buch.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: privat
ISBN 978-3-644-00056-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Schwester
Erster Teil
Dass ich den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippte, war nicht viel mehr als eine Spielerei. Im Lauf der Jahrzehnte hatte ich immer wieder versucht, eine Spur von ihr zu finden, ich hatte ans Rote Kreuz und andere Suchdienste geschrieben, an einschlägige Archive und Forschungseinrichtungen, an wildfremde Leute in der Ukraine und in Moskau, ich hatte in verblichenen Opferlisten und Karteien gesucht, aber es war mir nie gelungen, auch nur die Spur einer Spur zu finden, einen noch so vagen Beweis für ihr Leben in der Ukraine, ihre Existenz vor meiner Geburt.
Im Zweiten Weltkrieg hatte man sie als Dreiundzwanzigjährige zusammen mit meinem Vater aus Mariupol zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert, ich wusste nur, dass beide in einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns in Leipzig eingesetzt waren. Elf Jahre nach Kriegsende hatte meine Mutter sich in einer westdeutschen Kleinstadt das Leben genommen, unweit einer Siedlung für Heimatlose Ausländer, wie man die ehemaligen Zwangsarbeiter damals nannte. Außer meiner Schwester und mir gab es wahrscheinlich auf der Welt keinen einzigen Menschen mehr, der sie noch gekannt hatte. Und auch wir, meine Schwester und ich, hatten sie eigentlich nicht gekannt. Wir waren Kinder, meine Schwester gerade erst vier, ich zehn Jahre alt, als sie an einem Oktobertag im Jahr 1956 wortlos die Wohnung verließ und nicht wiederkam. In meiner Erinnerung war sie nur noch ein Schemen, mehr ein Gefühl als eine Erinnerung.
Inzwischen hatte ich meine Suche nach ihr längst aufgegeben. Sie war vor über neunzig Jahren geboren und hatte nur sechsunddreißig Jahre gelebt, nicht irgendwelche Jahre, sondern die Jahre des Bürgerkriegs, der Säuberungen und Hungerkatastrophen in der Sowjetunion, die Jahre des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Sie war in den Reißwolf zweier Diktaturen geraten, zuerst unter Stalin in der Ukraine, dann unter Hitler in Deutschland. Es war eine Illusion, Jahrzehnte später in dem Ozean vergessener Opfer die Spur einer jungen Frau zu finden, von der ich nicht viel mehr wusste als den Namen.
Als ich diesen Namen in einer Sommernacht des Jahres 2013 ins russische Internet eingegeben hatte, lieferte mir die Suchmaschine prompt ein Resultat. Meine Verblüffung dauerte nur wenige Sekunden. Ein erschwerender Umstand meiner Suche hatte immer schon darin bestanden, dass meine Mutter einen ukrainischen Allerweltsnamen hatte, es gab Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Ukrainerinnen, die hießen wie sie. Zwar trug die mir auf dem Bildschirm angezeigte Person auch den Vatersnamen meiner Mutter, sie war ebenfalls eine Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko, doch auch Jakow, der Name des Vaters meiner Mutter, war so verbreitet, dass mein Fund nichts zu bedeuten hatte.
Ich öffnete den Link und las: Iwaschtschenko, Jewgenia Jakowlewna, Geburtsjahr 1920, Geburtsort Mariupol. Ich starrte auf den Eintrag, er starrte zurück. So wenig ich über meine Mutter auch wusste, ich wusste, dass sie 1920 in Mariupol geboren war. Sollte es möglich sein, dass in einer kleinen Stadt wie dem damaligen Mariupol in einem Jahr zwei Mädchen mit demselben Vor- und Nachnamen zur Welt gekommen waren, deren Väter beide Jakow hießen?
Obwohl das Russische meine Muttersprache war, die ich im Lauf meines Lebens nie ganz verloren hatte und die ich seit meinem Umzug ins Nachwende-Berlin wieder fast täglich sprach, war ich nicht sicher, ob ich wirklich den Namen meiner Mutter auf dem Bildschirm las oder ob mir dieser Name vielleicht nur wie eine Fata Morgana in der Wüste erschien, die das russische Internet für mich war. Hier wurde ein Russisch gesprochen, das ich beinah als Fremdsprache erlebte, ein Newspeak, das sich rasant veränderte, ständig neue Vokabeln hervorbrachte, sich täglich mit neuen Amerikanismen vermengte, deren Herkunft sich nach der Transkription ins Kyrillische oft kaum noch erkennen ließ. Auch die Seite, die mich jetzt von meinem Bildschirm ansah, hatte einen englischen Namen, sie hieß «Azov’s Greeks». Ich wusste, dass Mariupol am Asowschen Meer lag, aber woher kamen plötzlich die «Asowschen Griechen»? Noch nie hatte ich von irgendeinem Zusammenhang zwischen der Ukraine und Griechenland gehört. Wäre ich Engländerin gewesen, hätte ich sehr treffend sagen können: It’s all Greek to me.
Über Mariupol wusste ich zu dieser Zeit so gut wie nichts. Auf der Suche nach meiner Mutter war es mir nie in den Sinn gekommen, mich über die Stadt kundig zu machen, aus der sie stammte. Mariupol, das vierzig Jahre lang Shdanow hieß und erst nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder seinen alten Namen erhielt, blieb ein innerer Ort für mich, den ich niemals dem Licht der Wirklichkeit aussetzte. Seit jeher war ich im Ungefähren zu Hause, in meinen eigenen Bildern und Vorstellungen von der Welt. Die äußere Wirklichkeit bedrohte dieses innere Zuhause, und deshalb wich ich ihr nach Möglichkeit aus.
Mein ursprüngliches Bild von Mariupol war davon geprägt, dass in meiner Kindheit niemand zwischen den einzelnen Staaten der Sowjetunion unterschied, alle Bewohner ihrer fünfzehn Republiken galten als Russen. Obwohl Russland im Mittelalter aus der Ukraine hervorgegangen war, aus der Kiewer Rus, die man die Wiege Russlands nannte, die Mutter aller russischen Städte, sprachen auch meine Eltern so über die Ukraine, als wäre sie ein Teil von Russland – dem größten Land der Welt, sagte mein Vater, ein gewaltiges Reich, das von Alaska bis nach Polen reichte und ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche einnahm. Deutschland war dagegen nur ein Klecks auf der Landkarte.
Das Ukrainische ging für mich im Russischen auf, und wenn ich mir meine Mutter in ihrem früheren Leben in Mariupol vorstellte, sah ich sie immer im russischen Schnee. Sie ging in ihrem altmodischen grauen Mantel mit dem Samtkragen und den Samtstulpen, dem einzigen Mantel, den ich je an ihr gesehen hatte, durch dunkle, eisige Straßen in irgendeinem unermesslichen Raum, durch den seit Ewigkeiten der Schneesturm fegte. Der sibirische Schnee, der ganz Russland und auch Mariupol bedeckte, das unheimliche Reich der ewigen Kälte, in dem die Kommunisten herrschten.
Meine kindliche Vorstellung vom Herkunftsort meiner Mutter überdauerte Jahrzehnte in meinen inneren Dunkelkammern. Auch als ich längst wusste, dass Russland und die Ukraine zwei verschiedene Länder waren und die Ukraine rein gar nichts mit Sibirien zu tun hatte, berührte das mein Mariupol nicht – obwohl ich nicht einmal Gewissheit darüber besaß, ob meine Mutter wirklich aus dieser Stadt kam oder ob ich ihr Mariupol angedichtet hatte, weil mir der Name so gut gefiel. Manchmal war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob es eine Stadt dieses Namens überhaupt gab oder ob sie eine Erfindung von mir war wie so vieles andere auch, das meine Herkunft betraf.
Eines Tages, als ich beim Blättern in einer Zeitung auf den Sportteil stieß und schon weiterblättern wollte, fiel mein Blick auf das Wort Mariupol. Eine deutsche Fußballmannschaft, so las ich, war in die Ukraine gereist, um gegen Iljitschewez Mariupol zu spielen. Allein die Tatsache, dass die Stadt eine Fußballmannschaft hatte, war so ernüchternd, dass mein inneres Mariupol sofort zerbröckelte wie ein modriger Pilz. Nichts auf der Welt interessierte mich weniger als Fußball, aber ausgerechnet der stieß mich zum ersten Mal auf das wirkliche Mariupol. Ich erfuhr, dass es sich um eine Stadt mit ausgesprochen mildem Klima handelte, eine Hafenstadt am Asowschen Meer, dem flachsten und wärmsten Meer der Welt. Es war von langen und weiten Sandstränden die Rede, von Weinhügeln, endlosen Sonnenblumenfeldern. Die deutschen Fußballer stöhnten unter den Sommertemperaturen, die sich der Vierzig-Grad-Marke näherten.
Die Wirklichkeit erschien mir viel unwirklicher als meine Vorstellung von ihr. Zum ersten Mal seit ihrem Tod wurde meine Mutter zu einer Person außerhalb von mir. Statt im Schnee sah ich sie plötzlich in einem leichten, hellen Sommerkleid auf einer Straße von Mariupol gehen, mit nackten Armen und Beinen, die Füße in Sandalen. Ein junges Mädchen, das nicht am kältesten und dunkelsten Ort der Welt aufgewachsen war, sondern in der Nähe der Krim, an einem warmen südlichen Meer, unter einem Himmel, der vielleicht dem über der italienischen Adria glich. Nichts erschien mir so unvereinbar wie meine Mutter und Süden, meine Mutter und Sonne und Meer. Ich musste alle meine Vorstellungen von ihrem Leben in eine andere Temperatur, in ein anderes Klima übertragen. Das alte Unbekannte, es hatte sich in ein neues Unbekanntes verwandelt.
Ein reales Winterbild von Mariupol aus der Zeit, als meine Mutter dort lebte, zeigte mir Jahre später eine russische Novelle, deren Titel ich vergessen habe: Hinter dem Fenster des Hotels Palmyra fiel nasser Schnee. Hundert Schritte weiter das Meer, von dem ich nicht zu sagen wage, dass es rauschte. Es gluckste, röchelte, das flache, unbedeutende, langweilige Meer. Ans Wasser angeschmiegt das unscheinbare Städtchen Mariupol mit seinem polnischen Kościół und seiner jüdischen Synagoge. Mit seinem stinkenden Hafen, seinen Lagerschuppen, mit dem löchrigen Zelt eines Wanderzirkus am Strand, mit seinen griechischen Tavernen und der einsamen, matten Laterne vor dem Eingang des erwähnten Hotels. Es kam mir vor wie eine intime Mitteilung über meine Mutter. Das alles hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Bestimmt war sie irgendwann einmal am Hotel Palmyra vorbeigegangen, vielleicht in ihrem grauen Mantel, vielleicht in demselben nassen Schnee, mit dem Gestank des Hafens in der Nase.
Auf der Internetseite, auf der ich nun gelandet war, erfuhr ich erneut Erstaunliches über Mariupol. Zu der Zeit, als meine Mutter dort geboren wurde, war die Stadt noch stark geprägt von der griechischen Kultur. Im 18. Jahrhundert hatte Katharina die Große es den christlichen Griechen aus dem damaligen Krimkhanat geschenkt. Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts durften sich wieder andere Ethnien in dem damaligen Marioypoli ansiedeln. Bis zum heutigen Tag lebt eine griechische Minderheit in der Stadt, und der Name meiner Mutter hatte mich aus irgendwelchen Gründen in ein Forum für griechischstämmige Ukrainer geführt. In mir regte sich ein dumpfer Verdacht. Ich hatte nur eine sehr dünne, kaum noch lesbare Erinnerung an das, was meine Mutter über ihr Leben in der Ukraine erzählt hatte, aber in meinem Gedächtnis hatte sich festgesetzt, dass ihre Mutter eine Italienerin gewesen war. Natürlich konnte ich mir nach der langen Zeit nicht sicher sein, ob es sich wirklich um eine Erinnerung handelte oder um irgendeine zufällige Ablagerung in meinem Gehirn. Vielleicht, das erschien mir am wahrscheinlichsten, hatte ich mir schon als Kind eine italienische Großmutter erdichtet und zum Gegenstand meiner abenteuerlichen Lügengeschichten gemacht, vielleicht war die italienische Großmutter dem einst heißen Wunsch entsprungen, meiner russisch-ukrainischen Haut zu entkommen, etwas anderes zu sein, als ich war. Jetzt fragte ich mich, ob ich mich womöglich nur insofern falsch erinnerte, als die Mutter meiner Mutter keine Italienerin, sondern Griechin gewesen war. Lag das nicht nahe angesichts dessen, was ich jetzt, erst jetzt über Mariupol erfahren hatte? Hatte die Griechin sich in meinem Gedächtnis mit der Zeit unmerklich in eine Italienerin verwandelt, vielleicht deshalb, weil Italien schon in meiner Jugend zu einem Sehnsuchtsort für mich geworden war?
Mir schien, als wäre ich in ein neues Dunkel meiner Herkunft eingetreten, als wurzelte ich plötzlich in einem noch fremderen, endgültig nicht mehr erkennbaren Grund. Ich starrte auf den Namen meiner Mutter auf dem Bildschirm und hatte dabei das Gefühl, dass die notdürftige Identität, die ich mir im Lauf meines Lebens zusammengebastelt hatte, zerplatzte wie eine Seifenblase. Für einen Moment löste sich alles um mich herum auf. Meine Sicherheit fand ich erst in dem Gedanken wieder, dass die griechischen Wurzeln der entdeckten Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko für mich nur insofern von Bedeutung waren, als sie den Beweis dafür erbrachten, dass es sich bei dieser Frau nicht um meine Mutter handeln konnte. Niemals, dessen war ich mir sicher, hatte ich von meiner Mutter das Wort greki gehört, es wäre damals, in unserer abgeriegelten, armseligen Barackenwelt, haften geblieben als etwas Außerordentliches und Exotisches. Andererseits war aber auch schwer zu glauben, dass meine Mutter die griechische Vergangenheit ihrer Heimatstadt nie erwähnt haben sollte, schließlich hatte ich den historischen Hintergrundinformationen des Forums entnommen, dass das Griechische in ihrer Lebenszeit in Mariupol noch sehr gegenwärtig gewesen war.
Ich versprach mir nichts davon, zu oft waren meine Nachforschungen ins Leere gelaufen, aber da «Azov’s Greeks» auch eine Plattform für die Suche nach Angehörigen bot, beschloss ich, trotzdem eine Nachricht zu hinterlassen. Um etwas schreiben zu können, musste ich mich allerdings erst registrieren. Auf einer russischen Internetseite hatte ich das noch nie gemacht, es kam mir unwahrscheinlich vor, dass ich diese technische Hürde meistern würde, aber zu meiner Überraschung ging alles sehr einfach, viel einfacher als auf deutschen Internetseiten. Bereits nach einer Minute war der Zugang freigeschaltet.
In die Suchanfrage konnte ich nicht viel mehr hineinschreiben als den Namen meiner Mutter und ihren Herkunftsort. Ihrem Vatersnamen, Jakowlewna, ließ sich entnehmen, dass ihr Vater Jakow geheißen hatte, aber schon den Mädchennamen ihrer Mutter kannte ich nicht mehr. Ich wusste, dass sie einen Bruder und eine Schwester gehabt hatte, aber auch deren Namen kannte ich nicht. Ich besaß eine ukrainische Heiratsurkunde, aus der hervorging, dass meine Mutter im Juli 1943 in dem von deutschen Truppen besetzten Mariupol meinen Vater geheiratet hatte. Auf einer vom Arbeitsamt Leipzig ausgestellten Arbeitskarte stand, dass sie 1944 zusammen mit meinem Vater nach Deutschland deportiert worden war. Das war alles, was ich über sie wusste.
Und die Frage war, nach wem ich eigentlich suchte. Es war so gut wie ausgeschlossen, dass ihre Geschwister noch lebten, es sei denn, sie waren in einem biblischen Alter. Selbst deren Kinder, sofern sie welche hatten, meine potenziellen Cousinen und Cousins, mussten schon in fortgeschrittenem Alter sein, ähnlich wie ich selbst. Sie konnten meine Mutter kaum noch gekannt haben, und es war fraglich, ob sie überhaupt von ihrer Existenz wussten, ob ihnen jemand von ihr erzählt hatte. Damals und noch Jahrzehnte später war es gefährlich, mit einem Menschen wie meiner Mutter verwandt zu sein, mit jemandem, der sich womöglich freiwillig hatte nach Deutschland deportieren lassen oder dem es zumindest nicht gelungen war, sich der Zwangsarbeit für den Kriegsfeind zu entziehen, notfalls durch Selbstmord, wie Stalin es von wahren Patrioten forderte. Von solchen Verwandten, die als Vaterlandsverräter galten, erzählte man damals seinen Kindern nicht, man wollte sie nicht gefährden.
Früher mussten meine Finger sich beim Tippen russischer Texte auf eine kyrillische Tastatur umstellen und auf mühsame Buchstabensuche gehen, jetzt konnte ich die Texte mit Hilfe eines wundersamen Computerprogramms auf der gewohnten lateinischen Tastatur tippen – das Programm setzte die lateinischen Buchstaben automatisch in kyrillische um. Zwar zweifelte ich daran, dass es mir gelingen würde, meine ins Translitprogramm getippte Nachricht auf die russische Internetseite zu transportieren, der Weg erschien mir zu weit, aber nach den paar üblichen Mausklicks sprang sie tatsächlich auf die Seite von «Azov’s Greeks». Ich setzte meine E-Mail-Adresse unter den Text und schickte ihn ab, ohne zu wissen, wo er landen würde. Vielleicht an irgendeinem toten Ort, in einem elektronischen Nichts, wo nie jemand meine Flaschenpost entdecken würde.
Seit ein paar Wochen war ich in meinem Arbeitsquartier in Mecklenburg. Die kleine Wohnung am Schaalsee teilte ich mir mit einer Freundin, wir benutzten sie abwechselnd. In diesem Jahr gehörte fast der ganze Sommer am See mir. Gilla war Schauspielerin, sie steckte bis zum Hals in einem Theaterprojekt irgendwo im Ausland und kam erst im September zurück. Ich hatte gerade ein Buch abgeschlossen und faulenzte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das länger als einen halben Tag getan hatte. Meine Stoffe standen unerbittlich Schlange und erlaubten keine Pausen, erinnerten mich zunehmend an meine begrenzte Lebenszeit. Normalerweise begann ich nach Abschluss eines Buchs schon am nächsten Tag mit der Arbeit an einem neuen, länger hielt ich es nicht aus ohne das Schreiben, ohne den Kampf mit den Worten. So war der größte Teil meines Lebens dahingegangen, ich hatte es kaum bemerkt. Jetzt wollte ich plötzlich nichts anderes mehr als draußen auf dem Balkon sitzen, die leise Bewegung der Luft an meiner Haut spüren und den sommerblauen See anschauen. Gegen Abend, wenn die Hitze nachgelassen hatte, machte ich mit meinen Nordic-Walking-Stöcken ausgiebige Gänge am Wasser, wo sich in den einsamen Feuchtgebieten riesige Wolken hungriger Stechmücken auf mich stürzten. Auf dem Nachhauseweg kaufte ich mir mein Abendessen beim Fischer, bei dem es frische Maränen und Saiblinge aus dem See gab.
Früher war durch den Schaalsee die deutsch-deutsche Grenze verlaufen. Ein Teil des Sees hatte zu Mecklenburg gehört, der andere zu Schleswig-Holstein. Ein paar Kilometer weiter fuhr man jetzt an einem Schild vorbei, auf dem stand: Hier waren Deutschland und Europa bis zum 18. November 1989 um 16 Uhr geteilt. In dem einstigen Grenzsperrgebiet auf der Ostseite hatten Flora und Fauna über vierzig Jahre lang Zeit gehabt, ihr Eigenleben zu entfalten, beinah ungestört von der Spezies Mensch, die hier nur in Gestalt von Grenzsoldaten vorkam. Nach der Wende wurde die verwilderte Landschaft zum Naturschutzgebiet erklärt und in die Liste der internationalen Biosphärenreservate der UNESCO aufgenommen: verwaltete Wildnis, in der inzwischen die Hamburger Bio-Elite angekommen war. Für die ökologisch bewegten Städter, die sich hier niedergelassen hatten oder am Wochenende in ihre Ferienwohnungen fuhren, hatten Bioläden eröffnet, Biorestaurants, regelmäßig wurden Ökomärkte abgehalten, für fünfzig Euro konnte man eine Kranichschutzaktie erwerben, im Ort gab es ein sogenanntes Zukunftszentrum Mensch – Natur. Die alteingesessenen ostdeutschen Einwohner traf man zumeist nur bei Penny und Lidl, sie waren hier zu Fremden geworden, zu Zaungästen ihrer eigenen Welt, in der sie jetzt in ihren renovierten DDR-Häuschen lebten.
Aus dem großen Panoramafenster meiner Wohnung sah ich nichts anderes als den See. Den ganzen Tag fühlte ich mich ein wenig betrunken vom ständigen Blick auf das blaue Wasser, das mir bodenlos erschien, von unendlicher kühler Tiefe, in der man nie zu sinken und zu trinken aufhören würde. Von weit her das Lachen und Schreien der Kinder, die sich im Wasser tummelten. Schulferien, die Geräusche und Gerüche, die ganze Herrlichkeit eines Kindheitssommers, von dem man glaubte, er würde nie zu Ende gehen. Zum Glück waren Motorboote verboten, der See gehörte den vielen Wasservögeln, die hier lebten, nur ab und zu sah man einen einsamen Kahn oder ein Boot mit einem kleinen weißen Segel vorüberziehen. Schwalben segelten zu Hunderten durch die Luft, manchmal so tief, dass sie mich fast streiften mit den scharfen Spitzen ihrer Flügel, während ich mit einem Buch auf dem Balkon saß und las oder aufs Wasser schaute, auf dessen Oberfläche zahllose Spiegel tanzten, sich gegenseitig silberne Reflexe zuwarfen. Wildgänse zogen in geometrischen Figuren über den Himmel, wie durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden, Mauersegler jagten sich gegenseitig, führten wilde, bizarre Spiele in der Luft auf. In der Abenddämmerung setzte das Konzert der Wasservögel ein, das geschäftige Plappern der Enten, das Schrillen der Singschwäne, das aufgeregte Trompeten der Kraniche, die, von den Feldern kommend, wo sie ihre Nahrung fanden, sich für die Nacht am See sammelten. Manchmal erschien ein Seeadler, mit seinen mächtigen, weitgespannten Schwingen schwebte er reglos über dem Wasser, die Majestät des Sees, der Schrecken der Fische und anderer Seebewohner. Einmal, so hatte man mir erzählt, konnte man vom Seeufer aus beobachten, wie ein Seeadler einen Kranich riss. Es war Winter, einer der Kraniche, die stehend im flachen Wasser schliefen, weil sie hier geschützt waren vor ihren Feinden, war im Schlaf mit den Beinen im See festgefroren. Als sich ein Adler auf ihn niederstürzte, konnte er nicht fliehen und wurde zerfleischt, gefangen im Eis.
Ich war so verliebt in diesen Sommer am See, dass ich nicht schlafen konnte. Manchmal saß ich die ganze Nacht draußen auf dem Balkon, badete in der abgekühlten Luft, sah auf die Lichtstraße, die der Mond auf das dunkle Wasser warf, und konnte mich nicht satthören an der Stille, in der nur noch ab und zu einer der unsichtbaren, im dunklen Schilf versteckten Wasservögel einen leisen, schlaftrunkenen Laut von sich gab.
Sonnenaufgänge wie an diesem See hatte ich nie zuvor gesehen. Sie kündigten sich schon bald nach drei Uhr morgens am Horizont an, erst als kaum wahrnehmbare Rosatönung des Himmels über dem Wasser, die aber zunehmend in eine Lichtorgie von unwirklicher Schönheit überging. Mich wunderte, dass alle anderen schliefen, dass niemand außer mir diesen kosmischen Darbietungen beizuwohnen schien. Der Himmel brannte in allen Farben von Hellgrün bis Golden, Lila und flammend Rot, jeden Tag anders, jeden Tag neu: Lichtschauspiele, surreale Gemälde, die die Sonne an den Himmel zauberte und deren minütlicher Verwandlung ich auf meinem Balkon wie von einem Logenplatz irgendwo im Universum folgte, betäubt vom panisch anmutenden Geschrei der Wasservögel, das sich anhörte, als erwarteten die Tiere eine Apokalypse, irgendein noch nie da gewesenes Ereignis, das jenseits der menschlichen Wahrnehmung lag. Die Farben verdichteten sich, explodierten, dann begannen sie zu verblassen, leise zu verlöschen, immer mehr aufzugehen in dem weißen, gleißenden Licht, das sich nach und nach über den See ergoss. Die Tiere verstummten, die Gefahr war vorüber, ein langer, brütender Sommertag brach an. Ich erhob mich aus dem großen alten Sessel, den ich auf den Balkon hinausgeschoben hatte, putzte mir die Zähne und ging in mein nach Westen gelegenes Schlafzimmer, dessen Fenster ich mit buntem Markisenstoff verhängt hatte, damit ich vor dem Tageslicht und der Hitze geschützt war. Selbst im Schlaf hörte ich noch die Stille und träumte irgendwelche luziden, epischen Träume. Wenn ich gegen Mittag aufwachte, sprang ich sofort aus dem Bett und lief im Nachthemd ans Fenster im anderen Zimmer, um endlich den See wiederzusehen, sein blaues Leuchten.
Seit meiner Suchanfrage bei «Azov’s Greeks» war fast eine Woche vergangen. Ich hatte die Sache schon vergessen, da erreichte mich eine E-Mail mit unleserlichen Schriftzeichen in der Absenderzeile. Ich bekam öfter E-Mails von russischen Absendern, aber diesmal hatte mein Mailprogramm die kyrillischen Buchstaben nicht erkannt. Ein Konstantin mit einem griechischen Nachnamen bat mich, ihm nähere Angaben zu meiner Mutter zu machen. Man werde versuchen, mir weiterzuhelfen, aber dazu müsse man etwas mehr über die Person wissen.
So weit war ich auf meiner Suche noch nie gekommen. Ein Mann in Mariupol war bereit und besaß offenbar Möglichkeiten, mir weiterzuhelfen, wenn ich ihm nähere Angaben zu meiner Mutter machte. Nur dass ich ihm diese Angaben nicht machen konnte, weil ich alles, was ich wusste, bereits mitgeteilt hatte. Aus irgendeinem Grund schämte ich mich dafür, als wäre es ein Armutszeugnis, eine Schande, so wenig über die eigene Mutter zu wissen. Und gleichzeitig war es, als hätte ich soeben etwas Neues über sie erfahren. Es schien, als könnte ich mit den Augen des Fremden hineinsehen nach Mariupol, als wäre er ein ehemaliger Nachbar meiner Mutter, der jeden Tag an ihrem Haus vorbeiging, mich mitnahm in Straßen, durch die sie einst gegangen war, Häuser, Bäume, Plätze sah, die sie einst gesehen hatte, das Asowsche Meer und die griechischen Tavernen, die es vielleicht immer noch gab. In Wirklichkeit war von dem Mariupol, in dem sie gelebt hatte, nicht mehr viel übrig. Die deutsche Wehrmacht hatte es im Krieg zum großen Teil in Schutt und Asche gelegt.
Ich dankte dem freundlichen Konstantin mit dem griechischen Nachnamen für seine Hilfsbereitschaft und schickte Grüße nach Mariupol, während meine Mutter, so glaubte ich, nach diesem erneuten Fehlschlag endgültig und für immer in Dunkelheit versank.
In Wahrheit hatte ich die russische Suchmaschine nicht ganz zufällig gerade jetzt nach ihrem Namen befragt. Schon lange beschäftigte mich der Gedanke, über das Leben meiner Mutter zu schreiben, vor allem über die Frau, die sie vor meiner Geburt in der Ukraine und in dem deutschen Arbeitslager gewesen war. Nur dass ich über diese Frau eben so gut wie nichts wusste. Von der Zeit ihrer Zwangsarbeit hatte sie nie gesprochen, weder sie noch mein Vater, jedenfalls erinnerte ich mich nicht daran. Was ich von ihren Erzählungen über ihr Leben in der Ukraine noch im Gedächtnis hatte, waren nicht mehr als ein paar vage Irrlichter in meinem Kopf. Ich konnte nur versuchen, eine fiktionale Biografie zu schreiben, die sich auf die Geschichtsschreibung stützte, auf die bekannten Fakten der Orte und der Zeit, in der meine Mutter gelebt hatte. Seit vielen Jahren schon suchte ich nach irgendeinem Buch von einem ehemaligen Zwangsarbeiter, nach einer literarischen Stimme, an der ich mich hätte orientieren können, vergeblich. Die Überlebenden der Konzentrationslager hatten Weltliteratur hervorgebracht, Bücher über den Holocaust füllten Bibliotheken, aber die nichtjüdischen Zwangsarbeiter, die die Vernichtung durch Arbeit überlebt hatten, schwiegen. Man hatte sie zu Millionen ins Deutsche Reich verschleppt, Konzerne, Unternehmen, Handwerksbetriebe, Bauernhöfe, Privathaushalte im ganzen Land bedienten sich nach Belieben am Kontingent der importierten Arbeitssklaven, deren maximale Ausbeutung bei geringstem Aufwand Programm war. Sie mussten unter meist unmenschlichen, oft KZ-ähnlichen Bedingungen die Arbeit der deutschen Männer machen, die an der Front waren, in den Heimatländern der Deportierten deren Dörfer und Städte verwüsteten, deren Familien umbrachten. Die nach Deutschland verschleppten Männer und Frauen wurden in bis heute unbekannter Zahl in der deutschen Kriegswirtschaft zu Tode geschunden, aber noch Jahrzehnte nach Kriegsende fand sich über die Verbrechen an den sechs bis siebenundzwanzig Millionen Zwangsarbeitern – die Zahlenangaben schwanken dramatisch von Quelle zu Quelle – nur gelegentlich ein einzelner, dünner Bericht in einem Kirchenblatt oder in einer lokalen Sonntagszeitung. Zumeist wurden sie beiläufig, unter «ferner liefen», zusammen mit den Juden erwähnt, eine Marginalie, ein Anhängsel des Holocaust.
Die längste Zeit meines Lebens hatte ich gar nicht gewusst, dass ich ein Kind von Zwangsarbeitern bin. Niemand hatte es mir gesagt, nicht meine Eltern, nicht die deutsche Umwelt, in deren Erinnerungskultur das Massenphänomen der Zwangsarbeit nicht vorkam. Jahrzehntelang wusste ich nichts von meinem eigenen Leben. Ich hatte keine Ahnung, wer all die Leute waren, mit denen wir in verschiedenen Nachkriegsghettos zusammenwohnten, wie sie nach Deutschland gekommen waren: all die Rumänen, Tschechen, Polen, Bulgaren, Jugoslawen, Ungarn, Letten, Litauer, Aserbaidschaner und viele andere, die sich trotz babylonischer Sprachverwirrung irgendwie untereinander verständigten. Ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war.
In der deutschen Schule hatte man uns beigebracht, dass die Russen Deutschland überfallen, alles zerstört und den Deutschen ihr halbes Land weggenommen hätten. Ich saß in der hintersten Reihe, neben Inge Krabbes, mit der auch niemand etwas zu tun haben wollte, obwohl sie eine Deutsche war, aber sie trug schmuddelige Kleider und roch schlecht, und die Lehrerin vorn am Pult erzählte, dass die Russen ihrem Verlobten die Augen mit glühenden Kohlen ausgebrannt und kleine Kinder mit ihren Stiefeln zertreten hätten. Alle Köpfe drehten sich nach mir um, selbst Inge Krabbes rückte ein Stück von mir ab, und ich wusste, nach Schulschluss würde wieder die Jagd beginnen.
Meine Lügen konnten mir längst nicht mehr helfen, ich zählte nicht nur zu den russischen Barbaren, sondern war längst als Hochstaplerin enttarnt. Um mich in den Augen der deutschen Kinder aufzuwerten, hatte ich ihnen erzählt, meine Eltern, für die ich mich so schämte, seien gar nicht meine wirklichen Eltern, sie hätten mich auf ihrer Flucht aus Russland im Straßengraben gefunden und mitgenommen, in Wirklichkeit würde ich aus einer reichen russischen Fürstenfamilie stammen, die Schlösser und Güter besaß, wobei ich zu erklären versäumte, wie ich als Fürstenkind in den Straßengraben geraten war, aber für einen Tag oder ein paar Stunden war ich ein verkanntes, geheimnisvolles Wesen, das die staunende Bewunderung der deutschen Kinder genoss. Irgendwann durchschauten sie mich natürlich, und dann jagten sie mich erst recht, die kleinen Rächer des untergegangenen Dritten Reiches, die Kinder der deutschen Kriegerwitwen und Naziväter, sie jagten sämtliche Russen in meiner Gestalt, ich war die Verkörperung der Kommunisten und Bolschewiken, der slawischen Untermenschen, ich war die Verkörperung des Weltfeindes, der sie im Krieg besiegt hatte, und ich rannte, rannte um mein Leben. Ich wollte nicht sterben wie Dschemila, die kleine Tochter der Jugoslawen, die die deutschen Kinder auch gejagt und eines Tages in die Regnitz gestoßen hatten, in der sie dann ertrunken war. Ich lief und zog eine Woge von Kriegsgeheul hinter mir her, aber ich war eine geübte Sprinterin, inzwischen hatte ich beim Laufen nicht einmal mehr Seitenstechen, sodass es mir meistens gelang, meine Verfolger abzuhängen. Nur bis zu den Kiesgruben musste ich kommen, wo die Grenze zwischen der deutschen Welt und der unseren verlief, hinter den Kiesgruben begann unser Hoheitsgebiet, unsere Terra incognita, auf die außer der Polizei und dem Briefträger noch nie ein Deutscher seinen Fuß gesetzt hatte, auch die deutschen Kinder trauten sich nicht dorthin. Vorn bei den Kiesgruben ging von der asphaltierten Straße ein Trampelpfad ab, der zu den «Häusern» führte. Ich wusste nicht, warum die Deutschen unsere steinernen Blocks so nannten, «Häuser», vielleicht war es die Unterscheidung zwischen uns und den Zigeunern, die noch weiter draußen in Holzbaracken wohnten. Sie standen noch eine Stufe unter uns und lösten in mir ein ähnliches Grausen aus wie wir wahrscheinlich in den Deutschen.
Sobald ich die magische Grenze passiert hatte, war ich in Sicherheit. Hinter der Kurve, wo meine Verfolger mich nicht mehr sehen konnten, ließ ich mich ins Gras fallen und wartete, bis mein rasendes Herz sich beruhigt hatte, bis ich wieder atmen konnte. Für diesen Tag hatte ich es geschafft, an den nächsten dachte ich jetzt noch nicht. Ich trödelte so lange wie möglich, trieb mich an den Flussauen herum, ließ flache Steine über das Wasser der Regnitz springen, stopfte mir Sauerampfer in den Mund, nagte die rohen Futtermaiskolben ab, die ich von den Feldern stahl. Ich wollte nie nach Hause. Ich wollte weg, immer nur weg, seit ich denken konnte, meine ganze Kindheit wartete ich nur aufs Erwachsenwerden, damit ich endlich wegkonnte. Ich wollte weg aus der deutschen Schule, weg aus den «Häusern», weg von meinen Eltern, weg von allem, das mich ausmachte und mir vorkam wie ein Versehen, in dem ich gefangen war. Selbst wenn ich hätte wissen können, wer meine Eltern und all die anderen waren, zu denen ich gehörte, ich hätte es nicht wissen wollen, es interessierte mich nicht, nichts weniger als das, ich hatte damit nichts zu tun. Ich wollte nur weg, nichts wie weg, alles für immer hinter mir lassen, mich endlich losreißen in mein eigenes und eigentliches Leben, das mich irgendwo draußen in der Welt erwartete.
Ich erinnere mich an mein erstes bewusstes Bild von meiner Mutter: Ich bin etwa vier Jahre alt, wir wohnen im Lagerschuppen einer Eisenwarenfabrik, wo meine Eltern vorübergehendes Asyl in Deutschland gefunden haben. Das Verlassen des Fabrikhofs ist mir unter Strafe verboten, aber schon damals versuche ich ständig zu entkommen. Hinter dem Fabrikhof, auf der großen Leyher Straße, beginnt eine andere, unbekannte Welt. Dort gibt es Geschäfte, eine Straßenbahn, an Kriegsruinen erinnere ich mich nicht, nur an Häuser, die mir vorkommen wie Paläste, Häuser aus Stein, mit großen schweren Türen und hohen Fenstern, an denen Gardinen hängen. Und es gibt eine Wiese mit wilden Birnbäumen. Ich habe noch nie Birnen gegessen, ich möchte wissen, wie sie schmecken. Aber ich bin zu klein, ich erreiche die Äste nicht, an denen die Früchte hängen. Ich probiere es mit einem Stein, den ich in den Baum werfe. Er prallt an einem Ast ab und schießt wieder auf mich zu, ein Bumerang, der mir ein Loch ins Gesicht schlägt, um Haaresbreite das linke Auge verfehlt. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme, weiß nur noch, dass ich auf dem Fabrikhof stehe und mich nicht hineintraue in unsere Behausung. Warmes Blut rinnt über mein Gesicht und tropft mir aufs Kleid. Hinter dem geöffneten Schuppenfenster meine Mutter. Sie hat den Kopf über ein Waschbrett gebeugt und schrubbt Wäsche, eine dunkle Haarsträhne fällt ihr ins Gesicht. Sie hebt den Kopf und sieht mich. Und ich sehe sie, das Bild, das in meiner Erinnerung an sie das erste ist. Sie beginnt mit einem Schrei, der Rest besteht nur aus Augen. Augen, in denen ein Entsetzen steht, das für mich zum Inbegriff von ihr werden wird. Ein Entsetzen von weit her, weit über mich hinaus, unbegreiflich, bodenlos. Das Entsetzen, das sie meint, wenn sie sagt: Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe … Immer wieder, der Kehrreim meiner Kindheit: «Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe …»
Ich besitze zwei Fotos von ihr, die sie aus der Ukraine mitgebracht hat, Porträtfotos, aufgenommen in einem Studio. Auf einem ist sie ein junges Mädchen im Alter von etwa achtzehn Jahren, neben einer zarten weißhaarigen Frau, von der ich nicht weiß, wer sie ist. Meine sehr schmale, wahrscheinlich unterernährte Mutter trägt ein schlichtes Sommerkleid, ihr dichtes, tintenschwarzes Haar ist zu einem Pagenkopf geschnitten, der damals wahrscheinlich Mode war. Offenbar wollte der Fotograf seine künstlerischen Fähigkeiten zur Geltung bringen und ihr etwas Geheimnisvolles verleihen, denn ihre linke Gesichtshälfte ist von einem Schatten verdunkelt. Sie sieht aus wie ein Kind, aber die Unschuld und Schutzlosigkeit in ihrem Gesicht sind mit einem erschreckenden Wissen gepaart. Schwer zu glauben, dass ein Mensch von solcher Zerbrechlichkeit so ein Wissen aushalten kann – als wäre ein Tonnengewicht an einem Zwirnsfaden aufgehängt. Die weißhaarige Frau neben ihr hat trotz ihrer Zartheit etwas Maskulines an sich, ihrem Alter nach könnte sie die Großmutter meiner Mutter sein. Ein graues Kleid mit weißem Spitzenkragen, die Haltung aufrecht, streng, im Gesicht der Stolz der Erniedrigten und Beleidigten. Es muss in etwa das Jahr 1938 sein, die Hochzeit des stalinistischen Terrors, des Hungers und der Angst.
Auf dem zweiten Foto ist meine Mutter wohl etwas älter, vielleicht ist diese Aufnahme im Krieg entstanden, kurz vor ihrer Deportation. Hier blicken ihre Augen ganz nach innen, in irgendeine ferne, unergründliche Landschaft, die Schwermut in ihren Zügen vermischt sich mit dem Anflug eines Lächelns. Ihr Gesicht ist eingerahmt von einem Tuch im ukrainischen Folklorestil, das sie lose um den Kopf geschlungen hat. Vielleicht ist sie zum Fotografen gegangen, um ein letztes Foto von sich in der Ukraine machen zu lassen, ein Erinnerungsfoto.
Was für eine schöne Frau, sagt jeder, der diese alten Schwarzweißaufnahmen sieht. Schon in meiner Kindheit war die Schönheit meiner Mutter ein Mythos. Was für eine schöne Frau, hörte ich andere ständig sagen. Und: Was für eine unglückliche Frau. Schönheit und Unglück schienen bei meiner Mutter zusammenzugehören, sich auf rätselhafte Weise zu bedingen.
Zu meinem Archiv gehört noch ein drittes Foto aus der Ukraine. Es zeigt einen gut gekleideten älteren Herrn mit klugen, melancholischen Augen, einer hohen Stirn und einem kurzen, halb ergrauten Vollbart. Er steht hinter zwei sitzenden Frauen, die eine in einem strengen, hochgeschlossenen Kleid, ihr Gesicht das einer Intellektuellen mit einem Zwicker auf der Nase. Die jüngere in einer weißen Bluse, mädchenhaft scheu, im Blick der Ausdruck von Vergeblichkeit. Auf der Rückseite dieses Fotos steht in der Handschrift meiner Mutter auf Deutsch: «Großvater und zwei Bekannte». Ich weiß nicht, wessen Großvater gemeint ist, meiner oder der meiner Mutter. Ich weiß nicht, warum sie dieses Foto auf Deutsch beschriftet hat, obwohl sie sich meinem Deutsch immer widersetzte und beharrlich Russisch mit mir sprach.
Außer diesen drei Fotos besitze ich noch die zwei bereits erwähnten amtlichen Dokumente. Um die Heiratsurkunde meiner Eltern lesen zu können, muss ich das postkartengroße Stück Papier vor einen Spiegel halten. Es handelt sich um eine mysteriöse Ablichtung mit seitenverkehrter weißer Handschrift auf schwarzem Grund. Im Spiegel kann ich lesen, dass meine Mutter, Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko, am 28. Juli 1943 in Mariupol die Ehe mit meinem Vater geschlossen hat. Die Urkunde ist auf Ukrainisch ausgestellt, der Stempel verblichen, aber deutlich erkennbar ist das deutsche Wort «Standesamt». Jedes Mal wieder stolpere ich über dieses Wort. Was hatten die Deutschen auf dem Standesamt von Mariupol verloren? Ein Detail aus einem Okkupationsalltag, von dem ich mir wenig Vorstellungen mache. Immer kommt es mir vor wie ein Wunder, dass dieses unscheinbare Dokument nicht nur Krieg, Deportation, Arbeitslager und die anschließende Odyssee durch die Nachkriegslager in Deutschland überlebt hat, sondern auch meine späteren Umzüge, von denen ich nicht wenige hinter mir habe. Das über siebzig Jahre alte, offenbar unverwüstliche Beweisstück einer nicht allzu langen, desaströsen Ehe.
Die deutsche Arbeitskarte meiner Mutter ist verschollen, vielleicht irgendwann in einem dunklen, luftlosen Winkel meines Schreibtisches zu Staub zerfallen, aber ich weiß, dass sie bis auf den Namen identisch war mit der am 8. August 1944 in Leipzig ausgestellten Arbeitskarte meines Vaters, die noch erhalten ist. Ein seifenstückgroßes, zweifach gefaltetes Stück Papier, stark vergilbt und abgegriffen. Name, Geburtsdatum, Geburtsort meines Vaters, der Kamyschin heißt, sich aber auf dem Weg aus seinem Mund in das Ohr der deutschen Schreibkraft in Chanuchin verwandelt hat. Es folgt:
Staatsangehörigkeit: ungeklärt, Ostarbeiter.
Herkunftsland: Besetzte Ostgebiete.
Kreis: Marienpol.
Wohnhaft: –
Beschäftigt als: Metallhilfsarbeiter.
Arbeitsstelle: ATG Maschinenbau GmbH, Leipzig W 32, Schönauer Str. 101
Im Inl. seit 14.5.44
Zwei Stempel mit Reichsadler, einer vom Polizeipräsidium, einer vom Arbeitsamt Leipzig, außerdem ein Foto meines Vaters mit einer Nummer, die am Revers seines Anzugs befestigt ist. Auf der Rückseite zwei Fingerabdrücke, linker Zeigefinger, rechter Zeigefinger. Darunter: Diese Arbeitskarte berechtigt nur zur Arbeit bei dem genannten Betriebsführer und wird beim Verlassen dieser Arbeitsstelle ungültig. Der Inhaber hat die Arbeitskarte als Ausweis ständig bei sich zu tragen. Gültig bis auf weiteres. Widerruf vorbehalten.
Aus diesen zwei historischen Dokumenten, der Heiratsurkunde und der Arbeitskarte, den drei Schwarzweißfotos und einer alten Ikone, die meine Mutter in ihrem Bündel auf die weite Reise mitgenommen hatte, bestand mein gesamtes Familienerbe. Die Ikone, handgemalt auf Goldgrund, zeigte die Schar der wichtigsten russisch-orthodoxen Heiligen. Jedes Detail war so kunstvoll ausgearbeitet, dass man sogar die Fingernägel der Heiligen sah.
Wenn ich mich an etwas genau erinnere, dann daran, wie meine Mutter von der Armut ihrer Familie in der Ukraine erzählt hat, vom ständigen Hunger. Die Angst vor Stalin und die Armut waren in meiner Erinnerung das, was ihr Leben in der Ukraine bestimmt hatte. Aber wie war die Armut mit der kostbaren, von dort mitgebrachten Ikone zu vereinbaren? Auch sie hatte auf wundersame Weise Deportation und Arbeitslager überlebt, sie war unterwegs nicht verlorengegangen, war nicht beschädigt worden, niemand hatte sie meiner Mutter weggenommen oder gestohlen. In jeder unserer Baracken hatte sie in einer Ecke gehangen, still und geheimnisvoll schimmernd, zu ihr hatte ich meine heißesten Kindergebete geschickt, die verzweifelten Bitten um das Leben meiner Mutter, wenn sie von meiner Schwester und mir wieder einmal Abschied nahm und sich zum Sterben hinlegte. Jetzt hing die Ikone in meiner Berliner Wohnung über einem alten katholischen Kirchenstuhl, den ich einmal auf einem Dachboden gefunden hatte. Wahrscheinlich war sie das kostbarste Stück, das ich je besaß.
Diesem dürftigen Archiv konnte ich nur noch ein paar unscharfe, fragwürdige Erinnerungen hinzufügen, die Erinnerungen eines Kindes, die vielleicht gar keine Erinnerungen mehr waren, sondern bloßer Schaum, den die jahrzehntelangen Gärungsprozesse der Zeit in meinem Gedächtnis zurückgelassen hatten:
Ich fand in mir das russische Wort advokat – ein solcher soll der Vater meiner Mutter gewesen sein. Immer hatte sie um ihn, den Herzkranken, gebangt, und als sie eines Tages in der Schule aus dem Unterricht geholt wurde, hatte sie sofort gewusst, dass er gestorben war.
Ich fand den Namen «De Martino» – so soll die Mutter meiner Mutter geheißen haben, eine aus einer vermögenden italienischen Familie stammende Frau, von der ich nicht wusste, was sie im letzten oder vorletzten Jahrhundert in die Ukraine verschlagen haben mochte. Dem Vermögen der Familie widersprach das Wort «Kohlenhandlung», das in meinem Gedächtnis gleich neben dem Namen «De Martino» angesiedelt war.
Ich fand den Namen «Medweshja Gora», zu Deutsch Bärenberg – so hieß in meiner Erinnerung der Ort, an den man die Schwester meiner Mutter verbannt hatte. Mehr wusste ich nicht über sie. Mein Gedächtnis hatte nur noch gespeichert, dass die Mutter meiner Mutter sich eines Tages auf den Weg nach Medweshja Gora gemacht hatte, um ihre Tochter im Lager zu besuchen. In dieser Zeit brach der Zweite Weltkrieg aus, und sie kam nicht mehr zurück. Das schien die größte Katastrophe im Leben meiner Mutter gewesen zu sein: dass sie ihre Mutter verloren hatte, dass sie nicht wusste, was mit ihr geschehen war – ob sie noch lebte oder ob sie im deutschen Bombenhagel den Tod gefunden hatte. In meiner kindlichen Vorstellung hatten die Bären in Medweshja Gora sie gefressen.
Ich fand noch einen Bruder, der ein bekannter Opernsänger gewesen sein soll und mit dem meine Mutter eine besonders innige Liebe verbunden hatte. Um ihn hatte sie fast so viele Tränen geweint wie um ihre Mutter.
Im Grunde glaubte ich fast nichts von alledem. Die vermögende italienische Familie, ein Großvater, der Rechtsanwalt gewesen war, der bekannte Opernsänger, sogar die Kohlenhandlung ähnelten verdächtig meinen kindlichen Sehnsüchten nach einer respektablen Herkunft, die aus meiner damaligen Perspektive auch ein Kohlenhändler besaß. Der Opernsänger stammte wahrscheinlich aus späterer Zeit, als ich, ein Mädchen noch, völlig überraschend die Oper entdeckte und mir offenbar einen Onkel erdichtete, der meine Lieblingsarien von Bellini und Händel sang. Und die Verbannung meiner Tante entstammte möglicherweise meinem kindlichen Verlangen nach tragischer Bedeutsamkeit oder auch nur dem Angstwort «Bärenberg», das ich in irgendeinem ganz anderen Zusammenhang von meiner Mutter gehört haben mochte, vielleicht in einem der vielen Märchen, die sie mir einst erzählte.
Deutlich erinnerte ich mich eigentlich nur noch an eine Erzählung meiner Mutter, in der es um eine Freundin ging. Von ihr hat sie immer wieder gesprochen, mit jenem Entsetzen in den Augen, das ich an ihr so fürchtete. Auch in Mariupol jagten die Nazis die Juden, allein an zwei Tagen im Oktober 1941 wurden in der Stadt achttausend von ihnen erschossen. Was in dem Massaker von Babij Jar gipfelte, gab es überall in der stark von Juden besiedelten Ukraine. Die Freundin meiner Mutter war ebenfalls Jüdin, und eines Tages fasste man auch sie. Sie musste zusammen mit anderen Juden einen langen Graben ausheben und sich dann mit dem Rücken zu den deutschen Maschinengewehren vor den Graben stellen. Sie schaffte es, der Kugel, die sie treffen sollte, zuvorzukommen, indem sie sich eine Sekunde vorher in den Graben fallen ließ. Sie wartete die Dunkelheit ab, arbeitete sich aus dem Leichenberg heraus, unter dem sie begraben lag, und lief zu meiner Mutter. Blutüberströmt stand sie vor ihrer Tür.
Seit langer Zeit zerbrach ich mir den Kopf darüber, in welchem Verhältnis meine Mutter im Krieg zu den deutschen Besatzern gestanden hatte. Die gesamte Bevölkerung der besetzten Gebiete musste damals für die Deutschen arbeiten, es gab keine Alternative. Nur wer arbeitete, bekam Lebensmittelmarken, und ohne Lebensmittelmarken konnte niemand überleben. Doch meine Mutter, die bei Ausbruch des Krieges erst einundzwanzig Jahre alt war, hatte einen besonderen Arbeitsplatz. Sie, die künftige Zwangsarbeiterin, war ausgerechnet beim deutschen Arbeitsamt angestellt, das die Zwangsarbeiter rekrutierte und auf den Transport nach Deutschland brachte. Es war, als hätte sie für ihre eigene Deportation gearbeitet. Zudem waren die Arbeitsämter wesentliche Macht- und Kontrollorgane der deutschen Besatzer, jeder musste sich dort melden, niemand kam an den deutschen Arbeitsämtern vorbei. Was für Aufgaben mochte meine Mutter dort gehabt haben? Stand sie auf der Seite der Deutschen, weil sie in ihnen die Befreier sah, die das Stalin-Regime besiegen würden? Arbeitete sie aus Überzeugung beim Arbeitsamt, oder war sie nur ein zufälliges Rädchen in der deutschen Kriegsmaschinerie? Hatte man sie am Ende genauso verschleppt wie alle andern auch, oder hatte sie sich freiwillig zum Transport gemeldet? War sie ein Opfer der allgegenwärtigen Propaganda, die den leichtgläubigen, in Armut lebenden Sowjetbürgern ein Paradies in Deutschland versprach? Hatte sie dieser Propaganda auch noch 1944 geglaubt, im Jahr ihrer Deportation, als eigentlich schon jeder wusste, was diejenigen erwartete, die täglich zu Tausenden ergriffen und in Viehwaggons ins Deutsche Reich gebracht wurden? Nicht wenige waren zu dieser Zeit bereits wieder zurückgekommen, krank, körperlich und seelisch ruiniert von den brutalen Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland, leistungsunfähig gewordene Arbeitssklaven, die die Nazis nicht mehr gebrauchen konnten. Vielleicht hatte meine Mutter, wenn sie wirklich freiwillig gegangen sein sollte, das alles gewusst, aber keine Wahl gehabt. Als abzusehen war, dass die Rote Armee Mariupol zurückerobern würde, blieb ihr nur noch die Flucht, denn eine Mitarbeiterin des deutschen Arbeitsamtes hätte man wahrscheinlich auf der Stelle als Kollaborateurin und Vaterlandsverräterin erschossen. Und womöglich hatte mein Vater noch schwerwiegendere Gründe gehabt als sie, die Sowjetunion zu verlassen. Vielleicht war sie ihm einfach gefolgt, einem Mann, der damals ihr Beschützer, ihre einzige Zuflucht war. Sie selbst war wahrscheinlich viel zu jung, zu unbedarft und zu verstört, um Entscheidungen von solcher Tragweite zu treffen, sich den Gewalten ihrer Zeit und ihres Ortes entgegenzustemmen.
Jetzt, in diesem verzauberten Sommer am See, wurde mir mit zunehmendem Schrecken bewusst, was ich mir vorgenommen hatte. Mein erstes, vor Jahrzehnten erschienenes Buch war so etwas wie der Versuch einer Autobiographie gewesen, aber damals hatte ich keine Ahnung gehabt von meiner Biographie, ich hatte mein Leben und seine Zusammenhänge nicht gekannt. Meine Mutter war immer eine innere Figur für mich geblieben, Teil einer vagen, im Ungefähren angesiedelten Privatvita, die ich mir jenseits politischer und historischer Zusammenhänge erfunden hatte, in einem Niemandsland, in dem ich ein herkunftsloses, wurzelloses Einzelwesen war. Erst sehr viel später begann ich zu begreifen, wer meine Eltern waren und was für einen «Stoff» sie mir hinterlassen hatten. Jetzt stand ich vor der Aufgabe, das Versäumte nachzuholen, in einem vielleicht letzten Buch zu sagen, was ich in meinem ersten hätte sagen müssen. Nur dass ich eben weiterhin so gut wie nichts vom Leben meiner Mutter vor meiner Geburt wusste, schon gar nichts von ihrer Zeit im deutschen Arbeitslager. Ich stand mit leeren Händen da, hatte nur die Geschichtsschreibung und meine Phantasie, die den Abgründen des Themas nicht gewachsen war.
Als diejenigen, die man nach einer Wortschöpfung von Hermann Göring «Ostarbeiter» nannte, in den 1990er Jahren mit großer Verspätung begannen, Entschädigungsansprüche zu stellen, rückte das Thema «Ostarbeiter» ins Licht oder zumindest Halblicht der deutschen Öffentlichkeit. Inzwischen gab es Sachbücher, Berichte und Dokumentationen über die Zwangsarbeit im Dritten Reich, ich konnte lesen und mich informieren. Mittlerweile hatte ich sogar die so lange vergeblich gesuchte literarische Stimme gefunden, ein Buch von Vitalij Sjomin, das in der deutschen Übersetzung «Zum Unterschied ein Zeichen» hieß und schon in den siebziger Jahren erschienen war. Der russische Autor erzählte darin die Geschichte eines Halbwüchsigen, den man aus Rostow am Don verschleppt hatte und der die Zwangsarbeit in Deutschland nur überlebte, weil er überzeugt davon war, dass das, was er sah und erfahren musste, nicht mit ihm zusammen untergehen durfte, dass er verpflichtet war, Zeugnis für die Nachwelt abzulegen. Im Arbeitslager, so schreibt er, war es besser als im Vernichtungslager, aber nur insofern, als man im Arbeitslager nicht sofort ermordet wurde, sondern nach und nach – durch ein unmenschliches Arbeitspensum, Hunger, Schläge, ständige Schikanen und fehlende medizinische Versorgung.
Zu meiner Überraschung hatte ich festgestellt, dass der Übersetzer des Buchs Alexander Kaempfe war, mit dem mich in den siebziger Jahren eine Freundschaft verband. Er las mir oft aus seinen Übersetzungen vor, gut möglich, dass er mir auch aus dem Buch von Vitalij Sjomin vorgelesen hat und ich mich nur deshalb nicht daran erinnerte, weil ich damals ja nicht wusste, dass das Buch von meinen Eltern handelte, dass sie einst ebenfalls zum Unterschied ein Zeichen trugen, den Abnäher «OST», der sie von den rassisch höher stehenden westeuropäischen Zwangsarbeitern unterschied.
Je länger ich recherchierte, auf desto mehr Ungeheuerlichkeiten stieß ich, von denen bisher kaum jemand gehört zu haben schien. Nicht nur ich selbst war in vielem immer noch ahnungslos, auch von meinen deutschen Freunden, die ich für aufgeklärte, geschichtsbewusste Menschen halte, wusste niemand, wie viele Nazi-Lager es früher auf deutschem Reichsgebiet gegeben hatte. Die einen gingen von zwanzig aus, andere von zweihundert, einige wenige schätzten zweitausend. Nach einer Studie des Holocaust Memorial Museums in Washington belief sich die Zahl aber auf 42500, die kleinen und die Nebenlager nicht mitgerechnet. 30000 davon waren Zwangsarbeiterlager. In einem Interview mit der «ZEIT», das am 4. März 2013 erschien, sagte der amerikanische Historiker Geoffrey Megargee, der an der Studie mitgearbeitet hatte: Die horrende Zahl der Lager bestätige, dass nahezu allen Deutschen die Existenz dieser Lager bekannt gewesen sei, selbst wenn sie das Ausmaß des Systems dahinter nicht begriffen oder nicht in jedem Fall über die Umstände in den Lagern Bescheid gewusst hätten. Es war die alte Geschichte: Niemand hatte etwas gewusst. Obwohl das mit 42500 und mehr Lagern überzogene Land ein einziger Gulag gewesen sein muss.
Ich verirrte mich immer tiefer in der Weltgeschichte, in den gespenstischen Tragödien des 20. Jahrhunderts. Die Berichte über die Zwangsarbeit im Dritten Reich waren voller blinder Flecken, Ungereimtheiten und Widersprüche. Mein Thema entglitt mir zusehends, wuchs mir über den Kopf. War es nicht ohnehin schon zu spät, so fragte ich mich, würde mein Atem überhaupt noch reichen, um diesem gewaltigen Stoff gerecht zu werden? Und gab es überhaupt Worte für alles das, Worte für das Leben meiner in der Anonymität verschollenen Mutter, deren Schicksal für das von Millionen anderer stand?
«Azov’s Greeks» hatte ich längst vergessen, da erreichte mich erneut eine E-Mail mit den seltsamen Hieroglyphen in der Absenderzeile, hinter denen sich Konstantin mit dem griechischen Nachnamen verbarg. Ich las:
Sehr geehrte Natalia Nikolajewna!
Ich habe noch einmal nachgesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der in unserem Archiv verzeichneten Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko mit großer Wahrscheinlichkeit doch um Ihre Mutter handelt. Lassen Sie mich von fernher beginnen. Im 19. Jahrhundert lebte in Mariupol ein ukrainischer Großgrundbesitzer aus der Tschernigowschtschina, ein Adeliger namens Epifan Jakowlewitsch Iwaschtschenko. Das war Ihr Urgroßvater. Wahrscheinlich gehörte er zu den ersten Nichtgriechen, die sich zu dieser Zeit in Mariupol ansiedelten, damals noch ein kleines Kaufmannsstädtchen von kaum fünftausend Einwohnern am Asowschen Meer. Er kaufte für sich und seine Familie ein Haus in der Mitropolitskaja-Straße, wurde Hofrat, Schiffseigner und Direktor der Hafenzollbehörde. Im Lauf der Zeit erwarb er mehrere Immobilien in der Stadt, eröffnete einige Geschäfte und kam zu hohem Ansehen. Er war mit einer Anna von Ehrenstreit verheiratet, von der wir nur wissen, dass sie aus dem baltendeutschen Landadel stammte und laut Kirchenbucheintrag von 1845 bis 1908 gelebt hat.
Ihre Urgroßeltern hatten sechs Kinder, zwei Jungen und vier Mädchen. Der älteste Sohn war Jakow, Ihr Großvater, der Vater Ihrer Mutter. Sein jüngerer Bruder Leonid ist laut Kirchenbucheintrag bereits im Alter von sechsundzwanzig Jahren an Epilepsie gestorben. Über die Schwestern Jelena und Natalia ist uns nichts bekannt, aber wir wissen, dass Olga, die dritte Schwester, mit dem bekannten Psychologen und Philosophen Georgi Tschelpanow verheiratet war, der griechische Wurzeln hatte. So ist es auch zu erklären, dass nicht nur der Name Ihrer Mutter, sondern auch Angaben zu Tschelpanows gesamter angeheirateter Familie in unser Archiv gelangt sind.
Die vierte Schwester Ihres Großvaters, Ihre Großtante Valentina, gehörte zur Crème de la Crème der Mariupoler Intelligenzia, sie ist noch heute bekannt in der Stadt. Im beiliegenden Artikel können Sie mehr über sie lesen.
Über Ihre Großmutter wissen wir leider gar nichts, nur dass sie Matilda Iosifowna hieß. Die Schwester Ihrer Mutter hieß Lidia und wurde laut Kirchenregister 1911 geboren. Der Bruder hieß Sergej und kam 1915 zur Welt. Er war Opernsänger, im Krieg sang er an der Front und wurde mit einem Orden ausgezeichnet. Die digitalisierte Ehrenurkunde finden Sie ebenfalls in der Anlage.
Vor kurzem ist ein Buch über Georgi Tschelpanow erschienen, in dem mehrfach auch von der Familie seiner Frau die Rede ist. Ihre Großtante Olga litt offenbar an einer Geisteskrankheit und hat sich mit dreiundvierzig Jahren in Moskau aus dem Fenster gestürzt. Wir werden den Autor um ein Exemplar des Buches für Sie bitten.
Die Geschwister Ihrer Mutter sind vermutlich nicht mehr am Leben. Aber auch deren Nachkommen werden nicht leicht zu finden sein, zumal der Name Iwaschtschenko weit verbreitet ist und wir von Ihrer Tante Lidia nicht mehr wissen als den Vornamen. Die Suche nach weiblichen Personen ist immer sehr erschwert, wenn man den Ehenamen nicht kennt. Deshalb schlage ich vor, dass wir unsere Suche erst einmal auf Ihren Onkel Sergej bzw. auf dessen Nachkommen konzentrieren. Für den Anfang könnten wir uns an die Redaktion der Fernsehsendung «Wart auf mich» wenden. Das ist ein sehr bekanntes Format für die Suche nach Angehörigen, das sowohl in Russland als auch in der Ukraine ausgestrahlt wird.