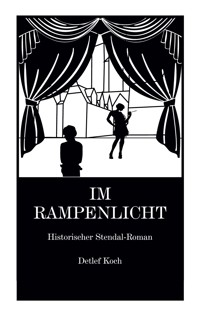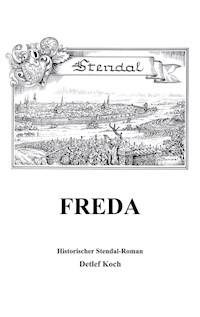Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stendal im Jahre 1517 - ein Fremder kommt mit einem geheimen Auftrag in eine der reichsten, bedeutensten Städte der Mark Brandenburg. Mit ihm ziehen unerwartet die dunklen Schatten der Vergangenheit in den Altag der Menschen. Was vor vielen Jahren in Stendal geschah, beginnt für immer mehr Bürger zum Alptraum zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Inhalt des Buches
Stendal im Jahre 1517 – ein Fremder kommt mit einem geheimen Auftrag in eine der reichsten, bedeutendsten Städte der Mark Brandenburg. Mit ihm ziehen unerwartet die dunklen Schatten der Vergangenheit in den Alltag der Menschen. Was vor vielen Jahren in Stendal geschah, beginnt für immer mehr Bürger zum Albtraum zu werden.
Oberamtmann Gretzko und der neue Scriptor Andreas Mendel vermuten als Erste, dass es hier eine Parallele zu den einstigen schlimmen Ereignissen und dem plötzlichen Tod des Abtes vom Franziskanerkloster gibt. Eine zunächst für unglaublich gehaltene Theorie der beiden Beamten erweist sich nach und nach als wahrer Grund für die Geschehnisse in der Stadt.
Ein raffiniertes Intrigen- und Mordgeschehen in einer deutschen Stadt am Ausgang des Mittelalters, verwoben mit zwei Liebesgeschichten, die auf eine harte Probe gestellt werden, entspinnt sich vor dem Leser.
Im Mittelpunkt steht ein Fremder, der gekommen ist, um Rache zu nehmen für einstige, furchtbare Taten. Mit jedem weiteren Tag aber ergeben sich für ihn selbst immer mehr Probleme. Erst nach und nach erkennt der Fremde, dass auch er selbst zum Ziel eines Mörders geworden ist.
Es ist die Zeit, in der Joachim I., Markgraf von Brandenburg sowie Kurfürst und Erzkämmerer des Heiligen Römischen Reiches, das Land regiert.
Abbildung 1 ‐ Stadtansicht von Nordosten
DER FREMDE AUS SPANIEN
Ein historischer Stendal-Roman
Inhaltsverzeichnis
Freitag, den 29. Oktober
Samstag, den 30. Oktober
Sonntag, den 31. Oktober
Montag, den 1. November
Dienstag, 2. November
Mittwoch, 3.November
Donnerstag, 4. November
Freitag, 5.November
Samstag, 6. November
Montag, 8. November
Donnerstag, 11. November
Samstag, 13. November
Worterklärungen
Freitag, den 29. Oktober
Bleierne, tiefhängende Wolken schoben sich über die langgezogene Anhöhe nördlich der Stadt. Das Quietschen der Windräder nahm zu. Hier oben standen sie dicht an dicht, eine ganze Reihe von meist altersschwachen Windmühlen. Der zunehmende Westwind fauchte über die kahlen Felder und die fast unbelaubten Sträucher nahezu ungehindert hinweg.
Unberührt vom aufziehenden Schlechtwetter saß der Mann auf einem Baumstumpf und schaute mit starrem Blick auf die vor ihm dort unten liegende Stadt mit ihren vier großen Stadtkirchen, deren Spitztürme die Silhouette prägten. Stendal war dem Fremden als reiche Handelsstadt bereits bekannt.
Sein markiges, prägnantes Gesicht trug zwei auffällige alte Wunden. Sowohl über dem linken Auge als auch unter dem Auge verliefen vertikal eine anderthalb bzw. etwa ein Zoll lange Narben. Der Mann war von starker, kräftiger Statur. Obwohl er sein schulterlanges Haar offen trug und es nahezu schlohweiß war, ebenso wie sein eindrucksvoller Kinnbart, konnte er noch keine 50 Jahre alt sein. Er trug einen weiten, wildledernen, wadenlangen Mantel, kniehohe Stiefel aus sehr robustem Leder. Hose und Wams schienen ein wenig unmodern, aber warm und bequem zu sein. Insgesamt bot er eine eindrucksvolle, nicht unattraktive Erscheinung. Bereits im Sitzen ahnte man die stattliche Größe des Mannes. Er maß sechs Fuß und drei Zoll. Ihn im Streit herauszufordern, würde sich so mancher zähneknirschend verkneifen. Noch immer den Blick auf Stendal gerichtet, griff er nun neben sich nach seiner großen Reittasche und entnahm ihr ein leinenes Säckchen. Bedächtig griff er sich ein Stück festen Käse und ein großes Ende von einem Fladenbrot. Alles ging sehr langsam vor sich, auch als der Mann zu essen begann. „Endlich, Tausende von Meilen von Saragossa über Köln bis hierher. Hier also wird alles es ein Ende finden. Wie viele Jahre habe ich darauf gewartet?“ Die Frage blieb unbeantwortet in der Luft hängen. Der fremde Mann griff nach der neben sich stehenden Korbflasche, entkorkte sie und nahm einen kräftigen Schluck.
Sein unweit von ihm grasender schwarzer Rappen Combatiente tänzelte plötzlich unruhig. Der Fremde drehte sich kurz um, dann kam plötzlich Leben in ihn. Er packte seine Tasche, erhob sich und ging nun geradewegs zu seinem treuen Gefährten. „Auf geht’s, Combatiente. suchen wir uns ein Quartier.“ Der Mann hängte seine Tasche um, bestieg ohne Mühe sein Pferd und entschied sich sogleich für das zu seiner Linken stehende Stadttor dort unten.
Eine mächtige Toranlage lag wenig später vor ihm. Eine hölzerne Brücke führte über den äußeren Stadtgraben, bevor ein großes fensterloses Steingebäude erreicht war. Der Durchlass, um auf den Zwinger des Vortores zu gelangen, besass ein eisernes Gitter, welches jedoch hochgezogen war. Eine Stadtwache winkte den Fremden einfach hindurch. Der zwingerförmige Hof hatte beachtliche Größe. Links standen zwei Wachgebäude und rechter Hand befand sich das Zollhaus.
Als Vincz dieses Gebäude verlassen hatte, schmunzelte er fast unmerklich. Natürlich hatte der Wachhabende nichts bei ihm gefunden. Das Durchstöbern sämtlicher Habseligkeiten schien diesem Halunken eine Wohltat. Sichtlich enttäuscht, da er nichts Anstößiges fand, bedeutete er Vincz, auf die besonderen Regeln beim Aufenthalt in der Stadt zu achten; hieß also, keine Waffen bei sich zu tragen, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, nicht innerhalb der Stadtmauern zu Pferde unterwegs zu sein, die Sperrstunde zu beachten und sich wöchentlich bei der Wache zu melden. „Diese Stümper“, dachte sich Vincz. Er hatte natürlich inzwischen reichlich Erfahrungen gemacht, wie man diese lästigen Kontrollen ohne Komplikationen meisterte. Er nahm Combatiente locker am Zügel, überquerte den Hof des Vortores in Richtung einer ummauerten langen Brücke, welche zum eigentlichen Stadttor führte. Ehe der Mann dieses wuchtige Stadttor mit Spitzdach, Viehthor genannt, erreichte, schaute er kurz hinauf. „Tatsächlich, wie passend für dieses graue, schmucklose Ding. Mal sehen, was die Stadt an Besserem zu bieten hat.“ Die Viehthorstraße zeigte sich ihm dann allerdings in krassem Gegenteil zum unansehnlichen Stadttor. Diese überraschend breite Straße säumten meist zweigeschossige, durchaus ansprechend verzierte Patrizierhäuser links und rechts, nur ab und an standen kleinere Gebäude dazwischen. Alle Häuser waren durchgängig in Fachwerkbauweise gehalten. Der Wind hatte inzwischen weiter zugenommen. Es begann, leicht zu regnen. Vincz zog seinen dunklen Hut aus der Satteltasche und begutachtete ihn kurz. Dieser breitkrempige Filzhut mit breitem Saum war mit einer beachtlichen Feder und auffälliger Agraffe verziert. Der eigentliche Besitzer baumelte derweil einige Hundert Meilen von hier an einer gallischen Eiche. Dumm von ihm, ausgerechnet an Vincz zu geraten. An der Krempe steckte ein Zettel mit der Adresse eines gewissen Hannes Schober. Monsieur Lambert hatte dem Fremden in Köln diesen Schober als zuverlässigen und verschwiegenen Mitmenschen beschrieben. Dort sollte Vincz also Quartier nehmen.
Der Fremde aus dem Spanischen hielt sich an der großen Straßenkreuzung also links, kam an einer mächtigen Kirche vorbei, bemerkte eine weitere ordentliche, ebenfalls relativ breite Straße mit überwiegend gut anzusehenden Fachwerkgebäuden, fand alsbald an einem verwinkelten Eckhaus einer Seitenstraße, auf einer Schiefertafel mit Kreide geschrieben, den Namen Hoock, darunter etwas kleiner Lange Hok, und so stand Vincz schließlich vor dem gesuchten Haus 515, als das lang angekündigte Unwetter endlich losbrach.
Samstag, den 30. Oktober
Andreas stand, sich seine kalten Hände vor dem verschnörkelten, eindrucksvollen Kamin reibend, im Arbeitszimmer des reichen Tuchhändlers und Ratsherren Techler. Dieses pompöse Gebäude hatte er schon oft besucht. Seine Liebste war die jüngere Tochter dieses reichen und einflussreichen Mannes. Heute jedoch stand Andreas nicht gar so furchtsam hier. Er hatte immerhin etwas vorzuweisen. Das Leben meinte es gut mit ihm. Innerhalb eines halben Jahres war er zunächst zum Stellvertreter des Oberamtmannes aufgestiegen, und seit gestern durfte Andreas sich gar Stendaler Stadtschreiber nennen. Mit 26 Jahren einen so rasanten Aufstieg vorweisen zu können, machte ihn stolz und auch mutig, nun die langersehnte Verlobung mit Betty voranzutreiben. Er trug heute seinen besten Gehrock, den hellblauen mit
den blitzenden silbernen Knöpfen, eine neue hellgraue Hose und seine guten Stiefel. Wie würde Bettys Vater ihm gegenüber heute auftreten? Andreas vernahm plötzlich schwere Schritte auf der Treppe. Flink nahm er sein Barett vom neben ihm stehenden Sessel und setzte es auf, sogleich der Etikette entsprechend aber wieder ab. Als sich die Tür öffnete, strich sich Andreas noch schnell seine braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Ein Bediensteter blieb an der Tür zur Bibliothek stehen, und dann betrat der Hausherr Herrmann Techler bedächtig den prunkvollen Raum. Eindrucksvoll von seiner gesamten Statur her, edel herausgeputzt und sich seines hohen Standes absolut bewusst, verharrte Techler nach drei, vier Schritten.
„Mein lieber Mendel, oh bitte entschuldigt...Mein verehrter Herr Scriptor und Unteramtmann, wie konnte ich nicht daran denken...Ich freue mich aufrichtig, Ihnen gratulieren zu können. Ich bin hocherfreut über Ihren neuen Stand. Setzen Sie sich doch.“ Er zeigte auf zwei neben dem Kamin stehende gepolsterte Stühle.
Das Gesagte sollte wohl höflich klingen und doch vernahm Andreas sehr wohl diesen ironischen Unterton. Techler setzte sich und bedeutete dem jungen Mann, den Platz neben ihm einzunehmen. Die eben noch so mutige innere Stimme und Zuversicht des Andreas Mendel wich sogleich der gewohnten Skepsis und Unterwürfigkeit angesichts seines Gegenübers. Leise und unbemerkt hatte sich Johann den beiden genähert. Der erste Diener des Hauses Techler brachte zwei große Humpen Bier und servierte sie gekonnt auf dem kleinen Beistelltischchen. „Zum Wohle, mein lieber Mendel, trinken wir auf Ihre neue Stellung bei der Stadt“, sagte Techler süffisant und reichte Andreas das Bier. Sie tranken, und der junge Mann versuchte, im Gesicht seines Gastgebers irgendeine Regung zu lesen. „In der Stadt geschieht kaum etwas nennenswert Verbrecherisches, wie Sie ja selbst wissen. Sie werden wohl kaum größere Probleme bekommen; so ist zu vermuten.“ Der Ratsherr fixierte Andreas.
„Im Übrigen treffen sich am heutigen Abend im Stadt-Keller einige hochgestellte Persönlichkeiten Stendals. Ich lade Sie hiermit ganz förmlich dazu ein, dieser illustren Runde beizuwohnen.“
Andreas schaute wohl etwas dümmlich vor Schreck, bedankte sich leise. Techler bemerkte es und klopfte ihm leicht auf die linke Schulter. „Sie müssen härter werden, sich selbst und anderen gegenüber. Sie werden es tatsächlich zu etwas bringen, denke ich, aber Sie sind noch viel zu weich und grüblerisch.“ Die weitere Unterhaltung führte eigentlich der Hausherr selbst. Andreas warf nur hin und wieder eine kurze Bemerkung ein. Als Techler sich schließlich erhob, war das das eindeutige Zeichen, den Besuch zu beenden. Andreas verabschiedete sich höflich und wandte sich bereits zum Gehen. „Betty hat heute Nachmittag Ausgang. Ich glaube, sie will Besorgungen machen“, kam es unvermittelt Andreas zu Ohren. Es war das einzige Mal, dass der junge Mann bei diesem Besuch lächelte. Draußen, vor dem Hause der Techlers, holte Andreas ganz tief Luft. Natürlich hätte er sich gewünscht, forscher aufgetreten zu sein, aber die letzten Worte des Ratsherren waren das Einzige, was Andreas jetzt durch den Kopf ging.
„Ja“, schrie er fast und streckte die rechte Faust nach oben. Mehrere Leute, die zu dieser vormittäglichen Stunde hier Auf dem Schadewachten flanierten, schüttelten verständnislos die Köpfe.
In dem etwas verspielt wirkenden Zimmer ihrer Schwester mit den vielen bunten Kissen auf dem großen Himmelbett und aufwendigen Wandteppichen, die verträumte Landschaften oder Blumen darstellten, verharrte Resi unbeweglich auf der flauschig, samtigen Überdecke, die etwas zerwühlt auf Bettys Bett lag. Den Kopf auf ihren angewinkelten Arm gestützt, sah sie Betty etwas gelangweilt zu, wie sie nun schon seit fast einer Stunde tänzelnd, ein Lied nach dem anderen trällernd und sich ständig drehend und begutachtend vor dem großen, goldgerahmten Spiegel betrachtete. Inzwischen lagen überall im Zimmer Kleidungsstücke auf dem Boden wild durcheinander. Betty konnte sich nie entscheiden, was sie anziehen sollte. Drei Tage hatte sie ihren geliebten Andreas nicht gesehen. Sie schnellte urplötzlich herum und sah Resi prüfend an. „Glaubst du, der Moment ist nun gekommen? Ich meine jetzt, da Andreas doch so richtig aufgestiegen ist, könnten wir doch endlich Verlobung feiern?“ Resi kam gar nicht dazu, darauf zu antworten. Die aufgedrehte Schwester plapperte weiter. Es war eine sehr typische Szenerie. Betty war 19, immer ausgelassen, spontan, der Mund oft schneller als ihre Gedanken, voller Lebensmut strotzend, liebenswert, aber vielleicht manchmal zu ungestüm. Beide Schwestern waren etwa gleich groß, 5 1/2 Fuß, beide trugen ihr blondes Haar lang, sehr schlank von der Statur her und doch; Resi war das ganze Gegenteil von Betty. Obwohl sie fünf Jahre älter und eigentlich auch viel hübscher als ihre Schwester war, zeigte sie sich fast immer beherrscht, grüblerisch, nachdenklich, in sich gekehrt, zurückhaltend, doch nicht schüchtern. Männer interessierten sie überhaupt nicht, auch wenn das ihre Eltern sehr unglücklich machte. Mit 24 Jahren sollte eine junge Frau längst verheiratet sein. Resi las lieber und zwar so ziemlich alles, was sie ergattern konnte. Fremde Kontinente begeisterten sie, fremde Kulturen, Religionen, Geschichte, Altertum... Immer wieder unternahm Betty Versuche, ihre Schwester zu verkuppeln, denn erst wenn Resi unter der Haube war, konnte auch sie an Heirat denken. Diesen Gedanken hatte sie freilich jetzt gerade vollkommen verdrängt. Die beiden jungen Frauen waren, wenn auch so unterschiedlich in ihrem Wesen, nahezu unzertrennlich. Betty hatte sich nun doch endlich entschieden; es sollte heute das silbergraue Kleid mit den ausgestellten Ärmeln sein, dazu ihre weißen Schnallenschuhe und das schwarze seidige Mieder. Der große, schwarzsamtene Hut mit einer mächtigen Feder wirkte dann auch wirklich etwas kühn. „Etwas zu fein“, dachte sich Resi. „Schließlich war heute lediglich der samstägliche Markt.“ Sobald die Schwester aufbrach, würde Resi zu ihrer besten Freundin Esther gehen. Dort fühlte sie sich eigentlich am Wohlsten. Schon lange verband die beiden eine herzliche Freundschaft, auch wenn Esther nicht von Stand war. Ihr Vater missfiel diese Freundschaft zutiefst, doch unterbinden vermochte er diese Verbindung nicht. „Rufe doch bitte Bruni. Sie soll mir beim Ankleiden zur Hand gehen“, sagte Betty und fing schon wieder an, eine schmalzige Ballade zu trällern. Resi zog an der Klingelschnur für die Bediensteten am Kopfende des Himmelbettes. „Bedränge Andreas nicht, Betty. Es ist an ihm zu entscheiden, wann und wie ihr die Verlobung feiert. Natürlich nur, wenn Vater seinen Segen dazu gibt. Allerdings habe ich heute Morgen, als Dein Zukünftiger seinen Antrittsbesuch machte, kein ungutes Gefühl bei Vater festgestellt.“ „Du hast gelauscht, Resi?“ „Nein, bin nur zufällig mit dem Ohr am Schlüsselloch hängen geblieben“, entgegnete die Schwester, und beide umarmten sich nun freudestrahlend und von ganzem Herzen. Als die Folgemagd Bruni erschien, ging Resi in ihr eigenes, sehr viel schlichter eingerichtetes Zimmer. Sie verspürte keinerlei Neid. Natürlich mochte sie Andreas gern, schon wegen seines ruhigen Wesens und seiner höflichen und charmanten Art, aber mehr gab es da nicht. Sie freute sich auf die Stunden bei Esther. Es würden wieder sehr lustige und angenehme Stunden bei der Freundin werden.
Vincz hatte es gut getroffen. Seine Unterkunft war reinlich, mit dem Nötigsten ausgestattet, und sein Zimmer lag recht abseits. Neben einem kleinen Schrank stand ein Tischchen mit Krug und Wasserschale an der einen Wand, an der anderen befand sich ein überraschend bequemes Bett, weich und nach frischem Stroh und Lavendel riechend sowie ein robuster Armstuhl im Zimmer. In der Ecke stand ein dreibeiniges Kohlebecken. Zu dieser Jahreszeit würde Vincz es noch gut brauchen können. Wenn der Fremde aus der Tür trat, konnte er von oben den gesamten Hof überblicken. Die Schobers besaßen nämlich mitten in der Stadt einen geräumigen, großen Hof mit Vorder- und Seitenhaus. Beide waren durch eine umlaufende Galerie im zweiten Stock miteinander verbunden. Auf der gegenüberliegenden Hofseite vom Seitenhaus befand sich der Mietstall. Schober war Hufschmied und hatte außerdem drei Zimmer für Reisende, die in Stendal eine Bleibe suchten. Da war der Mietstall gleich vor Ort von Vorteil. Die Hinterseite des Hofes wurde von einem Flüsschen begrenzt. Die Uchte führte schmutziges übelriechendes Wasser, da sie durch Färber und Gerber stark beansprucht wurde. Sie maß sicher nicht mehr als vier Fuß in der Breite. Für Schobers bedeutete das kein Problem, denn sie besaßen den Luxus eines eigenen Brunnens direkt im Hof. Frau Schober bewirtete die Gäste und war auch für die Zimmer zuständig. Waschen und nähen für die vornehmen Stände erledigte sie ebenfalls mit großer Sorgfalt.
Auf seiner Bettstatt hatte Vincz sieben Pergamentblätter ausgebreitet. Auf jedem Blatt hatte jemand mit großer Geschicklichkeit die Gesichter verschiedener Persönlichkeiten gezeichnet. Zu jedem der sieben Männer standen auf den Rückseiten entsprechende Daten und Details aus dem Leben der Leute. Vincz betrachtete die Blätter und entschied sich schließlich für einen Geistlichen, der hier abgebildet war. „Scheinheiliger Abt Martinus, Du wirst der Erste sein und Du wirst ganz sicher nicht zu Gott hochfahren, da sei Dir gewiss“, flüsterte der Fremde und nahm einen Schluck des vorzüglich schmeckenden Roten. Stendal war nicht nur seiner feinen Tuche wegen bekannt, sondern auch für seine schmackhaften Weine und Biere.
Schobers Tochter Esther machte sich in vielerlei Hinsicht nützlich. Sie war zwar nur gut fünf Fuß groß, aber kräftig und von umsichtiger, fleißiger Natur. Mal half sie dem Vater bei den Pferden im Stall, ging der Mutter bei der Wäsche und beim Nähen zur Hand, sorgte sich um den Haushalt; allgemein für einen ordentlichen Hof, versorgte die drei Gänse und vier Hühner und sammelte draußen vor der Stadt oft Klee, allerlei seltene Kräuter und Beeren. Zum Putzen ging Esther zweimal in der Woche zum ehemaligen alten Türmer Melchior, der sein kleines Häuschen allein nicht mehr sauberhalten konnte. Das brachte immerhin auch ein paar Pfennige in die Haushaltskasse. Ihre beste und einzige Freundin stammte aus einer der vornehmsten Familien der Stadt. Wie gern war sie doch mit Resi zusammen. Vater hatte für die beiden eine Holzbank mit Rückenlehne gewerkelt. Gleich am Flüsschen, etwas versteckt in einer Ecke, stand nun die Bank der beiden jungen Frauen. Entlang der Uchte hatte Esther vor Jahren schon duftende Blumen gepflanzt, um dem gar zu stinkenden Gewässer so gut es eben ging, entgegenzuwirken. Die beiden Freundinnen konnten nicht unterschiedlicher sein. Resi war der Schwarm aller jungen Burschen von Stand. Sie besaß eine wohlgeformte, hübsche Figur, ein ebenmäßiges schönes Gesicht und flocht ihre langen blonden Haare meist zu hübschen Zöpfen, was ihrem charmanten Wesen durchaus schmeichelte und ihre ganze Erscheinung noch unterstrich. Esther selbst war etwas zu klein geraten, und sie ärgerte sich jeden Morgen aufs Neue beim Blick in den Spiegel über ihre leuchtend roten, wüst durcheinander wuchernden Haare. Sie war weder schön noch hässlich, aber manchmal wünschte sie sich, ein wenig Glanz ihrer Freundin für sich selbst. Einzig der Müllerssohn Heinrich Strietzel versuchte seit Monaten, Esther den Hof zu machen, doch mit diesem aufgeblasenen Menschen wollte sie nichts zu tun haben. Pünktlich zur dritten Stunde traf Resi auf dem Schober-Hof ein. Sie sah entzückend aus in ihrem hellgrünen langen Kleid, den rotgeschlitzten Pufffärmeln, dem fein gearbeiteten Unterkleid in blassem Gelb, ihrem samtenen schwarzen Übermantel, ebenso erlesen wirkten ihr feines Mieder und ihre raffiniert gearbeiteten Schnallenschuhe. Wie immer gutgelaunt, begrüßte sie erst Esthers Eltern und kam dann schnurstracks zur geliebten Bank am Flüsschen. Diesmal hatte sie eine dicke Rolle Stoff unter ihrem Arm dabei. Als sich die Freundinnen herzlich umarmt hatten, lüftete Resi das Geheimnis. Sie entrollte den Stoff, und er erwies sich als eine weiche, warme Decke, die sie sogleich auf der Bank ausbreitete. „Sag mal Resi, eine echte Schafsdecke, wie wunderbar, aber woher hast Du sie?“ „Du weißt doch, dass Papa mir nichts abschlagen kann. Ich machte den schönsten Schmollmund und erklärte ihm, wie kalt und feucht es jetzt schon draußen ist, wenn wir beide hier zusammen sind. Erst kam natürlich das übliche Geplänkel, doch bald wurde er beim Blick in die traurigen Augen seiner Tochter zusehends weich“, Resi musste nun selbst lachen, aber sie war nun mal Techlers Liebling, auch wenn er das niemals zugeben würde. Zunächst tauschten sich die beiden natürlich über den allerneuesten Stadtklatsch aus. Schon bald waren Esther und Resi in ihrem Element. Resi erzählte aus den kürzlich gelesenen spannenden Büchern, und Esther, die eine blühende Phantasie besaß, malte dazu entsprechende hübsche Skizzen, und darin war sie unübertroffen. Der Fremde lehnte derweil an der oberen Galerie gegenüber und schaute hinunter zur anderen Hofseite. Ein Torflügel der Schmiede stand offen. Kräftige Schläge auf Metall. Schober selbst war nicht zu sehen, doch Vincz stellte sich seinen Gastgeber mit bloßem Oberkörper vor, muskelbepackt, kräftig. Er war sich noch nicht im Klaren darüber, wieviel Schober über ihn und seinen Auftrag wusste. Wie gut kannte er Lambert wirklich, dass dieser so absolutes Vertrauen zu dem Schmied hatte? War er damals, als diese Schandtat geschah, mehr als nur ein einfacher Schmied gewesen? Vincz bemerkte erst jetzt die beiden jungen Frauen, die so einträchtig und vertraut dicht bei dem Flüsschen auf einer Bank saßen. Die Blonde war von vornehmer Herkunft; ganz ohne Zweifel. Was hatte sie ausgerechnet mit der hiesigen Tochter zu schaffen? Der Fremde stieg langsam die Treppe hinunter. Unter seinen schweren Schritten ächzten die Holzstufen. Er trug trotz des kühlen Tages, immerhin war es bereits der vorletzte Tag im Oktober, keine Weste oder Jacke, lediglich ein weißes Leinenhemd, und dessen Schnürung hatte er sogar geöffnet, denn Vincz neigte sehr leicht zum Schwitzen. Je näher er nun den beiden Freundinnen kam, umso mehr erschrak er innerlich. Diese Blonde dort, sie war ein Ebenbild von Maria. Das Gesicht, ihre Gestik, die Mimik, die Figur. Nur die Haarfarbe störte das Ganze. Maria war schwarzhaarig, lange schwarze Haare umspielten ihr wunderschönes Gesicht. Damals, als Vincz Maria in Sevilla zum ersten Mal begegnete, da war sie etwa so alt wie dieses Mädchen da drüben. Resi bemerkte den fremden Mann zuerst. Sie stupste Esther leicht an, und ihre Augen zeigten der Freundin, wer da auf sie zukam. „Das ist der Fremde aus dem Spanischen“, flüsterte Esther Resi schnell ins Ohr. „Gestern ist er gekommen.“
Resi verkrampfte, ihr Körper zog sich irgendwie zusammen. Am liebsten wäre sie ganz schnell mit Esther weggelaufen. Der Anblick dieses Mannes ließ sie erschauern. Männer lösten bei ihr im Allgemeinen überhaupt keine Reaktion aus, aber einen wie diesen hatte sie noch nie gesehen. Den Mund halb offen, starrte sie ihm entgegen, erfasste blitzschnell seine makellose, beeindruckende, starke Statur, seinen selbstsicheren Gang, den breiten Oberkörper, die schlanke Taille, dieses von den Narben gezeichnete, jedoch sehr gefühlvolle männliche Gesicht, dann die fast weißen langen Haare und die Augen. Diese Augen waren einfach unglaublich. Resis Herz klopfte wie wild, ihr Atem ging schwer. Sie hatte sich nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Die Freundinnen sprangen auf und knicksten. Der Fremde, barhäuptig, verbeugte sich gekonnt vor den Damen. „Gott zum Gruß, ich wollte sie keineswegs stören.“ „Das taten sie nicht, Dominus del Torre“, entgegnete Esther. „Darf ich Ihnen meine Freundin Teresa Techler vorstellen?“
„Dominus.“ Resi neigte den Kopf, über ihre Lippen brachte sie nichts weiter. Sie knickste abermals. „Oh mein Gott, wie benehme ich mich nur“, tadelte sie sich wirsch. Esther ergriff rasch die Gelegenheit zur Flucht. „Ich muss Mutter in der Küche helfen. Wir erwarten noch heute einen neuen Gast. Bitte entschuldigt“, und schon eilte sie zum Vorderhaus.
„Senorita Teresa, Sie erinnern mich an eine ehemalige gute Bekannte. Sie sind von hohem Geblüt. Darf ich fragen, welchen Stand Ihr Vater in Stendal innehat?“ Der Fremde hatte leise, mit angenehmer, akzentfreier Stimme gesprochen. „Mein Vater ist ein sehr angesehener Tuchhändler, besitzt mehrere Geschäftshäuser in Lübeck, Bremen und in Brügge. Er ist stellvertretender Bürgermeister und gehört somit zu den vornehmen Ratsherren der Stadt Stendal, Dominus del Torre“, kam es wie einstudiert und ohne den Mann beeindrucken zu wollen. Resis Zunge schien belegt. Sie konnte keine klaren Gedanken fassen. „Nennen Sie mich bitte einfach Gil. So ist mein Vorname, Senorita Teresa.“ „Ich weiß nicht, ob sich das schickt. Ich meine, wir kennen uns doch noch gar nicht“, stammelte Resi verlegen. „Ach was, schieben Sie mal die Etikette beiseite. Wie ich sehe, wollen Sie nach Hause aufbrechen. Ich würde mich freuen, Sie begleiten zu dürfen.“ Da war sie wieder.
Diese wunderbare, leise und sonore Stimme des Fremden. Da ihn das junge Mädchen zum ersten Mal kaum merklich anlächelte, nahm Vincz es als Einverständnis. „Lassen Sie mir ein paar Minuten, um mich einigermaßen schicklich anzukleiden, Senorita Teresa. Bin sogleich wieder zur Stelle.“ Resi stand wie angewurzelt, betrachtete sich von oben bis unten, ob auch sie einen schicklichen Eindruck machte, und wartete dann gehorsam auf den Fremden.
Als sie das Hoftor passiert hatten, deutete Resi nach rechts. „Lassen Sie uns durch die Schmiedestraße gehen. Das ist der kürzeste Weg.“ „Wie kommen Sie eigentlich ausgerechnet nach Stendal, Dominus Gil? Oh, bitte verzeihen Sie meine Neugier. Das geht mich natürlich nichts an.“ Resi wurde tatsächlich rot, und sie schämte sich dafür. „Ich bitte Sie, ich habe keine Geheimnisse“, entgegnete der fremde Mann freundlich. „Die Bedeutung der Stadt Stendal innerhalb der Mark bleibt nicht unbemerkt in Handelskreisen.“
„Ich versuche zu ergründen, ob es Möglichkeiten gibt, Handelsbeziehungen von hier weiter nach Westen auszudehnen. Glauben Sie mir, die Zukunft des wirklich bedeutenden Handels liegt schon bald im Handel mit der neuen Welt.“ „Sie meinen dieses Amerika, nicht wahr?“ Resi wurde hellhörig, denn auch über dieses so unendlich weit entfernte Land hatte sie gelesen. „Es ist aber so weit weg, ich meine, Portugal und Spanien sind von hier aus schon eine unglaublich weite Entfernung und dann per Schiff erst in diese neue Welt“, etwas skeptisch, grüblerisch reagierte Resi. „Der Handel liegt in Zukunft dort, glauben Sie mir, Senorita Teresa.“ Gil, der Fremde, klang so sicher. Konnte das wirklich die Zukunft sein?
Sie schritten langsam Seite an Seite offensichtlich durch die Hauptverkehrsader der Stadt. Der samstägliche Markt schien beendet zu sein, denn weiter vorn stauten sich Kutschen, Rollwagen, Gefährte aller Art. Die beiden näherten sich einer breiten Holzbrücke, welche über die auch hier offen dahinfließende Uchte führte. Jetzt erblickte Vincz das eigentliche Hindernis für die vielen Menschen mit ihren Karren, Wagen und Kutschen. Links am Straßenrand stand ein größeres Gebäude, der Stadt-Keller, wie Teresa es nannte. Rechts befand sich eine sehr große Kirche, vermutlich war das die Stadtkirche Sankt Marien, die Vincz erkennen konnte, wenn er vor seiner Unterkunft auf der Galerie stand. Quer über die Straße erhob sich zwischen Stadt-Keller und Sankt Marienkirche ein mächtiges, gotisches Bauwerk aus rotem Backstein, und dort drunter, durch zwei hohe Schwibbögen, quälte sich der ganze Verkehr. „Seltsam, nicht wahr?“ Resi war den aufmerksamen Blicken des Fremden gefolgt. „Das ist der Schöppenstuhl. Dort arbeitet Andreas. Er will meine Schwester Betty heiraten, wissen Sie, Gil?“ „Merkwürdig ist es allerdings, dieses Bauwerk so quer über die Straße zu stellen. Wie stehen Ihre Eltern zu diesen Absichten? Was ist die Aufgabe dieses Andreas?“ „Er ist jetzt Unteramtmann und außerdem noch Stadtschreiber.“ Nicht ohne Stolz hatte Resi das geäußert, denn sie freute sich einfach für Andreas und Betty. Ich muss mir auch solche vermeintlichen Kleinigkeiten gut einprägen, könnte durchaus von Nutzen werden. Im Kopf des Fremden versuchten sich erste Zusammenhänge zu bilden. Natürlich war ihm gleich am Anfang der Bekanntschaft mit Teresa der Name aufgefallen...Techler. Auch dieser Mann stand auf seiner Liste!
Sie gingen schweigend nebeneinander her. Resi war eingeschüchtert und fasziniert von diesem Gil aus dem Spanischen, und der Fremde selbst hing seinen eigenen Gedanken nach. Sein Auftrag würde bald beginnen. Endlich breitete sich die lange Schmiedestraße zu einer Art Trichter aus; ein dreieckiger Platz war erreicht. „Und nun?“ Vincz schaute Resi fragend an. „Jetzt ist es nicht mehr weit. Sehen Sie, Gil. Dort ist meine Straße, Auf dem Schadewachten genannt. Viele Stendaler mit Geld besitzen dort ihre Häuser. Oh, das klingt jetzt eingebildet, oder?“ Wieder wurde sie rot. „Warum sich für Geld schämen, Senorita Teresa? Andere wären froh, wenn sie ein wenig mehr davon besäßen.“ Der Fremde sah ihr nun direkt in ihre grünen Augen, und sie hätte im Boden versinken mögen, und doch tat sie das Gleiche, hielt seinem Blick stand und schaute in seine wunderbaren hellblauen Augen. „Was für wunderschöne Augen“, dachte sich die junge Frau. Und dabei stellte sie sich die Menschen aus den südlichen Ländern ganz anders vor, jedenfalls nach den gelesenen Büchern. Hatten sie nicht pechschwarze Haare und ganz dunkle Augen? „Ich kann in Ihren Gedanken lesen, Teresa.“ Der Fremde lächelte, und seine ebenmäßigen Zähne passten einfach zu diesem Gesicht. „Nein, ich bin nicht von Geburt aus Spanier. Mein Vater ist Holländer, und meine Mutter kommt aus dem Hessischen. Ich lebe allerdings schon seit Jahrzehnten dort unten in Spanien.“ Resi fühlte sich ertappt in ihren Überlegungen. Sie verlangsamte ihre Schritte. Bald würde sie schon zu Hause sein. Wie könnte sie es fertigbringen, Gil wiederzusehen?
Das Ziel war bald erreicht. Sie standen nun vor dem vornehmen Haus der Techlers. Anerkennend über das gepflegte, großzügige Gebäude äußerte sich der Fremde in seiner gewohnt leisen, sachlichen Art. „Bevor wir uns trennen, Senorita Teresa; ich würde sie gern morgen zum Flanieren abholen wollen. Meinen Sie, Stendal ist eine Stadtführung wert?“ Resi musste sich zügeln vor Freude. „Ja, natürlich und ja, gern und ja, morgen wäre schön, da ist sogar Jahrmarkt.“ Mehr brachte sie nicht hervor. Der Fremde zog seinen eleganten Hut und nahm Resis Hand. Er deutete einen galanten Handkuss an und verbeugte sich dann. „Sagen wir, etwa um die dritte Stunde warte ich vor Ihrem Haus.“ „Ich freue mich sehr, Dominus Gil.“ Resi knickste, so gut es ging, und zog an der Klingelschnur. Ein Diener öffnete kurz darauf, und das Ebenbild Marias war entschwunden.
Kurzes Zögern bei Vincz. Vollkommen kalt hatte ihn diese Begegnung selbstverständlich nicht gelassen, ganz im Gegenteil; diese junge Frau war so anmutig, schüchtern und so unschuldig, war sich ihrer Ausstrahlung überhaupt nicht bewusst. „Ein anständiges, hübsches Mädchen ist sie in jedem Falle, egal, ob sie nun Maria ähnlich sieht oder nicht.
„Jetzt aber zu Dir, Du widerliche scheinheilige Kröte. Wollen doch mal sehen, wie Du so lebst, Heiliger Abt Martinus.“ Der Fremde zog die Stadtskizze aus seinem Ärmelaufschlag und machte sich auf den Weg, dem Franziskanerkloster entgegen. Er musste sich jetzt ganz auf seine Arbeit konzentrieren.
So schön dieser 30. Oktober 1517 auch gewesen war, mit der hereinbrechenden Dunkelheit begann sich das Wetter grundlegend zu ändern. Der Wind drehte auf Nord und brachte einen kräftigen Temperaturrückgang mit sich.
Zu lange war dieser Herbst wohl sonnig und schön gewesen.
Andreas Mendel sah der Einladung von Bettys Vater mit äußerst gemischten Gefühlen entgegen. Im Stadt-Keller würde er zum ersten Male im Kreis der vornehmen, einflussreichen Herren dabei sein. Es war eine Art Feuertaufe für ihn, doch schließlich musste er in Zukunft des Öfteren mit diesen Herren zurechtkommen. Trotz seiner neuen Anstellung bei der Stadt fühlte er sich irgendwie nicht zugehörig zu diesem erlauchten Kreis. Noch aber hing er den schönen Stunden mit seiner liebsten Betty nach. Sie war vorhin wieder so gutgelaunt, lustig und ganz in ihrem Element gewesen. Der eher ruhige Andreas mochte sie aber gerade deswegen. Sie hatte ein unglaubliches Temperament. Mit ihr zusammen zu sein, das war einfach unbeschreiblich schön. Die zwei Stunden verflogen so schnell, aber Andreas hoffte, Betty morgen wiederzusehen.
Er stand jetzt vor der großen Spiegelscherbe, die an der Wand in seiner Schlafkammer befestigt war und musterte seinen Aufzug.
Als Mutter und kurz darauf auch Vater starben, musste Andreas das elterliche kleine Häuschen verkaufen, um die mit den Jahren angehäuften Schulden zu begleichen. Seitdem bewohnte der junge Mann zwei kleine Kammern unter dem Dach bei der Witwe Renke Siefken in der Rorstraße. Es machte ihm nichts aus, so bescheiden zu hausen. Jetzt aber hatte sich sein Leben verändert. Konnte er sich eine solche Bleibe noch leisten oder sollte er sich nicht besser etwas Angenehmeres, seinem neuen Stand entsprechendes suchen? Er wischte diese Gedanken erst einmal weg. Die Zeit wurde knapp.
Als die siebente Stunde vom Turm der Marienkirche geschlagen wurde, stieg der junge Mann tief Luft holend die sechs Treppenstufen zum Oberparterre des Stadt-Kellers empor. Nur dieser Keller, von manchen auch Ratskeller genannt, und die Weiße Taube unweit von hier besaßen eine ordnungsgemäße Schankgenehmigung - also eine Lizenz. Alle anderen Schenken in der Stadt arbeiteten praktisch illegal, besaßen keine offizielle Genehmigung, wurden solange von den Ratsherren geduldet, wie sie ihren monatlichen Obolus an die Stadt zahlten.
Andreas öffnete den rechten schweren Flügel der großen Eichentür und betrat mit Ehrfurcht dieses alte Gemäuer. Von links her hörte er bereits vergnügtes und lautes Beisammensein. Die Herren waren also schon alle da. Gerade als sich der junge Mann dorthin wenden wollte, begrüßte ihn eine bekannte Stimme aus der rechten hinteren Stube. „Hallo Andreas, komm rasch einen Moment zu mir“, rief der Schankwirt ihm entgegen. Die beiden kannten sich, denn vor einiger Zeit, bevor Andreas die Bekanntschaft mit Betty gemacht hatte, war er mit der Tochter von Schankwirt Lukas Kaden ein Paar. Nur ungern mochte Andreas daran erinnert werden, denn sie trennten sich damals im Streit. Mit Sicherheit war auch Agnes heute hier. Ihr Vater empfing Andreas dennoch sehr herzlich. Überhaupt war Kaden ein gutherziger, allgemein beliebter Mann in der Stadt. Er kam auf den jungen Mann zu und umarmte ihn herzlich. Wie immer trug Kaden seine Arbeitskleidung: abgetragene Stiefel, die ausgewaschene schwarze Barchenthose, darüber ein altes, oftmals geflicktes, langes weißes Hemd und eine überlange Leinenweste unbestimmter Farbe. Auf dem Kopf saß ebenfalls wie immer seine lederne, enganliegende Haube. „Ich habe gehört, Du bist jetzt einer von denen dort hinten. Du bist ganz einfach zu anständig, Andreas. Zu denen wirst Du niemals passen. Trotzdem gratuliere ich Dir zu Deinen neuen Aufgaben bei der Stadt. Bleib ehrlich, Junge.“ Sichtlich ergriffen sprach Kaden, und er meinte es auch ehrlich. Das wusste Andreas sofort. „Agnes bedient die feine Gesellschaft gerade. Sie sind fast alle da: der Oberamtmann, Advokatus Engelmann, von Tissen, von Clausenitz, Techler und von Werth. Dann viel Glück, Andreas.“ Kaden schlug dem jungen Mann aufmunternd auf die Schulter und schob ihn in Richtung Ratsweinstube.
Diese Gaststube war Andreas durchaus nicht fremd, hatte er doch einmal ein Schäferstündchen damals mit Agnes genau hier gehabt. Mit leichtem Unbehagen dachte er beim Eintreten an diese delikate Sache.
Der Stadt-Keller stand schon immer hier, jedenfalls wusste niemand zu sagen, wie alt dieses Gemäuer war. So bestanden die Wände aus grobem Feldstein, ordentlich verfugt, und diese Ratsweinstube war bei Tag jedenfalls lichtdurchflutet, denn auf beiden Längsseiten waren jeweils drei Sprossenfenster mit durchsichtigem Glas eingearbeitet. An der Stirnseite befand sich der riesige Kamin, in dem jetzt ein kräftiges Feuer loderte. Eingenommen von diesem repräsentativen Raum, stand auf der linken Seite eine imposante Tafel, ein massiver, schön gedrechselter Tisch, an dessen Längsseiten jeweils vier hochlehnige, grün bespannte Stühle und am Kopfende ein weiterer. Alle waren handwerklich vorzüglich gearbeitet. Rechterhand gab es noch drei kleinere Tische, die allerdings etwas weniger fein gearbeitet waren.
Herrmann Techler übernahm die Vorstellung des neuen Stadtschreibers und Unteramtmannes Andreas Mendel, und dann richtete er sich an Andreas selbst und stellte ihm die anwesenden Herren vor. Diese becherten wohl schon geraume Zeit, denn man sah es den meisten an ihren roten Gesichtern an. Nach der Ankunft des jungen Mendel kam ein durchaus angenehmes Gespräch zustande, doch mit der Zeit wendeten sich die einflussreichen Herren wichtigeren Dingen zu. Weibergeschichten, Tratsch und Politik wechselten nun in rascher Folge. Andreas saß am Ende der Tafel etwas abseits. Jetzt, da er nicht mehr von Interesse schien, begann er sich die hohen Herren genauer anzusehen. Schräg gegenüber von ihm saß der fette Advokatus Veith Engelmann.
Ein verkniffenes, feistes Gesicht, bauschige Augenbrauen, Knollennase und ein zynischer Mund fielen Andreas unangenehm auf. Seine lange violette Amtsrobe hing halb über die linke Schulter an dem Advokatus herunter. Sein Wams spannte, und man musste um die Knöpfe fürchten, dass sie nicht absprangen. Sein weißes Jabot war inzwischen rotweinfleckig. Neben dem Rechtsgelehrten lehnte sich Erdmann von Clausenitz entspannt zurück. Das war ein Mann ganz anderen Kalibers, groß, kraftvoll, verschlagen, sein Gesicht wirkte herb, herrschsüchtig, unsensibel. Sein graues Haar trug von Clausenitz streng zurückgekämmt. Er trug Uniform, wenn auch Andreas diese nicht einordnen konnte, denn eigentlich war der Mann doch Ratsherr und Unternehmer eines großen Fuhrgeschäftes. Jobst von Tissen machte auch keinen guten Eindruck auf Andreas. Tuchhändler wie Bettys Vater, reich, kompromisslos, arrogant und von seinem Erscheinungsbild eher ungepflegt, schien es dem jungen Stadtschreiber gut daran, diesem Herren vorsichtig gegenüber zu sein. Von Tissens Anblick erinnerte ein wenig an einen Affen. Gut, dass keiner die Gedanken lesen konnte. An der Stirnseite der Tafel thronte
Herrmann Techler ganz so wie Andreas ihn kannte, adrett, makellos gekleidet, sich seiner Stellung bewusst und gleichzeitg mit guten Manieren ausgestattet. Neben Herrmann Techler saß zu dessen Linken Oberamtmann Jonas Gretzko, also der Vorgesetzte von Andreas. Gretzko war ein echter Edelmann, etwa vierzig Jahre alt, gutaussehend und durchaus ein Frauenschwarm, knapp sechs Fuß groß, schlank, gepflegtes Haar ebenso sein Kinnbart, angenehm im Umgang, ein guter Zuhörer, aufmerksamer Beobachter mit präzise ausgewählter Wortwahl, ein Mann, dem Andreas vollends vertraute. Auch heute war der Oberamtmann wieder sehr modern gekleidet, die Farben seiner Kleidung fein abgestimmt in Blasslila und Grau. Er trug seinen Amtstalar und natürlich seine Amtskette. Andreas konnte ihn nicht wirklich beobachten, denn vor dem Oberamtmann saß noch Simon von Werth, der die Sicht auf Gretzko einschränkte. Aus diesem vornehmen Herrn von Werth wurde Andreas nicht ganz schlau. Natürlich kannte er die Gerüchte um diesen vornehmen, galanten Lebemann, der die Burg Ziethlow und ein riesiges Anwesen samt Wäldern und Äckern besaß. Zwar lebte sein alter Vater noch, war jedoch durch eine langjährige rätselhafte Krankheit schon lange ans Bett gefesselt. Dem Simon von Werth hingen unzählige Weibergeschichten an, seine Festlichkeiten waren opulent und ausschweifend. Etwa Mitte dreißig an Jahren, kleiner als der Oberamtmann, aber adrett, glatt zurückgekämmtes pechschwarzes Haar, feine Gesichtszüge, geistreich und von guten Manieren geprägt, stellte er schon etwas Besonderes dar. Nicht zuletzt war von Werth ein ausgezeichneter Mann im Zweikampf mit dem Degen. Es hieß, dass er schon ein Dutzend solcher Duelle siegreich gestaltet hatte.
Das waren also die Gäste des heutigen Beisammenseins. Auf dem Tisch waren erlesene Köstlichkeiten angerichtet worden, auch wenn inzwischen schon manche zwischen den Gaumen der Anwesenden verschwunden waren. Gekochtes und gebratenes Fleisch, Hecht in Sülze und Salat aller Art, Weichseln und Trauben, ein mit Brot gefüllter Kapaun, Forelle, Eier auf hölzernen Spießen, in Öl gebackene Brezeln, Weichselmus, Kuchen, Nüsse, Lebkuchen und Konfekt sah Andreas und schämte sich für diesen Überfluss, denn er war anderes gewohnt.
Als Wein hatte man den Hypokras ausgewählt, ein mit Ingwer, Honig und Zimt gewürzter Rotwein. Andreas Mendel wurde nur noch selten in Gespräche mit einbezogen, doch er hielt standhaft durch und verließ mit dem Oberamtmann gegen Mitternacht den Stadt-Keller. Agnes hatte ihn beim Einschenken immer wieder mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihn noch immer nicht abgeschrieben hatte. Für Andreas hingegen war dieses Kapitel abgeschlossen.
„Ihr werdet morgen zur elften Stunde in meinem Amtszimmer zugegen sein, werter Mendel, und nun wünsche ich Ihnen einen guten Schlaf trotz der vielen Kelche von dem süffigen Roten.“ Damit verabschiedete sich Jonas Gretzko von seinem Untergebenen und ging einigermaßen gerade in Richtung Marktplatz davon.
Abbildung 2 ‐ Stadt Keller
Sonntag, den 31. Oktober
Spät, sehr spät war Andreas nach Hause gekommen. Der Hypokras hatte Wirkung gezeigt bei ihm. Er torkelte die knarrende Holzstiege hinauf, zog nur noch seine Stiefel aus und fiel aufs Bett. So schlief er sehr unruhig und wurde des Öfteren wach, da sein Kopf schmerzte. Kurz nach der neunten Stunde klopfte die Vermieterin Frau Siefken an seine Kammertüre. Natürlich hatte sie mitbekommen, wie der junge Mann nach Hause gekommen war. Sie machte sich Sorgen und wollte nach dem Rechten sehen. Andreas hörte das Klopfen wohl, doch er konnte sich einfach nicht aufraffen. „Ist alles in Ordnung, Frau Siefken, danke vielmals“, brachte er gerade noch über die Lippen. Er wusste doch ganz genau, dass er keinen schweren Wein vertrug.
Pünktlich zur elften Stunde war er wie befohlen im Schöppenstuhl, klopfte zaghaft an der Amtsstube des Oberamtmannes an, trat ein und nahm die ersten Verfügungen, Unterlagen und Gerichtsschriften entgegen. Der Besuch war schnell beendet, denn Herr Gretzko hatte wohl auch Besseres an diesem Sonntag zu tun. Er erwähnte den gestrigen Abend mit keiner Silbe, und Andreas war ihm dankbar dafür.