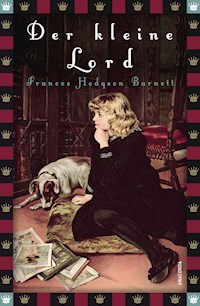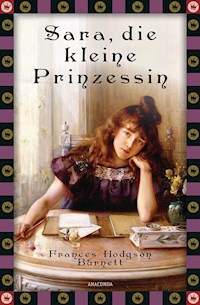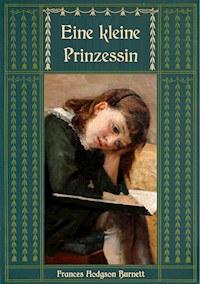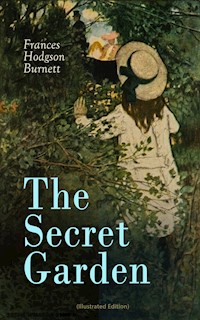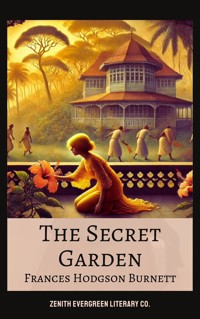Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die neunjährige Mary wird nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrem Onkel in dessen düsteres Gutshaus geschickt. Auf einem seiner Streifzüge entdeckt das unglückliche Mädchen den Zugang zu dem hinter hohen Mauern verborgenen Lieblingsgarten ihrer verstorbenen Tante und richtet sich dort ein. Denn im Haus gibt es niemanden, der sich um sie kümmern, der mit ihr spielen könnte. Oder doch? Nachts hört sie die Schreie eines kleinen Jungen, es ist ihr zehnjähriger Cousin Colin. Den kleinen Tyrannen hat man weggesperrt, er sitzt im Rollstuhl und scheint sehr krank zu sein.
Mary nimmt ihn mit in ihren Garten. Eine wunderbare Freundschaft beginnt.
Ein Kinderbuch-Klassiker in neuer Übersetzung. Ein spannender und anrührender Roman über die Wandlung zweier Kinder und über die wundersame Kraft der Natur.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burnett, Frances Hodgson
Der geheime Garten
Aus dem Englischen von Angelika Beck
Insel Verlag
Inhalt
1. Kapitel – Es ist niemand mehr da
2. Kapitel – Miss Mary, ein Querkopf ist sie
3. Kapitel – Übers Moor
4. Kapitel – Martha
5. Kapitel – Wer weint denn da?
6. Kapitel – »Und da hat doch jemand geweint!«
7. Kapitel – Der Schlüssel zum Garten
8. Kapitel – Das Rotkehlchen zeigt den Weg
9. Kapitel – Was für ein merkwürdiges Haus!
10. Kapitel – Dickon
11. Kapitel – Das Nest der Misteldrossel
12. Kapitel – »Könnte ich vielleicht ein Stückchen Erde haben?«
13. Kapitel – »Ich bin Colin«
14. Kapitel – Ein junger Radscha
15. Kapitel – Nestbau
16. Kapitel – »Ich muss überhaupt nichts!«, sagte Mary
17. Kapitel – Ein Wutanfall
18. Kapitel – »Du darfst keine Zeit verlieren«
19. Kapitel – »Er ist da!«
20. Kapitel – »Ich werde für immer und ewig leben!«
21. Kapitel – Ben Weatherstaff
22. Kapitel – Als die Sonne unterging
23. Kapitel – Magie
24. Kapitel – »Lassen wir sie ruhig lachen!«
25. Kapitel – Der Vorhang
26. Kapitel – »Das ist Mutter!«
27. Kapitel – Im Garten
1. Kapitel ES IST NIEMAND MEHR DA
Als Mary Lennox nach Misselthwaite Manor geschickt wurde, um fortan bei ihrem Onkel zu leben, behaupteten dort alle, noch nie ein so verdrossenes, hässliches Kind gesehen zu haben. Und das stimmte auch. Mary hatte ein spitzes Gesichtchen, einen mageren Körper und trug stets eine griesgrämige Miene zur Schau. Ihr strähniges Haar war so gelblich wie ihr Teint, weil sie in Indien geboren und ständig auf die eine oder andere Weise krank gewesen war. Ihr Vater hatte ein Amt in der englischen Regierung bekleidet und immer viel zu tun gehabt und ebenfalls dauernd gekränkelt, und ihre Mutter war eine gefeierte Schönheit gewesen, die sich nur um ihr eigenes Vergnügen gekümmert und die Gesellschaft fröhlicher Leute gesucht hatte. Ein kleines Mädchen hatte sie eigentlich überhaupt nicht haben wollen, und als Mary zur Welt kam, vertraute sie sie der Obhut einer Ayah an, der man zu verstehen gab, dass sie sich bei der Mem Sahib besonders beliebt mache, wenn sie das Kind so viel wie möglich von ihr fernhalte. Und so kam Mary, ob als kränkliches, quengeliges, hässliches Baby oder später als kränkliches, quengeliges Kleinkind, ihrer Mutter nur höchst selten unter die Augen. Die dunklen Gesichter ihrer Ayah und der anderen indischen Dienstboten waren das einzig Vertraute, an das sie sich später erinnern konnte. Sie gehorchten ihr stets und ließen ihr in allem ihren Willen, weil die Mem Sahib ärgerlich wurde, wenn das Geschrei des Kindes sie störte. Und deshalb war Mary bereits mit sechs Jahren ein so tyrannisches und eigensüchtiges Biest, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen konnte. Die junge englische Gouvernante, die ihr Lesen und Schreiben beibringen sollte, entwickelte eine derartige Abneigung gegen sie, dass sie nach drei Monaten ihre Stelle kündigte, und ihre Nachfolgerinnen gaben sogar nach noch kürzerer Zeit auf. Wenn sich also Mary nicht in den Kopf gesetzt hätte, wissen zu wollen, wie man Bücher liest, wäre sie Analphabetin geblieben.
An einem entsetzlich heißen Morgen erwachte die damals etwa Neunjährige mit sehr schlechter Laune und wurde noch missmutiger, als sie sah, dass die Dienerin, die an ihrem Bett stand, nicht ihre Ayah war.
»Was suchst du hier?«, sagte sie zu der fremden Frau. »Ich will dich hier nicht haben. Schick mir meine Ayah.«
Die Frau blickte verängstigt drein, stammelte aber nur, dass die Ayah nicht kommen könne, und als Mary fuchsteufelswild wurde und nach ihr schlug und trat, wirkte sie noch verängstigter und wiederholte, dass es der Ayah nicht möglich sei, zu Missie Sahib zu kommen.
An jenem Morgen lag etwas Geheimnisvolles in der Luft. Nichts ging seinen geregelten Gang, und etliche der einheimischen Dienstboten schienen zu fehlen, während diejenigen, die Mary sah, mit aschgrauen und entsetzten Gesichtern umherschlichen oder -rannten. Aber niemand gab ihr eine Auskunft, und ihre Ayah kam nicht. Stunde um Stunde verstrich, und sie blieb sich völlig selbst überlassen. Schließlich ging sie hinaus in den Garten und begann unter einem Baum in der Nähe der Veranda zu spielen. Sie tat so, als legte sie ein Blumenbeet an, indem sie große rote Hibiskusblüten in kleine Erdhaufen steckte. Dabei wurde sie immer zorniger und murmelte vor sich hin, was sie zu Saidie sagen und welche Schimpfwörter sie ihr an den Kopf werfen würde, wenn sie zurückkehrte.
»Schwein! Schwein! Tochter von Schweinen!«, sagte sie, denn Inder als Schweine zu bezeichnen ist die schlimmste Beleidigung überhaupt.
Während sie mit den Zähnen knirschte und die Schimpfwörter unentwegt vor sich hin murmelte, hörte sie, wie ihre Mutter mit jemandem auf die Veranda heraustrat. Sie war in Begleitung eines blonden jungen Mannes, und die beiden unterhielten sich mit merkwürdig klingender, sehr leiser Stimme. Mary kannte den blonden jungen Mann, der wie ein Jüngling aussah. Sie hatte erfahren, dass er ein noch junger Offizier und soeben aus England gekommen war. Mary starrte ihn an, aber vor allem starrte sie ihre Mutter an. Das tat sie immer, wenn sie eine Gelegenheit hatte, sie zu sehen, weil die Mem Sahib – Mary nannte sie selten anders – eine so hochgewachsene, schlanke hübsche Person war und so herrliche Kleider trug. Ihre Locken schimmerten wie Seide, und sie hatte große lachende Augen und ein zartes Näschen, das sie stets verächtlich zu rümpfen schien. Alle ihre Kleider waren aus hauchdünnen, fließenden Stoffen genäht und – in Marys Worten – »voller Spitze«. An jenem Morgen war der Spitzenbesatz noch auffälliger, aber aus ihren Augen sprühte kein Lachen mehr. Voller Angst und geradezu flehentlich blickten sie dem blonden jungenhaften Offizier ins Gesicht.
»Ist es wirklich so schlimm?«, hörte Mary sie sagen.
»Es ist entsetzlich«, antwortete der junge Mann mit zitternder Stimme. »Ganz schrecklich, Mrs. Lennox. Sie hätten schon vor zwei Wochen in die Berge fahren sollen.«
Mem Sahib rang die Hände.
»O ja, ich weiß!«, rief sie. »Ich bin nur wegen dieser albernen Abendgesellschaft hiergeblieben. Wie töricht von mir!«
Just in diesem Augenblick ertönte ein so lautes Wehklagen aus den Hütten der Dienstboten, dass sie den Arm des jungen Mannes umklammerte und Mary ein Schauer überlief. Das Wehklagen wurde immer heftiger.
»Was ist das? Was ist das?«, stieß Mrs. Lennox hervor.
»Irgendjemand ist gestorben«, antwortete der jungenhafte Offizier. »Sie haben mir nicht gesagt, dass sie unter Ihren Dienstboten ausgebrochen ist.«
»Das wusste ich doch nicht!«, jammerte Mem Sahib. »Kommen Sie mit! Kommen Sie mit!«, und sie drehte sich um und eilte ins Haus.
Danach ereigneten sich schreckliche Dinge, und Mary konnte sich nun die geheimnis-, ja unheilvolle Stimmung jenes Morgens erklären. Die Cholera in ihrer schlimmsten Form war ausgebrochen, und die Menschen starben wie die Fliegen. In der Nacht hatte es die Ayah erwischt, und ihr soeben eingetretener Tod war der Grund für das Wehklagen der Dienstboten. Noch ehe der nächste Tag anbrach, waren drei weitere Bedienstete tot und andere vor Entsetzen davongelaufen. Ringsumher herrschte Panik, und in allen Behausungen lagen Sterbende.
Während des Durcheinanders und der Verwirrung des zweiten Tages versteckte sich Mary im Kinderzimmer und wurde von allen vergessen. Niemand dachte an sie, niemand verlangte nach ihr, und es geschahen seltsame Dinge, von denen sie nichts mitbekam. Mary verbrachte die Stunden mit Weinen oder Schlafen. Sie wusste lediglich, dass viele Leute krank waren, und sie hörte allerlei geheimnisvolle und beängstigende Laute. Einmal schlich sie sich ins Esszimmer, das ihr wie ausgestorben vorkam, obwohl eine halb beendete Mahlzeit auf dem Tisch stand und Stühle und Teller so aussahen, als wären sie hastig zurückgestoßen worden, weil sich die Tafelnden aus irgendeinem Grund plötzlich erhoben hatten. Das Kind aß etwas Obst und einige Kekse, und da es Durst hatte, trank es ein Glas Wein, das noch fast voll war. Der Wein schmeckte süß, und Mary wusste nicht, wie stark er war. Schnell wurde sie davon sehr schläfrig, ging zurück in ihr Kinderzimmer und schloss sich wieder ein, verängstigt von dem Geheul aus den Hütten und vom Geräusch eiliger Schritte. Der Wein machte sie so müde, dass sie kaum mehr die Augen offen halten konnte, und so legte sie sich auf ihr Bett und nahm lange Zeit nichts mehr wahr.
Vieles ereignete sich während der Stunden, in denen sie so tief und fest schlief, dass sie weder vom Wehklagen noch von den Geräuschen im Haus gestört wurde, die durch das Hin- und Hertragen von allen möglichen Dingen verursacht wurden.
Als sie erwachte, starrte sie eine Weile auf die Wand. Im Haus herrschte Totenstille. Noch nie hatte sie es so still erlebt. Sie vernahm weder Stimmen noch Schritte und fragte sich, ob nun alle wieder von der Cholera genesen und das Durcheinander und der Trubel vorüber seien. Außerdem fragte sie sich, wer wohl nun, da ihre Ayah tot war, für sie sorgte. Gewiss würde es eine neue Ayah geben, von der sie ein paar neue Geschichten erzählt bekäme. Die alten hatten sie ziemlich gelangweilt. Den Tod ihrer Kinderfrau beweinte sie nicht. Denn sie war kein anhängliches Kind und noch nie jemandem besonders zugetan gewesen. Der Lärm und das Umhereilen und das Wehklagen über die Cholera hatten ihr Angst eingejagt. Und sie war wütend gewesen, weil sich offenbar niemand daran erinnerte, dass sie noch lebte. Alle waren so von Panik erfasst, dass ein kleines Mädchen, an dem niemandem etwas lag, leicht in Vergessenheit geriet. Wenn Leute die Cholera hatten, schienen sie nur an sich zu denken. Aber wenn alle wieder gesund waren, würde sich bestimmt jemand ihrer erinnern und nach ihr suchen.
Doch es kam niemand, und als sie so dalag und wartete, schien es im Haus immer ruhiger zu werden. Da hörte sie etwas auf der Fußmatte rascheln, und als sie nach unten blickte, sah sie eine kleine Schlange dahingleiten und sie mit ihren wie Edelsteine blitzenden Augen anfunkeln. Sie hatte keine Angst, weil es ein harmloses kleines Ding war, das ihr nichts zuleide tun würde, und die Schlange schien es eilig zu haben, aus dem Zimmer zu kommen. Und während sie es noch beobachtete, schlüpfte das Tierchen auch schon unter der Tür hindurch.
»Wie seltsam still es ist«, sagte sie. »Außer mir und der Schlange scheint niemand mehr hier zu sein.«
Im nächsten Moment hörte sie Schritte im Lager und dann auf der Veranda. Es waren die Schritte von Männern, und diese Männer traten ins Haus und unterhielten sich mit leiser Stimme. Niemand ging ihnen entgegen oder sprach mit ihnen, und so öffneten sie anscheinend alle Türen und schauten in die Zimmer.
»Welch ein Jammer!«, hörte sie eine Stimme sagen. »Diese bildhübsche Frau! Und vermutlich auch das Kind. Ich habe gehört, dass es ein Kind geben soll, obwohl niemand es gesehen hat.«
Mary stand mitten im Kinderzimmer, als ein paar Minuten später die Tür aufging. Sie sah aus wie ein hässliches, übellauniges kleines Ding und schmollte, weil sie allmählich Hunger bekam und sich schändlich vernachlässigt fühlte. Der erste Mann, der hereinkam, war ein stattlicher Offizier, den sie einmal mit ihrem Vater hatte reden sehen. Er wirkte müde und bekümmert, aber als er sie erblickte, machte er vor Schreck fast einen Satz rückwärts.
»Barney!«, rief er. »Da drinnen ist ein Kind! Mutterseelenallein! An einem Ort wie diesem! Gott sei uns gnädig, wer ist sie?«
»Ich bin Mary Lennox«, sagte das kleine Mädchen und richtete sich zu voller Größe auf. Sie hielt den Mann für ziemlich flegelhaft, weil er vom Haus ihres Vaters als einem »Ort wie diesem« sprach. »Ich bin eingeschlafen, als alle die Cholera hatten, und ich bin erst eben aufgewacht. Warum kommt denn niemand?«
»Es ist das Kind, das niemand je zu Gesicht bekommen hat!«, erklärte der Mann und wandte sich an seine Gefährten. »Man hat es tatsächlich vergessen!«
»Warum hat man mich vergessen?«, fragte Mary und stampfte mit dem Fuß auf. »Warum kommt denn niemand?«
Der junge Mann, der Barney hieß, schaute sie sehr traurig an. Mary hatte sogar den Eindruck, als blinzele er, um seine Tränen zu unterdrücken.
»Armes kleines Kind!«, sagte er. »Es ist niemand mehr da, der kommen könnte.«
Auf diese merkwürdige Weise erfuhr Mary, dass sie weder Vater noch Mutter mehr hatte, dass sie gestorben und in der Nacht weggeschafft worden waren und dass die wenigen noch lebenden indischen Dienstboten, so schnell sie nur konnten, das Haus verlassen hatten und keiner sich daran erinnerte, dass es eine Missie Sahib gab. Deshalb war alles so still im Haus. Ja, außer ihr und der kleinen raschelnden Schlange war wirklich niemand mehr da.
2. Kapitel MISS MARY, EIN QUERKOPF IST SIE
Mary hatte ihre Mutter gern aus der Ferne betrachtet und sie sehr hübsch gefunden, aber da sie sehr wenig von ihr wusste, konnte man schwerlich von ihr erwarten, sie zu lieben oder übermäßig zu vermissen, als sie nicht mehr da war. Eigentlich vermisste sie ihre Mutter überhaupt nicht, und weil sie sich ohnehin immer mit sich selbst beschäftigt hatte, kreisten ihre Gedanken auch jetzt nur um ihre eigene Person. Wenn sie schon ein wenig älter gewesen wäre, hätte es sie bestimmt sehr beunruhigt, so mutterseelenallein auf der Welt zurückgelassen worden zu sein, aber sie war ja noch ziemlich klein, und da sich stets jemand um sie gekümmert hatte, nahm sie an, dass dies immer so sein würde. Sie wollte nur wissen, ob sie zu netten Leuten kommen würde, die höflich zu ihr wären und ihr ihren Willen ließen, wie es ihre Ayah und die anderen indischen Dienstboten getan hatten.
Sie wusste, dass der Aufenthalt in dem Haus des englischen Geistlichen, zu dem sie zuerst gebracht worden war, nicht von Dauer sein würde. Dort wollte sie auch nicht bleiben. Der Pfarrer war arm und hatte fünf Kinder in etwa ihrem Alter, die schäbige Kleider trugen, sich andauernd stritten und einander die Spielsachen wegnahmen. Mary hasste das unordentliche Haus und war so unausstehlich zu ihnen, dass schon bald niemand mehr mit ihr spielen wollte. Bereits am zweiten Tag hatten sie ihr einen Spitznamen verpasst, der sie zur Weißglut brachte.
Basil hatte ihn sich ausgedacht. Er war ein kleiner Junge mit frechen blauen Augen und einer Stupsnase, und Mary hasste ihn. Sie spielte für sich allein unter einem Baum, genauso wie an jenem Tag, als die Cholera ausgebrochen war. Dort häufte sie Erdhügel auf und machte Wege für einen Garten. Basil lief herbei und schaute ihr zu. Die Sache begann ihn zu interessieren, und plötzlich kam ihm eine Idee.
»Warum schichtest du nicht Steine aufeinander und tust so, als sei es ein Steingarten?«, fragte er. »Dort in der Mitte«, und er beugte sich über sie, um auf die Stelle zu deuten.
»Geh weg!«, schrie Mary. »Ich will dich hier nicht haben. Hau ab!«
Einen Augenblick lang war ihm sein Zorn anzusehen, dann begann er sie zu hänseln wie seine Schwestern. Er tanzte um Mary herum, schnitt Grimassen, lachte und sang:
»Miss Mary, ein Querkopf ist sie,
Was macht ihr Garten?
Wo Silberglöckchen und Muschelschalen,
Und Ringelblumen warten.«
Das wiederholte er so lange, bis die anderen Kinder es hörten und in das Gelächter mit einstimmten. Und je wütender Mary wurde, desto öfter sangen sie »Miss Mary, ein Querkopf ist sie«. Und von da an hieß sie bei ihnen nur noch »Querkopf Mary«, und oft redeten sie sie sogar so an.
»Du wirst nach Hause geschickt«, sagte Basil zu ihr, »am Ende der Woche. Da sind wir vielleicht froh!«
»Und ich erst!«, erwiderte Mary. »Wo ist zu Hause?«
»Sie weiß nicht, wo zu Hause ist!«, feixte Basil mit der ganzen Häme eines Siebenjährigen. »In England natürlich. Unsere Großmutter lebt dort, und unsere Schwester Mabel ist letztes Jahr zu ihr geschickt worden. Du kommst aber nicht zu deiner Großmutter. Du hast nämlich gar keine. Du kommst zu deinem Onkel. Er heißt Mr.Archibald Craven.«
»Ich habe keine Ahnung, wer das ist«, schnauzte ihn Mary an.
»Dachte ich mir«, entgegnete Basil. »Du hast von nichts Ahnung. Wie alle Mädchen. Ich habe Vater und Mutter über ihn reden hören. Er wohnt in einem riesigen, einsamen alten Herrenhaus auf dem Land, und kein Mensch wagt sich in seine Nähe. Er ist so griesgrämig, dass er keinen zu sich kommen lässt, und es würde ohnehin keiner zu ihm kommen. Er hat einen Buckel und ist ganz entsetzlich.«
»Ich glaube dir kein Wort«, sagte Mary, drehte ihm den Rücken zu und steckte sich die Finger in die Ohren, weil sie nichts mehr hören wollte.
Aber hinterher dachte sie viel darüber nach, und als Mrs. Crawford ihr noch am selben Abend eröffnete, dass sie in wenigen Tagen zu ihrem Onkel, Mr.Archibald Craven, nach England reisen werde, trug sie eine so trotzige und teilnahmslose Miene zur Schau, dass sie nicht wussten, was sie von ihr halten sollten. Sie versuchten, nett zu ihr zu sein, aber sie wandte ihr Gesicht ab, als Mrs.Crawford ihr einen Kuss geben wollte, und stand wie versteinert da, als Mr.Crawford ihr die Schulter tätschelte.
»Sie ist ein so unansehnliches Kind«, sagte Mrs.Crawford hinterher. »Und ihre Mutter war eine solche Schönheit. Außerdem hatte sie eine sehr nette Art, und Mary ist so unsympathisch, wie ich es noch nie bei einem Kind erlebt habe. Die Kinder nennen sie ›Miss Mary, ein Querkopf ist sie‹, das ist zwar garstig von ihnen, aber man kann es ihnen auch nicht verargen.«
»Wenn sich diese Mutter mit ihrem hübschen Gesicht und ihrer netten Art öfter im Kinderzimmer hätte blicken lassen, hätte vielleicht auch auf Mary etwas davon abgefärbt. Es ist sehr traurig, wenn man heute, wo die arme schöne Frau nicht mehr unter uns weilt, bedenkt, dass viele Leute gar nichts von ihrem Kind wussten.«
»Ich glaube, sie hat es kaum je angesehen«, seufzte Mrs.Crawford. »Als die Kinderfrau tot war, hat sich kein Mensch mehr um das kleine Ding gekümmert. Denk nur, wie die Dienstboten auf und davon rannten und sie ganz allein in dem verlassenen Haus zurückließen! Oberst McGrew sagte, er wäre fast zu Tode erschrocken, als er die Tür öffnete und sie mutterseelenallein mitten im Zimmer stehen sah.«
Mary legte die weite Reise nach England unter der Obhut einer Offiziersgattin zurück, die ihre Kinder in ein Internat bringen wollte. Sie war mit ihrem kleinen Sohn und ihrem kleinen Mädchen vollauf beschäftigt und ziemlich erleichtert, als sie Mary der Frau übergeben konnte, die Mr.Archibald Craven nach London geschickt hatte, um sie abzuholen. Diese Frau hieß Mrs.Medlock, war die Haushälterin in Misselthwaite Manor und füllig mit tiefroten Wangen und scharfen schwarzen Augen. Sie trug ein auffallend violettes Kleid, einen schwarzen Seidenumhang mit Jetperlenfransen und eine schwarze Haube mit violetten Samtblumen, die nach oben standen und zitterten, wenn sie den Kopf bewegte. Mary konnte sie nicht ausstehen, aber da sie selten jemanden mochte, war daran nichts Besonderes. Im Übrigen schien umgekehrt auch Mrs.Medlock nicht viel von ihr zu halten.
»Du meine Güte! Was für ein unansehnliches kleines Ding!«, rief sie aus. »Und dabei haben wir gehört, dass ihre Mutter eine Schönheit war. Davon hat sie aber dem Kind nicht viel vermacht, nicht wahr, Madam?«
»Vielleicht wächst sie sich noch aus, wenn sie älter wird«, erwiderte die Offiziersfrau gutmütig. »Ihre Gesichtszüge sind nicht übel, wenn sie nur nicht so bleich wäre und etwas freundlicher gucken würde. Kinder verändern sich ja so sehr.«
»Da muss sich aber einiges verändern an ihr«, antwortete Mrs.Medlock. »Und wenn Sie mich fragen, ist Misselthwaite dazu nicht gerade der richtige Ort.«
Beide dachten, Mary höre nicht zu, weil sie ein Stück weg von ihnen am Fenster des Hotelzimmers stand, in dem sie Quartier bezogen hatten. Sie beobachtete zwar die vorbeifahrenden Busse und Taxen und die Passanten, verstand aber jedes Wort und wurde davon sehr neugierig auf ihren Onkel und das Anwesen, in dem er wohnte. Wie es dort wohl aussah? Und wie würde ihr Onkel sein? Was war überhaupt ein Buckliger? Sie hatte noch nie einen gesehen. Vielleicht gab es in Indien keine Buckligen.
Seit sie bei fremden Leuten lebte und keine Ayah mehr hatte, begann sie sich einsam zu fühlen, und es gingen ihr merkwürdige Gedanken durch den Kopf. So fragte sie sich inzwischen, warum sie nie zu jemandem zu gehören schien, selbst damals nicht, als ihre Eltern noch gelebt hatten. Andere Kinder schienen zu ihren Vätern und Müttern zu gehören, aber sie war anscheinend nie wirklich jemandes kleines Mädchen gewesen. Sie hatte ihre Dienstboten, ihre Mahlzeiten und ihre Kleidung gehabt, doch nie von irgendjemandem Beachtung erfahren. Sie wusste nicht, dass das an ihrer unsympathischen Art lag, aber andererseits wusste sie natürlich auch nicht, dass sie unsympathisch war, denn das waren in ihren Augen nur die anderen Leute.
Nie hatte sie jemanden so unsympathisch gefunden wie Mrs.Medlock mit ihrem gewöhnlichen, geröteten Gesicht und ihrer geschmacklosen Haube. Als sie sich am nächsten Tag auf ihre Reise nach Yorkshire begaben, lief Mary hocherhobenen Hauptes und so weit wie möglich von ihr entfernt durch den Bahnhof zum Eisenbahnabteil, damit niemand auf die Idee kam, sie gehöre zu Mrs.Medlock. Die Vorstellung, für deren Tochter gehalten zu werden, hätte sie furchtbar geärgert.
Aber Mrs.Medlock ließ sich durch Marys Verhalten nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen. Sie gehörte zu jenen Frauen, die »keine Dummheiten von Kindern vertrugen«. Zumindest hätte sie das gesagt, wenn sie gefragt worden wäre. Sie war äußerst widerwillig nach London gefahren, zumal ausgerechnet am selben Tag die Tochter ihrer Schwester Maria heiratete, aber sie hatte in Misselthwaite Manor eine bequeme, gutbezahlte Stellung als Haushälterin, und die konnte sie nur behalten, wenn sie umgehend tat, was Mr.Archibald Craven ihr auftrug. Daher wagte sie es nie, auch nur eine Frage zu stellen.
»Hauptmann Lennox und seine Frau sind an der Cholera gestorben«, hatte ihr Mr.Craven in seiner knappen, kühlen Art mitgeteilt. »Hauptmann Lennox war der Bruder meiner Frau, und ich bin der Vormund seiner Tochter. Das Kind soll hierhergebracht werden. Sie müssen es in London abholen.«
Und so packte sie ihr Köfferchen und machte sich auf die Reise.
Mary saß missmutig in ihrer Ecke des Zugabteils. Da sie nichts zu lesen oder anzuschauen hatte, faltete sie ihre in schwarzen Handschuhen steckenden mageren Händchen im Schoß zusammen. Ihr schwarzes Kleid ließ ihr Gesicht gelber denn je erscheinen, und unter ihrem Hut aus schwarzem Crêpe hingen Strähnen ihres blonden Haares hervor.
»Ein solcher verzogener Fratz ist mir mein Lebtag noch nicht begegnet«, dachte Mrs.Medlock bei sich. Sie hatte noch nie ein Kind gesehen, das so reglos und untätig dasaß; und schließlich wurde sie es leid, das Mädchen zu beobachten, und fing mit energischer, barscher Stimme ein Gespräch an.
»Ich sollte dir vielleicht schildern, wie es dort ist, wo du nun hinkommst«, sagte sie. »Weißt du etwas über deinen Onkel?«
»Nein«, antwortete Mary.
»Haben deine Eltern nie von ihm gesprochen?«
»Nein«, erwiderte Mary und runzelte die Stirn. Sie runzelte die Stirn, weil sie sich nicht erinnern konnte, dass ihre Eltern jemals über etwas Bestimmtes mit ihr gesprochen oder ihr gar irgendwelche Dinge erzählt hätten.
»Hm«, murmelte Mrs.Medlock und starrte in das eigenartige, teilnahmslos wirkende Gesichtchen. Sie schwieg eine Weile und begann dann von neuem:
»Ich denke, du solltest einiges erfahren – damit du vorbereitet bist. Du kommst in ein seltsames Haus.«
Mary sagte kein Wort, was Mrs.Medlock etwas aus der Fassung brachte. Doch nachdem sie tief Luft geholt hatte, fuhr sie fort.
»Es ist ein großes herrschaftliches Anwesen, irgendwie düster, und Mr.Craven ist auf seine Art stolz darauf – und auch die ist ziemlich düster. Das Haus ist sechshundert Jahre alt und liegt am Rande des Moors und hat an die hundert Zimmer, wenn auch die meisten abgeschlossen sind. Und es gibt Gemälde und prächtige alte Möbel und Sachen, die dort schon seit einer Ewigkeit herumstehen. Und rund ums Haus gibt es einen großen Park und Gärten und Bäume mit Ästen, die bei manchen bis auf den Boden herunterhängen.« Sie hielt inne und holte noch einmal tief Luft. »Aber sonst gibt es dort nichts«, schloss sie unvermittelt.
Unwillkürlich hatte Mary begonnen zuzuhören. Das alles schien so anders als Indien zu sein, und Neues hatte sie schon immer gereizt. Aber sie wollte nicht den Eindruck erwecken, als interessiere es sie. Das war eine ihrer bedauerlichen, unangenehmen Eigenarten. Und so saß sie weiter regungslos da.
»Nun«, sagte Mrs.Medlock. »Was hältst du davon?«
»Nichts«, antwortete sie. »Ich weiß nichts von solchen Häusern.«
Da musste Mrs.Medlock kurz auflachen.
»Also«, sagte sie, »du redest ja wie eine alte Frau daher. Kümmert es dich denn gar nicht?«
»Es ist doch völlig egal«, meinte Mary, »ob es mich kümmert oder nicht.«
»Da hast du allerdings recht«, entgegnete Mrs.Medlock. »Es ist egal. Keine Ahnung, warum du ausgerechnet in Misselthwaite Manor untergebracht werden sollst, außer vielleicht, weil es am einfachsten so ist. Er wird sich deinetwegen jedenfalls keine großen Gedanken machen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Er macht sich nie groß Gedanken über andere Leute.«
Sie hielt inne, als wäre ihr gerade noch rechtzeitig etwas eingefallen.
»Er hat einen verkrümmten Rücken«, sagte sie. »Und das ist ihm schlecht bekommen. Er war ein griesgrämiger junger Mann und wusste nichts anzufangen mit all seinem Geld und seinem riesigen Anwesen, bis er heiratete.«
Trotz ihrer Absicht, gleichgültig zu erscheinen, richtete Mary den Blick auf ihre Begleiterin. Denn dass Bucklige verheiratet sein können, hätte sie nie gedacht und war deshalb ein wenig überrascht, was Mrs.Medlock nicht entging, und da sie gern redete, fuhr sie noch angeregter fort. Immerhin war das eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben.
»Sie war ein liebes, hübsches Ding, und er hätte Berge für sie versetzt. Niemand hielt es für möglich, dass sie ihn heiraten würde, aber das tat sie, und die Leute behaupteten, sie habe ihn nur seines Geldes wegen geheiratet. Doch das stimmt nicht, ganz sicher nicht«, fügte sie mit Entschiedenheit hinzu. »Als sie starb –«
Mary fuhr unwillkürlich zusammen.
»Oh! Sie ist gestorben?«, entfuhr es ihr. Gerade war ihr ein französisches Märchen in den Sinn gekommen, das sie einmal gelesen hatte und das »Riquet à la Houppe« hieß. Es handelte von einem armseligen Buckligen und einer wunderschönen Prinzessin, und plötzlich empfand sie Mitleid mit Mr.Archibald Craven.
»Ja, sie ist gestorben«, antwortete Mrs.Medlock. »Und danach wurde er noch sonderbarer. Er interessiert sich für niemanden, will niemanden sehen. Die meiste Zeit verbringt er auf Reisen, und wenn er in Misselthwaite ist, schließt er sich im Westflügel ein und lässt keinen Menschen zu sich außer Pitcher. Das ist ein alter Kerl, aber er hat sich schon um ihn gekümmert, als Mr.Craven ein Kind war, und er kennt seine Eigenheiten.«
Das hörte sich wie die Geschichte aus einem Buch an, und Mary wurde davon nicht fröhlich. Ein Haus mit hundert Zimmern, die fast alle verschlossen und deren Türen verriegelt waren – ein Haus am Rande eines Moors – was immer das auch war –, all das klang ziemlich trostlos. Ein Mann mit einem Buckel, der sich ebenfalls einschloss! Mit zusammengepressten Lippen starrte sie aus dem Fenster, und es schien ganz natürlich, dass der Regen nun in grauen schrägen Linien niederging, gegen die Fensterscheiben prasselte und daran herunterlief. Wenn seine hübsche Frau noch am Leben gewesen und so wie ihre Mutter ständig in »spitzenbesetzten« Kleidern zu allen möglichen Bällen und Einladungen gegangen wäre, hätte sie vielleicht eine fröhlichere Stimmung verbreitet. Aber sie war ja nicht mehr da.
»Glaub ja nicht, dass du ihn zu Gesicht bekommst, denn das ist höchst unwahrscheinlich«, sagte Mrs.Medlock. »Und du darfst auch nicht erwarten, dass dort Leute sind, die sich mit dir unterhalten. Du wirst allein spielen und für dich selbst sorgen müssen. Man wird dir sagen, in welche Zimmer du gehen darfst und in welchen du nichts zu suchen hast. Gärten gibt es genug. Aber hüte dich davor, im Haus herumzuschnüffeln. Das hat Mr.Craven gar nicht gern.«
»Ich habe nicht die Absicht herumzuschnüffeln«, entgegnete Mary bissig; und ebenso plötzlich, wie sie mit Mr.Archibald Craven Mitleid bekommen hatte, hörte sie auf, ihn zu bedauern, und begann ihn für so unsympathisch zu halten, dass er all das zu verdienen schien, was ihm zugestoßen war.
Und sie wandte ihr Gesicht den triefenden Fensterscheiben des Zugabteils zu und blickte hinaus in den grauen Regen, der kein Ende nehmen wollte. Sie beobachtete ihn so lange und unverwandt, bis das Grau vor ihren Augen immer grauer und grauer wurde und sie einschlief.
3. Kapitel ÜBERS MOOR
Sie schlief lange, und als sie erwachte, hatte Mrs.Medlock in einem der Bahnhöfe, durch die sie kamen, einen Korb mit Proviant gekauft. Sie aßen etwas Huhn, kaltes Roastbeef mit Butterbrot und tranken heißen Tee. Es regnete offenbar noch stärker, und alle Leute auf den Bahnsteigen trugen feucht glänzende Regenmäntel. Der Schaffner entzündete die Gaslampen im Abteil, und Mrs.Medlock blühte bei Tee, Huhn und Roastbeef so richtig auf. Sie verspeiste eine ganze Menge, und danach fielen ihr die Augen zu. Mary starrte sie an und beobachtete dabei, wie ihre elegante Haube zur Seite kippte. Vom monotonen Plätschern des Regens gegen die Fensterscheiben eingelullt, schlief auch sie in ihrer Ecke bald wieder ein. Als sie von neuem erwachte, war es draußen schon ganz dunkel. Der Zug hatte an einem Bahnhof angehalten, und Mrs.Medlock rüttelte sie wach.
»Na, du hast ja vielleicht geschlafen!«, sagte sie. »Nun mach aber die Augen auf! Wir sind im Bahnhof von Thwaite und haben noch eine lange Fahrt vor uns.«
Mary stand auf und versuchte, die Augen offen zu halten, während Mrs.Medlock die Gepäckstücke zusammensuchte. Die Kleine machte keine Anstalten, ihr zu helfen, weil in Indien immer die Dienstboten alles getragen hatten, und von anderen Leuten bedient zu werden schien ihr durchaus in Ordnung zu sein.
Der Bahnhof war klein, und außer ihnen stieg offensichtlich niemand aus. Der Bahnhofsvorsteher redete mit Mrs.Medlock in seiner rauen, aber herzlichen Art, wobei er die Wörter merkwürdig dehnte, was, wie Mary später herausfand, der Dialekt von Yorkshire war.
»Sie sind also wieder zurück«, sagte er. »Und die Kleine haben Sie auch mitgebracht.«
»Jawohl, das ist sie«, antwortete Mrs.Medlock, die nun ebenfalls mit deutlichem Yorkshire-Akzent sprach und mit dem Kopf über ihre Schulter hinweg auf Mary deutete. »Wie geht’s Ihrer Frau?«
»Ganz gut. Der Wagen wartet draußen auf Sie.«
Eine Kutsche stand auf der Straße vor dem kleinen Bahnsteig. Mary sah, dass es ein schmucker Wagen war und ein schmucker Lakai ihr hineinhalf. Sein langer wasserdichter Mantel und die wasserdichte Kapuze, die seinen Hut bedeckte, glänzten und trieften vor Nässe wie alles ringsumher, einschließlich des Bahnhofsvorstehers.
Als der Lakai den Wagenschlag schloss, zum Kutscher auf den Bock kletterte und sie losfuhren, setzte sich Mary in einer bequem gepolsterten Ecke zurecht, wollte aber nicht wieder einschlafen. Sie schaute aus dem Fenster, um etwas von der Straße zu sehen, die zu dem seltsamen Anwesen führte, von dem Mrs.Medlock gesprochen hatte. Schüchtern war sie keineswegs und auch nicht gerade ängstlich, aber sie empfand eine tiefe Ungewissheit, was sie in einem Haus mit hundert Zimmern, die fast alle verschlossen waren, einem Haus am Rande eines Moores, erwarten würde.
»Was ist ein Moor?«, wandte sie sich plötzlich an Mrs.Medlock.
»Schau in ungefähr zehn Minuten aus dem Fenster, dann siehst du es«, antwortete die Frau. »Wir müssen fünf Meilen durchs Missel-Moor fahren, bevor wir beim Gutshaus sind. Du wirst zwar nicht viel sehen, weil es stockdunkel ist, aber ein wenig kannst du schon erkennen.«
Mary stellte keine weiteren Fragen mehr, sondern verharrte in ihrer dunklen Ecke und richtete den Blick aufs Wagenfenster. Die Lampen der Kutsche warfen ihre Lichtstrahlen ein Stück voraus, und sie erhaschte flüchtige Eindrücke von der Umgebung. Nachdem sie den Bahnhof verlassen hatten, waren sie durch ein winziges Dorf gefahren, und sie hatte weißgestrichene Hütten und die Lichter eines Wirtshauses gesehen. Dann waren sie an einer Kirche, einem Pfarrhaus und an einer Art kleinem Schaufenster vorbeigekommen, in dem Spielsachen und Süßigkeiten und seltsame Dinge zum Verkauf auslagen. Danach fuhren sie auf der Hauptstraße dahin, und links und rechts tauchten schemenhaft Hecken und Bäume auf. Anschließend ging es lange Zeit so weiter – zumindest kam es ihr so vor.
Endlich verlangsamten die Pferde ihre Gangart, so als stiege das Gelände an, und bald schien es keine Hecken und Bäume mehr zu geben. Eigentlich konnte sie überhaupt nichts mehr erkennen außer tiefer Finsternis auf beiden Seiten. Sie lehnte sich nach vorn und presste ihr Gesicht gegen die Fensterscheibe. Just in diesem Augenblick wurde die Kutsche heftig durchgerüttelt.
»Jetzt sind wir bestimmt im Moor«, sagte Mrs.Medlock.
Die Wagenlampen warfen ein gelbliches Licht auf eine holprig wirkende Straße, die sich durch Büsche und niedriges Gestrüpp zu bahnen und in der riesigen dunklen Weite rings um sie her zu enden schien. Wind kam auf und ließ ein eigenartig wildes Brausen vernehmen.
»Das – das ist aber nicht das Meer, oder?«, fragte Mary und blickte sich zu ihrer Begleiterin um.
»Natürlich nicht«, antwortete Mrs.Medlock. »Und hier gibt es auch keine Felder oder Berge, sondern nur meilenweit ödes Land, wo nichts wächst außer Heidekraut und Ginster und wo nur wilde Ponys und Schafe leben.«
»Wenn Wasser darauf wäre, käme es mir wie das Meer vor«, sagte Mary. »Gerade jetzt hört es sich wie das Meer an.«
»Das ist der Wind, der durch die Sträucher bläst«, erwiderte Mrs.Medlock. »Mir ist die Gegend zu wüst und trostlos, obwohl viele Leute sie mögen – besonders, wenn das Heidekraut blüht.«
Immer weiter fuhren sie durch die Dunkelheit. Zwar ließ der Regen nach, aber der Wind pfiff vorüber und erzeugte seltsame Geräusche. Die Straße führte auf- und abwärts, und mehrmals rumpelte die Kutsche über kleine Brücken, unter denen das Wasser rauschend dahinströmte. Mary hatte das Gefühl, als nähme die Fahrt nie ein Ende und als wäre das weite, öde Moor ein riesiger schwarzer Ozean, den sie auf einem Streifen festen Bodens durchquerte.
»Ich mag es nicht«, murmelte sie vor sich hin. »Ich mag es nicht.« Und sie presste ihre dünnen Lippen noch fester zusammen.
Als die Pferde eine leichte Anhöhe erklommen, erblickte sie zum ersten Mal ein Licht. Mrs.Medlock sah es im selben Moment und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.
»Ach, was bin ich froh, dieses Licht blinken zu sehen«, rief sie. »Es kommt aus dem Fenster des Pförtnerhauses. Jedenfalls bekommen wir jetzt bald eine gute Tasse Tee.«
Es dauerte jedoch noch eine Weile, denn als die Kutsche die Parktore passiert hatte, lag immer noch eine Allee von zwei Meilen vor ihnen, und da sich die Wipfel der Bäume fast berührten, entstand der Eindruck, als führe man durch ein langes, dunkles Gewölbe.
Danach gelangten sie auf eine freie Fläche und hielten vor einem langgestreckten, niedrigen Gebäude, das sich um einen gepflasterten Innenhof zu verzweigen schien. Zunächst meinte Mary, alle Fenster seien dunkel, doch als sie aus der Kutsche stieg, entdeckte sie in einem Zimmer in einer Ecke des Obergeschosses einen schwachen Lichtschein.
Die mächtige Tür bestand aus schweren, eigentümlich geformten Eichenholzpaneelen mit großen Eisennägeln und gewaltigen Eisenriegeln. Sie führte in eine riesige Eingangshalle, die so schwach erleuchtet war, dass die Porträts an den Wänden und die überall herumstehenden Ritterrüstungen in Mary keinerlei Verlangen erweckten, sie genauer zu betrachten. Wie sie da auf dem Steinfußboden stand, wirkte sie sehr klein und sonderbar in ihrem schwarzen Gewand, und genauso klein und verloren und sonderbar kam sie sich auch vor.
Neben dem Diener, der ihnen die Tür geöffnet hatte, stand ein gepflegt gekleideter, hagerer alter Mann.
»Sie sollen sie auf ihr Zimmer bringen«, sagte er mit heiserer Stimme. »Er will sie nicht sehen. Morgen früh fährt er nach London.«
»Sehr wohl, Mr.Pitcher«, entgegnete Mrs.Medlock. »Solange ich weiß, was man von mir erwartet, komme ich schon zurecht.«
»Was man von Ihnen erwartet, Mrs.Medlock«, sagte Mr. Pitcher, »ist, dass Sie dafür sorgen, dass er nicht gestört wird und nicht zu sehen bekommt, was er nicht sehen möchte.«
Und dann wurde Mary eine breite Treppe hinauf und durch einen langen Korridor zu einer schmalen Treppe und über diese durch einen zweiten Korridor und noch einen dritten geführt, bis sich eine Tür in der Wand öffnete und sie sich in einem Zimmer befand, in dem ein Kaminfeuer brannte und ein Abendessen auf dem Tisch stand.
Mrs.Medlock erklärte kurzerhand:
»Also, da wären wir! In dem Zimmer hier und dem nebenan wirst du wohnen – und in diesen beiden Zimmern hast du dich aufzuhalten. Vergiss das nicht!«
So also verlief Miss Marys Ankunft in Misselthwaite Manor, und noch nie zuvor in ihrem Leben hatte sie so mit dem Schicksal gehadert.
4. Kapitel MARTHA
Am Morgen schlug sie die Augen auf, als ein junges Dienstmädchen, das gekommen war, um Feuer zu machen, vor dem Kamin kniete und geräuschvoll die Asche herausfegte. Mary beobachtete es eine Weile und ließ dann den Blick umherschweifen. Noch nie hatte sie ein Zimmer wie dieses gesehen und fand es merkwürdig und düster. An den Wänden hingen Teppiche, die eine Waldszene darstellten. Phantasievoll gekleidete Menschen saßen unter den Bäumen, in der Ferne ragten schemenhaft die Ecktürme eines Schlosses empor, und im Vordergrund sah man Jäger mit Pferden und Hunden sowie feine Damen. Mary meinte sich mitten unter ihnen im Wald zu befinden. Durch ein bis zum Boden reichendes Fenster konnte sie eine langgestreckte Anhöhe erkennen, auf der keine Bäume zu wachsen schienen und die eher wie ein endloses, eintöniges, rötliches Meer aussah.
»Was ist das?«, sagte sie und deutete zum Fenster.
Martha, das junge Hausmädchen, das sich soeben erhoben hatte, folgte ihrem Blick und deutete ebenfalls zum Fenster.
»Das dort drüben?«, fragte sie.
»Ja.«
»Das ist das Moor«, erwiderte sie mit einem gutmütigen Grinsen. »Gefällt es dir?«
»Nein«, antwortete Mary. »Ich hasse es.«
»Weil du es noch nicht kennst«, sagte Martha und machte sich wieder an die Arbeit. »Jetzt kommt es dir nur riesig und kahl vor. Aber du wirst es mögen.«
»Magst du es denn?«, wollte Mary wissen.
»Und ob!«, antwortete Martha und fummelte fröhlich am Kaminrost herum. »Ich liebe es geradezu. Es ist überhaupt nicht kahl, sondern voller Pflanzen, die köstlich riechen. Im Frühjahr und im Sommer, wenn Ginster und Heidekraut blühen, ist es dort wunderschön. Es riecht nach Honig, die Luft ist so frisch und der Himmel so hoch, und die Bienen und Lerchen machen einen richtigen Lärm mit ihrem Summen und Singen. Also ich möchte um nichts auf der Welt woanders leben als hier am Moor.«
Mary hörte ihr verdutzt zu. Martha hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Dienstboten, an die sie in Indien gewöhnt gewesen war. In ihrer geradezu sklavischen Unterwürfigkeit erdreisteten sie sich nie, mit ihren Herren wie mit ihresgleichen zu sprechen. Die rechte Hand auf die Stirn gelegt verbeugten sie sich vor ihnen fast bis zum Boden und nannten sie »Beschützer der Armen« oder huldigten ihnen mit ähnlich schmeichelhaften Anreden. Indische Dienstboten bat man nicht, etwas zu tun, sondern man befahl es ihnen. In ihrer Gegenwart »bitte« und »danke« zu sagen, war nicht üblich, und wenn Mary die Wut packte, hatte sie ihre Ayah immer ins Gesicht geschlagen. Nun fragte sie sich, was wohl diese junge Frau tun würde, wenn sie ihr ins Gesicht schlüge. Dieses rundliche, rosige Geschöpf sah zwar recht gutmütig aus, trat aber mit einer solchen Bestimmtheit auf, dass Mary sich nicht sicher war, ob sie vielleicht zurückschlagen würde – wenn die Person, die ihr eine Ohrfeige verpasste, nur ein kleines Mädchen war.
»Du bist aber eine merkwürdige Dienerin«, sagte sie ziemlich hochmütig aus ihren Kissen heraus.
Die Wurzelbürste in der Hand, richtete sich Martha aus ihrer knienden Stellung auf und lachte, ohne offenbar im mindesten verstimmt zu sein.
»Oh ja, das weiß ich«, sagte sie. »Wenn es in Misselthwaite eine feine Herrin gäbe, wäre ich wohl nicht einmal ein einfaches Dienstmädchen geworden. Vielleicht hätte ich in der Küche Geschirr spülen, bestimmt jedoch nie ins Obergeschoss gehen dürfen. Ich bin viel zu ungebildet und spreche viel zu sehr Dialekt. Aber das hier ist ein komisches Haus, trotz all seiner Pracht. Es scheint hier weder Herr noch Herrin zu geben, außer Mr.Pitcher und Mrs.Medlock. Mr.Craven möchte nicht belästigt werden, wenn er hier ist, und er ist fast immer weg. Die Stellung hat mir Mrs.Medlock aus purer Freundlichkeit verschafft. Sie sagte mir, das wäre ihr nicht möglich gewesen, wenn Misselthwaite wie andere vornehme Häuser geführt würde.«
»Wirst du meine Dienerin sein?«, fragte Mary, immer noch in dem herrischen Ton, den sie aus Indien gewohnt war.
Martha begann wieder, den Kaminrost zu scheuern.
»Ich bin Mrs.Medlocks Dienerin«, entgegnete sie sehr bestimmt. »Und sie ist Mr.Cravens Dienerin – und ich soll hier oben die Dienstbotenarbeit verrichten und dich ein wenig bedienen. Aber du wirst ja wohl nicht viel bedient werden müssen.«
»Und wer soll mich dann anziehen?«, fragte Mary.
Martha setzte sich wieder auf und machte große Augen. Vor lauter Verblüffung verfiel sie in ihren breiten Yorkshire-Dialekt.
»Na, mach’s doch selbst!«, murmelte sie.
»Was meinst du damit? Ich verstehe dich nicht, wenn du so sprichst«, sagte Mary.
»Oh! Das habe ich ganz vergessen«, erwiderte Mary. »Mrs. Medlock hat mir eingeschärft, deutlich zu sprechen, damit du mich verstehst. Ich meinte, ob du dich nicht selbst anziehen kannst?«
»Nein«, antwortete Mary völlig entrüstet. »Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getan. Selbstverständlich hat mich meine Ayah immer angezogen.«
»Na, wenn das so ist«, sagte Martha, offenbar ohne zu merken, dass sie unverschämt war, »dann wird’s aber Zeit, dass du es lernst. Du bist ja alt genug, und es wird dir guttun, wenn du ein wenig für dich sorgst. Meine Mutter sagt immer, ihrer Meinung nach müssten die Kinder feiner Leute eigentlich allesamt regelrecht verblöden, so wie sie von ihren Kindermädchen gewaschen, angezogen und spazieren geführt werden, als wären sie kleine Hunde.«
»In Indien ist das anders«, konterte Mary verächtlich. Dies alles war für sie kaum zu ertragen.
Aber Martha ließ sich keineswegs unterkriegen.
»Klar ist es dort anders«, antwortete sie beinah mitfühlend. »Wahrscheinlich liegt das daran, dass es dort so viele Schwarze gibt anstatt ehrbarer Weißer. Als ich hörte, dass du aus Indien kommst, habe ich gedacht, auch du wärest schwarz.«
Wütend fuhr Mary in ihrem Bett hoch.
»Was?«, rief sie. »Was? Du hast gedacht, ich wäre eine Eingeborene? Du – du Tochter eines Schweins!«
Martha starrte sie mit hochrotem Kopf an.
»Warum beschimpfst du mich?«, sagte sie. »Du brauchst dich nicht so aufzuregen. Ich habe ja nichts gegen Schwarze. Nach dem, was man in den Traktaten über sie liest, sind sie sehr fromm. Da heißt es immer, dass ein Schwarzer ein ganz normaler Mensch und ein Bruder ist. Ich habe noch nie einen Schwarzen gesehen und mich richtig darauf gefreut, endlich eine Schwarze zu Gesicht zu bekommen. Als ich heute Morgen zum Feuermachen gekommen bin, habe ich mich zu deinem Bett geschlichen und die Decke vorsichtig zurückgezogen, um dich anzuschauen. Und da hast du gelegen«, fuhr sie enttäuscht fort, »keine Spur schwärzer als ich – wenn auch viel gelber.«
Mary versuchte nicht einmal, ihre Wut und Beschämung zu unterdrücken.
»Du hast gedacht, ich sei eine Eingeborene! Das hast du gewagt! Dabei weißt du doch überhaupt nichts über die Eingeborenen! Das sind keine Menschen, sondern Diener, die sich vor einem verbeugen müssen. Du hast ja keine Ahnung von Indien. Du hast überhaupt keine Ahnung!«
Sie war so wütend und fühlte sich gegenüber dem einfältigen Blick des Mädchens so hilflos und plötzlich irgendwie so allein und fern alles dessen, was sie verstand und wo sie verstanden wurde, dass sie das Gesicht in die Kissen vergrub und in heftiges Schluchzen ausbrach. Sie schluchzte so herzzerreißend, dass sie der gutmütigen Martha Angst einflößte und richtig leid tat. Sie ging zum Bett und beugte sich über die heulende Mary.
»Ach, heul doch nicht so«, bat sie. »Wirklich nicht. Ich wusste ja nicht, dass du dich so aufregst. Ich habe von nichts Ahnung – du hast ganz recht. Es tut mir leid, bitte, hör auf zu weinen.«
Ihr merkwürdiger Dialekt und ihre herzhafte Art hatten etwas Tröstliches, das auf Mary eine wohltuende Wirkung ausübte. Allmählich versiegten ihre Tränen, und sie wurde ruhig. Martha war die Erleichterung anzusehen.
»Es ist jetzt Zeit, dass du aufstehst«, sagte sie. »Mrs.Medlock hat mir aufgetragen, dir das Frühstück, den Tee und das Abendessen im Raum nebenan zu servieren. Den hat man für dich als Kinderzimmer eingerichtet. Sobald du aufstehst, helfe ich dir beim Anziehen. Wenn die Knöpfe auf dem Rücken sind, kannst du sie ja gar nicht allein zuknöpfen.«
Als sich Mary endlich entschloss aufzustehen, stellte sie fest, dass Martha ihr nicht die Kleidungsstücke hinlegte, die sie bei ihrer Ankunft angehabt hatte.
»Das sind nicht meine Kleider«, sagte sie. »Meine sind schwarz.«
Sie musterte den dicken weißen Wollmantel und das Kleid und fügte mit kühler Anerkennung hinzu:
»Sie sind aber schöner als meine.«
»Die musst du hier anziehen«, erwiderte Martha. »Mr.Craven hat Mrs.Medlock aufgetragen, sie in London zu besorgen. Er sagte: ›Ich möchte nicht, dass hier ein Kind in Schwarz herumläuft wie eine verlorene Seele. Das würde den Ort noch trauriger machen, als er schon ist. Ziehen Sie ihr was Farbiges an‹. Mutter sagt, sie weiß, was er damit meint. Mutter weiß immer, was die Leute meinen. Sie hat für Schwarz nicht viel übrig.«
»Ich hasse schwarzes Zeug«, sagte Mary.
Beim Ankleiden lernten beide etwas dazu. Martha hatte ihre kleinen Schwestern und Brüder »zugeknöpft«, aber noch nie ein Kind gesehen, das stocksteif dastand und darauf wartete, dass eine andere Person etwas für es tat, so als habe es keine eigenen Hände und Füße.
»Warum ziehst du dir nicht selbst die Schuhe an?«, fragte sie, als Mary ihr seelenruhig ihren Fuß hinhielt.
»Weil das immer meine Ayah getan hat«, antwortete Mary und machte große Augen. »Das war so üblich.«
Sie sagte sehr oft: »Das war so üblich.« Die indischen Dienstboten sagten das immer. Wenn man sie aufforderte, etwas zu tun, das ihre Vorfahren nicht schon seit tausend Jahren getan hatte, schauten sie einen sanft an und entgegneten: »Das ist nicht üblich«, und man wusste, dass damit der Fall erledigt war.
Es war nicht üblich gewesen, dass Miss Mary etwas anderes tat, als dazustehen und sich wie eine Puppe ankleiden zu lassen, doch ehe es ans Frühstücken ging, begann sie zu ahnen, dass sie in Misselthwaite Manor eine Reihe von Dingen würde lernen müssen, die ihr ganz neu waren – wie zum Beispiel ihre Strümpfe und Schuhe selbst anzuziehen und Sachen aufzuheben, die sie hatte fallen lassen. Wäre Martha die gut ausgebildete Zofe einer jungen Dame gewesen, hätte sie sich unterwürfiger und respektvoller verhalten und gewusst, dass es zu ihren Aufgaben gehörte, ihrer Herrin das Haar zu bürsten und die Stiefel zuzuknöpfen, Kleidungsstücke aufzuheben und zur Seite zu legen. Sie war jedoch nur ein einfaches Bauernmädchen aus Yorkshire, aufgewachsen in einem Häuschen im Moor mit einer Schar kleiner Brüder und Schwestern, die nicht im Traum daran gedacht hätten, bedient zu werden, und sich mit größter Selbstverständlichkeit um die Jüngeren kümmerten, die entweder noch Babys waren oder ihre ersten Gehversuche machten und andauernd hinfielen.
Wäre Mary Lennox ein umgängliches, aufgeschlossenes Kind gewesen, hätte sie vielleicht über Marthas Redseligkeit gelacht, aber sie hörte ihr nur unbewegt zu und wunderte sich über deren von keinerlei Respekt getrübte Unbefangenheit. Was das Hausmädchen da erzählte, interessierte sie zunächst überhaupt nicht, aber als es auf seine gutmütige, hausbackene Art immer so weiter quasselte, änderte sich das allmählich.