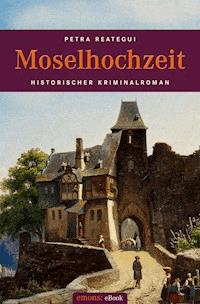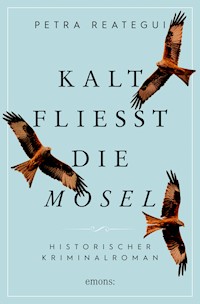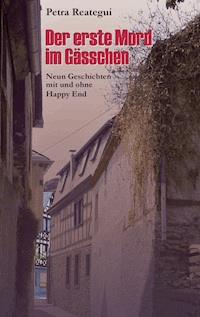Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köln 1737: Die junge Anna sieht sich schuldlos in ein Netz aus Diebstählen und Mord rund um das wertvolle Kölner Aqua mirabilis verstrickt und beginnt zu ermitteln. Von Pomeranzenhändlern, lombardischen Kaufleuten und Kölner Ratsherren: ein authentisches, hervorragend recherchiertes Bild der Kölner Gesellschaft zur Mitte des 18. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Reategui, geboren 1948 in Karlsruhe, war nach einem Dolmetscher- und Soziologiestudium viele Jahre lang Redakteurin bei der Deutschen Welle. Sie arbeitet heute als freie Journalistin und Autorin in Köln.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, einige sind es nicht. Der Anhang enthält ein Glossar.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Brian Barth eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck ISBN 978-3-86358-833-5 Historischer Kriminalroman Überarbeitete Neuausgabe Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Filzengraben«.
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für alle Spazzacamini und besonders für Faustino, der beim Schornsteinfegen ums Leben kam
Das Recht kann aus Übermut verletzt werden oder deshalb, weil der Einzelne sich von der Gesellschaft nicht verstanden fühlt.
Die Motivation des Einzelnen ist sehr unterschiedlich.
Manchmal geschieht es aus einer sehr tiefen Kränkung heraus oder aus Unverstand.
Manchmal ist es auch allein der Wunsch oder der Wille, die Gesetze zu übertreten.
Platz der Grundrechte Karlsruhe, Standort: Saumarkt, Durlach Künstler: Jochen Gerz
EINS
Ein Donnerschlag zerriss die ungewöhnliche Schwüle dieses letzten Freitagnachmittags im März des Jahres 1737. Erschrocken fuhr Anna herum. Das dunkelgrüne Fläschchen, das sie eben von einer kleinen Transportkiste in eine größere und sicherere umpacken wollte, entglitt ihren Fingern und zerschellte klirrend auf dem Steinfußboden. Zwischen den zerborstenen Glassplittern bildeten sich winzige Lachen einer wasserklaren Flüssigkeit, dünne Rinnsale versickerten in den Fugen der Fliesen.
Zuerst stand Anna vor Schreck wie gelähmt. Dann kniete sie nieder und sammelte vorsichtig die Scherben ein, die um den Schreibtischstuhl herum verstreut lagen. Sie schnupperte. Das würzige Odeur des ausgelaufenen Aqua mirabilis übertönte den kotigen Mief der Straße, der durch alle Ritzen von draußen ins Haus drang. Sie holte ein Tuch und wischte die Pfütze auf. Der fremde Geruch kitzelte ihr in der Nase. Nie zuvor hatte sie Gelegenheit gehabt, das kostbare Wunderwasser zu riechen. Sie schloss die Augen, sog tief den unbekannten Duft ein. Den sanften Duft von… Sie zögerte, atmete noch einmal.… von Orangen, überlegte sie. Und den scharfen der kleinen grünen Zitronen, die die welschen Bauchladenhändler an den Haustüren feilboten.
Da waren noch andere Aromen, zu denen sie keine Bilder fand. War diese schwere Süße, die sie fast mit der Zunge zu schmecken glaubte, Bergamotte, von der sie die Herren Dalmonte und Feminis oft hatte reden hören? Oder Neroli, das Öl, das manchmal in den Warenverzeichnissen aufgelistet war, die zwischen den beiden Geschäftsmännern hin- und hergingen? Neroli. Sie liebte den geheimnisvollen Klang des Wortes, in dem die ganze Welt des Südens verborgen lag. Die gleißende Weite des Mittelmeers, blau flirrende Luft über Zypressenhainen, tirilierende Lerchen, die hoch in den Himmel stiegen, schattige Alleen von Pomeranzenbäumen, durch die der Wind strich. So stellte sie sich die italienischen Lande vor.
Mit dem zweiten Donnerschlag setzte der Regen ein. Einer Sintflut gleich stürzten die Wassermassen herab, klatschten gegen die Scheiben und schwappten durch das angelehnte Fenster, das zum Filzengraben ging. Eine Windbö stieß die Flügel auf und schlug sie gegen die Wand.
Anna erhob sich, um das Fenster zu schließen. Frauen rannten mit gerafften Kleidern über die Gasse. Männer versuchten, in der vergeblichen Bemühung, nicht nass zu werden, ihre Röcke über den Kopf zu ziehen. Menschen drängten sich in Türnischen und unter Vordächer, wieder andere waren unter den Säulengang des Hauses »Zur gelben Lilie« schräg gegenüber geflüchtet. Sie erkannte die Magd des Pastors von Sankt Georg. Daneben, die Hände in den Taschen, ein hoch aufgeschossener Mann. Er spähte zu ihr herüber.
Rasch legte Anna den Fensterriegel vor. Durch das matte Glas lugte sie nach dem Unbekannten. Er hielt den Kopf schräg zwischen den hochgezogenen Schultern und bibberte am ganzen Körper, was ihn aber nicht davon abhielt, Dalmontes Haus mit unverhohlener Neugier in Augenschein zu nehmen. Mager war der Kerl und erbärmlich dünn angezogen, dachte Anna. Als sein Blick wieder das Fenster suchte, hinter dem sie stand, zog sie sich zurück. Obwohl der andere sie jetzt nicht mehr sehen konnte, fühlte sie sich beobachtet.
Sie hielt noch immer den Lappen und die Glassplitter in der Hand. Im Schrank fand sie einen flachen Zinnteller, auf den sie die Scherben abstreifte. Anna würde ihr Missgeschick Herrn Dalmonte sagen müssen. So konnte die Lieferung für Hartig in Maastricht nicht hinausgehen. Sie würden Feminis’ Tochter Johanna Catharina um Ersatz bitten müssen, falls sie selbst nicht mehr genügend Flaschen auf Lager hatten. Ihr war nicht wohl bei dem Gedanken. Nicht dass der Spediteur jemals unfreundlich zu ihr gewesen wäre. Im Gegenteil. Aber sie war wütend auf sich, dass sie die schmale Rosoli mit dem teuren Heilwasser hatte fallen lassen. Nur wegen eines dummen Gewitters. Eigentlich war sie sonst nicht schreckhaft.
Als sie noch mit ihren Eltern auf den Niederländerschiffen unterwegs war, hatte sie alles kennengelernt, vom Sturm zerfetzte Segel, geborstene Mastbäume, verrutschte Lasten, die drohten, das Schiff zum Kentern zu bringen. Donner, Blitze, Wetterleuchten. Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie jemals wirklich Angst gehabt hatte. Sie brauchte nur ihren Vater zu sehen, wie er, breitbeinig den Elementen trotzend, seine Männer befehligte, und sie wurde ganz ruhig. Ihr Vertrauen in ihn war grenzenlos, er würde sie alle heil und unversehrt zu ihrem Zielhafen bringen, nach Düsseldorf, Dordrecht, Rotterdam oder wohin auch immer. So dachte sie damals.
Heute war sie allerdings nicht mehr so sicher, ob ihr Vater wirklich jeden Sturm, jede heimtückische Stromschnelle meistern könnte. Sicher, er hatte die Rheinschifffahrt von klein auf gelernt, er war geschickt und besaß eine Menge Erfahrung. Aber auch Glück und Gottvertrauen gehörten dazu. Anna war jedes Mal erleichtert, wenn ihr Vater wieder heil und gesund in Köln anlegte.
Sie trat vor die Rheinkarte, die zwischen Kontobüchern und Aktenbündeln an der Schrankwand hing. Vor drei Tagen hatte sie den letzten Brief ihres Vaters erhalten und ihn wie immer zusammengefaltet in die Spalte zwischen Papier und Rahmen gesteckt. Er hatte aus Emmerich geschrieben. Die Fahrt verzögere sich um einen Tag, aber wenn sich das Wetter halte, kämen sie pünktlich in Dordrecht an. Mit den Augen verfolgte Anna den Flusslauf bis zu dem niederländischen Hafen. Wahrscheinlich lag der Vater schon längst dort vor Anker. Sie wünschte, sie könnte bei ihm sein wie früher.
Als Kind saß sie am liebsten mitten unter den Schiffsleuten und lauschte fasziniert den verschiedenen Sprachen, in denen die Männer fluchten, stritten, sangen und sich abenteuerliche Geschichten erzählten. Sie schnappte französische Brocken auf und italienische, Letzeburgisch und Alemannisch. Holländisch konnte sie ohnehin vom Vater, und mit der Mutter sprach sie deutsch, wie es die Leute um Bacharach herum redeten. Wenn sie sich dann breitbeinig wie ihr Vater vor den Schiffsknechten aufpflanzte und das Gehörte zum Besten gab, konnten diese sich vor Lachen kaum beruhigen und überboten sich darin, ihr Nüsse, Früchte und andere Leckereien zuzustecken. Anna genoss es, so verwöhnt zu werden. Nur die Mutter schimpfte und holte das kleine Mädchen vom Deck weg in die Küche. Dann saß sie schmollend beim Rübenschnippeln oder Erbsenpulen, zählte leise: »Un, deux, trois – quattro, cinque, sei– sieben und acht, sag gut’ Nacht– negen en tien, du bist hin« und schob sich bockig eine Handvoll der süßen grünen Dinger in den Mund.
Mit dreizehn brachte ihr Vater sie zur Familie nach Utrecht. Es schicke sich nicht, dass sie noch länger unter all den rauen Mannskerlen lebte. Also wurde sie in dem kleinen Städtchen zwischen Oudegracht und Nieuwegracht zur Schule geschickt, worüber sie nicht unglücklich war, lernte Lesen und Schreiben und von ihrem Onkel, einem Pfarrer, sogar ein paar Brocken Latein. Am meisten Gefallen aber fand sie zur Überraschung ihres Vaters an Mathematik. Und daher nahm er sie eines Tages mit nach Köln zu seinem alten Freund, dem Spediteur und Kommissionär Paul Dalmonte. Anna war gerade siebzehn Jahre alt. Wäre sie nicht die Tochter seines Schiffsmeisters gewesen, der Lombarde hätte es schlichtweg abgelehnt, eine junge Frau als Kontorgehilfin aufzunehmen. Andererseits wuchs ihm die Arbeit über den Kopf, und alle Versuche, einen guten Schreibergesellen zu bekommen, hatten sich bisher als Reinfall erwiesen. Ein ganzes Jahr später, in einer sehr schwachen Stunde, gestand er ihr, dass sie seine Vorstellungen von weiblichen Fähigkeiten gründlich durcheinandergebracht habe.
Anna wurde warm, als sie daran dachte.
Sie klaubte die letzten Splitter aus der Haut und wischte sich vorsichtig die Hände an einem Leintuch ab. Noch immer stak ihr der Duft des Aqua mirabilis in der Nase. Neroli! Bergamotte! Vielleicht auch ein wenig Lavendel? Nein, eher Rosmarin. Abwechselnd roch sie an der linken und an der rechten Handinnenfläche. Selbst unter den Fingernägeln haftete der zarte Geruch. Oh ja, es stimmte, was die Leute behaupteten! Das Wunderwasser befreite die verstopften Gänge des Gehirns. Sie fühlte sich plötzlich erfrischt und heiter. Schade um die schöne Flasche, schade um den kostbaren Inhalt, von dem nur noch ein dunkler Fleck auf den Steinfliesen übrig geblieben war.
Mit dem Teller in der Hand machte sie sich auf die Suche nach Herrn Dalmonte. Als sie am Fenster vorbeikam, sah sie, dass der Regen nachgelassen hatte. Es nieselte noch ein wenig, aber die Leute unter den Torbogen waren weitergegangen. Auch der lange Dürre war verschwunden.
Anna fand den Spediteur im Kontor auf der Galerie. Das Mädchen klopfte und blieb an der Tür stehen, bis er sie heranwinkte.
»Gut, dass du kommst. De Ridder will morgen früh um acht ablegen. Kümmere dich um die Fracht und die Zollpapiere. Und dass mir die Träger pünktlich sind! Wenn Melchior Pütz noch einmal betrunken hier auftaucht, hat er das letzte Mal für mich gearbeitet. Ich schwör’s bei der heiligen Madonna von Re.«
Wie zur Bestätigung krächzte der Papagei, der auf Dalmontes Schulter saß. Aufgebracht stieß er einen Schwall unverständlicher Töne aus. Ägyptisch sei das, hatte der Vogelhändler dem Spediteur versichert, als er ihm das Tier vor vielen Jahren aufschwatzte, ein Beweis für seine außerordentliche Klugheit! In weniger als zwei Monaten würde es seine, Dalmontes, Sprache sprechen. Der Lombarde hatte sich überreden lassen, weniger wegen der überragenden Intelligenz des Papageis als wegen dessen Augen, die ihn treu und ergeben anschauten. Und er wurde nicht enttäuscht– der Vogel liebte den alten Mann, kletterte, wenn dieser ihn aus dem Käfig holte, unermüdlich auf seinen Schultern herum, kroch ihm fast in den Kragen seines Hausrocks, knabberte zärtlich an seinem rechten Ohr und zog ihm die wenigen noch verbliebenen grauen Haare lang, die unter der Hauskappe hervorguckten. Nur Italienisch lernte er nie und Deutsch auch nicht.
»Ich muss fort. Zu Laurenz Bianco.«
Dalmonte zeigte auf einen Brief in seiner Hand. Für einen Augenblick sah es so aus, als ob er ihn Anna vorlesen wollte. Doch er besann sich, schubste den schimpfenden Papagei von seinem angestammten Platz und stand auf. Sein Gesicht war ernst, und Anna wusste, dass wieder etwas passiert war.
Vor ein paar Wochen fehlte ein Weinfass. Die Schröder hatten es in das kleine Lager im Keller getragen, wo Anna es ordnungsgemäß ins Warenbuch aufgenommen hatte. Aber am nächsten Tag war es spurlos verschwunden. Und mit ihm ein Glasballon Spiritus. Irgendjemand musste vergessen haben, die Türen abzuschließen. Wenig später suchten sie im Haus vergeblich nach zwei Kistchen mit mehreren Dutzend Flaschen Aqua mirabilis, die ein Amsterdamer Kunde bei dem Kölner Kaufmann und Parfumeur Johann Paul Feminis bestellt hatte, möglicherweise nicht wissend, dass dieser gerade vor Kurzem verstorben war. Allerdings verfügten die Witwe und seine Tochter Johanna Catharina, die das Geschäft im Haus Neuenburg in der Straße Unter golden Wagen, Ecke Minoritenstraße weiterführten, über Restbestände des gefragten Heilwassers. Eine Weile noch würden Kunden über Dalmonte weiter beliefert werden können.
Die Spedition im Filzengraben war nicht als einzige Opfer lichtscheuen Gesindels geworden. Auffällig oft hatte es in den letzten Wochen Einbrüche und Überfälle auf Lastenträger und Lieferwagen gegeben. Überall waren die Diebe aufgetaucht. Schnell und geschickt gingen sie vor. Ehe man sich umschaute, waren sie schon wieder weg. Niemand konnte sie beschreiben. Neben alkoholischen Getränken aller Art schienen die Lumpen es hauptsächlich auf Spezereien und ätherische Öle abgesehen zu haben, was die gesamte Kaufmannschaft als ausgesprochen befremdend empfand. Teure Stoffe, Gold- und Silberwaren, Gläser, Spiegel, das alles hätte Sinn gemacht. Aber ätherische Öle? Und dazu Südfrüchte, Weingeist, Lavendel- und Portugalwasser.
Anfänglich schien Dalmonte wegen dieser Ereignisse nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Im Speditions- und Kommissionshandel sei man vor derartigen Verlusten nie ganz gefeit, sagte er. Aber seit die Diebstähle überhandnahmen, häuften sich die Beschwerden. Der Lombarde hatte Entgegenkommen gezeigt. Er bot den betroffenen Kunden Entschädigung an und ging zum Tagesgeschäft über. Aber niemand, weder Dalmontes Frau Gertrude noch Anna und die Dienerschaft, nahmen ihm seine zur Schau gestellte Gelassenheit ab.
Der alte Herr griff nach seiner Perücke, die unordentlich über der Rückenlehne hing. Das teure Stück!, dachte Anna entsetzt. Herr Dalmonte musste wirklich mit seinen Gedanken ganz woanders sein. Gut, dass Frau Gertrude das nicht gesehen hatte.
Ein wenig umständlich setzte der Spediteur sich das Haarteil auf und rückte es vor dem Spiegel zurecht.
»Es kann länger dauern, esst bitte ohne mich«, sagte er und begutachtete sich prüfend.
Anna wartete, bis er das Kontor verlassen hatte. Sie überlegte, dann stellte sie den Teller mit den Glassplittern auf seinen Schreibtisch. Ein verführerischer Duft stieg von ihm auf. Sie zauderte. Ihre Hände zitterten, als sie die zwei größten Scherben in das Tuch wickelte, mit dem sie den Fußboden getrocknet hatte. Fast kam sie sich wie ein Dieb vor. Noch einmal roch sie die feine Blume, dann ließ sie das Päckchen in eine der Poschen unter ihren Röcken verschwinden. Sie rief den Papagei herbei, der, beleidigt, dass man ihn nicht gebührend beachtet hatte, auf dem Bücherschrank hin- und herstolzierte. Jetzt flog er bereitwillig in die große Voliere am Fenster zurück.
Anna sah Herrn Dalmonte auf die Straße treten– und da bemerkte sie ihn wieder, den klapperdünnen Fremden. Er beobachtete den Spediteur, wie der den Filzengraben überquerte und gegenüber in das Gässchen Auf Rheinberg einbog. Kaum war er außer Sicht, folgte er ihm. Anna schlug das Herz bis zum Hals.
ZWEI
Kalter Wind fuhr Giacomo ins Gesicht, als er die Rheingassenpforte passierte und den Thurnmarkt erreichte. Täuschte er sich oder folgten ihm die Blicke der Torwächter? Er sah sie miteinander tuscheln, einer lachte. Giacomo schoss das Blut in den Kopf, er zog seinen zerschlissenen Hut tief ins Gesicht und beschleunigte seine Schritte. Der Herr, der sehr viel rascher ging als er, war ihm weit voraus und bog kurz darauf in eine Seitenstraße, die weg vom Rhein führte. Giacomo verlor ihn aus den Augen.
Unschlüssig blieb er stehen. Er war sich sicher, dass dieser Mann im teuren Rock und mit den blitzenden Schnallenschuhen Paolo Luciano Dalmonte gewesen war. Er hatte auf seiner langen Wanderschaft durch das Rheinland oft von ihm reden gehört, von diesem Landsmann, den es wie ihn aus dem engen Vigezzotal in den Alpen nach Köln verschlagen hatte. Er betreibe einen gut gehenden Speditionshandel und sei nicht unvermögend. Aber er sei beileibe nicht der einzige Vigezzino in Köln. Da gebe es auch einen Farina aus dem heimatlichen Santa Maria, auch der ein Spediteur und Kommissionär, der darüber hinaus mit Französisch Kram handle. Und Giovanni Paolo Feminis aus Crana, Destillateur und Hersteller eines wundersamen Heilwassers, das sich gut verkaufe. Ein Mann, den der Pfarrer zu Hause stets in seine Gebete mit eingeschlossen hatte, damit er nie aufhören möge, Geld für die Kirche seines Geburtsorts, für die Armen und den Lehrer zu senden. Giacomo und seine Familie hatten allerdings nie etwas davon abbekommen. Ihm wurde übel.
Vor knapp einer Woche war er auf einem Oberländer in Köln eingetroffen. Zwei Tage lang waren sie damit beschäftigt gewesen, die Ladung Tuffsteine und Basalt zu löschen. Danach hatte der Schiffer nichts Besseres zu tun gehabt, als ihm mitzuteilen, dass er ihn für die Fahrt zurück nach Mainz nicht mehr benötige. Der andere Knecht grinste hämisch, als er seine wenigen Habseligkeiten zusammenschnürte und das Schiff verließ. Vom Ufer schaute er noch einmal zurück. Zwei kräftige Mannsleute, ihre Reisebündel über den Schultern, wurden gerade mit großem Hallo an Bord begrüßt. Sie waren ihm eben noch auf den schwankenden Holzstegen, die die festgemachten Schiffe mit dem Ufer verbanden, entgegengekommen. Giacomo biss sich auf die Lippen. So war es immer. Immer waren es zuerst die Fremden, die Welschen, die italienischen Wanderarbeiter, die geschasst wurden, wenn der Meister Leute loshaben oder jemandem gefällig sein wollte. Da stand er am letzten Montag und wusste nicht, wohin. Die Nacht verbrachte er im Schutz einer dunklen Kirchenmauer.
Sein erster Weg am nächsten Morgen ging zu ebenjenem Feminis in Unter golden Wagen. Aber er wurde enttäuscht. Der Mann sei vor vier Monaten gestorben, hatte ihm die Alte von gegenüber gesagt.
»Er war ja auch schon in den Siebzigern.«
»Und das Geschäft?«
Statt einer Antwort hatte sie nur mit der Schulter gezuckt und ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Nicht einmal nach Dalmonte oder Farina konnte er sie mehr fragen. Ohne zu wissen, wohin, ließ er sich durch die Straßen treiben, wich Karren aus, Sackträgern und Waschfrauen, zählte die Kirchen und Klöster hinter den hohen Mauern, bis es ihm zu viele wurden, und versuchte die Worte zu verstehen, die sich die Händler und Verkäuferinnen auf dem Markt zuwarfen. Vergeblich. Dabei hatte er sich immer eingebildet, dass er nach so vielen Jahren auf der Landstraße gut deutsch sprach.
Endlich hielt er auf dem Fischmarkt eine Rothaarige an.
»Dalmonte? Kenne ich nicht«, gab sie ihm schnippisch zur Antwort. Aber immerhin zeigte sie ihm den Weg zu Gerrit, in dessen Wirtshaus sich alle Ausstädtischen und Fremden träfen. Dort könne man ihm sicher weiterhelfen.
»Wenn du keinen Erfolg hast, komm zu mir.« Sie begleitete ihr Angebot mit einer eindeutigen Geste. Aber als Giacomo seine leeren Hosentaschen nach außen stülpte, spuckte sie vor ihm aus und ließ ihn stehen. Er ärgerte sich über sie, aber immerhin fand er Gerrits »Fliegenden Amsterdamer« und von dort Dalmontes Haus »Zum roten Schiff«.
»Etwas weiter oben, auf der anderen Seite des Mühlenbachs, vermietet eine Frau Schlafplätze«, hatte Gerrit ihm noch nachgerufen. »Vielleicht kannst du dort unterkommen.« Doch Giacomo zog es vor, in dem verborgenen Mauerwinkel zu bleiben, in dem er in der ersten Nacht Unterschlupf gefunden hatte.
In den folgenden Tagen strich er um das Haus des Spediteurs. Kaufleute gingen ein und aus, Knechte und Sackträger kamen mit Waren oder schleppten Kisten, Fässer, Stoffballen und Pakete jeglicher Größe hinunter zum Hafen. Einmal sah er durch die geöffnete Haustür eine eisenbeschlagene Truhe mit drei starken Vorhängeschlössern im Vorhaus stehen.
Wieder spürte er seinen Magen. Außer einem Kanten Brot und einem angefaulten Apfel hatte er seit vorgestern nichts mehr gegessen. Er machte kehrt und ging denselben Weg zurück, den er gekommen war. Als er das erste Mal Dalmontes Haus gesucht hatte, war ihm in einer kleinen Seitenstraße eine Kirche aufgefallen, vor der sich Bettler angestellt hatten. Vielleicht würde auch heute Abend Essen ausgeteilt werden.
Der Geruch von Kohl und Rüben in der schmalen Gasse beruhigte ihn. Er stellte sich zu den Wartenden, die mit Schüsseln und Löffeln gekommen waren. Ihre abschätzenden Blicke musterten ihn von oben bis unten, verharrten unangenehm lang auf seiner ausgebeulten Umhängetasche. Sie schämten sich nicht, ihm unverblümt ins Gesicht zu gaffen. Du bist nicht von hier, schienen sie zu sagen, und Giacomo wusste nicht, ob es ein Vorwurf war oder eine Einladung, sich dazuzugesellen. Er blieb.
Schon bald tauchten unter dem Kirchenportal zwei starke Mannskerle auf, die einen großen Suppentopf auf die Küchenbank hievten. Zwei Frauen, mit Schöpflöffeln bewaffnet, folgten ihnen. Die Leute verloren ihr Interesse an Giacomo und drängelten nach vorn, um ja genügend abzubekommen. Als er an der Reihe war, stand er unbeholfen vor den beiden barmherziglichen Matronen.
»Dä, nemm de Ming, ich kann waade.«
Verstanden hatte Giacomo den kleinen Mann nicht, der ihm gutmütig seinen Napf zugesteckt hatte. Aber er löffelte gierig die heiße Kohlsuppe und gab danach dem anderen sein Geschirr wieder zurück. Nachdem alle gesättigt waren, zupfte ihn der Mann, der ihm die Schüssel gegeben hatte, am Ärmel und zog ihn mit hinein in die Kirche. Giacomo ließ es sich gefallen. Zusammen mit den anderen Armen, die vor und hinter ihm in der Essensschlange gestanden hatten, kniete er nieder und leierte ein hastiges »Paternoster« herunter, ein »Avemaria par ul nést Signur« und erneut ein »Paternoster«, da die anderen noch immer ins Gebet vertieft waren. Er getraute sich nicht, aufzustehen und zu gehen. Er zog das Kettchen mit dem Amulett unterm Hemdkragen hervor. Eine Madonna mit dem Kind. Damals, als er mit dem Vater das Tal verließ, hatte es ihm die alte Nonna Zanotti um den Hals gelegt und ihn gesegnet.
»Cun la Madona di Re!«
Er erinnert sich. An die vier Zanotti-Jungfern, die vor der Caséla stehen und stumm glotzen. An Giovanna, die weint. An den flehenden Blick, den die Nonna der Mutter zuwirft. Doch diese geht schweigend ins Haus und zieht die Tür hinter sich zu. Die schwere Holztür, die tagsüber immer offen steht, um Licht und Luft in den Raum zu lassen und um sehen zu können, wer draußen vorübergeht. Er hört das scharrende Geräusch des Riegels, als sie die Tür schließt. Jetzt sitzt Mutter im Dunkeln.
Er läuft dem Vater hinterher, der schon ein Stück weit den holprigen, von Steinen übersäten Weg hinunter ins Tal gegangen ist. Giovanna begleitet sie mit ihrem verheulten Gesicht. Unten in Druogno streicht ihr der Vater übers Haar und schickt sie zurück zur Mutter hoch auf die Alm, nach Piodabella. Giovanna gehorcht. Sie umarmt Giacomo, der mit seinen acht Jahren schon fast so groß ist wie sie. »Komm zurück, wenn du ein Mann geworden bist. Bitte!«, flüstert die große Schwester ihm ins Ohr.
Er war kein Mann geworden, er war ein Bettler! Einer, der sich seine Suppe von der Armenbank holte und dafür für das Seelenheil der edlen Almosenstifter beten musste! Immerhin war er satt geworden. Giacomo küsste das Bild der Madonna von Re und schob es wieder zurück unter sein Hemd. Verstohlen stieß er seinen hilfsbereiten Nachbarn an und deutete mit dem Kinn zur Kirchentür.
»Frag nach mir, wenn du was brauchst. Ich bin Tilman«, nuschelte der andere, und wieder verstand Giacomo ihn nur mit Mühe. Dann rückte Tilman noch ein wenig näher an ihn heran und drückte ihm seine Suppenschüssel und den Löffel in die Hand. »Ich hab noch eine«, behauptete er und zog eine Grimasse. Oben in seinem Mund fehlten zwei Zähne.
Vor der Kirche wandte sich Giacomo nach rechts. Schon nach wenigen Schritten sah er wieder das dreigeschossige Haus mit dem von zwei Pfeilern getragenen Überhang, unter dem er noch eine Stunde zuvor Schutz vor dem Regen gesucht hatte. An der Ecke Filzengraben blieb er stehen. Die Sonne hatte sich durch die dunklen Wolken gekämpft, die scheuen Strahlen lockten ihn hinunter zum Rhein. Aber dann bog er doch in die entgegengesetzte Richtung und passierte das »Rote Schiff«. Das Eingangsportal war weit geöffnet. Giacomo ging langsam daran vorbei. Vor dem Nachbarhaus spielten Kinder Murmeln, zwei Frauen kamen ihm mit Wäschekörben entgegen.
»Dich han ich doch ald e paarmol he gesinn.«
Argwöhnisch setzte die Rundlichere der beiden ihre Last ab und pflanzte sich drohend vor ihm auf.
»Suchst du jemanden, oder warum lungerst du hier ständig rum?«
»Ich arbeite für Signor Dalmonte.«
Es klang nicht überzeugend. Er machte kehrt und hoffte, dass die Frauen ihm nicht folgten. Auf den Eingangsstufen zur Spedition blickte er sich nach ihnen um. Sie standen noch immer an derselben Stelle und beobachteten ihn. Da schlüpfte er leise durch die Tür.
Das fast quadratische Vorhaus war nicht hochherrschaftlich eingerichtet, aber das Mobiliar zeugte doch von Wohlstand. In der Mitte befand sich ein großer Tisch aus dunklem Holz, auf dem Geschäftsbücher und Dokumente lagen. Davor die eisenbeschlagene Truhe mit den drei Vorhängeschlössern. Ein einziger langer Bücherschrank verdeckte die ganze rechte Wand. Hinten links führte ein Gang in den rückwärtigen Teil des Hauses und, wie Giacomo vermutete, in den Hof. Rechter Hand konnte man über eine Wendeltreppe auf die Galerie im Zwischengeschoss gelangen. Am Fuß der Treppe wachte eine Heilige aus hellem Holz. Eine Madonna von Re.
Von irgendwoher wehten Stimmen an sein Ohr, aber er konnte nicht verstehen, was geredet wurde. Auf einem kleinen runden Tisch am Fenster lagen Schlüssel in einer Schale. Die Schlüssel zu der Truhe? Da hörte er Schritte, die näher kamen. Schneller als erwartet stand die junge Frau vor ihm.
Sie war groß, das glatte blonde Haar trug sie hochgesteckt, ein zierliches Häubchen bedeckte den Knoten. Seine Anwesenheit hatte sie erschreckt, aber sie schien sich schnell zu fangen. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, ging sie langsam zu dem Tisch in der Mitte des Raums und legte die Papiere ab, die sie in der Hand gehalten hatte. Am rechten Arm trug sie einen dünnen Silberreif. Ein ungewöhnliches Schmuckstück. Frauen trugen Bänder ums Handgelenk, mit Silberschnallen oder ohne, mit kleinen Gemmen, gar mit Perlen, aber keine Armreifen. Er hatte bisher nur eine einzige Frau gesehen, die auch einen Reif getragen hatte, einen goldenen. Aber das war vor langer Zeit.
Noch etwas war merkwürdig an der jungen Frau, er wusste nicht sofort, was es war. Dann fiel es ihm auf. Sie hatte blaue Augen, aber im linken leuchtete ein rotbrauner Fleck. Er konnte den Blick nicht davon lassen. Auch sie musterte ihn, ihre Augen tasteten sein Gesicht ab, seine Kleidung, bis hinunter zu den ausgetretenen Schuhen. Abschätzend kam es ihm vor. Er ärgerte sich über sie, wie er sich über die Rothaarige vom Fischmarkt geärgert hatte. Noch bevor sie ihn etwas fragen konnte, verlangte er, den Hausherrn zu sprechen.
»Dalmonte aus Craveggia«, fügte er rau hinzu. Sollte sie doch glauben, dass er mit dem Spediteur verwandt sei!
»Herr Dalmonte…«, das Mädchen betonte das Wörtchen »Herr«, »…Herr Dalmonte ist ausgegangen. Was willst du von ihm?«
Giacomo zog es vor, nicht zu antworten.
Er war erleichtert, als er wieder draußen auf der Straße stand. Er spürte ihre Blicke im Rücken. Eine Magd war sie nicht, dachte er. Vielleicht seine Tochter. Ihre Stimme klang in ihm nach. Angenehm dunkel und weich. Wenn auch nicht unbedingt freundlich.
DREI
Wie er es vorausgesagt hatte, war Paolo Luciano Dalmonte erst spät in der Nacht nach Hause gekommen. Lange hatte er nicht einschlafen können, sondern sich unruhig von einer Seite zur anderen gewälzt. Selbst die Honigmilch, die seine Frau für ihn heiß gemacht hatte, half nicht. Jetzt stand er früh auf, früher als gewöhnlich, und nach einem hastigen Morgenkaffee eilte er zu Filippo Matti in die Straßburgergasse, um sich rasieren zu lassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!