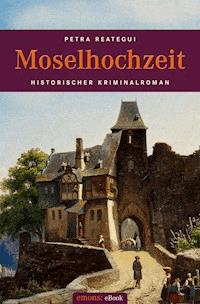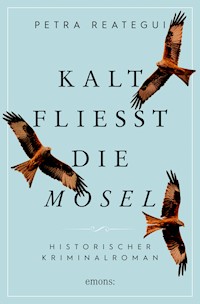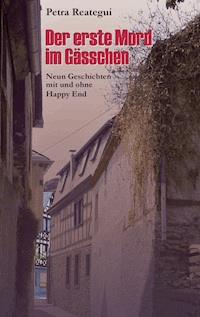Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Karlsruhe 1817. Oberbaudirektor Friedrich Weinbrenner ist auf der Höhe seines beruflichen Erfolgs: Unter seiner Leuitung entwickelt sich die junge barocke Residenz zu einer Hauptstadt des Klassizismus. Doch als ein Bäcker aus dem Dörfle, dessen Tochter bei Weinbrenner in Stellung ist, tot aufgefunden wird, muss der Baumeister um seinen Ruf fürchten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Reategui, geboren 1948 in Karlsruhe, war nach einem Dolmetscher- und Soziologiestudium Redakteurin bei der Deutschen Welle. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Köln. www.petra-reategui.de
Dieses Buch ist ein Roman, die Handlung ist frei erfunden, jedoch eingebettet in ein zeitgenössisches Umfeld. Einige Personen haben gelebt, Karlsruhe maßgeblich geprägt und bedeutende Spuren in der Stadt und darüber hinaus hinterlassen. Ihre Charaktere und Handlungsweisen entspringen jedoch der Phantasie der Erzählerin. Mehrere Vorkommnisse haben sich nachweislich so oder so ähnlich ereignet, wurden aber aus dramaturgischen Gründen zum Teil zeitlich enger zusammengefasst. Der Anhang enthält ein Glossar, Hinweise zu Orts- und Straßennamen, eine Personenübersicht, eine Auswahlliste erhaltener Weinbrennerbauten, Literatur- und Quellenangaben sowie Rezepte, die im Buch erwähnt sind und zum Nachkochen anregen.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Ausschnitt aus einem Stich des Karlsruher Marktplatzes/Stadtarchiv Karlsruhe/Signatur 8/PBS oXIIIb 169 Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Dr. Marion Heister eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-618-8 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Trudel, Hibi, Karin und Helge
DER ROTE BALL
Der Tag war eisig. In abgelegenen Winkeln und entlang der Häuser klebten schmutzige Schneehaufen. Über den Dächern des Markgräflich-Hochbergschen Palais am Rondell stand grau die Märzsonne und hüllte die Schloßstraße in fahles Licht. Auf den schwarzen Wassern des Landgrabens am Rande des Markts trieben Zweige und geborstene Latten, Reste eines Sacks, Papierfetzen, der aufgeblähte Körper einer toten Katze. Ein roter Stoffball wogte auf und ab, bevor er kreiselnd unter der steinernen Straßendecke verschwand, die den Kanal über die ganze Breite des Platzes überspannte.
Barbara Hemmerdinger, das dicke Wolltuch schützend um Kopf und Schultern geschlungen, war stehen geblieben. Wem hatte der Ball gehört? Wie lange würde er sich auf dem Wasser halten, bevor er sich vollsaugte und unterging? Sie klemmte die alte lederne Reisetasche mit dem abgerissenen Griff unter den Arm, rieb die steif gefrorenen Finger aneinander und ging dann hinüber zur anderen Seite. Dort, wo der Landgraben wieder zum Vorschein kam, zwischen Domainenkanzley und dem im Bau befindlichen neuen Rathaus, müsste auch der Ball wieder auftauchen.
Wenn er kommt, wird es Frühling. Richtiger Frühling.
Sie drückte fest beide Daumen und zählte.
Äste trudelten hervor. Ein Kantholz, das ein Stuhlbein gewesen sein mochte. Ein dickes Stück Kork, das Barbara an die kunstvoll geschnitzten Architekturmodelle erinnerte, die Oberbaudirektor Weinbrenner sammelte und im Bureau stehen hatte. Jede Menge Dreck und Unrat, nur kein roter Ball. Bei hundert gab sie enttäuscht auf.
Seit Monaten schon war das Wetter eine einzige Katastrophe. Nichts als Regen, Kälte und Gewitterstürme. Dazwischen, zur Abwechslung, Überschwemmungen, Hagelschauer und im letzten August ein Orkan, der in Karlsruhe Dächer abdeckte und Bäume entwurzelte. Viel zu früh hatte im vergangenen Jahr der Winter eingesetzt, und jetzt schien er nicht enden zu wollen. Niemand von den Alten konnte sich erinnern, jemals einen so verheerenden Temperatureinbruch erlebt zu haben. Kaum, dass Barbara das dünne Leinenkleid anziehen konnte, das ihr Friederike Weinbrenner geschenkt hatte. Nur einmal, im Spätherbst, als drei Tage lang die Sonne schien. Drei volle Tage! Um die Mittagszeit war es sogar heiß gewesen. Und danach alles wieder wie gehabt. Nass, trübe, kalt und überall im Land die Ernte abgesoffen. Die Kartoffeln waren im Boden verfault, Obst und Getreide hinüber, das neue Jahr 1817 begann für viele Menschen trostlos. Tausende von Kleinbauern und Tagearbeitern packten ihre Habseligkeiten und suchten ein Auskommen in der Fremde. Wer wollte schon gern hungers sterben.
Bei denen, die blieben, schlug das Wetter aufs Gemüt. Der Vater hatte aufgehört zu reden. Nicht erst seit Mutters Tod an Weihnachten. Vorher schon. Weil es kaum noch Mehl gab, und wenn er doch einmal welches finden konnte, war es so teuer, dass er nicht wusste, wie er den Händler bezahlen sollte. Es gab Tage, an denen der Vater nicht mal mehr den Ofen in der Backstube anfeuerte.
Der rote Ball blieb verschwunden, er musste in dem dunklen Tunnel hängen geblieben oder untergegangen sein. Ein ungutes Gefühl erfasste Barbara, etwas schnürte ihr die Kehle zu. Sie schüttelte den Kopf. Wie dumm sie war. Hatte sie tatsächlich gedacht, dass das Leben wieder besser würde, wenn nur der Ball ins Freie käme? So abergläubisch waren bloß Kinder und alte Weiber, alte Weiber wie Apolone.
»Du wirst sehen, auf uns kommen schwere Zeiten zu«, hatte Weinbrenners Haushälterin orakelt, als im Herbst 1812 schwarze Rosse die Kutsche mit dem Särglein des kleinen Erbgroßherzogs über die nächtliche Chaussee von Karlsruhe nach Pforzheim zur fürstlichen Familiengruft gezogen hatten. Schaurig, die flackernden Wachtfeuer in den Dörfern am Rande des Zugwegs, und die Menschen hatten geweint.
Es war aber auch eine Tragödie gewesen. Der erste Sohn des jungen Großherzogs Karl und seiner Gemahlin Stéphanie de Beauharnais, der heiß ersehnte Erbprinz, tot, kaum, dass er auf die Welt gekommen war. Keine drei Wochen hatte das Engele leben dürfen. Völlig unerwartet, von einem Tag auf den anderen, erlag es einem Stickfluss. Wochenlang war das traurige Ereignis Stadtgespräch. Kerngesund solle der Bub doch gewesen sein, hatten die einen gesagt, andere behaupteten das genaue Gegenteil. Apolone hingegen glaubte noch etwas ganz anderes und ließ sich davon nicht abbringen. Es gebe da jemanden am Hof, der, oder vielmehr, die nachgeholfen habe. Nie würde Apolone es wagen, so etwas Unerhörtes laut zu sagen.
»Aber ich weiß es genau, das ist eine Hex«, flüsterte sie, »du kennst sie auch, wohnt ganz in unserer Nähe«, und sie deutete vage in Richtung Rondellplatz, wo das Markgräflich-Hochbergsche Palais stand, und senkte ihre Stimme noch mehr. »Und es würde mich nicht überraschen, wenn auch der jetzige Erbprinz, das arme kleine Alexanderle, nicht alt werden wird. Da will jemand partout den Thron an sich reißen. Mehr sag ich nicht, aber du wirst sehen, auf uns kommen schwere Zeiten zu.«
Hatte Apolone recht? Sollte die zweite Frau des verstorbenen Großherzogs, die Hochbergin, beim Tod von Karls erstem Sohn ihre Hände mit im Spiel gehabt haben?
Ach was, beruhigte sich Barbara, wenn die Haushälterin zum zigsten Mal mit ihren Vermutungen anfing. Alles nur Altweibergewäsch. Aber dann war im Dezember 1812 der große Brand in Karlsruhe ausgebrochen. Als Nächstes forderten Napoleons Kriege unsägliche Opfer, und die Männer kamen, wenn überhaupt, verkrüppelt in die Heimat zurück. 1816 fingen die Wetterkapriolen an, und schließlich starb die Mutter. Waren das die schweren Zeiten, von denen Apolone redete?
Die Beklommenheit, die ihr Angst einflößte, ließ nicht nach, aber Barbara hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie band ihr Wolltuch fester und hastete mit der kaputten Reisetasche weiter über den Markt zur Langen Straße.
Nur wenige Passanten waren an diesem Mittwochmorgen unterwegs. Eine Gruppe Herren Buben, die Lernbücher an Gurten über dem Rücken, lungerte unter der Kolonnade der evangelischen Stadtkirche herum, sie zeigten sich gegenseitig ihre Hefte, schrieben geschwind noch Aufgaben voneinander ab und flitzten, als die Turmglocken zu schlagen anhoben, aufkreischend ins Lyceum nebenan. Barbara schaute ihnen belustigt nach, dann schweifte ihr Blick die mächtigen Säulen empor bis zum Fries, den Rosetten und Blumengirlanden schmückten. Für sie war dieses von Weinbrenner geschaffene Gotteshaus ein Wunder, ein Meisterwerk. Und für diesen Baumeister durfte sie arbeiten.
Sie hätte die sechs Säulen am Eingangsportal mit geschlossenen Augen beschreiben können. Helle, fast weiß getünchte, glattwandige Rundpfeiler auf breiten Sockeln. Darüber, als Abschluss, auf jedem ein fein gehauener steinerner Blätterbusch, etwas Schöneres, Erhabeneres gab es nicht. Sie sah die Risse vor sich, die überall in Direktor Weinbrenners Bauschule auf Tischen und Schemeln herumlagen und an den Wänden hingen. Immer wieder staunte sie, wie aus hingehuschten Skizzen und den mit dem Lineal akkurat gezeichneten Plänen Kirchen und Paläste, Theater und Wohngebäude entstanden. Wie Maurer und Zimmerleute daraus schlau wurden, sodass am Ende die bleifederschwarzen Rechtecke auf den Papieren zu veritablen Zimmern und Hallen emporwuchsen und Punkte oder Kreise zu Säulen. Ionische Säulen zum Beispiel oder korinthische, hörte sie manchmal die Schüler sagen, wenn sie abends ins Bureau zum Saubermachen kam. Sie hatte keine Ahnung, was korinthisch bedeutete, aber das Wort gefiel ihr.
Es erinnerte sie an Weihnachten, wenn in den Tagen vor dem Fest ihr Vater die Dambedeimännle und -fräuleins formte, die dann mit Rosinen, Korinthen und Mandeln bestückt wurden. Jeder in der Familie musste mithelfen. Zwei Korinthen als kohlschwarze Knopfaugen und eine halbe Mandel für den Mund. Selbst zum letzten Fest hatten die Leute, trotz des knappen und teuren Mehls, darum gebittelt und gebettelt, und der Vater hatte getan, was er konnte. »Aber dieses Jahr gibt’s nur Kinder«, hatte er entschieden, »ich kann die Dambedeis nur halb so groß machen wie sonst.«
Vaters Dambedeis waren berühmt. Im Dezember kamen die Leute aus ganz Karlsruhe, um bei ihnen in der Waldhorngasse die süßen Hefemänner zu kaufen. Das war schon früher so gewesen, zu der Zeit, als das schäbige Dörfle noch gar nicht zur neuen, aufstrebenden Residenzstadt gehörte, als in dem wild zusammengewürfelten Haufen von Hütten und Baracken nur die Handwerker hausten, die der Markgraf notgedrungen zum Bau seines Schlosses und der feinen Bürgerhäuser brauchte. Vom Hof vornehm Klein-Karlsruhe genannt, durfte und sollte dieser dreckige Wurmfortsatz jedoch nie Teil der neuen Stadtanlage sein. »Aber Frondienste verrichten!«, hatte der Vater einmal zur Mutter gesagt, »jahrelang Frondienste verrichten und Hintersassengeld blechen!« Da war Barbara noch klein gewesen und hatte nicht gewusst, was Frondienste und Hintersassen waren.
Das Leben in Klein-Karlsruhe war billig, billiger als in der Residenz, und weil die Ansiedlung nur einen Katzensprung vom Groß-Karlsruher Marktplatz entfernt lag, zog bald schon einfaches Volk aus dem ganzen Umland in das Geviert, auch niedrige Hofbedienstete und Soldaten der unteren Ränge. Die vornehmen Bürger hingegen, die Großkopferten, verirrten sich eher selten ins Dörfle. Die windschiefen Häuschen und staubigen Gassen beleidigten das Auge, und der stinkende Landgraben sei eine Zumutung, hatte einmal ein Gast im mit Kronleuchter bestückten und zolldicken Teppichen ausgelegten Weinbrenner’schen Salon abfällig erklärt und die Nase gerümpft. Und dieses Pack, das dort wohne! Steinbrecher, Tagelöhner, Wäscherinnen. Und jede Menge lediger Mütter. Eine Blamage für die schöne neue Stadt mit ihren schnurgeraden hellen Straßen und den artigen großherzoglichen Modellhäusern. Ob denn der Herr Oberbaudirektor als Leiter des staatlichen Bauamts da nicht endlich einmal durchgreifen könne?
Barbara störte sich nicht an so einem blasierten Geschwätz. Anders ihr älterer Bruder. Hätte Christian das gehört, es wäre mit Sicherheit zum Eklat gekommen. Viele im Dörfle hatten es satt, die Dünkelhaftigkeit Groß-Karlsruher Herrschaften als gottgegebene Ordnung hinzunehmen. Nur dass diese Leute nun mal mehr Geld besaßen, und wer das Geld hatte, hatte das Sagen. So war es doch. Aber zwischen Holzmarkt und Landgraben rumorte es.
Ungern trennte sie sich vom Bild der Stadtkirche und stieß fast mit der Magd von Weinbrenners Bruder zusammen, Zimmermeister Ludwig Weinbrenner, der ein paar Häuser weiter wohnte. Zu jeder anderen Zeit hätte sie sich über einen kleinen Schwatz mit Ida gefreut. Jetzt aber wechselten sie nur ein paar Worte, dann entschuldigte sich Barbara. Sie hatte viel zu erledigen.
Bei Dürr in der Kreuzgasse die Reiseuhr des Oberbaudirektors aus der Reparatur abholen. Apotheker Sommerschu bitten, bis Ende der Woche Medizin für Weinbrenners Fahrt nach Leipzig zusammenzustellen. Die Liste mit dem, was benötigt wurde, hatte sie bei sich. Dann zum Schuster und schließlich zum Gürtler am Durlacher Thor, ganz am Ende der Stadt. Bis übermorgen sollte er den neuen Tragegriff an die Tasche nähen. Dabei gab es bei Gott andere Lederwarenmacher, deren Werkstätten näher am Haus des Architekten in der Schloßstraße lagen, aber Götzle war der preiswerteste.
»Und zufrieden bin ich überdies mit ihm, warum soll ich also mein Geld zum Fenster rausschmeißen«, hatte Weinbrenner geknurrt, als sie ihm den Sattler in der sehr viel näheren Erbprinzenstraße vorgeschlagen hatte.
Manchmal kann er ganz schön knausrig sein, der Herr Oberbaudirektor. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, macht nach Adam Riese sechzig Minuten. Nur wegen ein paar Kreuzern! Als ob das bei seinem Verdienst einen Unterschied machte. Was hätte sie dagegen in dieser Zeit alles schaffen können!
Als Barbara später aus Götzles Werkstatt hinaus auf die Straße trat, fielen ihr die Leute auf, die sich jenseits des Durlacher Thors etliche Mètres entfernt an der Uferböschung des aus den Feldern kommenden Schaafgrabens drängelten, und von überall her kamen noch mehr Neugierige angerannt. Die Wachtmänner riefen sich knappe Befehle zu, ein Soldat löste sich aus der Truppe, sprang auf ein Pferd und sprengte in waghalsigem Galopp in die Lange Straße hinein, an Barbara vorbei, Richtung Markt.
Es war untersagt, innerhalb der Stadt zu galoppieren. Etwas Schlimmes musste passiert sein.
Der Ball, den der Landgraben geschluckt hatte!
Abermals schnürte es Barbara die Kehle zu. Das Kind, dem das Spielzeug gehört hatte, war beim Versuch, es herauszufischen, in den Graben gefallen.
Es widerstrebte ihr, doch irgendetwas zog sie zum Ort des Unfalls. Sie passierte die schmiedeeisernen Gitter und näherte sich der Menge. Vielleicht war aber auch nur ein Hund oder ein Pferd in den Kanal gestürzt. Aber wegen eines Hundes oder eines Pferds jagt keiner im wilden Ritt durch die Lange Straße, wegen eines Hundes oder eines Pferds kommt niemand, um zu gaffen.
Langsam drängte sie sich durch die dicht stehenden Schaulustigen. Warum klopfte ihr das Herz bis zum Hals? Vielleicht war das Kind ein kleines Mädchen.
Jetzt sah sie die Füße, dann die Beine, die reglos in einer Wasserlache lagen. Es waren nicht die Füße, nicht die Beine eines kleinen Mädchens. Auch nicht die eines kleinen Jungen, dem ein roter Ball gehört haben könnte. Es waren Männerbeine, bekleidet mit einer grauen Hose, die Füße steckten in klobigen schwarzen Schuhen. Hatte der Mann für das Kind den Ball aus dem Wasser angeln wollen?
Vergiss den Ball, Barbara! Um den geht es nicht.
Sie stand nun ganz vorn, in der ersten Reihe. Ein Mann kniete neben dem Verunglückten.
»Der Polizeyarzt«, wisperte die Frau neben ihr.
Barbara beobachtete schweigend die Bewegungen des Mediziners, der mit seinem Körper Kopf und Leib des Unbekannten verdeckte. Nur dessen linke Hand ragte seitwärts heraus, eine große, kräftige Hand, die einer älteren Person.
Hinter Barbara kam Bewegung in die Menge.
»Platz da«, rief jemand, »macht Platz für den Rettungskasten.«
Ein Wachtsoldat trieb die Menschen auseinander, ihm auf den Fersen folgte Oberhofrat Dr. Schweikhard und ein zweiter Mann, der das städtische Beatmungsgerät schleppte.
Auch Schweikhard bückte sich zu dem am Boden Liegenden hinunter, gleich darauf wies er seinen Assistenten an, den Blasebalgapparat vorzubereiten. Als der Doktor sich erhob, um seinem Mitarbeiter Platz zu machen, konnte Barbara das Gesicht des Ertrunkenen sehen. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie wollte schreien, aber kein Laut kam ihr über die Lippen, die Beine knickten ihr weg.
IM DUNKEL DER NACHT
»Ich fühl mein Herz sich regen, so leise sanft bewegen, o welche süßen Triebe, das macht der Gott der Liebe.«
Weinbrenner ertappte sich dabei, dass er mitsang. Zwar nur leise, aber er hatte gesungen. Peinlich berührt schielte er hinüber zu Heger, der mit ihm in der Loge saß, aber sein Schüler schien es nicht bemerkt zu haben oder tat zumindest so. Der junge Mann blickte gebannt auf die Bühne, wo Sänger und Sängerinnen sich zum Schlusskanon sammelten, der reiche Gutsbesitzer und seine Gemahlin, das entzückende Bauernweibchen und ihr junger Mann. Die letzten Worte von Franz Stanislaus Spindlers Singspiel »Die Reue vor der That« jauchzten durch den Zuschauerraum, das Orchester frohlockte ein letztes Mal, um danach in anmutigster Weise zu enden. Weinbrenner lehnte sich selbstvergessen auf seinem Platz zurück. Was für ein heiterer Abend! Die Musik hatte ihn erfrischt und der Gesang etwas in ihm wachgerufen, das er schon lange nicht mehr gespürt hatte.
»Ich fühl mein Herz sich regen …«
Mit dem letzten Ton brach der Applaus los. Weinbrenner erhob sich und suchte durch seinen Operngucker die erhitzten, aber strahlenden Mienen der Darsteller. Sie hatten ihm alle ohne Ausnahme gefallen.
»… das macht der Gott der Liebe«, summte er mit geschlossenen Lippen, damit es niemand sähe. Beschwingt fühlte er sich und leicht wie eine Feder. Ganz nebenbei lag es vielleicht auch daran, dass er mit seinem Theaterbau zufrieden war.
Während das Licht der Bühnenlampen ausgeputzt und der goldgesäumte Vorhang zugezogen wurden, folgte der Architekt mit den Augen dem mitten im Raum hängenden Kronleuchter, der jetzt nach der Vorstellung lautlos und behäbig von der bunt gestrichenen Decke herabzuschweben begann. Schon warteten Saaldiener, um die neuen aufgesteckten Argand’schen Öllampen zu löschen.
Das Auditorium, ein großer, zu Vorbühne und Bühne geöffneter Kreis mit drei ringförmig angeordneten Rängen, war ihm vorbildhaft geraten. »Sie nennen dich den ersten Theaterbaumeister unserer Zeit«, hatte Gretl ihm bei der feierlichen Einweihung 1808 ins Ohr geflüstert, und er war tatsächlich rot geworden. Am liebsten hätte er sie in den Arm genommen und ihre leuchtenden Augen geküsst, aber in der Öffentlichkeit beließ er es dabei, ihr lediglich die Hand zu drücken. »Warte nur, bis wir wieder zu Hause sind«, hatte er gerade noch sagen können und ihre Finger gekitzelt, bevor der Großherzog zu seiner Laudatio anhob.
Wieder einmal hat sich das Studium antiker Gesetze und Konstruktionen als richtig erwiesen, dachte er jetzt bei sich. Nach diesen Regeln hatte er die Tiefe der Bühne, der Logen und der darunterliegenden Lauben vor den Ausgängen berechnet, hatte überflüssige Vorsprünge und Verzierungen vermieden, diese vielmehr, wo gewünscht, nur aufmalen lassen, damit die Tonstrahlen nirgendwo auf Widerstand stießen, sondern sich ungehindert im Raum verteilen könnten. Er hatte es ausprobiert, war während vorangegangener Proben überall herumgeklettert. Der Klang im Parterre und in den Rängen, ja, selbst noch in der obersten Galerie begeisterte ihn. Mit dem Hoftheater hatte der Architekt seine Vaterstadt Karlsruhe mit einem Schmuckstück beehrt.
»Nun ja«, krittelte Weinbrenner leise vor sich hin, irgendwo hakte es halt immer. »Die Säulenhalle am Eingang fehlt noch, und das Rot der Wand hätte eine Spur heller sein können.« Oder war der Stuckmarmor mit den Jahren nachgedunkelt? Wenn er jetzt demnächst in Leipzig sein würde, wollte er dort besser auf die Farbqualität achten. Und auf das Können der Handwerker, auch darauf kam es an.
»Gucken Sie, Heger! Diese vielen Menschen! Was heißt das für uns?«
Weinbrenner hielt seinen Begleiter am Ärmel fest. Beide beugten sich über die Logenbrüstung, plaudernd und scherzend bewegten sich drunten im Parkett die Zuschauer auf die Saaltüren zu.
»Das heißt, dass wir an alles denken müssen. Gänge, Treppen und Türen habe ich so angelegt, dass zweitausendfünfhundert Menschen innerhalb von sechs Minuten den Zuschauerraum verlassen können«, erklärte Weinbrenner seinem Schüler nicht ohne Stolz. »Aber beten wir, dass ein solcher Notfall nie eintreten wird«, fügte er hinzu.
»Ich würde mir gern die Dachkonstruktion über dem Kulissenraum anschauen, bevor wir abreisen. Und auch die Ankleide- und Kostümzimmer«, bat Heger.
»Das sollten Sie in der Tat, das kann nicht schaden. Die Risse, die Sie in der Schule kopieren, ist eine Sache, einen Theaterbau in natura zu studieren, etwas ganz anderes. Aber Sie haben Zeit, morgen ist erst Donnerstag, und wir fahren nicht vor Sonntag.«
Sie verließen ihre Loge und wurden sofort von anderen Theaterbesuchern in Beschlag genommen. Weinbrenner musste nach allen Seiten hin grüßen. Er blieb bei Juwelier Bartoli stehen, wechselte ein paar Worte mit Archivrat Brodhag und sagte nicht Nein, als Kupferstecher Haldenwang ihn zu einem Gläschen Wein im Kaffeehaus im Erdgeschoss überredete. Als er und Heger sich eine Stunde später auf den Nachhauseweg machen wollten, kam ihnen Witwe Lux mit ausgestreckten Armen entgegen.
»Friedrich! Ich habe Sie eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen?«
Zerknirscht ergriff Weinbrenner die Hände der alten Dame und küsste sie. Ja, er hatte sich rargemacht. Aber sie schien darüber nicht ungehalten zu sein.
So fürsorglich, wie ihr verstorbener Mann, Artilleriemajor und Pagenmeister Johann Jakob Lux, sich um ihn, den kleinen Zimmermannssohn, nach dem viel zu frühen Tod seiner Eltern gekümmert hatte, so herzlich hatte auch sie sich seiner angenommen. Oft war er in ihrem Haus zum Essen eingeladen gewesen, weil sie wusste, dass ein sechzehnjähriger Lyceumsschüler, der sich mit Mathematik und Geometrie herumschlagen musste, immer hungrig war. Zum Abschied hatte sie ihm jedes Mal ein paar Kreuzer in die Tasche gesteckt, und er hatte sich verlegen bedankt. Vielleicht hätte er ohne die väterlichen Ermutigungen ihres Mannes nicht die Courage gehabt, Architekt zu werden. Vielleicht wäre er ohne dessen Empfehlungen nicht da, wo er heute war, in der Position des Oberbaudirektors des Großherzogs von Baden, zuständig für die Residenzstadt und das ganze übrige Land vom Bodensee bis weit über Mannheim hinaus. Wobei Recommendationen auf Dauer schwerlich genützt hätten, wenn er nicht bewiesen hätte, dass er sich auf seine Kunst verstand.
Er freute sich aufrichtig, die Luxin wiederzusehen. Alt war sie geworden, ihr Kopf zitterte und jeder kleine Haarkringel mit. Doch sie hielt sich kerzengerade, und ihre Augen blickten noch immer so lebendig und lustig wie ehedem. Er hätte sie schon längstens besuchen müssen. Aber die Arbeit!
»Die Arbeit«, murmelte er, »die Arbeit lässt mir so wenig Zeit. Und dann Julie und Friederike.«
»Ich bitte Sie, Friedrich, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Die Mädchen brauchen Sie nach dem Tod Ihrer Frau. Es ist schlimm, die Mutter so früh zu verlieren.«
Seine offene Wunde. Sie hatte den Finger mitten hineingelegt. Es schmerzte noch immer.
Vor knapp zwei Jahren war Gretl von ihm gegangen, am vierten Juli 1815. Ein Schlaganfall. Der Tod war Gnade gewesen. Aber sie fehlte ihm, immer und überall. Es war ihm, als hätten sie gestern noch zusammengesessen. Du bist empfindlich geworden, sagten die Freunde, und das war er. Der Verlust war noch genauso schlimm wie am ersten Tag.
Das Gesicht Sophie Reinhards schob sich vor das Antlitz seiner verstorbenen Frau.
Ich fühl mein Herz sich regen …
Könnte er wieder lachen lernen?
Das macht der Gott der Liebe …
Wie hatten die Stimmen auf der Bühne gejubelt!
»Frau Lux, ich komm Sie besuchen, ganz bestimmt, versprochen. Sobald ich von Leipzig zurück bin. Ich habe den Auftrag, dort das Theater umzubauen. Franz Heger …«, er stellte ihr seinen Schüler vor, »… wird mich begleiten, und meine Töchter ebenfalls.«
»Kommen Sie, wenn Sie Zeit haben. Und dann …«, die alte Dame gluckste wie ein junges Mädchen, »… und dann mach ich uns Apfelpfanneküchle mit Zimt, wie früher, als Sie noch der Herr Bub waren. Und dazu Wein vom Kaiserstuhl, den beschte, den ich finden kann.«
»Dann will ich bei unserm Herrgott drum bitten, dass die Apfelernte net widder ins Wasser fällt wie im letzten Jahr.«
Durch die weit geöffneten Eingangsportale strömte die frostige Nachtluft in die Vorhalle. Weinbrenner und Heger setzten ihre Hüte auf und schlugen die Mantelkrägen hoch, bevor sie hinaus in die baumbestandene Allee traten. Die nackten Kastanienreihen lagen in tiefster Finsternis, kein Stern stand am Himmel, nur vom Vorderen Cirkel blinkte das flackernde Licht einer einsamen Straßenlaterne herüber. Der Platz, auf dem die Mietchaisen nach den Theatervorstellungen auf Kundschaft warteten, war ausgestorben.
»Also werden wir wohl oder übel zu Fuß gehen müssen«, seufzte der Architekt und bedauerte, dass er am Morgen seinen Kutscher mit dem Wagen zur Wartung geschickt hatte. Fröstelnd zog er den Kopf zwischen die Schultern, der Wind pfiff scharf aus Osten.
Schweigend liefen sie nebeneinanderher, aber sie waren noch nicht weit gekommen, als sie ein Keuchen hinter sich hörten.
»Herr Oberbaudirektor, einen Augenblick, bitte.«
Weinbrenner drehte sich um, auch Heger blieb stehen.
»Verzeihen Sie, dass ich Sie behellige.«
Der Mann atmete heftig, beim Sprechen quollen weiße Dampfwölkchen aus seinem Mund. Weinbrenner kannte ihn flüchtig. Steiger. Steiger lebte seit einiger Zeit in der Residenz und bezeichnete sich als Architekten wie er, aber die staatliche Verwaltung hatte es bisher abgelehnt, ihn mit einem Projekt zu betrauen. In Karlsruhe stammte kein einziges Gebäude von ihm. Wobei der Oberbaudirektor nicht ausschließen wollte, dass der Mann andernorts vielleicht als Werkmeister oder Steinmetz tätig war und in diesem Zusammenhang möglicherweise einfache Wohnräume, vielleicht auch einen Weinbergpavillon oder Backhäuschen gebaut hatte. Zu den Großen seiner Zunft gehörte der Mann bestimmt nicht, aber für Bauvorhaben in den Dörfern der Umgebung mochten seine Kenntnisse genügen.
Abermals entschuldigte sich Steiger, dass er ihn störe, verneigte sich servil. Schleimer, dachte Weinbrenner und trat von einem Fuß auf den anderen. Ihm war kalt, er wollte nach Hause.
»Ich habe Sie eben im Theater gesehen, Herr Oberbaudirektor. Ein stimmungsvolles Gebäude, eine Preziose. Welch ein Genuss, dort drinnen sitzen zu dürfen.«
»Was wollen Sie, Herr Steiger? Elogen halten? Mir Honig um den Mund schmieren?« Es war zu dunkel, als dass Weinbrenner Steigers Mimik hätte sehen können, aber irgendetwas störte ihn an seinem Gegenüber, er vermochte nicht zu sagen, was es war. Die Stimme? Die Körperhaltung? Die Lobreden zu unpassender Stunde, die dem anderen nur als Vorwand zu dienen schienen, ihn ansprechen zu können?
»Bitte, Herr Oberbaudirektor, hören Sie mich an. Es geht nicht um mich. Es geht um einen Kollegen, einen hoffnungsvollen Architekten. Signor Leonelli. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Er hatte verschiedentlich versucht, bei Ihnen vorzusprechen, Sie aber bedauerlicherweise nie angetroffen.«
Leonelli?
Weinbrenner erinnerte sich an den Namen. Mehrere Male habe der Fremde in den letzten Tagen in der Schloßstraße vorbeigeschaut, hatte Apolone ihm ausgerichtet. Aber entweder sei er gerade nicht zu Hause gewesen oder so sehr beschäftigt, dass die Haushälterin den Mann gar nicht erst eingelassen hatte. Sie wusste, wenn der Hausherr arbeitete, wollte er niemanden empfangen. »Es sei denn, die Welt geht unter.«
»Das letzte Mal hatte er Ihnen Entwürfe hinterlassen. Er würde gern wissen, ob Sie sich die Risse angeschaut haben, und bittet untertänigst um Ihre gütige Beurteilung. Außerdem ersucht er Sie um eine Anstellung beim Bauamt.«
»Und warum hinterlässt er mir keine Nachricht und wartet, wie es Usus ist, dass ich ihm einen Tag nenne, an dem ich ihn empfangen kann? Hat er Sie geschickt?«
»Nein, nein, gewiss nicht, ich hatte Sie gesehen, und da dachte ich …«
»… dass man mich zu jeder Uhrzeit stören kann.«
»Bitte, Herr Oberbaudirektor, so habe ich es doch gar nicht gemeint.«
»Passen Sie auf, Herr Steiger! Sagen Sie Ihrem Freund, dass ich keine Zeit habe. Ich bin eigentlich bereits unterwegs nach Leipzig, und eine Anstellung, aber das wissen Sie so gut wie ich, kann ich ihm eh nicht vermitteln, die vergibt allein Seine Königliche Hoheit, der Großherzog. Gute Nacht.«
Weinbrenner ließ Steiger stehen. Seine Worte hatten harsch geklungen, vielleicht tat er dem Mann unrecht.
»Kennen Sie diesen Leonelli?«, fragte er Heger nach ein paar Schritten.
»Ich habe von ihm gehört. Miniaturenmaler, seit drei oder vier Wochen hier in Karlsruhe. Soll vorher in Straßburg gewesen sein. Was sind das für Pläne, von denen Steiger gesprochen hat? Haben Sie sie angeschaut?«
»Es ist nichts darunter, was der Rede wert wäre. Der schlechteste meiner Schüler, Sie wollen jetzt hoffentlich keinen Namen wissen, zeichnet besser. Wenn der Mann Vedutenmaler ist, wie Sie sagen, erklärt das allerdings manchen Fehler, den er gemacht hat. Die Risse signiert er freilich als Architekt.«
»Klingt ein wenig nach Hochstapelei«, ließ sich Heger vernehmen.
»Mag sein.«
An der Ecke Waldgasse, Vorderer Cirkel trennten sie sich. Heger wohnte in Richtung Mühlburger Thor. Weinbrenner setzte seinen Weg allein fort, Steiger hatte ihm den Abend verdorben, vielleicht war es auch dieser Leonelli.
Natürlich hatte er sich die Risse angeschaut.
Ein Bebauungsplan für die Brache zwischen Neuer Herren- und Rittergasse. In- und auswendig kannte er das Areal. Nächtelang hatte er selbst an Skizzen und Entwürfen für den neuen Palast gearbeitet, den Markgraf Friedrich, ein Onkel des regierenden Großherzogs, dort für sich und seine Frau inmitten einer weitläufigen Gartenanlage errichten wollte. Selbstverständlich hatte Weinbrenner als Oberbaudirektor seine Ideen eingereicht, und ebenso selbstverständlich ging er davon aus, dass Großherzog und Markgraf sie billigten. Auf die Entscheidung wartete er indes jetzt schon lang, überraschend lang.
War der Grund dafür dieser Fremde mit seinen Plänen für genau dieses Grundstück? Aber wie kommt ein völlig wildfremder Miniaturenmaler auf eine solch abwegige Idee, wer hatte ihn dazu ermuntert?
Leonelli?
Etwas in ihm klingelte.
Es soll in Karlsruhe einen Italiener gleichen Namens gegeben haben, vielleicht gab es ihn auch noch, einen Mathematiker oder mathematischen Astronom. Der Mann habe so etwas wie eine Logarithmentabelle veröffentlicht. War es Johann Peter Hebel, der Lyceumsdirektor, der ihm von dem Mann erzählt hatte? Wahrscheinlich war er abgelenkt gewesen, hatte nur mit einem Ohr zugehört, Mathematik jenseits von Baukunst und Architektur war ohnehin nicht seine Stärke.
Ob es sich um ein und dieselbe Person handelte oder um einen Verwandten? Oder war Leonelli in Italien ein so gebräuchlicher Name wie Müller und Meier hierzulande?
Weinbrenner grübelte, während er den Marktplatz überquerte.
Die Baupläne dieses unbekannten Was-auch-immer waren ungenügend. Was also wollte der Mann? Und dann diese Bitte um eine Anstellung beim Bauamt!
»Wer hat ihm nur diesen Floh ins Ohr gesetzt?«
In der menschenleeren Schloßstraße klang seine Stimme merkwürdig dünn.
BACKWERK
Es war schummrig im Raum. Durch die Fenster zum Hof drang kaum noch Tageslicht, aber niemand stand vom Küchentisch auf, um eine Kerze anzuzünden. Allmählich gewöhnten sich Christian Hemmerdingers Augen an die Dunkelheit. Barbara nestelte am Kragen ihres Kleides, die Augen im Nirgendwo. Als Christina ihr beschwichtigend die Hand auf den Unterarm legte, ließ sie los und begann stattdessen das Sacktuch, das sie schon die ganze Zeit über in den Händen hielt, um ihre Finger zu wickeln. Bernhard am anderen Ende des Tisches schluchzte hemmungslos.
»Ich hab Hunger.« Der kleine Lorenz rutschte von Elisabeth Mauckles Schoß herunter, trippelte um den Tisch herum und rüttelte an Christians Hosenbein. »Ich hab Hunger.« Aber sein Vater reagierte nicht.
»Pst«, machte Stephanie und fasste den Dreijährigen am Schürzenbändel. »Net jetzt. Guck, alle sind traurig.«
»Traurig?«
»Ja, traurig.«
»Warum?«
»Der Opa ist tot«, erklärte Stephie im Tonfall einer Erwachsenen.
»Warum?«
Elisabeth Mauckle, die Nachbarin aus dem Mansardgeschoss, erhob sich.
»Ich mach euch Kindern was zu essen.«
Sie nahm Lorenz auf den Arm. Dann schob sie Stephie durch die Tür nach draußen und winkte auch Anton mitzukommen. Der wollte nicht, stampfte mit dem Fuß auf, aber als Christian ihm einen Klaps gab, gehorchte er.
Christian hörte die drei Kleinen die Treppe nach oben trampeln, seine beiden Buben Anton und Lorenz und die Tochter seiner Schwester Christina. Stephanie war eine Woche vor Anton zur Welt gekommen, und das Mädchen tat gern groß damit. »Ich bin älter als du, du musst mir gehorchen, dädedededääde«, kommandierte sie den Vetter ständig. Wenn es aber darum ging, dass der Hemmerdingernachwuchs sein Revier gegen die Maucklekinder aus dem Dachgeschoss verteidigen musste oder alle Waldhorngassenkinder zusammen Krieg gegen die Kinder aus den benachbarten Straßen führten, hielten Stephanie und Anton fest zusammen, und sie fügte sich der größeren militärtaktischen Begabung ihres Cousins.
Eine Zeit lang war oben in der Mansardwohnung noch Lorenz’ Getrappel zu vernehmen, dann wurden Stühle gerückt, und gleich darauf herrschte Stille.
Bernhard hatte zu heulen aufgehört, nur ab und zu schnupfte er noch vor sich hin, jedes Mal zuckte Christian zusammen. Der jüngere Bruder war dem Vater nahe gewesen, sah ihm auch verblüffend ähnlich. Gemeinsam war ihnen allen die Liebe zum Backen gewesen, der Wunsch nach einer Conditorei. Eines Tages, hatte Christian dem Vierzehnjährigen versprochen, eines Tages gehen wir weg von hier, dann kaufe ich uns das Karlsruher Bürgerrecht, und wir machen eine Conditorei auf, du und ich, in bester Gegend, am Markt, in der Bärengasse, am Vorderen Cirkel, wo auch immer. Bernhards Augen hatten geleuchtet, und auch ihn berauschte die Idee. Bis letztes Jahr, bis zu diesem vermaledeiten Sommer, der kein Sommer war, hatte er für seinen Traum sparen können, und der Vater bestärkte ihn.
Hatte ihn bestärkt. Christian biss die Zähne zusammen. Nur nicht heulen. Nicht vor den Geschwistern. Er war der Älteste, er musste stark sein.
Schon ihr Großvater, Hintersasse in Klein-Karlsruhe, war Bäcker gewesen, er hatte in der Conditorei des Schlosses gearbeitet. Jeden Tag hatte er weißes Brot gebacken und Weckle, Pistazienplätzchen, Zwetschge im Teig, Basler Leckerle. Als sein Sohn Georg, ihr Vater, zwölf war, hatte der Alte ihn zu sich in die Lehre genommen, und bei jeder Gelegenheit hatte Georg Hemmerdinger später seinen vier Kindern mit hocherhobenem Haupt erzählt, dass die damalige Markgräfin, die gute Karoline Luise, seine Brioches allem anderen Backwerk vorgezogen habe.
Vielleicht hätte Georg Hemmerdinger am Hof ein bequemeres Leben gehabt, aber schon er hatte seine Träume, er wollte sich selbstständig machen. Und als er die Mutter kennenlernte und vom Markgrafen die Heiratserlaubnis erhielt, richtete er im Hof des kleinen elterlichen Häuschens in der Waldhorngasse seine Backstube ein. Aus dem Zimmer zur Straße hin machte er einen Verkaufsraum. »Die Mensche in Klein-Karlsruh wolle auch gutes Brot«, pflegte er zu sagen. Das war 1789 gewesen. Später, weil zwei Ecken weiter noch eine Bäckerei aufmachte und dann eine dritte, bot Georg Hemmerdinger beim Kauf von einem Laib Roggenbrot oder einem meliert-ökonomischen seinen Kunden Durlacher Wein zu einem besonders günstigen Preis an. Beim Kauf von drei Broten gab’s ein Gläschen kostenlos, direkt im Laden, und den Kindern der Umgebung schenkte er Zuckerplätzle. Dann erhielt er die Konzession für eine kleine Wirtschaft, und Mutter stellte zwei Tische und Bänke auf.
Doch so viel die Eltern auch schufteten, für die Erlangung des Karlsruher Bürgerrechts, das die Bewohner des Dörfle endlich nach langem Hin und Her erwerben konnten, reichte das Geld hinten und vorn nicht.
Das neue Edikt war ein Hohn, war das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben stand. Kaum eine Handvoll Klein-Karlsruher konnte die hohen Gebühren bezahlen. Umgekehrt ja, umgekehrt kamen seitdem jede Menge Groß-Karlsruher ins Dörfle, denen das Leben in der Residenz inzwischen zu teuer geworden war. Ihr städtisches Bürgerrecht verloren sie dabei nicht, und so hofften sie auf den großen Reibach in der kleinen Gemeinde, die doch so gar nichts darstellte, weder Dorf noch Stadt, aber in der sie, die Zugezogenen, steuerfrei leben konnten, hurra! Denn da Klein-Karlsruhe nach wie vor kein Teil der Residenzstadt war, konnte es von Karlsruher Bürgern keine Akzise nehmen. Das kam erst ein paar Jahre später, als das Dörfle endlich eingemeindet wurde. Am Alltag der meisten Menschen änderte sich damit dennoch nicht viel, denn mehr Geld als die früheren Hintersassen des Dörfle hatten die Groß-Karlsruher allemal, und sie kauften die heruntergekommenen Hütten und Häuschen der Einheimischen auf, gründeten eigene Geschäfte und trieben die alteingesessenen Handwerker in den Ruin.
Es war ein schleichender Prozess gewesen. Am Anfang hatte es niemand gemerkt. Aber dann hatten die drei Kübler des Dörfle aufgeben müssen, einer nach dem anderen. Die zwei, die inzwischen hier arbeiteten, stammten aus der Residenz. Genauso der Schlosser, die Metzger, die Schreiner und die Gastwirte. Nur an der Vertreibung der Maurer und Tagelöhner war den großmäuligen Karlsruhern nicht gelegen, irgendjemand musste ja ihre noblen Häuser bauen, selbst mitten im Dörfle gab es nun schon solche neureichen Bauten.
In Christian kochte die Wut hoch, wenn er daran dachte. Aber da biss die Maus keinen Faden ab: Kein Karlsruher Bürgerrecht bedeutete, keinen Meistertitel. Bedeutete, keine Aussicht auf ein besseres Leben.
Dass sein Vater die Bäckerei trotz zunehmender Konkurrenz hatte halten können, verdankten sie seinem Ruf, der beste Bäcker im ganzen Umkreis zu sein. Und weil Georg Hemmerdinger immer ehrlich gewesen war, nie schlechtes Mehl verwendet und den Teig immer nach Vorschrift abgewogen hatte, auch in diesen Zeiten der Not, wo doch jeder sich selbst der Nächste war.
Aber Christian wollte weg von hier, raus aus dem Viertel. Eintausendzweihundert Gulden bräuchte er allein für sich, um das Bürgerrecht zu bekommen. Das konnte er jetzt vergessen. Jetzt hatte er die Familie zu ernähren, die Geschwister, die Kinder. Zugegeben, Barbaras Lohn war nicht zu verachten. Und sogar die lahmfüßige Christina, der der Herrgott im frühen Kindesalter unseligerweise die Gicht oder eine Nervenkrankheit beschert hatte, verdiente mit Waschen, Bügeln und Nähen noch ein paar Kreuzer hinzu.
Wenn die wenigstens einen Mann hätte, dann wären zwei Mäuler weniger zu stopfen. Aber der Kerl, der Christina die kleine Stephanie gemacht hatte, irgendein lumpiger Soldat des großherzoglichen Heers, war längst über alle Berge. Wer will auch schon eine Frau, die sich bewegt wie ein Storch im Salat. Die verdammten Militärs, die hier im Hinterhof der Residenz zu Hunderten hausten, unterm Dach, in Anbauten, im letzten freien Bett einer armen Familie, versprachen den Mädchen das Blaue vom Himmel herunter und machten sich dann aus dem Staub. Und nicht nur den jungen Mädchen. Auch seine Susanna war so einem verlogenen Lump aufgesessen und hatte ihn mit Anton und Lorenz sitzen lassen. Rabenmutter.
Nach außen tat er, als mache es ihm nichts aus. Aber tief in seinem Innern wurmte es ihn, dass das Weib davongelaufen war. Was hatte der andere, was er nicht hatte? Mehr Geld? Kaum vorstellbar. Diese elenden Kerle besaßen doch nichts als ihre Uniformen am Leib. Die zweifellos stattlich aussahen, stattlicher als sein mehlbestäubter Kittel. Wenigstens hatte sie ihm die Kinder gelassen. Um derentwillen wollte er sich zusammenreißen, für sie musste er die Bäckerei weiterführen, genauso gut wie der Vater. Besser.
Es war jetzt stockfinster geworden in der Küche.
»Was für ein Segen, dass die Mutter das nicht mehr erlebt hat.«
Barbaras Stimme kam dumpf und gebrochen aus der Ecke, aber wenigstens redete sie wieder. Seit der Stadtphysikus sie nach Hause gebracht hatte, war bis zu dieser Stunde noch kein einziges Wort über ihre Lippen gekommen. Der Arzt hatte ihr auf die Sitzbank geholfen, seither saß sie dort, bleich im Gesicht, mit leeren Augen.
Sie hätten getan, was sie konnten, hatte der Assistent erklärt, aber alle ärztlichen Bemühungen seien erfolglos gewesen, alle Versuche, den Verunglückten mit modernstem Gerät zu beatmen, hätten versagt. Es fiel dem jungen Mann sichtlich schwer, über das, was geschehen war, zu sprechen. Christian hatte ihn reden lassen, ihm kein Wort erspart, und der andere wand sich, suchte nach Formulierungen, stotterte, fing noch einmal von vorn an, bis er schließlich mitten im Satz abbrach, die Hände ratlos an seinen Rockschößen reibend. Scheinbar unbeteiligt, als ginge ihn das alles nichts an, hatte Christian abgewartet. Aber kaum war der Assistenzarzt gegangen, übermannte ihn der Schmerz, so scharf und schneidend, als hätte ihm jemand ein Messer in den Leib gerammt. Er krümmte sich, rang nach Luft.
Als es draußen klopfte, kostete es ihn schier unmenschliche Kraft, die Tür aufzumachen und die Beileidsbekundungen der Nachbarn entgegenzunehmen. Die Nachricht von Georg Hemmerdingers Tod hatte sich rasend schnell im Quartier verbreitet. Jakob Bastiani und dessen Schwester Hedwig waren die Ersten, die kondolieren kamen, nicht, weil Bastiani Polizeysergeant war, sondern weil er viele Jahre bei den Hemmerdingers gewohnt hatte, bevor er nach dem frühen Tod von Hedwigs Mann zu ihr gezogen war, sechs Häuser weiter. Für Georg Hemmerdinger war er nicht einfach Untermieter gewesen, eher ein Sohn, der älteste, auf dessen Schoß alle Kinder des Bäckers reiten durften. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er …
Bastiani redete nicht viel, er redete nie viel. Er setzte sich neben Barbara und legte den Arm um sie. Die beiden brauchten keine Worte, um sich zu verstehen, bemerkte Christian fast eifersüchtig. Ihr Verhältnis schien vertrauensvoller zu sein als das zwischen ihm und der Schwester. Auch zum Vater waren die Bande brüchig gewesen, fast so wie die zwischen Konkurrenten. Vielleicht waren sie das ja auch.
Jetzt lag sein Vater in einem kühlen Raum des Feuerhauses am Marktplatz. Dr. Schweikhard wollte eine Sektion vornehmen, um herauszufinden, woran der Vater gestorben war. Ohne den Leichnam gesehen zu haben, hatte Christian zugestimmt und gleichzeitig abgelehnt, sich von dem kalten Körper zu verabschieden.
»Er hat seinen Siegelring nicht angehabt.«
Barbara sprach deutlicher als zuvor, aber noch immer schleppend. »Ich hab ihn noch nie ohne den Ring gesehen.«
»Doch«, sagte Christina, »wenn er Teig knetet – wenn er Teig geknetet hat, hat er ihn immer abgelegt.«
»Aber nur beim Teigkneten. Sonst hatte er ihn immer an.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Christian. »Vielleicht hat er nach dem Händewaschen einfach nicht mehr dran gedacht.«
»Vielleicht.« Barbara schwieg.
Erneut schlug jemand gegen die Tür.
Christina erhob sich, zündete das Licht an, das düstere Schatten auf die Wände und die niedrige Decke malte, und öffnete. Mit einem großen Topf heißer Suppe kam Witwe Dollmätsch aus der Achtunddreißig herein, stellte das Essen auf den Tisch und legte ein schwarzes Säckchen daneben. Mit leisem Klimpern schlugen darin Münzen aneinander. Die alte Frau schaute zuerst zu Bernhard, der verloren vor sich hin stierte, dann nickte sie Barbara zu.
»Armes Mädel. Es ist schlimm, dass du ihn so hast sehen müssen. Er war ein guter Mann, euer Vater, wirklich, ein guter Mensch. So ein Ende hat er nicht verdient. Wie ist es denn passiert, und was hat er dort zu schaffen gehabt hinterm Durlacher Thor?«
Als niemand antwortete, nickte sie wieder, die Bänder ihrer Haube wippten.
»Na ja, ist ja auch egal. Wenn ich euch helfen kann, ihr wisst, wo ihr mich findet.« Und sie verabschiedete sich.
Beinahe wäre sie gegen den großen, korpulenten Mann gestoßen, der hinter ihr ins Zimmer getreten war. Abrupt hielt sie inne, klopfte hart mit ihrem Stock auf den Dielenboden, einmal, zweimal, der Mann wich zur Seite. Die Witwe würdigte ihn keines Blicks.
Sie wird es Hackschmitt nie verzeihen, dass er damals ihr Haus und Grundstück haben wollte, dachte Christian, er konnte es ihr nicht verdenken.
Die Art und Weise, wie der Mann aus Groß-Karlsruhe sich vor ein paar Jahren hier im Dörfle wie ein feiner Pinkel aufgespielt und sich breitgemacht hatte, war auch einfach ungebührlich gewesen, ungebührlich und empörend. Als Schmeicheleien nichts fruchteten, hatte Witwe Dollmätsch dem Vater und ihm erzählt, habe er ihr schließlich gedroht, wenn sie ihm ihren Besitz nicht verkaufte. »Sie werden schon sehen, was Sie davon haben«, soll er gesagt haben, aber die Dollmätschin hatte sich nicht kopfscheu machen lassen. »Nur weil mein Seliger tot ist, glaubt er, er kann mit mir machen, was er will. Aber da täuscht er sich gewaltig.«
Später hatte Heinrich Hackschmitt ein paar halbherzige Entschuldigungen vorgebracht, die Witwe Dollmätsch habe ihn missverstanden, und er hatte ihr fünf Flaschen feinsten Rheinwein zukommen lassen.
Die Gabe hatte sie genommen. Und getrunken. »Aber vergessen werd ich’s ihm nicht«, hatte sie gesagt und mit ihrem Stock gebieterisch auf den Boden geklopft. Im Übrigen war der Mann von da an Luft für sie. Einfach nicht vorhanden.
Hackschmitt hatte bald danach das Nachbargrundstück in der Waldhorngasse erworben, die Nummer vierzig, Ecke Kleine Hospitalgasse, und die Leute munkelten, der alte Mann, dem das Haus bislang gehörte, habe sich von dem Kneipenwirt aus der Residenz übers Ohr hauen lassen. Aber vielleicht stimmte es nicht. Der alte Schuttler redete nie schlecht von seinem neuen Mietherrn, der ihn weiter in einer Kammer im Hinterhof wohnen ließ.
»Bei meiner Seel, der nutzt ihn nur aus«, behauptete dagegen die Englerin, wenn in Hemmerdingers Bäckerei die Rede auf den zugezogenen Karlsruher Bürgerlichen kam. Vielleicht, mutmaßte Christian, während er dem ungebetenen Gast einen Stuhl anbot, vielleicht hat die Wäscherin ja mehr Einsicht als wir, holte sie doch regelmäßig Tischtücher und anderes Leinenzeug beim Hackschmitt ab. Denn dieser hatte in dem kleinen Häusle eine Wirtsstube eingerichtet, die schon bald so gut lief, dass Hackschmitt sie zu einer geräumigen Restauration hatte umbauen lassen. Zweistöckig, mit Anbau und Lagerräumen im Hof. »Es wurde auch Zeit«, hatte er einmal zu ihm gesagt und die Nasenflügel gebläht.
Um die Renovierung hatte es zwischen Hackschmitt und Baumeister Weinbrenner Krach gegeben. Und was für einen! Jeder in der Straße hatte die explosive Auseinandersetzung mitbekommen, aber was der eigentliche Streitpunkt war, hätte Christian nicht zu sagen vermocht. Es ging ihn nichts an.
Vater hatte sich ebenfalls aus dem Disput der beiden Männer herausgehalten, er hatte ohnedies nie zu erkennen gegeben, was er über Hackschmitt dachte.
»Ein bisschen kleiner hätt’s auch getan«, war seine einzige kritische Bemerkung gewesen, als bekannt wurde, dass der Wirt den größten und teuersten aller Karlsruher Architekten mit dem Umbau seines Besitzes beauftragt hatte. Mag sein, dass Vater aber auch auf die riesigen protzigen Lettern angespielt hatte, die schon bald über dem neuen Eingang leuchteten. »Zum Goldenen Füllhorn«, war dort in leuchtender Farbe hingepinselt, darunter ein prächtig verziertes, mit gelben und blauen Trauben gefülltes Horn in Rot und Grün, schreiender Kontrast zu dem klaren Hellgrau anderer Weinbrenner’scher Gebäude in der Stadt.
»Mein Beileid«, sagte der Wirt in die Runde, zog den Hut, deutete Barbara und Christina gegenüber einen Diener an und grüßte Bastiani und Hedwig mit einer jovialen Geste. »Er war mein bester Zulieferer.«
Fragend wandte er sich an Christian, aber der schaute ihn nicht an.
»Du wirst doch weiter für mich Brot und Bretzeln backen?«
»Warum sollte ich nicht?«
Christian schluckte seinen Ärger hinunter. Noch keinen Tag war der Vater tot, und Hackschmitt hatte nichts im Kopf als sein Geschäft. Natürlich würde er weiter für ihn backen, wie sie es all die Jahre getan hatten, das war keine Frage. Sie waren nicht nur gute Zulieferer, der Wirt des Füllhorns war auch ihr bester Kunde. Christian konnte es sich nicht leisten, auf ihn zu verzichten, gerade nicht in diesen mageren Zeiten. Für persönliche Abneigungen war da kein Platz.
Heinrich Hackschmitt war ihm zuwider. Er konnte dessen scheinheilige Freundlichkeit nicht leiden. Die Art, wie dieser seinen Reichtum zur Schau trug, die dicken Ringe an den Fingern, die Golduhr vor seinem fetten Wanst. Sein dröhnendes Gewiehere. Und dass er immer die hübschesten Mädchen abbekam. Wann immer er ihm begegnete, hatte der Kerl eine andere junge Frau am Arm, und Christian beschlich jedes Mal der Verdacht, dass auch seine Susanna, die Hure, dem windigen Charme dieses Weiberhelden erlegen war.
Ob einer seiner Söhne gar nicht von ihm war? Oder beide? Nein, bestimmt nicht, sie sahen ihm doch ähnlich. Lorenz weniger. Aber Lorenz war noch klein. Das konnte sich auswachsen. Und wenn nicht?
Aber er war auf Hackschmitt und dessen Speisehaus angewiesen. Sonst würde Vaters Bäckerei, jetzt seine, die Durststrecke nicht überleben und auch die kleine Weinwirtschaft nicht. Die würde den Bach runtergehen, wie all die anderen Gasthäuser im Viertel in den letzten Jahren. Zolter in der Rüppurrer Thorgasse hatte bereits dichtgemacht, auch der Löwenwirt, und erst neulich war Carl Weichsle zu ihm gekommen und hatte ihm verkündet, dass, wenn nicht bald was passierte, er sich die Kugel gäbe. Christian hatte ihn ausgelacht.
Doch es stimmte schon. Kaum jemand, außer in den besseren Kreisen, trank noch den teuren Wein, in diesen Zeiten war billiges Bier angesagt, und in Karlsruhe schossen Brauereien wie Pilze aus dem Boden. Darauf hatte Hackschmitt gesetzt, als er sein Füllhorn eröffnete. Immerhin hatte Vater davon profitiert. Brot wurde immer gegessen. An den Tables d’hôte der Gasthäuser genauso wie in den Familien. Brot brauchten sie alle, in guten wie in schlechten Zeiten. Noch vor Kartoffeln. Er würde nur die Qualität halten müssen. Nein. Er müsste besser werden, viel besser. Vielleicht wäre dann seine Conditorei noch nicht verloren.
Christian hob den Kopf.
»Keine Sorge, Hackschmitt, ich back dir das beste Brot, das du jemals deinen Gästen aufgetischt hast.«
»Genau das habe ich von dir hören wollen.«
ASSISI AN DER WAND
Weinbrenner schob sich mit der Gabel ein daumendickes Stück warmen Schweinebratens in den Mund, kostete den saftigen Geschmack, wie er sich angenehm im Mund verbreitete, und kaute mit Bedacht. Der erste Bissen am Morgen, wenn die Stadt neu erwachte, wenn noch keine Schüler im Bureau hinten im Atelierbau waren und ihr Stimmengemurmel durch den Garten herüberwehte, war der beste. Das Hündchen zu seinen Füßen unterm Tisch winselte leise. Der Oberbaudirektor schaute zur Tür, ob sie geschlossen war und Apolone ihn nicht sähe, bevor er Herrn Beppo ein kleines Stückchen besten Fleischs gab und ihn am Kopf kraulte. Mit der Serviette, die er wider alle Etikette in den eigenen vier Wänden im Knopfloch seines Hemdes verknotete, wischte er sich über den Mund, griff zum Weinglas und nahm einen kräftigen Schluck. Dann mischte er Wasser dazu.
An der Wand vor ihm schwang unerschütterlich das Perpendikel der alten Schwarzwälder Schilduhr, ein Erbstück von seinen Eltern. Klick machte es und klack. Klick – klack, klick – klack. Beruhigend, gleichmäßig, Garant von Beständigkeit, die er sich ersehnte, wohl wissend, dass das Leben meist anders spielte. Er erhob sich, um die Uhr aufzuziehen. Leise ratterten die schweren Tannenzapfengewichte nach oben. Er verglich die Uhrzeit mit der Zeit auf seiner Taschenuhr, rückte den großen Zeiger der Schwarzwalduhr um fünf Minuten vor und betrachtete das kleine Gemälde auf dem Schildbogen, als hätte er es nie zuvor gesehen. Vom Maler in eine liebliche Berglandschaft gesetzt, ragte am Ufer eines Gewässers ein burgähnliches Wohnhaus empor. Hohe Bäume, ähnlich Zypressen, umgaben das idyllische Anwesen. Dahinter war ein Dorf zu sehen, Fischerhütten, ein Bauernhof, ein Kirchlein. Nirgendwo ein Mensch.
Die Alpen, dachte Weinbrenner, es könnte in den Alpen sein, an einem der tiefgrünen Gletscherseen. Seine Gedanken flogen davon.
Italien. Die Überquerung des Gotthards, Airolo, der Lago Maggiore. Später Pisa, Florenz, Rom. Vor allem Rom und der Ausflug nach Neapel. Die fünf schönsten Jahre seines Lebens. Die unbeschwertesten, wenngleich er nie Geld in der Tasche gehabt hatte. Aber jung war er gewesen, herrliche sechsundzwanzig Jahre jung. Und noch schlank und rank. Nun gut, das war übertrieben, er hatte schon immer ein wenig zur Fülle geneigt. Die Natur meinte es eben gut mit ihm.
Er schmunzelte, während er an sich hinunterblickte. Um seine Füße zu sehen, musste er den Bauch einziehen. Gretl hatte ihn geliebt, so wie er war, mit seinem stattlichen Körper und dem widerborstigen Haar, das sich nicht zähmen lassen wollte. In Straßburg hatten sie sich verlobt, er, Johann Jakob Friedrich Weinbrenner, und Margaretha Salome Arnold, die Tochter seines Onkels aus der elsässischen Verwandtschaft. Sie war ihm nach Karlsruhe gefolgt. Gern, hatte sie ihm versichert und trauerte nichtsdestotrotz zeit ihres Lebens dem romantischen Städtchen an der Ill mit seinen Fachwerkhäusern und überkragenden Erkern nach. Doch sie wusste um die Einmaligkeit der Chance, die der selige Markgraf Carl Friedrich ihrem Mann bot: eine noch nicht einmal einhundertjährige Residenzstadt planen und aufbauen zu können, nicht gerade von null, aber doch fast.
Das Schloss hatte es bereits gegeben. Auch die zweiunddreißig Strahlenalleen, die dem Ort seinen eigenwilligen Grundriss verpassten, waren schon angelegt. Und natürlich standen eine Reihe von Amtsgebäuden und Wohnhäusern, zwei Kirchen, die evangelische und die reformierte, und ein Brunnenhaus. Aber die Stadt wuchs, und sie sollte nach dem Willen des Hofs geordnet weiterwachsen. Wie viele Baumeister gab es schon, die so eine Gelegenheit erhielten? Bestimmt keinen zweiten. Johann Jakob Friedrich Weinbrenner durfte jungfräuliches Terrain beackern, sozusagen.
Es war ihr so herausgerutscht, und sie war rot geworden, als er sie daraufhin in den Arm genommen und auf den Mund geküsst hatte.
»Genauso ist es, Gretl. Ein paar Kollegen vor mir haben den Boden vorbereitet, und ich darf nun säen und hoffentlich ernten.«
Nur kurz hatte er gezögert, als Hannover ihn mit einem finanziell sehr viel reizvolleren Angebot lockte. Aber das jungfräuliche Terrain und seine Zuneigung zu Gretl gaben den Ausschlag. Karlsruhe lag nun einmal näher an der geliebten Heimat seines jungen Weibs als die Stadt an Ihme und Leine. Seine Entscheidung für die badische Residenz war auch ein Geschenk an die Frau seines Herzens, und sie fiel ihm umso leichter, als sein erlauchter Landesvater sich gönnerhaft erwies und eiligst sein Jahressalär aufstockte. Weinbrenner hatte sich mit Verve in die große Aufgabe gestürzt.
Die Uhr schnaufte rasselnd, holte Atem wie ein alter Mann. So wie ich auch mittlerweile schnaufe, ging es dem Oberbaudirektor durch den Kopf. Dann schlug das Uhrwerk sieben Mal.
Er ging nach nebenan in seine private Schreibstube, in der er auch die wichtigsten Risse und Dokumente aufbewahrte, damit sie nicht in unbefugte Hände fielen, nahm Papier und Stifte und rückte das Stehpult nahe ans Fenster zur Schloßstraße. Das frühe Morgenlicht genügte kaum, dennoch setzte er seine Brille auf und begann zu zeichnen. Die Albaner Berge, die er als junger Student vor einem Vierteljahrhundert mit Freund Feodor durchstreift hatte, der steinige Feldweg vor ihnen, das Wäldchen zur Rechten. Er sah alles vor sich, als wäre es gestern gewesen. Das Dorf in flimmernder Mittagshitze. Die rötlich gelben Bauernhäuser aus schwerem Bruchstein, die Kirche, die Osteria. Feodor Iwanowitsch mit seinem Skizzenbuch am wackeligen Holztisch, trunken von der Schönheit der römischen Landschaft.
»Eigentlich muss ich diesen Hurensöhnen von Kosaken dankbar sein. Hätten sie mich nicht als unschuldiges Knäblein meiner Mutter Hand entrissen und mich an den Zarenhof nach Petersburg verschleppt und zu buckelnder Pagendienerei verurteilt, ich hätte nie gewusst, dass es ein Paradies auf Erden gibt«, hatte der Freund gesagt. Aber auf dem braunen kalmückischen Mongolengesicht des Freundes hatte ein melancholisches Lächeln gelegen, und in seinen Augen glitzerte es verräterisch, als sie sich zugetrunken hatten. Weinbrenner schmeckte den beerig-süßen Rotwein, roch das Brot, das eben aus dem Ofen gekommen war. Sie hieß Giulia. Er hatte sich nicht getraut, sie zu einem Spaziergang einzuladen.
»Bist du schon am Arbeiten?«
Friederikes Stimme schreckte ihn auf. Sie war, ohne dass er es bemerkt hatte, hereingekommen und hinter ihn getreten. Jetzt hielt sie den Leuchter hoch, um zu sehen, was er aufs Papier gezaubert hatte.
»Wie schön«, sagte sie. »Dorthin würde ich auch gern einmal reisen.«
Er fühlte sich ertappt. Das italienische Mädchen musste damals so alt gewesen sein wie seine älteste Tochter heute. Er legte die Bleifeder aus der Hand, nahm Friederike in die Arme und hauchte ihr einen Kuss ins Haar. »Guten Morgen, Jungfer Tochter.«
Sie küsste ihn zurück.
»Guten Morgen, Herr Vater. Kaffee ist fertig. Julie kommt auch gleich. Nur mit frischem Brot kann ich nicht dienen, wir haben nur noch altes von vorgestern. Du weißt ja …«
»Dann tunken wir eben. Wir können dankbar sein, dass es uns gut geht. Der arme Hemmerdinger. Entsetzlich. So einfach von jetzt auf gleich. Die Familie kann einem leidtun.«
Er hakte sich bei seiner Tochter unter, und gemeinsam gingen sie zurück ins Frühstückszimmer. Sie passte ihren rascheren Schritt dem seinen an.
»Wann wird Barbara wieder zur Arbeit kommen?«
Er dachte an den ständigen Staub und Dreck im Bureau, der einfach nicht zu vermeiden war, wenn zehn oder fünfzehn Schüler gleichzeitig um die Zeichentische herumstanden oder sich hin und her bewegten, um die Skizzen und Entwürfe der anderen zu sehen. Er konnte schließlich nicht von ihnen verlangen, die Straßenschuhe auszuziehen, und leider kam es nicht jedem in den Sinn, sie gefälligst vorher auf der Matte am Eingang abzuputzen. Und erst die Brotkrümel! Dabei hatte er das Essen und Trinken im Bureau strikt untersagt. Jeder Schüler wurde bei Aufnahme in seine Bauschule eigens darauf hingewiesen. Aber sie schienen Orgien zu feiern, kaum dass er ihnen den Rücken kehrte.
Barbara war die Einzige, bei der er keine Angst hatte, dass sie beim Saubermachen die Papiere beschädigen könnte. Er hatte es vor ihr mit vielen Mägden versucht, alle waren sie schusselig gewesen, hatten Eselsohren und Knicke in die Blätter gemacht oder sie so verlegt, dass er hinterher nichts mehr fand, und eine hatte gar Seifenwasser über die Risse gespritzt. Er hatte alles neu machen müssen. Bis er Barbara Hemmerdinger fand. Persönlich hatte er sie ins Bureaugebäude geführt. Er ließ sich dies von niemandem nehmen. Niemand außer ihm hätte ihr erklären können, auf was sie zu achten habe und worauf es ihm besonders ankäme, nicht einmal seine Töchter. Sie hatte aufmerksam zugehört und sich über die Zeichnungen gebeugt, die auf den Tischen lagen, hatte die Skizzen von der Stephanskirche an der Wand betrachtet, wie er sie sich ursprünglich vorgestellt hatte, und dann die Bilder mit den italienischen Motiven. Tivoli, die Landschaft bei Paestum, der Minervatempel in Assisi. Vor dieser Vedute war sie lange stehen geblieben.
»Das sieht aus wie unsere neue Stadtkirche am Markt«, hatte sie dann bemerkt, ohne sich nach ihm umzudrehen. »Wo ist das?«
»In Italien«, hatte er geantwortet und gewusst, dass sie die Richtige für diese Arbeit war.
»Barbara wird voraussichtlich schon morgen wiederkommen«, sagte Friederike, während sie ihm und sich Kaffee eingoss. »So hat der Bub es gesagt, als er uns gestern die Nachricht gebracht hat.«
»Welcher Bub? Hat Barbara denn Kinder?«
»Ach, Vater, du bringst aber auch alles durcheinander.« Seine jüngste Tochter Julie kam wie ein Wirbelwind ins Zimmer hereingestürmt. Sie musste seine Frage noch gehört haben. »Barbara hat doch keine Kinder, ihr Bruder ja, ich glaube, die Schwester auch, aber Barbara nicht. Und mir kannst du auch schon einschenken, mich gibt’s nämlich auch noch«, fauchte sie ihre Schwester an. Dann umarmte sie den Vater, drückte ihm einen vernehmbaren Schmatzer auf die Backe und plotzte auf ihren Stuhl.
»Schenk dir doch selber ein!«, konterte Friederike und knallte ihr die Kanne hin. »Ich bin nicht deine Hanna.«
»Streitet euch nicht!« Weinbrenner hob flehentlich die Arme. »Eure arme Mutter dreht sich im Grab um, wenn sie euch so hört.«
»Wir streiten uns doch nicht.« Julie guckte ihn treuherzig an. »Oder streiten wir, Schwesterchen?«, wandte sie sich harmlos an Friederike.
»Mit vollem Mund ist schlecht reden«, brummte die und mümmelte mit vorgestrecktem Hals und gespitzten Lippen heftig vor sich hin.
Weinbrenner zog die Augenbrauen hoch. Töchter waren anstrengend, seine zumindest. Es musste am Alter liegen. Sie waren keine Kinder mehr, aber auch noch nicht richtig erwachsen. Eigentlich ungenießbar.
Andererseits, wenn er sie während der Versammlungen des Kleinen Museums beobachtete, füllte sich seine Brust mit väterlicher Sanftmut. Beide, Friederike und Julie, zeigten sich an diesen Abenden von ihrer besten Seite, keine nahm der anderen etwas weg, sie ergänzten sich vorzüglich. Wie ihre Mutter erwiesen sie sich als die geborenen Gastgeberinnen, ganz besonders Friederike ging in dieser Rolle auf. Im vergangenen Jahr hatte sie, selbstverständlich nicht ohne ihn vorher um Erlaubnis zu bitten, den kleinen Museumskreis ins Leben gerufen. Den Namen hatten sich seine beiden jungen Dämchen ungeniert von der großen Karlsruher Museumsgesellschaft abgekupfert, diesem noblen Treffpunkt Karlsruher Honoratioren in der Langen Straße. Zu seiner Überraschung entwickelte sich Friederikes Kleines Museum im eigenen Haus schon bald zu einem beliebten Salon. Von Monat zu Monat erschienen mehr Gäste, neben jungen Männern mit keck geschlungenen Bindern und modischen Beinkleidern auch gebildete Frauen und Desmoiselles. Denn das große Museum in der Stadt war der Weiblichkeit verwehrt, die dortige Bibliothek, die Lesezimmer, die Restauration und der Debattierclub waren ausschließlich den männlichen Bürgern vorbehalten. Nur zu den regelmäßigen Tanzvergnügungen waren Frauen geladen, es tanzte sich so schlecht ohne sie.
Und doch hatte drei Jahre zuvor eine Frau das Gebäude eingeweiht, sein Gebäude, das er an der Kreuzung zur Rittergasse mit einem imposanten Eckrondell abgeschlossen hatte. In der Beletage führte ein offener Balkon um die Rundung herum und schützte drei hohe, durch Pilaster voneinander getrennte Rundbogentüren, die viel Tageslicht in den Saal lenkten. Großherzogin Stéphanie höchstpersönlich hatte die Grußworte gesprochen und ihn zu seinem Werk beglückwünscht, in ihrer Ansprache seine Kunst in höchsten Tönen gelobt. Er hatte bescheiden abgewinkt.
»Und das war’s dann mit Frauen«, hatte Friederike geschimpft, kaum dass sie von der feierlichen Zeremonie wieder zu Hause waren. »Ich werde irgendwann auch mal ein Museum gründen, aber dann nur für Frauen.«
Gretl, die zu diesem Zeitpunkt noch lebte, hatte das Kind zu besänftigen versucht, er hatte es geneckt. Aber er musste erkennen, dass er sich in seinen Mädels getäuscht hatte. Wenn die beiden sich etwas in den Kopf setzten, kämpften sie hartnäckig dafür. Er konnte es nicht leugnen, Friederike und Julie waren seine Töchter.
Zuerst hatte er es überhaupt nicht gern gesehen, dass Sophie Reinhard, die Malerin, nach Gretls Tod Friederike und ihre Schwester in ihren Plänen unterstützte.
»Aber was wollen Sie, Friedrich? Das Rad der Zeit anhalten?«
Nein, natürlich nicht. Und ein Unmensch war er auch nicht. Es gab unbestreitbar viele Fräuleins und Damen, die ebenso geistreiche Gespräche führen konnten wie Männer. Nicht wenige waren der Lektüre zugetan, einige fanden Gefallen an wissenschaftlichen Sujets, die selige Markgräfin Karoline Luise, diese gelehrte Frau, war ihnen Vorbild. Er hatte Durchlaucht noch erlebt, wie sie in Begleitung ihres Gemahls Carl Friedrich das Lyceum besuchte und sich mit ihm und den Schulkameraden unterhielt. Schon damals hatte er sich gewundert, wieso eine Frau solch umfassende Kenntnisse in Botanik und Medizin besaß. Sogar für Mathematik und Physik interessierte sie sich. In der Nacht hatte er von ihr geträumt, und sie war schön und liebreizend gewesen wie eine Elfe.