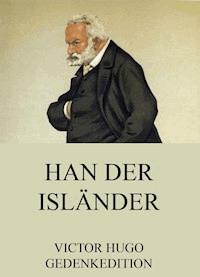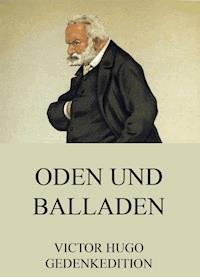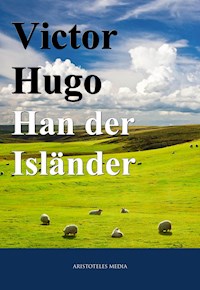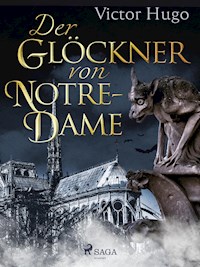
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Eifersucht, Folter und Hexenjagd – Victor Hugos Meisterwerk der Romantik, das im Spätmittelalter in der berühmten Pariser Kathedrale spielt: Im Zentrum dieses historischen Romans steht Quasimodo, der buckelige Glöckner von Notre Dame, der sich in die schöne Zigeunerin Esmeralda verliebt. Doch Esmeralda hat es auch dem Priester Dom Frollo, bei dem Quasimodo als Findelkind aufgewachsen ist, und dem Hauptmann Phoebus angetan...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
Der Glöckner von Notre-Dame
Übersetzt Walter Keiler
Saga
Der Glöckner von Notre-Dame ÜbersetztWalter Keiler OriginalNotre-Dame de ParisCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1831, 2020 Victor Hugo und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726643046
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Vor einigen Jahren fand der Verfasser dieses Buches, als er die Notre-Dame-Kirche besuchte oder, richtiger gesagt, als er die Kirche durchstöberte, in einem finsteren Schlupfwinkel eines ihrer Türme das mit der Hand in die Wand eingegrabene Wort: ANÁTKH («Verhängnis»).
Diese vom Alter geschwärzten und ziemlich tief in den Stein getriebenen griechischen Versalbuchstaben, gewisse, ich weiß nicht was für welche, der gotischen Schreibkunst eigentümliche Zeichen, vor allem der düstere und schicksalsschwere Sinn, den sie in sich schließen, frappierten den Verfasser außerordentlich. Er ging mit sich zu Rate und suchte zu erforschen, wer die gepeinigte Seele sein konnte, die nicht aus dieser Welt hatte scheiden mögen, ohne dieses Wundmal des Verbrechens oder des Unglücks auf dem Stein der altertümlichen Kirche zu hinterlassen. Seitdem hat man (ich weiß auch nicht, wer) die Wand getüncht oder abgekratzt, und die Inschrift ist verschwunden. Denn so verfährt man seit bald zwei Jahrhunderten mit den wundervollen Kirchen des Mittelalters. Die Verstümmelungen widerfahren ihnen von allen Seiten, von innen sowohl wie von außen. Der Priester tüncht sie; der Baumeister kratzt an ihnen herum; dann kommt das Volk hinzu, das sie zerstört.
So bleibt auch heute, außer dem fernen Gedenken, das ihm der Verfasser dieses Buches hier weiht, nichts übrig mehr von dem geheimnisvollen, auf dem finsteren Turm von Notre-Dame eingegrabenen Wort — nichts übrig mehr von dem unbekannten Schicksal, das es in so trübsinniger, schwermütiger Weise in sich begreift. Der Mensch, welcher dieses Wort auf die Wand geschrieben hat, ist seit Jahrhunderten aus der Mitte der Geschlechter getilgt — das Wort seinerseits ist von der Wand der Kirche getilgt — die Kirche selbst wird vielleicht bald von der Erde getilgt sein. Das Wort aber war der Anlaß, daß dieses Buch entstand.
Februar 1831
ERSTES KAPITEL
Es sind heute dreihundertachtundvierzig Jahre, sechs Monate und neunzehn Tage her, seitdem die Pariser beim Geläut aller Glocken der Altstadt, Universität und Neustadt erwachten.
Dieser sechste Januar 1482 aber war kein Tag, dessen sich die Geschichte erinnert. Es war nichts Merkwürdiges an dem Ereignis, das auf solche Weise die Glocken und die Bürgerschaft von Paris in früher Morgenstunde in Bewegung setzte. Denn am 6. Januar, der «den ganzen populus von Paris auf die Beine brachte», fand seit undenklicher Zeit die Doppelfeier des Dreikönigstages und des Narrenfestes statt. Es sollten an diesem Tage auf dem Grèveplatz Freudenfeuer, in der Braque-Kapelle die Maibaum-Pflanzung und im Gerichtssaal das Mysterienspiel stattfinden. Der Aufruf war schon am Abend vorher unter Trompetengeschmetter an den Straßenecken verkündet worden.
Die große Masse der Bürger und Bürgersfrauen machte sich darum, während Häuser und Läden geschlossen blieben, aus sämtlichen Gegenden her vom frühen Morgen an auf den Weg nach einem von den drei bezeichneten Plätzen. Das Volk strömte hauptsächlich in die Gänge und Korridore des Justizpalastes, weil es bekannt geworden war, daß die am Vorabend angekommenen vlämischen Gesandten sich vorgenommen hatten, der Aufführung des Mysteriums und der Wahl des Narrenpapstes, die sich gleichfalls in dem Hauptsaal vollziehen sollte, beizuwohnen.
Es war keine leichte Sache, an diesem Tage in den Hauptsaal zu dringen, obgleich er zur damaligen Zeit im Ruf des größten gedeckten Versammlungsraumes stand, den es auf Erden gab.
An den Toren, an den Fenstern, an den Luken, auf den Dächern drängten sich Abertausende von gutmütigen, ruhigen, ehrsamen Bürgersfrauen-Gesichtern, die den Palast und das Gewimmel anguckten und nach nichts anderem verlangten; denn viele Leute in Paris begnügen sich damit, Zuschauer zu sein, und eine Mauer, hinter welcher sich etwas ereignet, ist auch für uns schon eine sehr seltsame Sache. Wenn es uns heutigen Menschen nur möglich werden könnte, in Gedanken uns zu jenen Parisern des fünfzehnten Jahrhunderts zu gesellen und mit ihnen, gezerrt, gedrängt, gestoßen, in jenen gewaltigen und am 6. Januar 1482 doch so engen Gerichtssaal zu treten! Mitten im Saal, der Haupttür gegenüber, gegen die Mauer gestützt, in die man vermittels eines Schiebefensters von der goldenen Kammer her einen besonderen Eingang gefügt hatte, war eine mit Goldbrokat bekleidete Estrade errichtet worden, die für die vlämischen Gesandten und für die übrigen zur Darstellung des Mysteriums geladenen Persönlichkeiten bestimmt war. Auf der Plattform sollte, dem Brauch gemäß, das Schauspiel aufgeführt werden. Sie war seit dem Morgen zu diesem Zweck hergerichtet worden. Ihre reiche Marmortafel, die von den Hacken der prozeßführenden Anwaltschaft ganz zerkratzt und zerfurcht war, trug ein ziemlich hohes Kastengerüst, dessen obere, den Blicken des ganzen Saales zugängliche Fläche als Theater dienen sollte, während das durch Tapeten verhängte Innere den bei dem Schauspiel beschäftigten Personen als Ankleideraum bestimmt war. Eine in harmlosester Weise außen angerückte Leiter hatte den Zweck, die Verbindung zwischen der Schaubühne und dem Ankleidezimmer herzustellen; auf ihren Sprossen mußten Auftritte und Abgänge erfolgen. Jede Erscheinung, und wenn sie noch so unerwartet wirken sollte, jede Lösung oder Schürzung des Knotens, jede Wandlung oder Überraschung mußte auf dem Weg über diese Leiter bewirkt werden.
Vier Büttel des Palastamtmannes standen als obligate Wächter über die Volksvergnügungen an Fest- wie an Hinrichtungstagen kerzengrade an den vier Ecken der Marmortafel. Erst wenn der zwölfte Glockenschlag von der großen Turmuhr am Palast die Mittagszeit verkündete, sollte das Stück seinen Anfang nehmen. Es war dies für eine Theateraufführung zweifelsohne zu spät; aber man mußte sich hinsichtlich der Zeit nach der vlämischen Gesandtschaft richten.
Die ganze Volksmenge wartete nun seit dem Morgen. Eine stattliche Anzahl dieser ehrsamen und neugierigen Philister stand schon seit Tagesanbruch fröstelnd vor der großen Palasttreppe. Die Menge wurde mit jedem Augenblick dichter. Die Enge, die Ungeduld, die Langeweile, die Freiheit eines Rüpelund Narrentags, das Gezänke, das bei jeglichem Anlaß um eines spitzen Ellbogens oder beschlagenen Schuhes willen hervorbrach, die Anstrengung des langen Wartens — dies alles verursachte einen scharfen und bitteren Klang in den Worten des eingesperrten, eingeschachtelten, gedrängten, gezwängten, erstickten Volks. Man hörte nur Klagen und Verwünschungen gegen die Vlämischen, gegen den Obermeister der Kaufmannsgilden, den Kardinal von Bourbon, den Amtmann des Palastes, gegen Margarete von Österreich, gegen die Büttel mit den Stäben, gegen die Kälte, die Hitze, das schlechte Wetter, gegen den Bischof von Paris und gegen den Narrenpapst.
Alles dies diente zur mächtigen Erlustigung der Schülerbanden und Lakaienhaufen, die sich verstreut in dem Hause befanden. Eine Gruppe solch lustiger Teufel hatte sich, nachdem sie die Scheiben eines Fensters eingeschlagen hatte, keck auf das Gesims geschwungen. Von dort aus schossen ihre Blicke und Witzeleien abwechselnd in die Menge im Saal und die Menge auf dem Platz. Aus den Fratzen, die sie schnitten, aus ihrem schallenden Gelächter, aus den höhnischen Zurufen, die sie von einem Saalende zum anderen mit ihren Kameraden wechselten, ließ sich leicht schließen, daß dieses junge Studentenvolk die Langeweile und Beschwerde der übrigen Anwesenden nicht teilte.
«Meiner Seel! Ihr seid’s, Jean Frollo du Moulin?» schrie einer von ihnen einer Art von blondem Teufelchen mit hübscher und boshafter Fratze zu, das am Blattwerk eines Kapitells hing. «Ihr seid fürwahr mit Recht als ‹Mühlenhans› bekannt, denn Eure Arme und Eure Beine sehen aus wie die Windmühlenflügel. Wie lange seid Ihr denn schon hier?»
«Bei Satans Barmherzigkeit!» gab Jean Frollo zur Antwort, «an die vier Stunden sind’s, und ich will hoffen, daß sie mir dereinst von meiner Fegfeuerzeit abgezogen werden.»
Die Lustigkeit verdoppelte sich. Doch auch Gegenstimmen wurden laut.
«Schimpf und Schande, daß Schuljungen heutzutage solche Reden führen dürfen! Als ich so alt war, hätte man sie mit einem Rutenbesen gepeitscht und dann damit verbrannt!»
Da brach die ganze Bande los.
«Holla ho! Wer leiert denn diese Tonleiter? Wer ist denn dieser Unglückskauz?»
«Ich kenne ihn», rief einer, «’s ist Meister Andry Musnier.»
«Was, einer von den vier vereidigten Universitätsbuchhändlern?
Musnier, wir werden dir deine alten Schwarten verbrennen!» «Musnier, wir werden dir dein Weib verärgern!»
«Die liebe, gute, dicke Mamsell Oudarde!»
«Die so frisch ist und so lustig, als ob sie Wittib wäre!»
«Der Teufel soll euch holen!» brummte Meister Andry Musnier.
«Meister Andry», rief Jean wieder, der noch immer an seinem Kapitell hing, «schweig still, oder ich fall dir auf den Schädel!» Meister Andry blickte empor, schien eine Sekunde lang die Höhe der Säule und die Schwere des Schlingels abzuschätzen, multiplizierte im Geist dieses Gewicht mit dem Quadrat seiner Fallgeschwindigkeit und — verhielt sich mucksmäuschenstill. Jean fuhr als der Herr des Schlachtfelds im Triumph fort: «Ich tät’s, und wenn ich auch der Bruder eines Archidiakonus bin!»
«Schöne Herren, die Leute auf unserer Universität!» rief ein anderer der Studenten. «Nicht einmal an einem Tag wie dem heutigen respektieren sie unsere Vorrechte!»
«Nieder mit dem Rektor!» fiel Jean ein. «Nieder mit den Wahlmännern! Nieder mit den Staatsanwälten!»
«Heute abend werden wir mit Meister Andrys Schwarten ein Freudenfeuer anzünden», meinte der andere.
«Und mit den Schreiberpulten!» rief sein Nachbar.
«Und mit den Pedellstöcken!»
«Und mit den Spucknäpfen der Dekane!»
«Und mit den Aktenschränken der Staatsanwälte!»
«Und mit den Truhen der Wahlmänner!»
«Und mit dem Schemel des Rektors!»
«Nieder!» rief der kleine Jean wieder mit falscher Baßstimme, «nieder mit Meister Andry! Nieder mit den Pedellen und den Schreibern! Nieder mit den Theologen, den Ärzten und den Kirchenrechtslehrern! Nieder mit den Staatsanwälten, mit den Wahlmännern und mit dem Rektor!»
«Das bedeutet ja doch das Ende der Welt!» murmelte Meister Andry und stopfte sich die Ohren zu.
Plötzlich schrie einer der Studenten am Fenster:
«Achtung, der Rektor! Dort tritt er auf den Platz hinaus!»
Alle Gesichter wandten sich in die angegebene Richtung.
«Ist’s wirklich und wahrhaftig unser ehrwürdiger Rektor Meister Thibaut?» fragte Jean Frollo du Moulin, der, weil er sich an eine Säule im Saalinnern gehängt hatte, nicht sehen konnte, was draußen vorging.
«Jawohl, jawohl», antworteten alle andern; «er ist’s, er ist’s! Der Herr Rektor Thibaut!»
Es war wirklich der Rektor mit allen Würdenträgern der Universität, die sich in Prozession nach der Gesandtschaft begaben und in diesem Augenblick den Platz überquerten. Die am Fenster zusammengedrängten Schüler empfingen sie beim Vorbeimarsch mit spöttischen Bemerkungen und Beifallsrufen. Der Rektor, der die Spitze seiner Schar bildete, bekam die erste Tracht.
«Guten Tag, Herr Rektor! Holla ho! Guten Tag doch!»
«Wie geht denn das zu, daß der hier ist, der alte Spieler? Hat er denn seine Würfel im Stich gelassen?»
«Wie er einhertrabt auf seinem Maulesel! Das Tier hat weniger lange Ohren als er!»
«Holla ho! Guten Tag, mein Herr Rektor Thibaut! Alter Strohkopf! Alter Spieler!»
«Behüt Euch Gott! Habt Ihr heut nacht oft Doppelsechs geworfen?»
Dann kamen die anderen Würdenträger an die Reihe.
«Nieder mit den Pedellen! Nieder mit den Stabträgern!»
«Sag mir doch, Robert Poussepain, wer ist denn der da?»
«Das ist Gilbert de Suilly, der Kanzler vom Kolleg in Autun.»
«Da, hier hast du meinen Schuh! Du hast einen besseren Platz als ich — wirf ihn ihm ins Gesicht!»
Der Universitätsbuchhändler indes, Herr Andry Musnier, neigte sich zum Ohr des Pelz- und Rauchwarenlieferanten für die Gewandkammer des Königs, des Herrn Meisters Gilles Lecornu.
«Ich sage Ihnen, mein Nachbar, die Welt geht zu Ende! Solche Auswüchse der Schuljungenschaft hat man noch nie zuvor wahrgenommen! Die heillosen Erfindungen dieses Jahrhunderts sind’s, die alles verderben. Die Geschütze, Feldschlangen, Donnerbüchsen und vor allem die Buchdruckerkunst, diese aus Deutschland gekommene zweite Pest! Gibt’s kein Manuskript mehr, gibt’s auch kein Buch mehr! Der Buchdruck ertötet den Buchhandel. Ich sag’ Euch, das Weltende ist da!»
«Ich merke es auch daran, daß immer mehr Samtstoffe gekauft werden!» erwiderte der Pelzhändler.
In diesem Augenblick schlug es zwölf. Die Mittagsstunde war gekommen.
«Ha!» rief die ganze Menge wie aus einem Munde. Die Studentenschaft schwieg. Nun entstand ein großes Durcheinander, ein gewaltiges Gestampfe mit den Beinen und ein reges Schütteln der Köpfe — dann ein großer gemeinsamer Spektakel von Husten und Schnauben — ein jeder setzte sich zurecht, stellte sich zurecht, reckte sich zurecht, es bildeten sich Gruppen — dann eine tiefe Stille. Jeder Mund stand offen, jeder Blick richtete sich nach der Marmortafel. Nichts zeigte sich dort. Die vier Büttel des Palastamtmannes standen noch immer straff und unnahbar — bewegungslos gleich einer bemalten Bildsäule. Aller Augen wendeten sich nach der für die vlämische Gesandtschaft vorbehaltenen Estrade. Die Tür blieb geschlossen und die Estrade leer. Die Menge hier harrte seit dem Morgen auf drei Dinge: auf die Mittagszeit, auf die Gesandtschaft aus Flandern und auf das Mysterium. Bloß die Mittagszeit war pünktlich eingetreten.
Das war zu arg. Man wartete eine Minute, zwei, drei, fünf Minuten, eine Viertelstunde; nichts kam, nichts zeigte sich. Die Estrade blieb leer, das Theater blieb stumm. Zur Ungeduld hatte sich nun der Zorn gesellt. Ergrimmte Reden machten, allerdings noch mit leiser Stimme, die Runde.
«Das Mysterium! Das Mysterium!» flüsterte es überall dumpf. In der Menge gärte es. Ein Gewittersturm, der zunächst nur sein Grollen hören ließ, brodelte über dieser Menschenflut.
Jean Frollo du Moulin war’s, der den ersten Zündfunken hineinwarf.
«Das Mysterium! Und zum Teufel mit den vlämischen Bauern!» rief er aus voller Lungenkraft und wand sich wie eine Schlange um seinen Säulenknauf.
Die Menge klatschte mit den Händen.
«Das Mysterium!» schrie sie ihm nach, «und zu allen Teufeln mit Flandern!»
«Das Mysterium müssen wir haben, auf der Stelle haben!» rief der Schüler wieder, «oder ich schlage vor, wir hängen den Amtmann auf in Ermangelung von Komödie und Sittenspiel!» «Sehr gut gesagt!» schrie das Volk; «fangen wir das Hängen mit den Bütteln an!»
Rauschendes Beifallklatschen folgte. Die vier armen Teufel fingen an blaß zu werden und schauten sich verstohlen an. Die Menge drang auf sie ein. Schon sahen sie, wie das schmale Holzgeländer, das zwischen ihr und ihnen war, sich bog und unter dem Druck der Massen nachgab. Die Lage war kritisch. «Nieder mit ihnen!» schrie es von allen Seiten.
In diesem Augenblick hob sich der Tapetenvorhang des Ankleideraumes und gab einer Persönlichkeit den Weg frei, deren bloßer Anblick die Menge plötzlich aufhielt und ihren Zorn wie durch Zauberei in Neugierde wandelte.
«Silentium! Stille! Stille!» ertönte es ringsum.
Der Ankömmling, dem es gar nicht sehr behaglich zumute war, der im Gegenteil an allen Gliedern zitterte, trat unter einer gewaltigen Anzahl von Verbeugungen bis an den Rand der Marmortafel vor. Unterdes war die Ruhe langsam wieder hergestellt.
«Meine verehrten Herren Bürger», sprach er, «und meine verehrtesten Frauen Bürgerinnen! Wir sollen der Ehre teilhaftig werden, vor Seiner Eminenz dem Herrn Kardinal ein sehr schönes Sittenspiel des Titels ‹Das lautere Urteil der edlen Jungfrau Maria› zu sprechen und darzustellen. Ich, sehr geehrte Versammlung, mache den Jupiter. Seine Eminenz begleitet in diesem Augenblick die sehr ehrbare Gesandtschaft des Herrn Herzogs von Österreich, die zur gegenwärtigen Stunde dabei verweilt, an der Pforte von Baudet die Ansprache des Herrn Universitätsrektors anzuhören. Sobald der allerlauchte Herr Kardinal eingetroffen sein wird, werden wir sofort beginnen . . .»
Da verlor sich seine Stimme in einem Donner von Hohngeschrei.
«Fangt auf der Stelle an! Das Mysterium, sogleich das Mysterium!» raste das Volk. Und über alle Stimmen hinweg hörte man diejenige des Jean Frollo du Moulin, der das Getöse überschrie wie der Pfeifer bei einer Katzenmusik von Nîmes. «Fangt auf der Stelle an!» kreischte der Student.
«Auf der Stelle das Sittenspiel!» wiederholte die Menge. «Sogleich, sogleich! Den Sack und den Strick für die Komödianten und den Kardinal!»
Der arme hohläugige, verstörte, unter seiner Schminke erbleichte Jupiter ließ seinen Blitz fallen und griff mit der Hand nach seinem Zweispitz. Er wußte nicht, was er, wie er sprechen sollte. Im Grunde hatte die Furcht, gehenkt zu werden, ihn beschlichen. Gehenkt von der Volksmasse, weil er wartete — gehenkt vom Kardinal, weil er nicht gewartet hätte: so sah er auf beiden Seiten bloß ein einziges Ende, nämlich den Galgen. Zum Glück kam jemand herzu, ihn seiner Verlegenheit zu entreißen und die Verantwortung auf sich zu nehmen. Dieses Individuum, ein großer, magerer, bleicher, blonder, noch junger, wenn auch an Stirn und Mundwinkeln tiefe Falten aufweisender Mensch mit leuchtenden Augen und lächelnden Lippen, der in schwarzes, vom Alter zerschlissenes und glänzend gewordenes Sergezeug gekleidet war, näherte sich der Marmortafel und gab dem armen Dulder einen Wink. Der andere aber, völlig in Schrecken gejagt und verdutzt, sah nichts. Der neue Ankömmling trat noch einen Schritt vor.
«Jupiter!» rief er, «mein lieber Jupiter!»
Der andere hörte nicht das geringste. Endlich rief der lange Blonde, von Ungeduld ergriffen, fast unmittelbar vor seiner Nase:
«Michel Giborne!»
«Wer ruft nach mir?» sprach Jupiter, wie jäh aus dem Schlafe geschreckt.
«Ich», sagte die schwarzgekleidete Person.
«Ah!» machte Jupiter.
«Fangt auf der Stelle an!» nahm der andere wieder das Wort. «Befriedigt das Volk! Ich nehme es auf mich, den Herrn Justizamtmann zu besänftigen, der seinerseits den Herrn Kardinal besänftigen mag.»
Jupiter schöpfte Atem.
«Meine Herren städtischen Bürger!» schrie er mit aller Kraft seiner Lungen zu der Menge, die fortfuhr, ihn zu höhnen, «wir werden sogleich beginnen!»
Darauf ertönte ein ohrenbetäubendes Händeklatschen, und Jupiter war schon wieder unter seinem Tapetenvorhang verschwunden, als der Saal noch immer von beifälligen Zurufen erbebte. Die unbekannte Persönlichkeit indessen, die so zauberhaft den «Sturm zu Stille» gewandelt hatte, war bescheidentlich in das Halbdüster einer Säule zurückgetreten und wäre dort unzweifelhaft unsichtbar, unbeweglich und stumm verblieben, wäre sie nicht von zwei jungen Frauenzimmern von dort hinweggezogen worden, die in der ersten Zuschauerreihe ihren Platz gefunden und das Zwiegespräch mit Michel Giborne-Jupiter verfolgt hatten.
«Magister!» sagte die eine von ihnen, während sie ihm ein Zeichen gab, näherzukommen.
«Verhalten Sie sich doch still, liebe Liénarde», sprach ihre Nachbarin Gisquette, ein niedliches, frisches und in seinem Sonntagsstaat recht stattliches Mädchen. «Es ist ja kein Geistlicher, sondern ein Weltlicher; da darf man nicht ‹Magister›, da muß man ‹Herr› sagen.»
«Mein Herr!» wiederholte darauf Lienarde.
Der Unbekannte trat an das Geländer heran.
«Was wünschen Sie wohl von mir, meine Damen?» fragte er mit Diensteifer.
«Oh, nichts», sagte Liénarde ganz verwirrt; «meine Nachbarin Gisquette la Gencienne wollte Euch sprechen.»
«Nicht doch», antwortete Gisquette errötend; «Liénarde hat Euch mit ‹Magister› gerufen; ich habe ihr nur gesagt, daß man mit ‹Herr› zu rufen hat.»
Die beiden jungen Mädchen schlugen die Augen nieder. Der Fremde, der nichts anderes wünschte, als ein Gespräch anzuknüpfen, betrachtete sie mit lächelnder Miene.
«Sie haben mir also gar nichts zu sagen, meine Damen?»
«Oh, gar nichts!» antwortete Gisquette.
«Nichts!» sagte Liénarde.
Der lange, junge, blonde Mensch tat einen Schritt, um sich zurückzuziehen. Die beiden neugierigen Frauenzimmer hatten aber keine Lust, ihn freizugeben.
«Mein Herr», begann Gisquette von neuem, «wird denn dieses Mysterium hübsch werden?»
«Zweifelsohne», antwortete er. Dann setzte er mit einer gewissen Emphase hinzu: «Meine Damen! Ich bin sein Verfasser!»
«Wahrhaftig?» riefen die jungen Mädchen ganz verdutzt.
«Wahrhaftig!» antwortete der Dichter, sich leicht in die Brust werfend, «das heißt, wir sind unser zwei: Jean Marchand, der das Gerüst zum Theater aufgeführt hat, und ich, der ich das Stück gemacht habe. Mein Name ist Pierre Gringoire.»
Schon eine geraume Zeit war verflossen seit dem Augenblick, da Jupiter wieder unter dem Tapetenvorhang verschwunden war. Studiosus Jean war indes keineswegs eingeschlafen.
«Holla ho!» schrie er plötzlich in das friedfertige Warten hinein, das auf den Wirrwarr gefolgt war, «Jupiter! Heilige Jungfrau! Gaukler des Satans! Foppt ihr uns? Das Stück! Das Stück! Fangt an — oder wir fangen wieder an!»
Weiteres war nicht nötig. Eine Musik von hohen und tiefen Instrumenten ward aus dem Innern des Gerüstes vernehmlich. Der Tapetenvorhang hob sich. Vier buntscheckige, geschminkte Personen kamen zum Vorschein, kletterten die steile Theaterleiter hinauf und stellten sich, auf der oberen Plattform angelangt, in Reih und Glied vor dem Publikum auf, vor welchem sie sich tief verneigten. Darauf schwieg die Musik. Das Mysterium fing endlich an. Die vier Personen begannen, nachdem sie für ihre Komplimente den reichsten Lohn in Beifallsklatschen eingeheimst hatten, inmitten eines gläubigen Schweigens einen Prolog zu sprechen.
Es hätte viel böser Wille dazu gehört, um aus dem poetischen Inhalt des Prologs nicht zu begreifen, daß in Gestalt der vier allegorisch die Arbeit mit dem Handel, die Geistlichkeit mit dem Adel vermählt war.
In dieser Menschenmenge, auf welche die Sprecher nach bestem Können Fluten von Metaphern ergossen, gab es kein aufmerksameres Ohr, kein schlagenderes Herz, kein unruhigeres Auge, keinen gestreckteren Hals als das Auge, das Ohr, den Hals und das Herz des Verfassers, des Dichters, jenes braven Pierre Gringoire, der im Augenblick zuvor der Freude, den beiden hübschen Mädchen seinen Namen zu sagen, nicht hatte widerstehen können. Er war ein paar Schritte von ihnen entfernt hinter seinen Pfeiler zurückgetreten, und dort hörte er, sah er, dort weidete er sich an allem. Das wohlwollende Beifallsgeklatsch, das den Anfang seines Prologs bewillkommnet hatte, hallte noch in seinem Innersten wider, und er war ganz und gar vertieft in jene Art von verzückter Betrachtung, mit welcher ein Verfasser seine Gedanken Stück für Stück aus dem Munde des Darstellers in die Stille einer großen Zuhörerschaft gleiten sieht oder hört. Ehrsamer Pierre Gringoire! Aber diese erste Ekstase wurde sehr schnell zerstört. Kaum hatte Gringoire seinen Lippen jenen berauschenden Becher der Wonne und des Triumphes genähert, als ein Wermutstropfen sich darein mischen sollte.
Ein zerlumpter Bettler, welcher, verirrt mitten in der Menge, nicht hatte betteln können und in den Taschen seiner Nachbarn keinen ausreichenden Schadenersatz gefunden haben mochte, war auf den Einfall gekommen, sich auf irgendeinem scharf in die Augen springenden Punkt niederzulassen, um die Blicke und damit womöglich Almosen auf sich zu lenken. Er hatte sich infolgedessen während der ersten Verse des Prologs mit Hilfe der Pfeiler an der für das Publikum gesperrten Estrade emporgearbeitet. Dort hatte er seinen Sitz genommen, um die Aufmerksamkeit und das Mitleid der Menge mit seinen Lumpen und durch eine häßliche Wunde, die seinen rechten Arm bedeckte, wachzurufen. Im übrigen redete er kein Wort. Das Schweigen, das er wahrte, ließ den Prolog ohne Hindernis vonstatten gehen. Keinerlei merkliche Störung wäre eingetreten, wenn nicht das Unglück es gewollt hätte, daß der Student Jean von der Höhe seiner Säule herab den Bettler und seine Firlefanzereien bemerkte. Ein närrisches Gelächter bemächtigte sich des jungen Taugenichts, der, ohne sich darum zu scheren, daß er das Schauspiel störte und die allgemeine Aufmerksamkeit und Sammlung in Verwirrung brachte, lustig hinunterschrie:
«Ei, seht doch den siechen Kerl, der um Almosen bettelt!»
Gringoire zitterte, als ob ihn ein elektrischer Schlag erschüttert hätte. Der Prolog blieb stecken, und alle Köpfe drehten sich lärmend nach dem Bettler herum, der, statt aus der Fassung zu geraten, in diesem Zwischenfall vielmehr eine günstige Gelegenheit zur Ernte sah und mit schmerzzerrissener Miene, die Augen halb schließend, zu rufen anfing:
«Eine milde Gabe, wenn Sie geruhen wollen!»
«Holla doch, bei meiner Seele!» rief Jean; «das ist ja Clopin Trouillefou! Holla, Freund! Hat dich denn deine Wunde am Bein geniert, daß du sie dir auf den Arm gelegt hast?»
Der Bettler nahm, ohne zu mucksen, Almosen und Spott hin und fuhr mit jämmerlicher Stimme fort:
«Eine milde Gabe, wenn Sie geruhen wollen!»
Dieser Zwischenfall hatte die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft erheblich abgelenkt. Gringoire war äußerst unzufrieden. Nachdem er sich von seiner Bestürzung erholt hatte, ermannte er sich so weit, den vier auf der Bühne stehenden Personen zuzurufen:
«Fahrt doch fort! Teufel auch, so fahrt doch fort!»
In diesem Augenblick fühlte er sich am Saume seines Mantels gezupft. Er drehte sich um, nicht ohne einigen Verdruß, und es kostete ihn Mühe, ein Lächeln zu zeigen. Es blieb ihm indes nichts weiter übrig. Es war der hübsche Arm Gisquettes, der durch das Geländer gegriffen und seine Aufmerksamkeit so wachgerufen hatte.
«Sagen Sie doch, mein Herr», fragte das junge Mädchen, «werden sie denn fortfahren?»
«Ohne Zweifel», antwortete Gringoire, von der Frage ziemlich unangenehm berührt.
«In diesem Falle, mein Herr», bat sie weiter, «hätten Sie wohl die Höflichkeit, mir auseinanderzusetzen —»
«Was sie sagen werden?» unterbrach Gringoire. «Nun, dann hören Sie doch zu!»
«Nein!» meinte Gisquette, «sondern was sie bis jetzt gesagt haben.»
Gringoire machte einen Satz wie ein Mensch, in dessen Wunde man den Finger legt.
«Die Pest über dich, dummes, vernageltes Ding!» brummte er zwischen den Zähnen. Von diesem Augenblick an war Gisquette für ihn eine abgetane Sache.
Die Schauspieler hatten jedoch seiner Aufforderung gehorcht, und das Publikum, als es sah, daß sie erneut zu sprechen anfingen, hatte sich wieder darein gefügt, zuzuhören — freilich nicht ohne daß ihm bei der Art der Lötung, wie die beiden Teile des so plötzlich unterbrochenen Stückes zusammengeschweißt wurden, mancherlei Schönheiten entgingen. Gringoire stellte diese bittere Betrachtung bei sich ganz leise an. Die Ruhe war indes allmählich wiederhergestellt; der Bettler zählte einiges Kleingeld in seinem Hut. Das Schauspiel hatte endgültig die Oberhand gewonnen, als die weithin schallende Stimme des Türstehers verkündete:
«Seine Eminenz der hochwürdige, gnädige Herr Kardinal von Bourbon!»
Was Gringoire befürchten mußte, verwirklichte sich nur allzu sehr. Der Eintritt Seiner Eminenz brachte die Zuhörerschaft außer Rand und Band. Alle Köpfe wendeten sich nach der Estrade. Es war kein Wort mehr zu verstehen.
«Der Kardinal! Der Kardinal!» wiederholte ein Mund wie der andere. Der unglückliche Prolog geriet zum zweiten Male ins Stocken.
Der Kardinal blieb einen Augenblick auf der Schwelle der Estrade stehen. Während er einen ziemlich gleichgültigen Blick über die Zuhörerschaft schweifen ließ, verdoppelte sich der Tumult. Jeder wollte Seine Eminenz am besten sehen.
Es war in der Tat eine bedeutsame Persönlichkeit, deren Anblick wohl jedem Schauspiel gleichkam. Charles, Kardinal von Bourbon, Erzbischof und Graf von Lyon, Primas beider Gallien, war zugleich verwandt mit Ludwig XI. durch seinen Bruder Pierre, Seigneur von Beaujeu, der die älteste Tochter des Königs geehelicht hatte, und durch seine Mutter, Agnes von Burgund, verwandt mit Karl dem Kühnen. Im übrigen war er ein guter Mensch. Er führte ein vergnügliches Kardinalsleben, erfreute sich gern an dem königlichen Gewächs von Chaluau, gab hübschen Dirnen lieber ein Almosen als alten Weibern und war aus allen diesen Gründen beim Volk von Paris sehr wohlgelitten. Darüber hinaus war der Herr Kardinal von Bourbon ein stattlicher Mann, der mit außerordentlichem Anstand ein sehr schönes rotes Gewand trug; aus diesem Umstand folgte, daß er die ganze Frauen- und Damenwelt, und infolgedessen den stärkeren Teil der Zuhörerschaft, für sich hatte.
Er trat also ein, begrüßte die Versammlung mit jenem bei den großen Herren erblichen Lächeln für das Volk und verfügte sich mit langsamen Schritten nach seinem scharlachnen Samtsessel, mit einer Miene, die auf Beschäftigung mit allerhand anderen Dingen deutete. Diese Sorge, die ihm auf den Fersen folgte und fast zur nämlichen Zeit wie er den Fuß auf die Estrade setzte, war die Gesandtschaft von Flandern. Der Kardinal drehte sich, und zwar mit der bestmöglichen Huld der Welt, nach der Tür herum, als der Türsteher mit weithin schallender Stimme verkündete:
«Die Herren Gesandten des gnädigen Herrn Herzogs von Österreich!»
Nunmehr kämen, paarweise, voller Gravität, die achtundvierzig Gesandten Maximilians von Österreich. In der Versammlung trat eine von ersticktem Lachen begleitete Stille ein, da man alle die kauderwelschen Namen und bürgerlichen Klassifizierungen vernehmen wollte, die eine jede von diesen Persönlichkeiten, ohne sich irremachen zu lassen, in schier unerschütterlicher Weise dem Türsteher bekanntgab, welcher sodann Namen, Rang und Titel in buntem Wirrwarr und greulich verstümmelt mitten hinein in die Menge warf.
Es waren richtige vlämische Köpfe, würdige und strenge Gestalten vom Schlage jener, die Rembrandt so kräftig und ernst auf dem schwarzen Hintergrund seiner «Nachtwache» herausgehoben hat; Persönlichkeiten, denen sämtlich auf der Stirn geschrieben stand, daß Maximilian «vollen Grund» hatte, wie es in seinem diesbezüglichen Erlaß hieß, «auf ihren Sinn, auf ihre Tapferkeit, Erfahrung, Treue und auf ihren ehrlichen Willen sich zu verlassen».
Einen indes ausgenommen, und das war ein feines, pfiffiges, verschlagenes Gesicht, eine Art von «Affen- und Diplomaten-Visage», welcher der Kardinal drei Schritt entgegenging und vor der er eine tiefe Verbeugung machte; trotzdem hieß diese Persönlichkeit schlichtweg nur Wilhelm Rym, Rat und Pensionär der Stadt Gent.
Während der Pensionär von Gent und die Eminenz sich gegenseitig ein sehr tiefes Kompliment machten und mit noch tieferer Stimme ein paar Worte wechselten, zeigte sich ein Mann von hoher Gestalt, mit breitem Gesicht und gewaltigen Schultern im Eingang, um neben Wilhelm Rym die Estrade zu betreten. Es war, als wenn sich eine Dogge neben einen Fuchs drängte. Sein Zweispitz aus Filz und sein ledernes Koller erschienen gewissermaßen wie ein Fleck mitten in diesem Sammet und dieser Seide. In der Meinung, einen verlaufenen Stallknecht vor sich zu haben, hielt der Türsteher ihn fest.
«Heda, Freundchen, hier ist kein Eingang!»
Der Mann mit dem Lederkoller stieß ihn mit einem Ruck der Schulter zurück.
«Was will der Hansdampf von mir?» rief er mit einer Stimme, so laut, daß der ganze Saal auf dieses seltsame Zwiegespräch aufmerksam wurde. «Siehst du nicht, daß ich hierher gehöre?» «Euer Name?» fragte der Türsteher.
«Jakob Coppenole.»
«Euer Stand und Rang?»
«Strumpfwirker, mit dem Schilde ‹Zu den drei Kettchen› in Gent.»
Der Türsteher fuhr zurück. Stuhlschöppen und Bürgermeister anzukündigen ging noch an; aber einen Strumpfwirker, das war hart. Der Kardinal stand wie auf Nadeln. Das ganze Volk sah und hörte. Zwei Tage nun plagte sich schon Seine Eminenz, diese vlämischen Bären zu lecken, um sie dem Volk ein wenig vorstellungsfähiger zu machen, und nun ein solch gröbliches Geschehnis! Wilhelm Rym trat indes mit seinem pfiffigen Lächeln an den Türsteher heran.
«Rufen Sie aus: Meister Jakob Coppenole, Schöppenstuhlschreiber der Stadt Gent!» blies er ihm leise ein.
«Türsteher!» ergriff nun auch der Kardinal mit lauter Stimme das Wort, «verkündigt: Meister Jakob Coppenole, Schöppenstuhlschreiber der erlauchten Stadt Gent!»
Das war ein Fehlgriff. Wilhelm Rym allein hätte die Schwierigkeit spielend beseitigt; aber den Kardinal hatte Coppenole verstanden.
«Nein, beim Kreuze Jesu!» rief er mit seiner Donnerstimme.
«Jakob Coppenole, Strumpfwirker! Verstehst du, Türsteher? Nichts mehr, nichts weniger. Beim Kreuze Jesu, Strumpfwirker, das ist genug. Der Herr Erzherzog hat mehr als einmal seinen Handschuh in meinen Hosen gesucht.»
Gelächter und Klatschen erschallte. Ein schlechter Witz wird in Paris sofort verstanden und mithin immer beklatscht. Setzen wir hinzu, daß Coppenole wie das ihn hier umgebende Publikum aus dem Volk stammte. Deshalb war die Beziehung zwischen ihnen und ihm im Nu, elektrisch, sozusagen stehenden Fußes, bewirkt worden. Der hochmütige Ausfall des vlämischen Strumpfwirkers hatte, da er die Hofleute demütigte, in sämtlichen plebejischen Gemütern ein gewisses, im fünfzehnten Jahrhundert noch unklares und undeutlich zutage tretendes Würdigkeitsgefühl aufgerüttelt. Er war einer von ihrem Stand, ihrem Schlag, dieser Strumpfwirker, der eben dem Herrn Kardinal die Stirn geboten hatte!
Coppenole begrüßte Seine Eminenz mit Stolz, und der Kardinal erwiderte den Gruß des allvermögenden, von Ludwig XI. gefürchteten Bürgers. Dann, während Wilhelm Rym den beiden mit spöttischem und überlegenem Lächeln folgte, begaben sie sich jeder auf seinen Platz, Seine Eminenz ganz außer Fassung und voller Sorgen, Coppenole ruhig und hochmütig. Indes war für den armen Kardinal noch nicht alles zu Ende, und er mußte den Becher, sich in so schlechter Gesellschaft zu befinden, bis zur Neige leeren!
Die Ankunft der erlauchten Gäste hatte jenen frechen Bettler durchaus nicht vermocht, seine Beute fahren zu lassen, und während Prälaten und Gesandte sich wie richtige holländische Heringe in die Verschläge der Tribünen zusammenpferchten, hatte er sich bequem hingestreckt und die Beine auf dem Schwibbogen keck übereinandergeschlagen. Die Unverschämtheit war beispiellos, und niemand hatte sie im ersten Augenblick bemerkt, da sich die Aufmerksamkeit anderswohin richtete. Er seinerseits ließ sich durch nichts im Saale stören, wiegte mit neapolitanischer Sorglosigkeit den Kopf hin und her und wiederholte von Zeit zu Zeit in dem Lärmen mit der Gewohnheit einer Maschine: «Ein Almosen, wenn die Herrschaften geruhen wollen!» Und ganz gewiß war er in der ganzen Versammlung der einzige, welcher sich nicht herbeigelassen hatte, bei der Auseinandersetzung zwischen Coppenole und dem Türsteher den Kopf zu drehen.
Nun wollte es der Zufall, daß der Genter Strumpfwirkmeister, mit dem das Volk so lebhaft sympathisierte und auf den aller Augen gerichtet waren, gerade in die erste Reihe oberhalb des Bettlers zu sitzen kam, und das Erstaunen war nicht gering, als man den vlämischen Gesandten, sobald er den unter seinen Augen postierten Strolch beaugenscheinigt hatte, ihm freundschaftlich auf die mit Lumpen bedeckte Schulter klopfen sah. Der Bettler drehte sich um; auf beiden Gesichtern stand Erstaunen, Dankbarkeit, Freude zu lesen; dann fingen der Strumpfwirker und der Sieche, ohne sich im geringsten um die Welt der Zuschauer zu bekümmern, mit leiser Stimme an zu plaudern; dabei ruhten beider Hände ineinander, und die Lumpen Clopin Trouillefous, die sich über den Goldstoff der Estrade breiteten, machten den Eindruck einer Raupe auf einer Apfelsine.
Die Neuartigkeit dieses merkwürdigen Schauspiels erregte einen solchen Sturm von Narrheit und Lustigkeit im Saal, daß der Kardinal nicht umhin konnte, von ihm Notiz zu nehmen. Er beugte sich also über die Brüstung, und da er von dem Standpunkt, auf den ihn die Festordnung gewiesen hatte, das abscheuliche Bettlerkleid Trouillefous nur sehr unvollkommen sehen konnte, bildete er sich ganz naturgemäß ein, daß der Strolch um Almosen bitte, und rief, über solche Verwegenheit empört:
«Herr Palastamtmann! Werft diesen Schlingel in den Fluß!»
«Beim Kreuze Jesu, hochwürdiger Herr Kardinal!» sagte da Coppenole, ohne Clopins Hand loszulassen, «das ist ja einer von meinen Freunden.»
«Juchhe, juchhe!» schrie der Haufen. Von diesem Augenblick an hatte Coppenole wie in Gent, auch in Paris gewaltiges Ansehen beim Volke gefunden.
Seit der Kardinal eingetreten war, hatte Gringoire nicht aufgehört, sich um das Wohlergehen seines Prologs zu beunruhigen. Er hatte zuerst den in Ungewißheit schwebenden Darstellern auferlegt, fortzufahren und die Stimmen zu verstärken; dann, als er sah, daß niemand zuhörte, hatte er ihnen Halt geboten, und seit etwa einer Viertelstunde — so lange dauerte nun die Störung — hatte er nicht eine Sekunde aufgehört, mit dem Fuße zu stampfen und sich um Aufmerksamkeit für das Stück zu bemühen. Alles umsonst! Kein einziger wandte den Blick von dem Kardinal, von der Gesandtschaft und von der Estrade, dem alleinigen Mittelpunkt dieses weitumfassenden Kreises. Man darf übrigens auch glauben, und wir sprechen dies zu unserem Leidwesen aus, daß der Prolog die Zuhörerschaft seit dem Augenblick, da Seine Eminenz das Interesse von ihm abgelenkt hatte, einigermaßen zu langweilen anfing. Schließlich war es auf der Estrade wie auf der marmornen Tafel immer das nämliche Schauspiel: der Konflikt zwischen Arbeit und Geistlichkeit, zwischen Adel und Handel. Und viele Leute sahen sie lieber lebendig und leibhaftig, so wie sie atmeten und handelten, sich stießen und drängten, in Fleisch und Knochen, in jener vlämischen Gesandtschaft, in diesem bischöflichen Hof, unter dem Talar des Kardinals, unter dem Koller Coppenoles, als geschminkt, herausstaffiert, in Versen plappernd und sozusagen ausgestopft und ausgefüttert unter den gelben und weißen Röcken, mit denen Gringoire sie vermummt hatte.
Als unser Dichter indessen sah, daß die Ruhe ein bißchen wiederzukehren anfing, drängte er sich möglichst weit in die Menge vor und fing mit lauter Stimme an zu schreien:
«Fangt wieder von vorn an mit dem Mysterium! Fangt wieder von vorn an!»
«Teufel auch!» rief Jean Frollo du Moulin, «was plärren die Kerle dort unten am Ende? Sagt, Kameraden! Ist das Mysterium denn noch nicht zu Ende? Sie wollen’s von vorn wieder anfangen — das ist nicht in der Ordnung!»
«Nein, nein!» riefen sämtliche Schüler. «Nieder mit dem Mysterium! Nieder damit!»
Dieses Geschrei zog die Aufmerksamkeit des Kardinals auf sich. Er winkte den Justizamtmann herbei. Dieser näherte sich Seiner Eminenz und erklärte, nicht ohne sehr für seinen Frieden zu fürchten, stotternd die populäre Ungebührlichkeit und Kopflosigkeit: daß die Mittagsstunde vor Seiner Eminenz gekommen und die Darsteller zum Anfang gezwungen worden seien, ohne den Eintritt Seiner Eminenz abzuwarten.
Der Kardinal schüttelte sich vor Lachen.
«Meiner Treu! Was sagen Sie dazu, Meister Wilhelm Rym?»
«Gnädigster und hochwürdigster Herr», antwortete Wilhelm Rym, «erklären wir uns zufrieden damit, daß wir der Hälfte der Komödie entgangen sind. Etwas gewonnen ist immer dabei!»
«Können die Halunken also mit ihrer Posse weitermachen?» fragte der Amtmann.
«Fahrt fort! Fahrt fort!» sagte der Kardinal; «mir ist’s gleichgültig. Ich will inzwischen mein Brevier lesen.»
Der Amtmann trat an den Rand der Estrade vor und rief, nachdem er mit einer Handbewegung Schweigen geboten hatte: «Bürger, Sassen und Einwohner! Um diejenigen, welche den Wiederanfang, und diejenigen, welche den Schluß begehren, zufriedenzustellen, befiehlt Seine Eminenz die Fortsetzung des Spiels!»