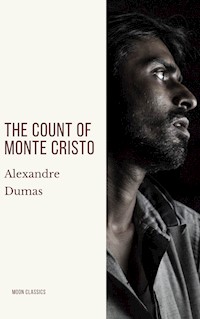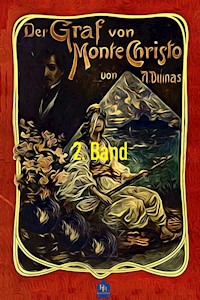
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dantès stellt Nachforschungen an über seine einstigen Freunde und über diejenigen, denen er Rache geschworen hat. Dabei tritt er in verschiedenen Verkleidungen und unter verschiedenen Namen auf. Er besucht Caderousse, seinen einstigen Nachbarn, der jetzt einen heruntergekommenen Landgasthof führt. Von ihm erfährt er auch, dass die Beteiligten gesellschaftlich aufgestiegen sind und hohe Positionen bekleiden. Sein eigener Vater ist an Hunger und Gram gestorben. Sein einstiger Förderer, der Reeder Morrel, steht kurz vor dem Bankrott. In dieser Situation der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung greift Dantès als rettender Engel ein. Neun Jahre lang bereitet Dantès seinen Rachefeldzug vor. Er erkundet die Lebensumstände der Verhassten bis ins kleinste Detail und entdeckt dabei, dank unglaublicher Zufälle, noch weitere von ihnen begangene Schandtaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Graf von Monte Christo, 2. Band
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Walter Brendel
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Impressum
Kapitel 28. Das Gefängnisregister
Kapitel 29. Das Haus von Morrel & Son
Kapitel 30. Der fünfte September
Kapitel 31. Italien: Sindbad der Seefahrer
Kapitel 32. Das Erwachen
Kapitel 33. Römische Banditen
Kapitel 34. Das Kolosseum
Kapitel 35. La Mazzolata
Kapitel 36. Der Karneval zu Rom
Kapitel 37. Die Katakomben des Heiligen Sebastian
Kapitel 38. Das Rendezvous
Kapitel 39. Die Gäste
Kapitel 40. Das Frühstück
Kapitel 41. Die Präsentation
Kapitel 42. Monsieur Bertuccio
Kapitel 43. Das Haus in Auteuil
Kapitel 44. Die Rache
Kapitel 45. Der Blutregen
Kapitel 46. Unbegrenzter Kredit
Kapitel 47. Die gefleckten Grauen
Kapitel 28. Das Gefängnisregister
Am Tag nach dem, an dem sich die eben beschriebene Szene auf der Straße zwischen Bellegarde und Beaucaire abgespielt hatte, ein Mann von etwa dreißig oder zweiunddreißig Jahren, gekleidet in einen hellblauen Gehrock, eine Nankeen-Hose und eine weiße Weste , der das Aussehen und den Akzent eines Engländers hatte, stellte sich dem Bürgermeister von Marseille vor.
„Sir“, sagte er, „ich bin Prokurist des Hauses Thomson & French in Rom. Wir sind seit zehn Jahren mit dem Haus Morrel & Son in Marseille verbunden. Wir haben ungefähr hunderttausend Francs auf ihre Wertpapiere geliehen, und wir sind ein wenig beunruhigt über Berichte, die uns erreicht haben, dass die Firma am Rande des Ruins steht. Ich bin daher per Eilboten aus Rom gekommen, um Sie um Auskunft zu bitten.“
„Sir“, antwortete der Bürgermeister. „Ich weiß sehr gut, dass das Unglück M. Morrel in den letzten vier oder fünf Jahren zu verfolgen schien. Er hat vier oder fünf Schiffe verloren und drei oder vier Bankrotte erlitten; aber es steht mir nicht zu, obwohl ich selbst Gläubiger in Höhe von zehntausend Francs bin, über den Stand seiner Finanzen Auskunft zu geben. Fragen Sie mich als Bürgermeister, was ich von M. Morrel halte, und ich werde sagen, dass er ein bis zum letzten Grad ehrenhafter Mann ist, der bis zu diesem Zeitpunkt jede Verpflichtung mit gewissenhafter Pünktlichkeit erfüllt hat. Das ist alles, was ich sagen kann, mein Herr; wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an M. de Boville, den Inspektor der Gefängnisse, Nr. 15, Rue de Nouailles; er hat, glaube ich, zweihunderttausend Francs in Morrels Händen, und falls es irgendeinen Grund zur Besorgnis gibt, da dies ein größerer Betrag ist als meiner.“
Der Engländer schien diese extreme Delikatesse zu schätzen, machte eine Verbeugung und entfernte sich mit einem typisch britischen Schritt in Richtung der erwähnten Straße.
Herr de Boville war in seinem Privatzimmer, und der Engländer machte, als er ihn bemerkte, eine überraschte Geste, die darauf hinzudeuten schien, dass es nicht das erste Mal war, dass er in seiner Gegenwart war. Was Herrn von Boville betrifft, so war er in einem solchen Zustand der Verzweiflung, dass es offensichtlich war, dass alle Fähigkeiten seines Geistes, die in den Gedanken versunken waren, der ihn im Augenblick beschäftigte, weder seinem Gedächtnis noch seiner Vorstellungskraft erlaubten, dorthin abzuschweifen die Vergangenheit.
Der Engländer sprach ihn mit der Gelassenheit seiner Nation mit fast ähnlichen Worten an, mit denen er den Bürgermeister von Marseille angesprochen hatte.
„Oh, mein Herr“, rief Herr de Boville aus, „Ihre Befürchtungen sind leider zu begründet, und Sie sehen einen verzweifelten Mann vor sich. Mir wurden zweihunderttausend Francs in die Hände von Morrel & Son gelegt; diese zweihunderttausend Francs waren die Mitgift meiner Tochter, die in vierzehn Tagen heiraten sollte, und diese zweihunderttausend Francs waren zu zahlen, die Hälfte am 15. dieses Monats und die andere Hälfte am 15. des nächsten Monats. Ich hatte M. Morrel von meinem Wunsch informiert, diese Zahlungen pünktlich zu erhalten, und er war innerhalb der letzten halben Stunde hier, um mir mitzuteilen, wenn sein Schiff, die Pharaon , am 15. nicht in den Hafen einlaufen würde, wäre er vollständig kann diese Zahlung nicht leisten.“
„Aber“, sagte der Engländer, „das sieht sehr nach Zahlungsaufschub aus.“
„Es sieht eher nach Insolvenz aus!“ rief Herr de Boville verzweifelt aus.
Der Engländer schien einen Moment nachzudenken und sagte dann: „Woher es den Anschein hat, Sir, dass dieser Kredit Sie mit beträchtlicher Besorgnis erfüllt?“
„Um die Wahrheit zu sagen, ich halte es für verloren.“
"Nun, dann werde ich es Ihnenabkaufen!"
"Sie?"
"Ja ich!"
„Aber natürlich zu einem enormen Preisnachlass?“
„Nein, für zweihunderttausend Franken. Unser Haus“, fügte der Engländer lachend hinzu, „macht das nicht so.“
„Und Sie werden bezahlen –“
„Das Geld liegt bereit.“
Und der Engländer zog aus seiner Tasche ein Bündel Banknoten, das vielleicht das Doppelte der Summe gewesen wäre, die Herr de Boville zu verlieren befürchtete. Ein Freudenstrahl huschte über Monsieur de Bovilles Gesicht, doch er bemühte sich um Selbstbeherrschung und sagte:
„Mein Herr, ich muss Ihnen sagen, dass Sie aller Wahrscheinlichkeit nach sechs Prozent dieser Summe nicht realisieren werden.“
„Das ist nicht meine Angelegenheit“, erwiderte der Engländer, „das ist die Angelegenheit des Hauses Thomson & French, in dessen Namen ich handele. Sie haben vielleicht ein Motiv, den Ruin einer konkurrierenden Firma zu beschleunigen. Aber alles, was ich weiß, mein Herr, ist, dass ich bereit bin, Ihnen diese Summe im Austausch gegen Ihre Abtretung der Schuld auszuhändigen. Ich frage nur einen Makler.“
„Das ist natürlich vollkommen gerecht“, rief Herr de Boville. „Die Provision beträgt normalerweise anderthalb; wollen Sie zwei – drei – fünf Prozent oder noch mehr? Was auch immer du sagst."
„Sir“, erwiderte der Engländer lachend, „ich bin wie mein Haus und tue solche Dinge nicht – nein, der Auftrag, den ich verlange, ist ein ganz anderer.“
„Nennen Sie es, Sir, ich bitte.“
„Sie sind der Inspektor der Gefängnisse?“
„Das bin ich seit vierzehn Jahren.“
„Sie führen die Ein- und Ausreiseregister?“
"Ich tue es."
„Zu diesen Registern gibt es Anmerkungen zu den Gefangenen?“
„Über jeden Gefangenen gibt es Sonderberichte.“
„Nun, mein Herr, ich wurde in Rom von einem armen Teufel von Abbé erzogen, der plötzlich verschwand. Seitdem habe ich erfahren, dass er im Château d'If eingesperrt war, und ich würde gerne einige Einzelheiten seines Todes erfahren.“
"Was war sein Name?"
„Der Abbé Faria.“
"Oh, ich erinnere mich genau an ihn," rief Herr de Boville; "Er war verrückt."
„Das haben sie gesagt.“
„Oh, das war er entschieden.“
„Sehr wahrscheinlich; aber was war das für ein Wahnsinn?“
„Er gab vor, einen immensen Schatz zu kennen, und bot der Regierung enorme Summen an, wenn sie ihn befreien würden.“
„Armer Teufel! – Und er ist tot?“
„Ja, Sir, vor fünf oder sechs Monaten, letzten Februar.“
„Sie haben ein gutes Gedächtnis, Sir, um sich so gut an Daten zu erinnern.“
"Ich erinnere mich daran, weil der Tod des armen Teufels von einem einzigartigen Vorfall begleitet wurde."
"Darf ich fragen, was das war?" sagte der Engländer mit einem neugierigen Ausdruck, den ein aufmerksamer Beobachter mit Erstaunen in seinem phlegmatischen Gesichtsausdruck entdeckt hätte.
„Oh je, ja, mein Herr; der Kerker des Abbé war vierzig oder fünfzig Fuß von dem eines Abgesandten Bonapartes entfernt – einer von denen, die 1815 am meisten zur Rückkehr des Usurpators beigetragen hatten, ein sehr entschlossener und sehr gefährlicher Mann.“
"In der Tat!" sagte der Engländer.
"Ja", antwortete Herr de Boville; „Ich selbst hatte 1816 oder 1817 Gelegenheit, diesen Mann zu sehen, und wir konnten nur mit einer Reihe von Soldaten in sein Verlies gehen. Dieser Mann machte einen tiefen Eindruck auf mich; Ich werde sein Antlitz nie vergessen!“
Der Engländer lächelte unmerklich.
»Und Sie sagen, Sir«, warf er ein, »dass die beiden Kerker …«
„Waren durch eine Entfernung von fünfzig Fuß getrennt; aber es scheint, dass dieser Edmond Dantès …«
»Der Name dieses gefährlichen Mannes war …«
„Edmond Dantes. Es scheint, Sir, dass dieser Edmond Dantès Werkzeuge beschafft oder hergestellt hatte, denn sie fanden einen Tunnel, durch den die Gefangenen miteinander in Verbindung standen.“
„Dieser Tunnel wurde zweifellos mit Fluchtabsicht gegraben?“
"Ohne Zweifel; aber unglücklicherweise für die Gefangenen hatte der Abbé Faria einen Anfall von Katalepsie und starb.“
„Das muss die Fluchtpläne vereitelt haben.“
„Für den Toten, ja“, antwortete Herr de Boville, „aber nicht für den Überlebenden; im Gegenteil, dieser Dantès sah ein Mittel, um seine Flucht zu beschleunigen. Er dachte ohne Zweifel, dass Gefangene, die im Château d'If starben, auf einem gewöhnlichen Friedhof begraben würden, und er brachte den Toten in seine eigene Zelle, nahm seinen Platz in dem Sack ein, in den sie den Leichnam genäht hatten , und wartete auf den Moment der Beerdigung.“
„Es war ein mutiger Schritt, der Mut gezeigt hat“, sagte der Engländer.
„Wie ich Ihnen bereits sagte, Sir, war er ein sehr gefährlicher Mann und glücklicherweise hat er durch seine eigene Tat die Regierung von den Befürchtungen, die sie für ihn hatte, in Verlegenheit gebracht.“
"Wie war das?"
"Wie? Verstehen Sie nicht?“
"Nein."
"Das Château d'If hat keinen Friedhof, und sie werfen die Toten einfach ins Meer, nachdem sie eine sechsunddreißig Pfund schwere Kanonenkugel an ihren Füßen befestigt haben."
"Warum?" beobachtete den Engländer, als sei er begriffsstutzig.
„Nun, sie befestigten einen 36-Pfund-Ball an seinen Füßen und warfen ihn ins Meer.“
"Wirklich!" rief der Engländer.
„Ja, Sir“, fuhr der Gefängnisinspektor fort. „Sie können sich das Erstaunen des Flüchtlings vorstellen, als er kopfüber über die Felsen geschleudert wurde! Ich hätte in diesem Moment gerne sein Gesicht gesehen.“
„Das wäre schwierig gewesen.“
„Macht nichts“, erwiderte De Boville in höchster guter Laune über die Gewissheit, seine zweihunderttausend Francs wiederzuerlangen, „egal, ich kann es mir vorstellen.“ Und er schrie vor Lachen.
„Ich auch“, sagte der Engländer und lachte auch; aber er lachte, wie es die Engländer tun, „am Ende seiner Zähne“.
„Und so“, fuhr der Engländer fort, der sich zuerst beruhigt hatte, „ist er ertrunken?“
"Zweifellos."
„Damit der Gouverneur gleichzeitig den gefährlichen und den verrückten Gefangenen losgeworden ist?“
"Genau."
„Aber ich nehme an, es wurde ein offizielles Dokument zu dieser Angelegenheit erstellt?“ fragte der Engländer.
„Ja, ja, die Leichenschau. Sie verstehen, Dantès' Verwandte, falls er welche hatte, könnten ein Interesse daran haben, zu wissen, ob er tot oder lebendig ist.“
„Damit sie jetzt, wenn es etwas von ihm zu erben gibt, dies mit gutem Gewissen tun können. Er ist tot, und daran besteht kein Zweifel.“
"Oh ja; und sie können die Tatsache beglaubigen lassen, wann immer sie wollen.“
„So sei es“, sagte der Engländer. „Aber um auf diese Register zurückzukommen.“
„Es stimmt, diese Geschichte hat unsere Aufmerksamkeit von ihnen abgelenkt. Verzeihung."
„Entschuldigung wofür? Für die Geschichte? Auf keinen Fall; es kommt mir wirklich sehr merkwürdig vor.“
„Ja, in der Tat. Also, mein Herr, Sie möchten alles sehen, was mit dem armen Abbé zu tun hat, der wirklich die Sanftheit selbst war.“
„Ja, Sie werden mir sehr gefällig sein.“
„Gehen wir in mein Arbeitszimmer, und ich zeige es Ihnen.“
Und beide betraten das Arbeitszimmer von Herrn de Boville. Alles war hier in perfekter Ordnung angeordnet; jedes Register hatte seine Nummer, jeder Aktenordner seinen Platz. Der Inspektor bat den Engländer, sich in einen Lehnsessel zu setzen, legte ihm das Register und die Dokumente des Château d'If vor und gab ihm so viel Zeit, wie er für die Prüfung wünschte, während De Boville sich in eine Ecke setzte und begann seine Zeitung zu lesen. Der Engländer fand leicht die Einträge bezüglich des Abbé Faria; aber es schien, dass ihn die Geschichte, die der Inspektor erzählt hatte, sehr interessierte, denn nachdem er die ersten Dokumente gelesen hatte, blätterte er die Blätter um, bis er zu der Aussage über Edmond Dantès kam. Dort fand er alles geordnet, die Anklage, die Untersuchung, die Petition von Morrel, die Randbemerkungen von M. de Villefort. Er faltete die Anklage leise zusammen und steckte sie ebenso leise in seine Tasche; las die Prüfung und sah, dass der Name von Noirtier darin nicht erwähnt wurde; las auch den Antrag vom 10. April 1815, in dem Morrel auf Anraten des stellvertretenden Procureurs (denn Napoleon saß damals auf dem Thron) die Dienste, die Dantès der kaiserlichen Sache erwiesen hatte, in bester Absicht übertrieb – Dienste, die Villeforts Zertifikate unbestreitbar gemacht. Dann durchschaute er das Ganze. Diese von Villefort zurückgehaltene Petition an Napoleon war bei der zweiten Restauration in den Händen des königlichen Anwalts zu einer schrecklichen Waffe gegen ihn geworden.
Er wunderte sich nicht mehr, als er bei der Suche im Register diesen Vermerk fand, der in Klammern neben seinem Namen stand:
Edmond Dantes.
Ein eingefleischter Bonapartist; nahm aktiv an der Rückkehr von der Insel Elba teil.
In strenger Einzelhaft gehalten und streng überwacht und bewacht werden.
Unter diesen Zeilen stand von fremder Hand geschrieben: „Siehe Anmerkung oben – nichts kann getan werden.“
Er verglich die Schrift in der Klammer mit der Schrift der Bescheinigung unter Morrels Petition und entdeckte, dass die Notiz in der Klammer die gleiche Schrift war wie die Bescheinigung – das heißt, in Villeforts Handschrift.
Was die Begleitnotiz anbelangt, verstand der Engländer, dass sie möglicherweise von einem Inspektor hinzugefügt worden war, der sich vorübergehend für Dantès' Situation interessiert hatte, der es aber nach den von uns zitierten Bemerkungen unmöglich fand, ihm irgendeine Wirkung zu verleihen das Interesse, das er gespürt hatte.
Wie gesagt, der Inspektor hatte sich aus Diskretion und um den Schüler des Abbé Faria bei seinen Nachforschungen nicht zu stören, in eine Ecke gesetzt und las Le Drapeau Blanc . Er sah nicht, wie der Engländer die von Danglars unter der Laube von La Réserve geschriebene Anklage mit dem Poststempel „Marseille, 27. Februar, Zustellung 6 Uhr, PM“ zusammenfaltete und in seine Tasche steckte.
Aber es muss gesagt werden, dass er, wenn er es gesehen hätte, diesem Stück Papier so wenig Bedeutung beimaß und seinen zweihunderttausend Francs so viel Bedeutung beimaß, dass er sich nicht dagegen gewehrt hätte, was auch immer der Engländer tun würde, wie unregelmäßig es auch sein mag sein.
„Danke“, sagte dieser und schloss die Akte mit einem Knall, „ich habe alles, was ich will; jetzt ist es an mir, mein Versprechen zu erfüllen. Geben Sie mir eine einfache Abtretung Ihrer Schulden; bestätige darin den Erhalt des Geldes, und ich werde dir das Geld aushändigen.“
Er erhob sich, überließ Herrn de Boville seinen Platz, der ihn ohne Umschweife einnahm, und entwarf schnell die erforderliche Aufgabe, während der Engländer auf der anderen Seite des Schreibtisches die Banknoten zählte.
Kapitel 29. Das Haus von Morrel & Son
Ein jeder, der Marseille vor einigen Jahren verlassen hatte und mit dem Inneren von Morrels Lagerhaus gut vertraut war und zu diesem Zeitpunkt zurückgekehrt war, hätte eine große Veränderung gefunden. Statt dieser Lebens-, Behaglichkeits- und Fröhlichkeitsluft, die ein florierendes und prosperierendes Geschäftshaus durchdringt – statt fröhlicher Gesichter an den Fenstern, geschäftiger Angestellter, die in den langen Gängen hin und her eilen – statt des mit Warenballen gefüllten Hofes , die von den Schreien und Witzen der Träger widerhallten, hätte man sofort alle Aspekte von Traurigkeit und Düsternis wahrgenommen. Von all den zahlreichen Angestellten, die früher den verlassenen Korridor und das leere Büro gefüllt hatten, blieben zwei übrig. Einer war ein junger Mann von drei oder vierundzwanzig Jahren, der in M. Morrels Tochter verliebt war, und war trotz der Bemühungen seiner Freunde, ihn zum Rückzug zu bewegen, bei ihm geblieben; der andere war ein alter einäugiger Kassierer namens „Cocles“ oder „Cockeye“, ein Spitzname, den ihm die jungen Männer gegeben hatten, die früher diesen riesigen, jetzt fast verlassenen Bienenstock bevölkerten und der seinen so vollständig ersetzt hatte richtigen Namen, den er aller Wahrscheinlichkeit nach niemandem geantwortet hätte, der ihn damit anredete.
Cocles blieb im Dienst von M. Morrel, und in seiner Position hatte eine höchst einzigartige Änderung stattgefunden; er war zugleich zum Kassierer aufgestiegen und zum Diener herabgesunken. Er war jedoch derselbe Cocles, gut, geduldig, hingebungsvoll, aber unnachgiebig in Sachen Arithmetik, dem einzigen Punkt, in dem er der Welt, sogar M. Morrel, standgehalten hätte; und stark im Einmaleins, das er an seinen Fingerspitzen hatte, egal welches Schema oder welche Falle ihm gestellt wurde, um ihn zu fangen.
Inmitten der Katastrophen, die das Haus heimsuchten, blieb Cocles der einzige, der sich nicht bewegte. Aber das entsprang nicht einem Mangel an Zuneigung; im Gegenteil, aus fester Überzeugung. Wie die Ratten, die das dem Untergang geweihte Schiff nach und nach verlassen, noch bevor das Schiff Anker lichtet, so hatten all die zahlreichen Angestellten nach und nach das Büro und das Lager verlassen. Cocles hatte sie gehen sehen, ohne daran zu denken, nach dem Grund ihrer Abreise zu fragen. Alles war, wie gesagt, für Cocles eine Frage der Arithmetik, und während zwanzig Jahren hatte er alle Zahlungen immer so genau gesehen, dass es ihm unmöglich schien, dass das Haus die Zahlungen einstellen sollte, wie es einem Müller das würde der Fluss, der so lange seine Mühle gedreht hatte, sollte aufhören zu fließen.
Bis jetzt war nichts geschehen, um Cocles' Glauben zu erschüttern; die letzte Monatszahlung war mit der gewissenhaftesten Genauigkeit geleistet worden; Cocles hatte in seinem Bargeld einen Überschuss von vierzehn Sous festgestellt und sie am selben Abend zu M. Morrel gebracht, der sie mit einem melancholischen Lächeln in eine fast leere Schublade warf und sagte:
„Danke, Cocles; Sie sind die Perle der Kassierer.“
Cocles ging vollkommen glücklich davon, denn diese Lobpreisung von Herrn Morrel, selbst die Perle der ehrlichen Männer von Marseille, schmeichelte ihm mehr als ein Geschenk von fünfzig Kronen. Aber seit Ende des Monats hatte M. Morrel viele ängstliche Stunden hinter sich.
Um die dann fälligen Zahlungen zu leisten; Er hatte alle seine Mittel gesammelt, und aus Angst, dass der Bericht über seine Not in Marseille im Ausland verbreitet werden könnte, als er bekanntermaßen zu einem solchen Extrem gebracht wurde, ging er zum Jahrmarkt von Beaucaire, um den Schmuck seiner Frau und seiner Tochter und einen Teil davon zu verkaufen seines Tellers. Damit war das Ende des Monats vorbei, aber seine Mittel waren nun erschöpft. Dank der Berichte über Wasser war kein Kredit mehr zu haben; und um die am 15. des laufenden Monats fälligen 100.000 Francs und die am 15. des nächsten Monats an M. de Boville fälligen 100.000 Francs zu bezahlen, hatte M. Morrel in Wirklichkeit keine andere Hoffnung als die Rückkehr der Pharao, von dessen Abfahrt er von einem Schiff erfahren hatte, das gleichzeitig Anker gelichtet hatte und bereits im Hafen angekommen war.
Aber dieses Schiff, das wie der Pharao aus Kalkutta kam, war seit vierzehn Tagen dort, ohne dass vom Pharao eine Nachricht erhalten worden war .
Dies war der Stand der Dinge, als sich am Tag nach seiner Unterredung mit M. de Boville, dem vertraulichen Schreiber des Hauses Thomson & French in Rom, bei M. Morrel vorstellte.
Emmanuel empfing ihn; dieser junge Mann war durch das Erscheinen jedes neuen Gesichts beunruhigt, denn jedes neue Gesicht konnte das eines neuen Gläubigers sein, der ängstlich kam, um den Leiter des Hauses zu befragen. Der junge Mann, der seinem Arbeitgeber den Schmerz dieses Gesprächs ersparen wollte, befragte den Neuankömmling; aber der Fremde erklärte, dass er M. Emmanuel nichts zu sagen habe und dass seine Angelegenheit mit M. Morrel persönlich zu tun habe.
Emmanuel seufzte und rief Cocles zu sich. Cocles erschien, und der junge Mann bat ihn, den Fremden zu M. Morrels Wohnung zu führen. Cocles ging voran, und der Fremde folgte ihm. Auf der Treppe begegneten sie einem schönen Mädchen von sechzehn oder siebzehn Jahren, das den Fremden besorgt ansah.
"M. Morrel ist in seinem Zimmer, nicht wahr, Mademoiselle Julie?« sagte der Kassierer.
"Ja; Das glaube ich zumindest«, sagte das junge Mädchen zögernd. „Geh und sieh nach, Cocles, und wenn mein Vater da ist, melde diesen Herrn.“
„Es ist sinnlos, mich anzukündigen, Mademoiselle“, entgegnete der Engländer. "M. Morrel kennt meinen Namen nicht. Dieser würdige Herr muss nur den vertraulichen Angestellten des Hauses Thomson & French in Rom bekannt geben, mit dem Ihr Vater Geschäfte macht.“
Das junge Mädchen wurde blass und stieg weiter hinab, während der Fremde und Cocles weiter die Treppe hinaufstiegen. Sie betrat das Büro, in dem Emmanuel war, während Cocles mit Hilfe eines Schlüssels, den er besaß, eine Tür in der Ecke eines Treppenabsatzes auf der zweiten Treppe öffnete, den Fremden in ein Vorzimmer führte, eine zweite Tür öffnete, die er hinter ihm geschlossen, und nachdem er den Angestellten des Hauses von Thomson & French allein gelassen hatte, kehrte er zurück und winkte ihm, dass er eintreten könne.
Der Engländer trat ein und fand Morrel an einem Tisch sitzend vor, wo er die beeindruckenden Spalten seines Hauptbuchs umblätterte, die die Liste seiner Verbindlichkeiten enthielten. Beim Anblick des Fremden schloss M. Morrel das Hauptbuch, erhob sich und bot dem Fremden einen Platz an; und als er ihn sitzen gesehen hatte, nahm er seinen eigenen Stuhl wieder ein. Vierzehn Jahre hatten den würdigen Kaufmann verändert, der in seinem sechsunddreißigsten Jahr bei der Eröffnung dieser Geschichte jetzt in seinem fünfzigsten war; sein Haar war weiß geworden, Zeit und Kummer hatten tiefe Furchen in seine Stirn gepflügt, und sein Blick, einst so fest und durchdringend, war jetzt unentschlossen und schweifend, als fürchtete er, gezwungen zu sein, seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Person zu richten.
Der Engländer sah ihn mit einem Hauch von Neugier an, der offensichtlich mit Interesse vermischt war. „Monsieur“, sagte Morrel, dessen Unbehagen durch diese Untersuchung noch verstärkt wurde, „Sie möchten mit mir sprechen?“
„Ja, mein Herr; wissen Sie, von wem ich komme?“
„Das Haus von Thomson & French, zumindest sagt mir das mein Kassierer.“
„Er hat es Ihnen richtig gesagt. Das Haus Thomson & French hatte diesen Monat in Frankreich 300.000 oder 400.000 Francs zu zahlen; und im Wissen um Ihre strenge Pünktlichkeit haben Sie alle mit Ihrer Unterschrift versehenen Wechsel eingesammelt und mir bei Fälligkeit berechnet, sie vorzulegen und das Geld anderweitig zu verwenden.“
Morrel seufzte tief und fuhr sich mit der Hand über die schweißbedeckte Stirn.
»Also, Sir«, sagte Morrel, »haben Sie meine Wechsel?«
„Ja, und für eine beträchtliche Summe.“
"Was ist der Betrag?" fragte Morrel mit einer Stimme, die er sich bemühte, fest zu machen.
„Hier ist“, sagte der Engländer und nahm eine Menge Papiere aus seiner Tasche, „eine Abtretung von 200.000 Franken an unser Haus von Herrn de Boville, dem Inspektor der Gefängnisse, denen sie zustehen. Sie erkennen natürlich an, dass Sie ihm diese Summe schulden?“
"Ja; Er hat mir das Geld vor fast fünf Jahren zu viereinhalb Prozent in die Hand gegeben.“
"Wann zahlen Sie?"
„Die Hälfte des 15. dieses Monats, die Hälfte des 15. des nächsten.“
"Einfach so; und jetzt sind hier 32.500 Franken in Kürze fällig; Sie sind alle von Ihnen unterschrieben und von den Inhabern unserem Haus zugeordnet.“
„Ich erkenne sie wieder“, sagte Morrel, dessen Gesicht verfärbt war, als er dachte, dass er zum ersten Mal in seinem Leben nicht in der Lage sein würde, seine eigene Unterschrift zu würdigen. "Ist das alles?"
„Nein, ich habe für Ende des Monats diese Rechnungen, die uns vom Haus Pascal und dem Haus Wild & Turner in Marseille zugeteilt wurden, die sich auf fast 55.000 Franken belaufen; insgesamt 287 500 Franken.»
Es ist unmöglich zu beschreiben, was Morrel während dieser Aufzählung erlitten hat. „Zweihundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Franken“, wiederholte er.
„Ja, Sir“, antwortete der Engländer. „Ich werde Ihnen nicht verheimlichen“, fuhr er nach einem Moment des Schweigens fort, „dass, obwohl Ihre Redlichkeit und Genauigkeit bis zu diesem Augenblick allgemein anerkannt sind, in Marseille doch die Meldung im Gange ist, dass Sie Ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen können. ”
Bei dieser fast brutalen Rede wurde Morrel totenbleich.
„Mein Herr“, sagte er, „bis zu diesem Zeitpunkt – und es ist jetzt mehr als vierundzwanzig Jahre her, seit ich die Leitung dieses Hauses von meinem Vater erhalten habe, der es selbst fünfunddreißig Jahre lang geleitet hatte – noch nie wurde etwas mit der Unterschrift von Morrel & Son entehrt.“
„Das weiß ich“, antwortete der Engländer. "Aber da ein Ehrenmann einem anderen antworten sollte, sagen Sie mir ehrlich, werden Sie diese mit der gleichen Pünktlichkeit bezahlen?"
Morrel schauderte und sah den Mann an, der mit mehr Selbstsicherheit sprach, als er bisher gezeigt hatte.
„Auf offen gestellte Fragen“, sagte er, „sollte eine klare Antwort gegeben werden. Ja, ich werde bezahlen, wenn mein Schiff, wie ich hoffe, sicher ankommt; denn seine Ankunft wird mir wieder den Kredit verschaffen, den mir die zahlreichen Unfälle, deren Opfer ich geworden bin, geraubt haben; aber wenn die Pharao verloren gehen sollte und diese letzte Ressource weg ist –“
Die Augen des armen Mannes füllten sich mit Tränen.
"Nun", sagte der andere, "wenn diese letzte Ressource Sie versagt?"
„Nun“, entgegnete Morrel, „es ist grausam, das sagen zu müssen, aber da ich bereits an Unglück gewöhnt bin, muss ich mich an Scham gewöhnen. Ich fürchte, ich werde gezwungen sein, die Zahlung auszusetzen.“
„Haben Sie keine Freunde, die Ihnen helfen könnten?“
Morrel lächelte traurig.
„Im Geschäft, mein Herr“, sagte er, „hat man keine Freunde, nur Kokurennten.“
"Es ist wahr", murmelte der Engländer; "Dann haben Sie nur eine Hoffnung."
"Aber ja."
"Das Letzte?"
"Das Letzte."
„Sollte dies fehlschlagen –“
„Ich bin ruiniert, – ganz ruiniert!“
„Als ich auf dem Weg hierher war, lief ein Schiff in den Hafen ein.“
„Ich weiß es, mein Herr; ein junger Mann, der immer noch an meinem gefallenen Glück festhält, verbringt einen Teil seiner Zeit in einem Belvedere im Dachgeschoss des Hauses, in der Hoffnung, mir als erster gute Nachrichten zu verkünden; er hat mich über die Ankunft dieses Schiffes informiert.“
„Und es ist nicht Ihres?“
„Nein, es ist ein Schiff aus Bordeaux, La Gironde; sie kommt auch aus Indien; aber sie ist nicht mein Schiff.“
„Vielleicht hat sie mit dem Pharao gesprochen und bringt Ihnen Neuigkeiten von ihr?“
„Soll ich Ihnen eines klar sagen, Sir? Ich fürchte mich fast so sehr davor, Nachrichten von meinem Schiff zu erhalten, als im Zweifel zu bleiben. Ungewissheit ist immer noch Hoffnung.“ Dann fügte Morrel leise hinzu: „Diese Verzögerung ist nicht natürlich. Der Pharao verließ Kalkutta am 5. Februar; sie hätte schon vor einem Monat hier sein sollen.“
"Was ist das?" sagte der Engländer. "Was hat dieses Geräusch zu bedeuten?"
"Oh mein Gott!" rief Morrel und erbleichte, „was ist denn?“
Auf der Treppe war ein lautes Geräusch von Menschen zu hören, die sich hastig bewegten, und halb ersticktes Schluchzen. Morrel erhob sich und ging zur Tür; aber seine Kraft verließ ihn und er sank auf einen Stuhl. Die beiden Männer blieben einander gegenüber, Morrel zitterte an allen Gliedern, der Fremde blickte ihn mit tiefem Mitleid an. Der Lärm hatte aufgehört; aber es schien, dass Morrel etwas erwartete – etwas hatte den Lärm verursacht, und etwas musste folgen. Der Fremde glaubte, Schritte auf der Treppe zu hören; und dass die Schritte, die die von mehreren Personen waren, an der Tür anhielten. Ein Schlüssel steckte im Schloss der ersten Tür, und das Knarren von Scharnieren war zu hören.
„Es gibt nur zwei Personen, die den Schlüssel zu dieser Tür haben“, murmelte Morrel, „Cocles und Julie.“
In diesem Augenblick öffnete sich die zweite Tür, und das junge Mädchen erschien mit tränenüberströmten Augen. Morrel erhob sich zitternd und stützte sich an der Stuhllehne ab. Er hätte gesprochen, aber seine Stimme versagte ihm.
„Ach, Vater!“ sagte sie und faltete ihre Hände, „vergib deinem Kind, dass es der Überbringer böser Botschaften ist.“
Morrel änderte erneut die Farbe. Julie warf sich in seine Arme.
„Ach, Vater, Vater!“ murmelte sie, "Mut!"
„Die Pharao ist also untergegangen?“ sagte Morrel mit heiserer Stimme. Das junge Mädchen sprach nicht; aber sie machte mit ihrem Kopf ein bejahendes Zeichen, als sie an der Brust ihres Vaters lag.
„Und die Besatzung?“ fragte Morrel.
„Überlebt“, sagte das Mädchen; „gerettet von der Besatzung des Schiffes, das gerade in den Hafen eingelaufen ist.“
Morrel hob seine beiden Hände mit einem Ausdruck von Resignation und erhabener Dankbarkeit zum Himmel.
„Danke, mein Gott“, sagte er, „wenigstens triffst du nur mich allein.“
Eine Träne befeuchtete das Auge des phlegmatischen Engländers.
„Kommen Sie herein, kommen Sie herein“, sagte Morrel, „denn ich nehme an, Sie stehen alle an der Tür.“
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, trat Madame Morrel bitterlich weinend ein. Emmanuel folgte ihr, und im Vorzimmer waren die rauen Gesichter von sieben oder acht halbnackten Matrosen zu sehen. Beim Anblick dieser Männer zuckte der Engländer zusammen und trat einen Schritt vor; dann hielt er sich zurück und zog sich in die entfernteste und dunkelste Ecke der Wohnung zurück. Madame Morrel setzte sich neben ihren Mann und nahm eine seiner Hände in ihre, Julie lag immer noch mit ihrem Kopf auf seiner Schulter, Emmanuel stand in der Mitte des Zimmers und schien das Bindeglied zwischen Morrels Familie und den Matrosen an der Tür zu bilden.
"Wie ist es passiert?" sagte Morrel.
„Komm näher, Penelon“, sagte der junge Mann, „und erzähl uns alles darüber.“
Ein alter Seemann, von der Tropensonne gebräunt, kam näher und drehte die Reste eines Hutes zwischen seinen Händen.
„Guten Tag, Monsieur Morrel“, sagte er, als hätte er gerade am Vorabend Marseille verlassen und sei soeben aus Aix oder Toulon zurückgekehrt.
„Guten Tag, Penelon“, entgegnete Morrel, der sich ein Lächeln unter Tränen nicht verkneifen konnte, „wo ist der Kapitän?“
„Der Kapitän, M. Morrel, – er ist krank in Palma zurückgeblieben; aber bitte Gott, es wird nicht viel sein, und Sie werden ihn in ein paar Tagen ganz lebendig und munter sehen.“
„Nun, jetzt erzählen Sie Ihre Geschichte, Penelon.“
Penelon rollte sein Priem in der Wange, legte die Hand vor den Mund, drehte den Kopf und schickte einen langen Strahl Tabaksaft in das Vorzimmer, rückte mit dem Fuß vor, balancierte sich aus und begann.
„Sehen Sie, Monsieur Morrel“, sagte er, „wir waren irgendwo zwischen Cape Blanc und Cape Boyador und segelten nach einer Woche Windstille mit einer leichten Brise Süd-Südwest, als Kapitän Gaumard auf mich zukam – ich war dabei das Ruder zu befestigen – und sagt: „Penelon, was hältst du von diesen Wolken, die da drüben aufziehen?“ Ich habe sie mir gerade selbst angeschaut. „Was denke ich, Kapitän? Warum ich denke, dass sie schneller aufsteigen, als sie etwas zu tun haben, und dass sie nicht so schwarz wären, wenn sie keinen Unfug meinen.“ – „Das ist auch meine Meinung,“ sagte der Kapitän, „und ich werde entsprechende Vorkehrungen treffen. Wir tragen zu viel Leinwand. Vorwärts, alle Hände! Nehmen Sie die beschlagenen Segel auf und verstauen Sie die fliegende Fock.' Es war an der Zeit; Die Bö war auf uns, und das Schiff begann zu krängen. „Ah,“ sagte der Kapitän, „wir haben noch zu viel Segeltuch gespannt. Alle Mann setzen das Großsegel! „Fünf Minuten später war es unten; und wir segelten unter Mizzen-Toppsegeln und top-ritterlichen Segeln. „Nun, Penelon“, sagte der Kapitän, „was bringt Sie dazu, den Kopf zu schütteln?“ „Warum“, sage ich, „ich finde immer noch, dass du zu viel anhast.“ „Ich glaube, Sie haben recht,“ antwortete er, „wir werden einen Sturm haben.“ 'Ein Sturm? Mehr als das, wir werden einen Sturm haben, oder ich weiß nicht, was ist.“ Man konnte den Wind kommen sehen wie den Staub in Montredon. Zum Glück verstand der Kapitän sein Handwerk. „Nehmen Sie zwei Reffs in den Toppsegeln ein,“ rief der Kapitän. ‚Lass die Bowlins los, hol die Stütze, hol die top-galanten Segel ein, hol die Riffgeräte auf die Rahen.'
„Das reichte für diese Breitengrade nicht“, sagte der Engländer; „Ich hätte vier Reffs in den Marssegeln nehmen und den Spanker einrollen sollen.“
Seine feste, sonore und unerwartete Stimme ließ alle aufschrecken. Penelon legte die Hand über die Augen und starrte dann den Mann an, der damit die Manöver seines Kapitäns kritisierte.
„Wir haben es besser gemacht, Sir“, sagte der alte Matrose respektvoll. „Wir stellen das Ruder auf, um vor dem Sturm zu laufen; Zehn Minuten, nachdem wir unsere Toppsegel gesetzt hatten und unter nackten Stangen hindurchgerutscht waren.“
„Das Schiff war sehr alt, um das zu riskieren“, sagte der Engländer.
„Eh, das war es, was das Geschäft gemacht hat; Nachdem wir zwölf Stunden lang heftig aufgeschlagen hatten, brach ein Leck aus. „Penelon“, sagte der Kapitän, „ich glaube, wir sinken, geben Sie mir das Ruder und gehen Sie in den Laderaum hinunter.“ Ich gab ihm das Ruder und stieg hinab; es gab bereits einen Meter Wasser. 'Alle Hände an die Pumpen!' Ich schrie; aber es war zu spät, und es schien, je mehr wir pumpten, desto mehr kamen herein. „Ah,“ sagte ich nach vier Stunden Arbeit, „da wir sinken, lassen Sie uns sinken; wir können nur einmal sterben.' „Ist das dein Beispiel, Penelon?“ schreit der Kapitän. "Sehr gut, warten Sie eine Minute." Er ging in seine Kabine und kam mit einem Paar Pistolen zurück. ‚Ich werde dem ersten Mann, der die Pumpe verlässt, das Gehirn ausblasen‘, sagte er.“
"Gut erledigt!" sagte der Engländer.
„Nichts macht so viel Mut wie gute Gründe“, fuhr der Matrose fort; „Und während dieser Zeit hatte der Wind nachgelassen, und das Meer war gesunken, aber das Wasser stieg weiter; nicht viel, nur zwei Zoll pro Stunde, aber es stieg trotzdem. Zwei Zoll pro Stunde scheinen nicht viel zu sein, aber in zwölf Stunden macht das zwei Fuß, und drei, die wir vorher hatten, macht das fünf. „Kommen Sie“, sagte der Kapitän, »wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, und M. Morrel wird uns nichts vorzuwerfen haben, wir haben versucht, das Schiff zu retten, jetzt wollen wir uns selbst retten. Zu den „Booten, meine Jungs, so schnell ihr könnt.“ „Nun“, fuhr Penelon fort, „sehen Sie, M. Morrel, ein Seemann ist mit seinem Schiff verbunden, aber noch mehr mit seinem Leben, also haben wir nicht darauf gewartet, es zweimal zu sagen; umso mehr, als das Schiff unter uns versank und zu sagen schien: 'Kommt voran - rettet euch!' Wir starteten bald das Boot, und alle acht von uns kamen hinein. Der Kapitän stieg zuletzt ab, oder besser gesagt, er stieg nicht ab, er würde das Schiff nicht verlassen; also nahm ich ihn um die Taille und warf ihn ins Boot, und dann sprang ich hinter ihm her. Es war an der Zeit, denn gerade als ich aufsprang, zerbarst das Deck mit einem Geräusch wie von der Breitseite eines Kriegsschiffes. Zehn Minuten später warf sie sich nach vorne, dann in die andere Richtung, wirbelte herum und herum, und dann verabschiedete sie sich von der Pharao. Wir waren drei Tage lang ohne Essen und Trinken, so dass wir anfingen, auszulosen, wer die übrigen ernähren sollte, als wir La Gironde sahen ; wir haben Notsignale gegeben, sie hat uns wahrgenommen, für uns gemacht und uns alle an Bord genommen. So, M. Morrel, das ist die ganze Wahrheit, bei der Ehre eines Matrosen; ist es nicht wahr, ihr da?“ Ein allgemeines Gemurmel der Zustimmung zeigte, dass der Erzähler ihr Unglück und Leiden genau beschrieben hatte.
„Nun gut“, sagte M. Morrel, „ich weiß, dass niemand außer dem Schicksal schuld war. Es war der Wille Gottes, dass dies geschehen sollte, gepriesen sei sein Name. Welcher Lohn steht Ihnen zu?“
„Oh, lassen Sie uns nicht darüber reden, Monsieur Morrel.“
„Ja, aber wir werden darüber reden.“
„Nun, dann drei Monate“, sagte Penelon.
„Cocles, zahlen Sie jedem dieser guten Burschen zweihundert Franken“, sagte Morrel. „Ein andermal“, fügte er hinzu, „hätte ich gesagt: Geben Sie ihnen außerdem zweihundert Francs zum Geschenk; aber die Zeiten haben sich geändert, und das wenige Geld, das mir bleibt, gehört nicht mir, also glaube nicht, dass ich es in dieser Hinsicht böse mache.“
Penelon wandte sich an seine Gefährten und wechselte ein paar Worte mit ihnen.
„Was das betrifft, Monsieur Morrel“, sagte er und drehte wieder sein Pfund, „was das betrifft –“
„Was denn?“
"Das Geld."
"Was ist damit?"
„Nun, wir alle sagen, dass uns jetzt fünfzig Franken reichen und wir den Rest abwarten.“
„Danke, meine Freunde, danke!“ rief Morrel dankbar; „Nimm es – nimm es; und wenn Sie einen anderen Arbeitgeber finden können, treten Sie in seinen Dienst ein; es steht Ihnen frei, dies zu tun.“
Diese letzten Worte erzeugten eine erstaunliche Wirkung auf den Matrosen. Penelon schluckte beinahe sein Pfund; glücklicherweise erholte er sich.
„Was, Monsieur Morrel!“ sagte er mit leiser Stimme, „Sie schicken uns weg; dann sind Sie uns böse!“
„Nein, nein“, sagte M. Morrel, „ich bin nicht böse, ganz im Gegenteil, und ich schicke Sie nicht weg; aber ich habe keine Schiffe mehr, und deshalb brauche ich keine Matrosen.“
„Keine Schiffe mehr!“ kehrte Penelon zurück; „Nun, dann werden Sie welche bauen; wir warten auf Sie.“
„Ich habe kein Geld, um Schiffe zu bauen, Penelon“, sagte der arme Besitzer traurig, „deshalb kann ich Ihr freundliches Angebot nicht annehmen.“
"Kein Geld mehr? Dann müssen Sie uns nicht bezahlen; wir können wie der Pharao unter kahlen Stangen kriechen.“
"Genug genug!" rief Morrel, fast überwältigt; „verlasst mich, ich bitte euch. Wir werden uns in einer glücklicheren Zeit wiedersehen. Emmanuel, geh mit ihnen und sorge dafür, dass meine Befehle ausgeführt werden.“
„Zumindest sehen wir uns wieder, M. Morrel?“ fragte Penelon.
"Ja; Ich hoffe es zumindest. Jetzt geht." Er machte Cocles, der zuerst ging, ein Zeichen; die Matrosen folgten ihm und Emmanuel bildete die Nachhut. „Nun“, sagte der Besitzer zu seiner Frau und seiner Tochter, „verlasst mich; Ich möchte mit diesem Herrn sprechen.“
Und er warf einen Blick auf den Angestellten von Thomson & French, der während dieser Szene, an der er außer den wenigen erwähnten Worten keinen Anteil hatte, regungslos in der Ecke geblieben war. Die beiden Frauen sahen diese Person an, deren Anwesenheit sie völlig vergessen hatten, und zogen sich zurück; aber als sie die Wohnung verließ, warf Julie dem Fremden einen flehenden Blick zu, worauf er mit einem Lächeln antwortete, das einen gleichgültigen Zuschauer überrascht hätte, es auf seinen strengen Zügen zu sehen. Die beiden Männer blieben allein zurück. „Nun, Sir“, sagte Morrel und ließ sich auf einen Stuhl sinken, „Sie haben alles gehört, und ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen.“
„Ich sehe“, entgegnete der Engländer, „dass ein frisches und unverdientes Unglück Sie überwältigt hat, und das steigert nur meinen Wunsch, Ihnen zu dienen.“
„Ach, Herr!“ rief Morrel.
„Lassen Sie mich sehen“, fuhr der Fremde fort, „ich bin einer Ihrer größten Gläubiger.“
„Zumindest sind Ihre Rechnungen die ersten, die fällig werden.“
„Wünschst du Zeit zum Bezahlen?“
„Ein Aufschub würde meine Ehre und damit mein Leben retten.“
„Welchen Aufschub wünschen Sie sich?“
Morrel überlegte. „Zwei Monate“, sagte er.
„Ich gebe drei“, antwortete der Fremde.
„Aber“, fragte Morrel, „wird das Haus Thomson & French zustimmen?“
„Oh, ich nehme alles auf mich. Heute ist der 5. Juni.“
"Ja."
„Nun, erneuern Sie diese Rechnungen bis zum 5. September; und am 5. September um elf Uhr (der Zeiger der Uhr zeigte auf elf) werde ich kommen, um das Geld in Empfang zu nehmen.“
„Ich werde Sie erwarten,“ entgegnete Morrel; „und ich werde Sie bezahlen – oder ich werde tot sein.“ Diese letzten Worte wurden in einem so leisen Ton ausgesprochen, dass der Fremde sie nicht hören konnte. Die Rechnungen wurden erneuert, die alten vernichtet, und der arme Reeder hatte drei Monate Zeit, um seine Mittel einzusammeln. Der Engländer empfing seinen Dank mit dem seiner Nation eigentümlichen Phlegma; und Morrel, der ihn mit dankbaren Segnungen überwältigte, führte ihn zur Treppe. Der Fremde begegnete Julie auf der Treppe; sie tat so, als würde sie absteigen, aber in Wirklichkeit wartete sie auf ihn. „Oh, Sir“ – sagte sie und faltete ihre Hände.
„Mademoiselle“, sagte der Fremde, „Sie werden eines Tages einen Brief mit der Unterschrift ‚Sinbad der Seefahrer' erhalten. Tun Sie genau das, was der Brief Ihnen sagt, so seltsam es auch erscheinen mag.“
„Ja, Sir“, erwiderte Julie.
"Versprechen Sie es?"
„Ich schwöre, ich werde es tun.“
"Es ist gut. Adieu, Mademoiselle. Bleiben Sie weiterhin das gute, süße Mädchen, das Sie derzeit sind, und ich habe große Hoffnungen, dass der Himmel Sie belohnen wird, indem er Ihnen Emmanuel zum Ehemann gibt.“
Julie stieß einen leisen Schrei aus, errötete wie eine Rose und lehnte sich an den Baluster. Der Fremde winkte mit der Hand und stieg weiter hinab. Im Hof fand er Penelon, der mit einem Rouleau von hundert Francs in jeder Hand nicht in der Lage zu sein schien, sich zu entschließen, sie zu behalten. "Kommen Sie mit, mein Freund", sagte der Engländer; „Ich möchte Sie sprechen.“
Kapitel 30. Der fünfte September
Die Verlängerung, die der Agent von Thomson & French in dem Moment vorsah, in dem Morrel es am wenigsten erwartete, war für den armen Reeder ein so entschiedener Glücksfall, dass er fast zu glauben wagte, dass das Schicksal es endlich satt hatte, ihre Bosheit zu verschwenden auf Ihm. Am selben Tag erzählte er seiner Frau Emmanuel und seiner Tochter alles, was vorgefallen war; und ein Strahl der Hoffnung, wenn nicht der Ruhe, kehrte in die Familie zurück. Leider hatte Morrel jedoch nicht nur Verpflichtungen mit dem Haus Thomson & French, das sich ihm gegenüber so rücksichtsvoll gezeigt hatte; und wie er gesagt hatte, hatte er geschäftlich Korrespondenten und keine Freunde. Als er darüber nachdachte, konnte er sich dieses großzügige Verhalten von Thomson & French ihm gegenüber keineswegs erklären und konnte es nur einem egoistischen Argument wie diesem zuschreiben:
Leider vertraten nicht alle Korrespondenten von Morrel diese Ansicht, ob aus Neid oder Dummheit; und einige kamen sogar zu einer gegenteiligen Entscheidung. Die von Morrel unterschriebenen Rechnungen wurden mit peinlicher Genauigkeit in seinem Büro vorgelegt und dank der vom Engländer gewährten Verzögerung von Cocles mit der gleichen Pünktlichkeit bezahlt. Cocles blieb also in seiner gewohnten Ruhe. Nur Morrel erinnerte sich mit Besorgnis daran, dass er am 15. die 50.000 Francs von M. de Boville und am 30. die 32.500 Francs an Wechseln zurückzahlen musste, sowie die Schulden gegenüber dem Inspektor von Gefängnisse, ihm wurde Zeit gewährt, er muss ein ruinierter Mann sein.
Die Meinung aller Kaufleute war, dass es ihm unter den Rückschlägen, die Morrel nach und nach niedergedrückt hatten, unmöglich war, zahlungsfähig zu bleiben. Groß war daher das Erstaunen, als er am Ende des Monats alle seine Verpflichtungen mit gewohnter Pünktlichkeit absagte. Noch war das Vertrauen nicht in allen Gemütern wiederhergestellt, und die allgemeine Meinung war, dass der vollständige Ruin des unglücklichen Reeders nur bis zum Ende des Monats verschoben worden war.
Der Monat verging, und Morrel unternahm außerordentliche Anstrengungen, um all seine Ressourcen zusammenzubekommen. Früher wurde sein Papier jedenfalls mit Vertrauen aufgenommen und sogar angefragt. Morrel versuchte jetzt, Rechnungen mit nur neunzig Tagen auszuhandeln, und keine der Banken gewährte ihm Kredit. Glücklicherweise hatte Morrel einige Gelder, auf die er sich verlassen konnte; und als sie ihn erreichten, fand er sich in einem Zustand, um seine Verpflichtungen zu erfüllen, wenn Ende Juli kam.
Der Agent von Thomson & French war in Marseille nicht wieder gesehen worden; am Tag danach oder zwei Tage nach seinem Besuch bei Morrel war er verschwunden; und da er in dieser Stadt nur mit dem Bürgermeister, dem Gefängnisinspektor und M. Morrel Umgang gehabt hatte, hinterließ seine Abreise keine Spur außer in den Erinnerungen dieser drei Personen. Was die Matrosen der Pharao betrifft, so müssen sie woanders gemütliche Liegeplätze gefunden haben, denn auch sie waren verschwunden.
Kapitän Gaumard, von seiner Krankheit genesen, war aus Palma zurückgekehrt. Er zögerte, sich bei Morrel vorzustellen, aber der Besitzer, der von seiner Ankunft hörte, ging ihn besuchen. Der würdige Reeder wusste aus Penelons Erzählung von der tapferen Führung des Kapitäns während des Sturms und versuchte, ihn zu trösten. Er brachte ihm auch die Höhe seiner Heuer, die Kapitän Gaumard nicht zu beantragen gewagt hatte.
Als er die Treppe hinabstieg, begegnete Morrel Penelon, der nach oben ging. Penelon hatte, wie es schien, sein Geld gut genutzt, denn er war neu gekleidet. Als er seinen Arbeitgeber sah, schien der würdige Teer sehr verlegen zu sein, zog sich auf eine Seite in die Ecke des Anlegeplatzes, reichte sein Priem von einer Backe zur anderen, starrte dümmlich mit seinen großen Augen und bemerkte nur das Drücken des Hand, die ihm Morrel wie üblich durch einen leichten Gegendruck gab. Morrel führte Penelons Verlegenheit auf die Eleganz seiner Kleidung zurück; es war offensichtlich, dass der gute Kerl solche Kosten nicht auf eigene Rechnung getragen hatte; er war ohne Zweifel an Bord eines anderen Schiffes beschäftigt, und so entstand seine Schüchternheit aus der Tatsache, dass er, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, keine getragene Trauer um die Pharao länger hatte. Vielleicht war er gekommen, um Kapitän Gaumard von seinem Glück zu erzählen und ihm eine Anstellung bei seinem neuen Herrn anzubieten.
„Würdige Gesellen! Möge Ihr neuer Herr Sie lieben, wie ich Sie geliebt habe, und glücklicher sein als ich!“, sagte Morrel im Weggehen.
August rollte vorbei in unaufhörlichen Bemühungen seitens Morrel, seinen Kredit zu erneuern oder den alten wiederzubeleben. Am 20. August wurde in Marseille bekannt, dass er die Stadt mit der Postkutsche verlassen hatte, und dann hieß es, die Rechnungen würden Ende des Monats zum Protestieren gehen, und Morrel sei weggegangen und habe seinen Prokuristen Emmanuel zurückgelassen , und sein Kassierer Cocles, um die Gläubiger zu treffen. Aber wider alle Erwartung, als der 31. August kam, öffnete das Haus wie gewöhnlich, und Cocles erschien hinter dem Gitter des Schalters, prüfte alle vorgelegten Rechnungen mit der üblichen Prüfung und bezahlte von Anfang bis Ende alles mit dem gewohnte Genauigkeit. Außerdem gingen zwei Wechsel ein, die M. Morrel voll vorausgesehen hatte und die Cocles so pünktlich bezahlte wie die Rechnungen, die der Reeder angenommen hatte. All dies war unverständlich, und dann kam am 1. Morrel zurück; er wurde von seiner Familie mit größter Sorge erwartet, denn von dieser Reise nach Paris erhofften sie sich Großes. Morrel hatte an Danglars gedacht, der jetzt ungeheuer reich war und Morrel in früheren Tagen große Verpflichtungen auferlegt hatte, da es ihm zu verdanken war, dass Danglars in den Dienst des spanischen Bankiers trat, mit dem er den Grundstein für sein riesiges Vermögen gelegt hatte Vermögen. In diesem Moment hieß es, Danglars sei sechs bis acht Millionen Franken wert und habe unbegrenzten Kredit. Dann konnte Danglars Morrel retten, ohne eine Krone aus der Tasche zu nehmen; Er musste nur sein Wort für ein Darlehen geben, und Morrel war gerettet. Morrel hatte lange an Danglars gedacht, sich aber von einem instinktiven Motiv ferngehalten und es so lange wie möglich hinausgezögert, diese letzte Ressource in Anspruch zu nehmen. Und Morrel hatte recht, doch bei seiner Ankunft beschwerte sich Morrel nicht und sagte auch kein einziges schroffes Wort. Er umarmte seine weinende Frau und seine Tochter, drückte Emmanuels Hand mit freundlicher Wärme, und dann ging er in sein Privatzimmer im zweiten Stock und ließ Cocles kommen.
„Dann“, sagten die beiden Frauen zu Emmanuel, „sind wir wirklich ruiniert.“
In einem kurzen Rat wurde zwischen ihnen vereinbart, dass Julie ihrem Bruder, der in Nîmes in der Garnison war, schreiben sollte, damit er so schnell wie möglich zu ihnen komme. Die armen Frauen spürten instinktiv, dass sie ihre ganze Kraft brauchten, um den bevorstehenden Schlag zu unterstützen. Außerdem hatte Maximilian Morrel, obwohl kaum zweiundzwanzig, großen Einfluss auf seinen Vater.
Er war ein willensstarker, aufrechter junger Mann. Als er sich für seinen Beruf entschied, hatte sein Vater keine Lust, für ihn zu wählen, sondern hatte den Geschmack des jungen Maximilians befragt. Er hatte sich sofort zum Militärberuf erklärt, in der Folge fleißig studiert, die Polytechnische Schule glänzend durchlaufen und sie als Unterleutnant der 53. Linie verlassen. Ein Jahr lang hatte er diesen Rang inne und erwartete eine Beförderung bei der ersten Vakanz. In seinem Regiment war Maximilian Morrel für seine strenge Einhaltung nicht nur der einem Soldaten auferlegten Pflichten, sondern auch der Pflichten eines Mannes bekannt; und so erhielt er den Namen „der Stoiker“. Wir brauchen kaum zu sagen, dass viele von denen, die ihm diesen Beinamen gaben, ihn wiederholten, weil sie ihn gehört hatten und nicht einmal wussten, was er bedeutete.
Dies war der junge Mann, den seine Mutter und seine Schwester zu Hilfe riefen, um sie in der schweren Prüfung zu unterstützen, die sie ihrer Meinung nach bald ertragen müssten. Sie hatten den Ernst dieses Ereignisses nicht verkennen können, denn in dem Moment, nachdem Morrel mit Cocles sein Privatbüro betreten hatte, sah Julie, wie dieser es blass und zitternd verließ und seine Züge äußerste Bestürzung verrieten. Sie hätte ihn gefragt, als er an ihr vorbeiging, aber das würdige Wesen eilte mit ungewöhnlicher Eile die Treppe hinunter und hob nur die Hände zum Himmel und rief:
„Oh, Mademoiselle, Mademoiselle, was für ein schreckliches Unglück! Wer hätte das je geglaubt!“
Einen Moment später sah Julie ihn nach oben gehen, mit zwei oder drei schweren Büchern, einer Mappe und einer Tasche voller Geld.
Morrel prüfte die Bücher, öffnete die Mappe und zählte das Geld. Sein gesamtes Guthaben belief sich auf 6.000 oder 8.000 Franken, seine Wechselforderungen bis zum 5. auf 4.000 oder 5.000, was ihm, wenn er das Beste aus allem herausholte, 14.000 Franken einbrachte, um Schulden in Höhe von 287.500 Franken zu begleichen. Er hatte nicht einmal die Mittel für eine eventuelle Abschlagszahlung.
Als Morrel jedoch zu seinem Abendessen hinunterging, wirkte er sehr ruhig. Diese Ruhe beunruhigte die beiden Frauen mehr, als es die tiefste Niedergeschlagenheit gewesen wäre. Nach dem Essen ging Morrel gewöhnlich aus und pflegte seinen Kaffee im Klub der Phocéens zu trinken und die Semaphore zu lesen. An diesem Tag verließ er das Haus nicht, sondern kehrte in sein Büro zurück.
Cocles schien völlig verwirrt zu sein. Einen Teil des Tages ging er in den Hof, setzte sich barhäuptig auf einen Stein und war der prallen Sonne ausgesetzt. Emmanuel versuchte, die Frauen zu trösten, aber seine Beredsamkeit ließ nach. Der junge Mann war mit den Angelegenheiten des Hauses zu gut vertraut, um nicht das Gefühl zu haben, dass eine große Katastrophe über der Familie Morrel hing. Die Nacht kam, die beiden Frauen hatten zugesehen und gehofft, Morrel würde zu ihnen kommen, wenn er sein Zimmer verließ, aber sie hörten ihn vor ihrer Tür vorbeigehen und versuchten, das Geräusch seiner Schritte zu verbergen. Sie haben zugehört; er ging in sein Schlafzimmer und schloß die Tür innen. Madame Morrel schickte ihre Tochter ins Bett, und eine halbe Stunde, nachdem Julie sich zurückgezogen hatte, stand sie auf, zog ihre Schuhe aus und ging heimlich den Korridor entlang, um durch das Schlüsselloch zu sehen, was ihr Mann tat.
Im Gang sah sie einen sich zurückziehenden Schatten; es war Julie, die, selbst unruhig, ihrer Mutter zuvorgekommen war. Die junge Dame ging auf Madame Morrel zu.
„Er schreibt“, sagte sie.
Sie hatten sich wortlos verstanden. Madame Morrel sah wieder durchs Schlüsselloch, Morrel schrieb; aber Madame Morrel bemerkte, was ihre Tochter nicht bemerkt hatte, dass ihr Mann auf gestempeltem Papier schrieb. Die schreckliche Vorstellung, dass er sein Testament schrieb, durchzuckte sie; sie schauderte und hatte doch nicht die Kraft, ein Wort hervorzubringen.
Am nächsten Tag schien M. Morrel so ruhig wie immer, ging wie gewöhnlich in sein Büro, kam pünktlich zu seinem Frühstück, und dann, nach dem Abendessen, legte er seine Tochter neben sich, nahm ihren Kopf in seine Arme und hielt sie lange fest Zeit an seiner Brust. Am Abend erzählte Julie ihrer Mutter, dass sie, obwohl er scheinbar so ruhig war, bemerkt hatte, dass das Herz ihres Vaters heftig schlug.
Die nächsten zwei Tage verliefen ähnlich. Am Abend des 4. September fragte M. Morrel seine Tochter nach dem Schlüssel seines Arbeitszimmers. Julie zitterte bei dieser Bitte, die ihr als schlechtes Omen erschien. Warum verlangte ihr Vater diesen Schlüssel, den sie immer aufbewahrte und der ihr erst in der Kindheit zur Strafe abgenommen wurde? Das junge Mädchen sah Morrel an.
„Was habe ich falsch gemacht, Vater“, sagte sie, „dass du mir diesen Schlüssel abgenommen hast?“
„Nichts, mein Lieber“, antwortete der Unglückliche, und bei dieser einfachen Frage stiegen ihm die Tränen in die Augen, „nichts, nur ich will es.“
Julie tat so, als würde sie nach dem Schlüssel tasten. „Ich muss es in meinem Zimmer gelassen haben“, sagte sie.
Und sie ging hinaus, aber anstatt in ihre Wohnung zu gehen, beeilte sie sich, Emmanuel um Rat zu fragen.
„Gib diesen Schlüssel nicht deinem Vater“, sagte er, „und verlass ihn, wenn möglich, morgen früh keinen Augenblick.“
Sie befragte Emmanuel, aber er wusste nichts oder wollte nicht sagen, was er wusste.
In der Nacht vom 4. auf den 5. September lauschte Madame Morrel auf jedes Geräusch, und bis drei Uhr morgens hörte sie ihren Mann in großer Aufregung im Zimmer auf und ab gehen. Es war drei Uhr, als er sich aufs Bett warf. Mutter und Tochter verbrachten die Nacht zusammen. Sie hatten Maximilian seit dem Vorabend erwartet. Um acht Uhr morgens betrat Morrel ihre Kammer. Er war ruhig; aber die Aufregung der Nacht war in seinem blassen und verhärmten Gesicht ablesbar. Sie wagten nicht, ihn zu fragen, wie er geschlafen hatte. Morrel war freundlicher zu seiner Frau, zärtlicher zu seiner Tochter als je zuvor. Er konnte nicht aufhören, das süße Mädchen anzustarren und zu küssen. Julie, eingedenk von Emmanuels Bitte, folgte ihrem Vater, als er das Zimmer verließ, aber er sagte schnell zu ihr:
„Bleib bei deiner Mutter, Liebste.“ Julie wollte ihn begleiten. „Das wünsche ich von dir“, sagte er.
Dies war das erste Mal, dass Morrel so sprach, aber er sagte es in einem Ton väterlicher Freundlichkeit, und Julie wagte es nicht, ungehorsam zu sein. Sie blieb an derselben Stelle stehen, stumm und regungslos. Einen Augenblick später öffnete sich die Tür, sie spürte, wie sich zwei Arme um sie schlossen, und ein Mund drückte ihre Stirn. Sie blickte auf und stieß einen Freudenschrei aus.
„Maximilian, mein liebster Bruder!“ Sie weinte.
Bei diesen Worten erhob sich Madame Morrel und warf sich in die Arme ihres Sohnes.
„Mutter“, sagte der junge Mann und sah abwechselnd Madame Morrel und ihre Tochter an, „was ist passiert – was ist passiert? Der Brief hat mich erschreckt, und ich bin mit aller Eile hierhergekommen.“
„Julie“, sagte Madame Morrel und machte dem jungen Mann ein Zeichen, „geh und sag deinem Vater, dass Maximilian gerade eingetroffen ist.“
Die junge Dame stürzte aus der Wohnung, aber auf der ersten Stufe der Treppe fand sie einen Mann, der einen Brief in der Hand hielt.
„Sind Sie nicht Mademoiselle Julie Morrel?“ erkundigte sich der Mann mit einem starken italienischen Akzent.
"Ja, Herr," antwortete Julie mit dem Zögern. „Was macht Ihnen Freude? Ich kenne Sie nicht."
„Lies diesen Brief“, sagte er und reichte ihn ihr. Julia zögerte. „Es geht um das Wohl deines Vaters“, sagte der Bote.
Das junge Mädchen nahm ihm hastig den Brief ab. Sie öffnete es schnell und las:
„Gehen Sie in diesem Moment zu den Allées de Meilhan, betreten Sie das Haus Nr. 15, fragen Sie den Portier nach dem Schlüssel des Zimmers im fünften Stock, betreten Sie die Wohnung, nehmen Sie aus der Ecke des Kaminsimses eine in rote Seide geflochtene Geldbörse und gib es deinem Vater. Es ist wichtig, dass er es vor elf Uhr erhält. Du hast versprochen, mir bedingungslos zu gehorchen. Erinnere dich an deinen Eid.
„Sinbad der Seefahrer.“
Das junge Mädchen stieß einen Freudenschrei aus, hob die Augen, sah sich um, um den Boten zu fragen, aber er war verschwunden. Sie warf einen weiteren Blick auf die Notiz, um sie ein zweites Mal zu lesen, und sah, dass da ein Nachsatz war. Sie las:
„Es ist wichtig, dass Sie diese Mission persönlich und allein erfüllen. Wenn Sie von einer anderen Person begleitet werden oder jemand anderes an Ihrer Stelle geht, wird der Portier antworten, dass er nichts davon weiß.“
Dieser Nachsatz schmälerte das Glück des jungen Mädchens erheblich. Gab es nichts zu befürchten? Wurde ihr nicht eine Schlinge gelegt? Ihre Unschuld hatte sie in Unkenntnis der Gefahren gehalten, die ein junges Mädchen in ihrem Alter überfallen könnten. Aber man muss die Gefahr nicht kennen, um sie zu fürchten; ja, es kann beobachtet werden, dass es gewöhnlich unbekannte Gefahren sind, die den größten Schrecken einflößen.
Julie zögerte und beschloss, Rat einzuholen. Doch aus einem einzigartigen Impuls heraus bewarb sie sich weder bei ihrer Mutter noch bei ihrem Bruder, sondern bei Emmanuel. Sie eilte hinunter und erzählte ihm, was sich an dem Tag ereignet hatte, als der Agent von Thomson & French zu ihrem Vater gekommen war, erzählte die Szene auf der Treppe, wiederholte ihr Versprechen und zeigte ihm den Brief.
„Dann musst Du gehen, Mademoiselle“, sagte Emmanuel.
"Ich geh dorthin?" murmelte Julie.
"Ja; Ich werde dich begleiten."
„Aber hast du nicht gelesen, dass ich allein sein muss?“ sagte Julia.
„Und du sollst allein sein“, antwortete der junge Mann. „Ich werde Dic an der Ecke der Rue du Musée erwarten, und wenn Sie so lange abwesend sind, dass es mich unruhig macht, werde ich mich beeilen, zu Dir zurückzukehren, und wehe dem, über den Du Dich bei mir beklagen musst!“
„Also Emmanuel?“ sagte das junge Mädchen mit Zögern, „du meinst, ich solle dieser Aufforderung Folge leisten?“
"Ja. Hat der Bote nicht gesagt, die Sicherheit deines Vaters hänge davon ab?“
„Aber welche Gefahr droht ihm denn, Emmanuel?“ fragte sie.
Emmanuel zögerte einen Moment, aber sein Wunsch, Julie zu einer Entscheidung zu zwingen, ließ ihn sofort antworten.
„Hör zu“, sagte er; „Heute ist der 5. September, nicht wahr?“
"Ja."
„Dann hat dein Vater heute um elf Uhr fast dreihunderttausend Francs zu bezahlen?“
„Ja, das wissen wir.“
„Nun denn“, fuhr Emmanuel fort, „wir haben keine fünfzehntausend Francs im Haus.“
"Was wird dann passieren?"
"Nun, wenn dein Vater heute vor elf Uhr niemanden gefunden hat, der ihm zu Hilfe kommt, wird er gezwungen sein, sich um zwölf Uhr für bankrott zu erklären."
„Ach, komm, dann komm!“ rief sie und eilte mit dem jungen Mann davon.
Während dieser Zeit hatte Madame Morrel ihrem Sohn alles erzählt. Der junge Mann wusste ganz genau, dass nach der Reihe von Unglücksfällen, die seinen Vater getroffen hatten, große Veränderungen im Lebensstil und in der Haushaltsführung stattgefunden hatten; aber er wusste nicht, dass die Dinge so weit gekommen waren. Er war wie vom Donner gerührt. Dann eilte er hastig aus der Wohnung und rannte nach oben, in der Erwartung, seinen Vater in seinem Arbeitszimmer zu finden, aber er klopfte dort vergebens.
Als er noch an der Tür des Arbeitszimmers war, hörte er die Schlafzimmertür aufgehen, drehte sich um und sah seinen Vater. Anstatt direkt in sein Arbeitszimmer zu gehen, war M. Morrel in sein Schlafzimmer zurückgekehrt, das er erst jetzt verließ. Morrel stieß beim Anblick seines Sohnes, von dessen Ankunft er nichts wusste, einen überraschten Schrei aus. Regungslos blieb er stehen und drückte mit der linken Hand auf etwas, das er unter seinem Mantel verborgen hatte. Maximilian sprang die Treppe hinunter und schlang die Arme um den Hals des Vaters; aber plötzlich wich er zurück und legte seine rechte Hand auf Morrels Brust.
„Vater“, rief er und wurde totenbleich, „was willst du mit dem Pistolenpaar unter deinem Mantel machen?“
„Oh, das habe ich befürchtet!“ sagte Morrel.
„Vater, Vater, in Himmels Namen“, rief der junge Mann, „wozu sind diese Waffen da?“
„Maximilian“, erwiderte Morrel und sah seinen Sohn unverwandt an, „Du bist ein Mann, und ein Mann von Ehre. Komm, ich werde es dir erklären.“
Und Morrel ging mit festem Schritt in sein Arbeitszimmer, während Maximilian ihm zitternd folgte. Morrel öffnete die Tür und schloss sie hinter seinem Sohn, dann durchquerte er das Vorzimmer, ging zu seinem Schreibtisch, auf dem er die Pistolen ablegte, und deutete mit dem Finger auf ein offenes Hauptbuch. In diesem Hauptbuch wurde eine genaue Bilanz seiner Angelegenheiten erstellt. Morrel musste innerhalb einer halben Stunde 287.500 Franken bezahlen. Alles, was er besaß, waren 15.257 Franken.
"Lesen!" sagte Morrel.
Der junge Mann war beim Lesen überwältigt. Morrel sagte kein Wort. Was konnte er sagen? Was muss er einem solch verzweifelten Beweis in Zahlen hinzufügen?
„Und hast du alles Mögliche getan, Vater, um diesem katastrophalen Ergebnis entgegenzuwirken?“ fragte der junge Mann nach einer kurzen Pause.
„Das habe ich“, antwortete Morrel.
„Du hast kein Geld, auf das Du dich verlassen kannst?“
"Keines."
„Du hast alle Ressourcen erschöpft?“
"Alles."
„Und in einer halben Stunde“, sagte Maximilian mit düsterer Stimme, „ist unser Name entehrt!“
„Blut wäscht Schande aus“, sagte Morrel.
„Du hast recht, Vater; Ich verstehe dich." Dann streckte er seine Hand nach einer der Pistolen aus und sagte: „Da ist eine für dich und eine für mich – danke!“
Morrel ergriff seine Hand. „Deine Mutter – deine Schwester! Wer wird sie unterstützen?“
Ein Schauder durchlief den Körper des jungen Mannes. „Vater“, sagte er, „denkst du, dass du mir befiehlst zu leben?“
„Ja, das verspreche ich Dir“, antwortete Morrel, „es ist Deine Pflicht. Du hast einen ruhigen, starken Verstand, Maximilian. Maximilian, du bist kein gewöhnlicher Mann. Ich mache keine Bitten oder Befehle; Ich bitte Dich nur, meine Position so zu prüfen, als ob es Deine eigene wäre, und dann selbst zu urteilen.“
Der junge Mann überlegte einen Moment, dann erschien ein Ausdruck erhabener Resignation in seinen Augen, und mit einer langsamen und traurigen Geste nahm er seine beiden Epauletten ab, die Insignien seines Ranges.
„Dann sei es so, mein Vater“, sagte er und streckte Morrel die Hand entgegen, „stirb in Frieden, mein Vater; ich werde leben."
Morrel wollte sich gerade vor seinem Sohn auf die Knie werfen, aber Maximilian fing ihn in seinen Armen auf, und diese beiden edlen Herzen drückten sich für einen Moment aneinander.
„Du weißt, dass es nicht meine Schuld ist“, sagte Morrel.
Maximilian lächelte. „Ich weiß, Vater, du bist der ehrenhafteste Mann, den ich je gekannt habe.“
„Gut, mein Sohn. Und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen; geh und triff dich wieder mit deiner Mutter und deiner Schwester.“
„Mein Vater“, sagte der junge Mann und beugte sein Knie, „segne mich!“ Morrel nahm den Kopf seines Sohnes zwischen seine beiden Hände, zog ihn nach vorne und sagte mehrmals, indem er seine Stirn küsste:
„O ja, ja, ich segne Dich in meinem eigenen Namen und im Namen von drei Generationen tadelloser Männer, die durch mich sagen: ‚Das Gebäude, das das Unglück zerstört hat, kann die Vorsehung wieder aufbauen.' Wenn sie mich einen solchen Tod sterben sehen, werden die Unerbittlichsten Mitleid mit dir haben. Dir werden sie vielleicht die Zeit gewähren, die sie mir verweigert haben. Dann tue Dein Bestes, um unseren Namen frei von Schande zu halten. Geh an die Arbeit, arbeite, junger Mann, kämpfe eifrig und mutig. Lebe, du selbst, deine Mutter und deine Schwester, mit der strengsten Sparsamkeit, damit sich von Tag zu Tag das Eigentum derer, die ich in deinen Händen lasse, vermehre und befruchte. Denke darüber nach, was für ein herrlicher Tag es sein wird, wie großartig, wie feierlich dieser Tag der vollständigen Wiederherstellung, an dem Du in genau diesem Amt sagen werden: „Mein Vater ist gestorben, weil er nicht tun konnte, was ich heute getan habe.“
„Mein Vater, mein Vater!“ rief der Jüngling, warum sollst du nicht leben?“
„Wenn ich lebe, würde sich alles ändern; wenn ich lebe, würde sich Interesse in Zweifel verwandeln, Mitleid in Feindseligkeit; wenn ich lebe, bin ich nur ein Mann, der sein Wort gebrochen hat, in seinen Verpflichtungen gescheitert ist – eigentlich nur ein Bankrotteur. Wenn ich dagegen sterbe, denke daran, Maximilian, mein Leichnam ist der eines ehrlichen, aber unglücklichen Mannes. Lebend würden meine besten Freunde mein Haus meiden; tot, ganz Marseille wird mir in Tränen in meine letzte Heimat folgen. Lebend würdest du dich über meinen Namen schämen. Wenn ich tot bin, kannst Du Deinen Kopf heben und sagen: ‚Ich bin der Sohn dessen, den Ihr getötet habt, weil er zum ersten Mal gezwungen wurde, sein Wort zu brechen.'“
Der junge Mann stieß ein Stöhnen aus, wirkte aber resigniert.
„Und jetzt“, sagte Morrel, „lass mich in Ruhe und bemühe dich, deine Mutter und deine Schwester fernzuhalten.“