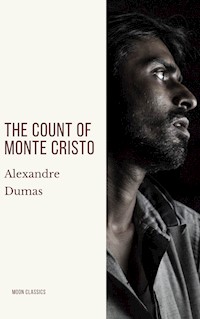4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Graf von Monte Christo
- Sprache: Deutsch
Durch das Eingreifen des Grafen von Monte Christo kommt die Wahrheit über die Umstände ans Licht, unter denen der hoch angesehene Offizier Fernand Mondego sein Glück machte. Bei der Belagerung von Janina durch die Türken beging er Verrat an seinem Befehlshaber Ali Pascha, dem Herrscher von Janina. Dessen Tochter Haydée und ihre Mutter verkaufte er als Sklavinnen. Haydée, die später von Monte Christo freigekauft wurde und bei ihm ein zurückgezogenes Leben in fürstlichem Luxus führt, tritt als Zeugin vor der hohen Pairskammer auf: Mondego ist entehrt, und sein Sohn Albert fordert daraufhin den Grafen von Monte Christo zum Duell. Infolgedessen wendet sich die Gräfin von Morcerf, Mercédès, an den Grafen von Monte Christo und bittet ihn um Gnade für ihren Sohn. Sie gesteht nun auch, dass sie nichts vom Verrat Mondegos wusste und dass sie ihn, den Grafen, erkannt hat und nennt ihn bei seinem wahren Namen, Edmond Dantès. Dieser verpflichtet sich aufgrund der plötzlichen Offenbarung dazu, Albert nicht zu töten. Er macht ihr aber klar, dass er es nun sein werde, der bei dem Duell sterben wird. Daraufhin legt Mercédès gegenüber ihrem Sohn die Wahrheit offen. Bei dem Duell am Morgen des nächsten Tages entschuldigt sich Albert daraufhin demütig beim Grafen von Monte Christo und erklärt ihm, er wisse jetzt um die wahren Beweggründe um die Entehrung seines Vaters und verstehe sie. Er dankt Monte Christo auch dafür, dass er keine größere Rache genommen hat, denn auch das würde er jetzt verstehen. Mondego stellt daraufhin den Grafen von Monte Christo in seinem Anwesen zur Rede und fordert ihn zum Duell. Dieser enthüllt ihm nun seine wahre Identität, worauf Mondego flieht und kurze Zeit später Selbstmord begeht. Noirtier verhindert Valentines Hochzeit mit Franz d'Epinay und setzt sie als Alleinerbin ein. Als Monte Christo von Maximilian Morrels Liebe zu Valentine von Villefort erfährt, versucht er verzweifelt, sie und Noirtier vor der mordenden Hand im Hause zu schützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Graf von Monte Christo, 4. Band
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Walter Brendel
Illustrator: © Copyright versch. Künstler
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Kapitel 74. Die Familiengruft von Villefort
Zwei Tage später versammelte sich gegen zehn Uhr morgens eine beträchtliche Menschenmenge um die Tür des Hauses von Herrn de Villefort, und eine lange Reihe von Trauerkutschen und Privatkutschen erstreckte sich entlang der Faubourg Saint-Honoré und der Rue de la Pepinière. Darunter war eine von sehr eigentümlicher Form, die aus der Ferne gekommen zu sein schien. Es war eine Art Planwagen, schwarz lackiert, und war einer der ersten, die ankamen. Eine Untersuchung wurde durchgeführt, und es wurde festgestellt, dass dieser Wagen durch einen seltsamen Zufall die Leiche des Marquis de Saint-Méran enthielt und dass diejenigen, die gekommen waren, um an einer Beerdigung teilzunehmen, zwei folgen würden. Ihre Zahl war groß. Der Marquis de Saint-Méran, einer der eifrigsten und treuesten Würdenträger Ludwigs XVIII. und König Karl X., hatte sich eine große Anzahl von Freunden bewahrt, und diese,
Die Behörden wurden ordnungsgemäß informiert und die Erlaubnis eingeholt, dass die beiden Beerdigungen gleichzeitig stattfinden sollten. Ein zweiter Leichenwagen, geschmückt mit demselben Begräbnisprunk, wurde zur Tür von Herrn de Villefort gebracht, und der Sarg wurde aus dem Postwagen hineinbewegt. Die beiden Leichen sollten auf dem Friedhof von Père-Lachaise beigesetzt werden, wo Herr de Villefort seit langem ein Grabmal für den Empfang seiner Familie herrichten ließ. Dort wurden bereits die Überreste der armen Renée deponiert, und jetzt, nach zehnjähriger Trennung, sollten ihr Vater und ihre Mutter wieder mit ihr vereint werden.
Die Pariser, immer neugierig, immer von Beerdigungen betroffen, sahen mit religiösem Schweigen zu, während die prächtige Prozession zwei aus der Reihe der alten Aristokratie, die größten Beschützer des Handels und aufrichtige Anhänger ihrer Prinzipien, zu ihrer letzten Bleibe begleitete.
In einem der Trauerwagen sprachen Beauchamp, Debray und Château-Renaud über den plötzlichen Tod der Marquise.
„Ich habe Madame de Saint-Méran erst letztes Jahr in Marseille gesehen, als ich aus Algier zurückkam“, sagte Château-Renaud; „Sie sah aus wie eine Frau, die dazu bestimmt ist, hundert Jahre alt zu werden, aufgrund ihrer offensichtlich gesunden Gesundheit und ihrer großen körperlichen und geistigen Aktivität. Wie alt war sie?"
„Franz hat mir versichert“, erwiderte Albert, „dass sie sechsundsechzig Jahre alt ist. Aber sie ist nicht an Altersschwäche gestorben, sondern an Gram; es scheint, dass sie seit dem Tod des Marquis, der sie sehr getroffen hat, ihre Vernunft nicht vollständig wiedererlangt hat.“
„Aber an welcher Krankheit ist sie denn gestorben?“ fragte Debray.
„Es soll eine Gehirnkongestion oder ein Schlaganfall gewesen sein, was dasselbe ist, nicht wahr?“
„Was?"
„Es ist schwer zu glauben, dass es ein Schlaganfall war“, sagte Beauchamp. „Madame de Saint-Méran, die ich einmal gesehen habe, war klein, von schlanker Gestalt und von viel nervöserem als sanguinischem Temperament; Trauer könnte in einer Verfassung wie der von Madame de Saint-Méran kaum einen Schlaganfall hervorrufen.“
„Jedenfalls“, sagte Albert, „welche Krankheit oder welcher Arzt sie auch getötet haben mag, Herr von Villefort, oder besser gesagt, Mademoiselle Valentine – oder noch besser, unser Freund Franz, erbt ein großartiges Vermögen, das sich, glaube ich, auf 80.000 Livres pro Jahr.“
„Und dieses Vermögen wird sich beim Tod des alten Jakobiners Noirtier verdoppeln.“
„Das ist ein hartnäckiger alter Großvater", sagte Beauchamp. „ Tenacem propositi virus. Ich denke, er muss eine Vereinbarung mit dem Tod getroffen haben, um alle seine Erben zu überleben, und er scheint wahrscheinlich erfolgreich zu sein. Er ähnelt dem alten Konventionalisten von 1993, der 1814 zu Napoleon sagte: „Du beugst dich, weil dein Imperium ein junger Stamm ist, geschwächt durch schnelles Wachstum. Nehmen Sie die Republik für einen Tutor. Lasst uns mit neuer Kraft auf das Schlachtfeld zurückkehren, und ich verspreche euch 500.000 Soldaten, ein weiteres Marengo und ein zweites Austerlitz. Ideen sterben nicht aus, Herr; sie schlummern manchmal, aber erwachen nur stärker, bevor sie ganz schlafen.'“
„Ideen und Menschen erschienen ihm gleich“, sagte Albert. „Eines ist mir nur ein Rätsel, nämlich, wie Franz d'Épinay einen Großvater mögen wird, der von seiner Frau nicht getrennt werden kann. Aber wo ist Franz?“
„Im ersten Wagen, mit Herrn de Villefort, der ihn bereits als einen der Familie ansieht.“
So war die Unterhaltung in fast allen Waggons; diese beiden plötzlichen Todesfälle, die so schnell aufeinander folgten, erstaunten alle, aber niemand ahnte das schreckliche Geheimnis, das Herr d'Avrigny auf seinem nächtlichen Spaziergang zu Herrn von Villefort mitgeteilt hatte. Sie kamen in ungefähr einer Stunde auf dem Friedhof an; das Wetter war mild, aber trüb und im Einklang mit der Trauerfeier. Unter den Gruppen, die zur Familiengruft strömten, erkannte Château-Renaud Morrel, der allein in einem Cabriolet gekommen war, und ging schweigend den von Eiben gesäumten Weg entlang.
"Du hier?" sagte Château-Renaud und führte seine Arme durch die des jungen Kapitäns. „Sind Sie ein Freund von Villefort? Wie kommt es, dass ich dich noch nie in seinem Haus getroffen habe?“
„Ich bin kein Bekannter von Herrn von Villefort“, antwortete Morrel, „aber ich war einer von Madame de Saint-Méran.“ Albert kam in diesem Augenblick mit Franz auf sie zu.
„Zeit und Ort sind für eine Vorstellung nur ungeeignet.“ sagte Albert; „aber wir sind nicht abergläubisch. M. Morrel, gestatten Sie mir, Ihnen M. Franz d'Épinay vorzustellen, einen entzückenden Reisegefährten, mit dem ich die Italienreise gemacht habe. Mein lieber Franz, M. Maximilian Morrel, ein ausgezeichneter Freund, den ich in Ihrer Abwesenheit erworben habe und dessen Namen Sie mich jedes Mal nennen hören werden, wenn ich auf Zuneigung, Witz oder Liebenswürdigkeit anspiele.“
Morrel zögerte einen Moment; er fürchtete, es wäre heuchlerisch, den Mann, dem er sich stillschweigend widersetzte, freundlich anzusprechen, aber sein Eid und die Schwere der Umstände kamen ihm wieder ins Gedächtnis; er bemühte sich, seine Rührung zu verbergen und verneigte sich vor Franz.
„Mademoiselle de Villefort ist in tiefer Trauer, nicht wahr?“ sagte Debray zu Franz.
"Äußerst", antwortete er. „Sie sah heute Morgen so blass aus, ich kannte sie kaum.“
Diese scheinbar einfachen Worte trafen Morrel ins Herz. Dieser Mann hatte Valentine gesehen und mit ihr gesprochen! Der junge und temperamentvolle Offizier brauchte seine ganze Geisteskraft, um sich dagegen zu wehren, seinen Eid zu brechen. Er nahm den Arm von Château-Renaud und wandte sich dem Gewölbe zu, wo die Diener bereits die beiden Särge aufgestellt hatten.
„Dies ist eine großartige Behausung", sagte Beauchamp und blickte zum Mausoleum; „ein Sommer- und Winterpalast. Du wirst ihrerseits eintreten, mein lieber d'Épinay, denn Du wirst bald als ein Mitglied der Familie gezählt. Ich als Philosoph möchte ein kleines Landhaus, ein Häuschen dort unten unter den Bäumen, ohne so viele freie Steine auf meinem armen Körper. Im Sterben werde ich meinen Mitmenschen sagen, was Voltaire an Piron geschrieben hat: „ Eo rus, und alles wird vorbei sein.“ Aber komm, Franz, fasse Mut, deine Frau ist eine Erbin.“
„In der Tat, Beauchamp, Du bist unerträglich. Die Politik hat dich dazu gebracht, über alles zu lachen, und Politiker haben dich dazu gebracht, alles nicht zu glauben. Aber wenn Du die Ehre hast, mit gewöhnlichen Männern Umgang zu haben, und das Vergnügen hast, die Politik für einen Moment zu verlassen, versuche, Dein liebevolles Herz zu finden, wenn Du in die Kammer gehen.
„Aber sag mir“, sagte Beauchamp, „was ist Leben? Ist es nicht ein Halt im Vorzimmer des Todes?“
„Ich habe Vorurteile gegen Beauchamp“, sagte Albert, zog Franz weg und ließ ersteren seine philosophische Dissertation mit Debray beenden.
Das Gewölbe von Villefort bildete ein Quadrat aus weißen Steinen, ungefähr sechs Meter hoch; eine innere Trennwand trennte die beiden Familien, und jede Wohnung hatte ihre eigene Eingangstür. Hier waren nicht, wie in anderen Gräbern, unwürdige Schubladen übereinander, wo die Sparsamkeit ihre Toten verschenkt und sie wie Exemplare in einem Museum etikettiert. Alles, was hinter den Bronzetoren zu sehen war, war ein düster aussehender Raum, der durch eine Wand vom Gewölbe selbst getrennt war. Die beiden zuvor erwähnten Türen befanden sich in der Mitte dieser Mauer und umschlossen die Särge von Villefort und Saint-Méran. Dort konnte sich die Trauer frei entfalten, ohne von den unbedeutenden Liegen gestört zu werden, die von einer Picknickparty kamen, um Père-Lachaise zu besuchen, oder von Liebenden, die es zu ihrem Rendezvous machten.
Die beiden Särge wurden auf Böcke gestellt, die zuvor für ihren Empfang in der rechten Krypta der Familie Saint-Méran vorbereitet worden waren. Allein Villefort, Franz und einige nahe Verwandte betraten das Heiligtum.
Da die religiösen Zeremonien alle an der Tür durchgeführt worden waren und keine Adresse angegeben war, trennte sich die Gruppe. Château-Renaud, Albert und Morrel gingen in die eine Richtung, Debray und Beauchamp in die andere. Franz blieb bei M. de Villefort; am Tor des Friedhofs entschuldigte sich Morrel, um zu warten; er sah, wie Franz und Herr von Villefort in denselben Trauerwagen stiegen, und dachte, diese Begegnung verheiße Böses. Dann kehrte er nach Paris zurück, und obwohl er mit Château-Renaud und Albert in derselben Kutsche saß, hörte er kein Wort ihrer Unterhaltung.
Als Franz sich von Herrn de Villefort verabschieden wollte: „Wann sehe ich Sie wieder?“ sagte letzteres.
„Zu welcher Zeit, mein Herr“, erwiderte Franz.
„So bald wie möglich."
„Ich stehe zu Ihrem Befehl, Sir; Sollen wir zusammen zurückkehren?“
„Wenn es Ihnen nicht unangenehm ist.“
„Im Gegenteil, ich werde viel Freude empfinden.“
So stiegen der zukünftige Schwiegervater und der zukünftige Schwiegersohn in dieselbe Kutsche, und Morrel wurde unruhig, als er sie vorbeifahren sah. Villefort und Franz kehrten in die Faubourg Saint-Honoré zurück. Der Procureur, ohne seine Frau oder seine Tochter zu sehen, ging sofort in sein Arbeitszimmer und bot dem jungen Mann einen Stuhl an:
„M. d'Épinay“, sagte er, „erlauben Sie mir, Sie in diesem Moment daran zu erinnern, der vielleicht nicht so schlecht gewählt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, denn der Gehorsam gegenüber den Wünschen der Verstorbenen ist das erste Opfer, das dargebracht werden sollte an ihrem Grab – gestatten Sie mir, Sie an den Wunsch zu erinnern, den Madame de Saint-Méran auf ihrem Sterbebett ausgedrückt hat, dass die Hochzeit von Valentin nicht verschoben werden möge. Sie wissen, dass die Angelegenheiten der Verstorbenen in bester Ordnung sind, und ihr Testament vermacht Valentine den gesamten Besitz der Familie Saint-Méran; der Notar hat mir gestern die Dokumente gezeigt, die es uns ermöglichen, den Vertrag sofort aufzusetzen. Sie können den Notar, M. Deschamps, Place Beauveau, Faubourg Saint-Honoré, anrufen, und Sie haben meine Vollmacht, diese Urkunden zu prüfen.“
„Sir“, erwiderte M. d'Épinay, „es ist vielleicht nicht der richtige Moment für Mademoiselle Valentine, die sich in tiefer Not befindet, an einen Ehemann zu denken; in der Tat, ich fürchte –“
„Valentine wird kein größeres Vergnügen haben, als die letzten Anordnungen ihrer Großmutter zu erfüllen. Von dieser Seite wird es kein Hindernis geben, das versichere ich Ihnen.“
„In diesem Fall“, erwiderte Franz, „da ich keine erhebe, können Sie Vorkehrungen treffen, wann Sie wollen. Ich habe mein Wort gegeben und werde Freude und Glück empfinden, wenn ich mich daran halte.“
„Dann“, sagte Villefort, „ist nichts weiter erforderlich. Der Vertrag sollte drei Tage später unterzeichnet worden sein, wir werden alles fertig vorfinden und können es heute unterzeichnen.“
„Aber die Trauer?“ sagte Franz zögernd.
"Seien Sie in dieser Sache nicht unruhig," antwortete Villefort. „In meinem Haus wird keine Zeremonie vernachlässigt. Mademoiselle de Villefort kann sich während der vorgeschriebenen drei Monate auf ihr Anwesen Saint-Méran zurückziehen. Ich sage ihr, denn sie erbt es heute. Dort soll nach einigen Tagen, wenn Sie wollen, die standesamtliche Trauung ohne Prunk und Zeremonie gefeiert werden. Madame de Saint-Méran wünschte, ihre Tochter würde dort heiraten. Wenn das vorbei ist, können Sie, mein Herr, nach Paris zurückkehren, während Ihre Frau die Trauerzeit bei ihrer Schwiegermutter verbringt.“
„Gerne, mein Herr“, sagte Franz.
„Dann“, erwiderte Herr von Villefort, „haben Sie die Güte, eine halbe Stunde zu warten. Valentine soll in den Salon herunterkommen. Ich werde nach M. Deschamps schicken. Wir werden den Vertrag lesen und unterschreiben, bevor wir uns trennen, und heute Abend wird Madame de Villefort Valentine zu ihrem Anwesen begleiten, wo wir in einer Woche wieder zu ihnen kommen werden.“
„Sir“, sagte Franz, „ich habe eine Bitte.“
„Was ist es?"
„Ich wünsche, dass Albert de Morcerf und Raoul de Château-Renaud bei dieser Unterzeichnung anwesend sind. Sie wissen, dass sie meine Zeugen sind.“
„Eine halbe Stunde genügt, um sie zu benachrichtigen; werden Sie sie selbst holen oder sollst sie schicken?“
„Ich gehe lieber selbst, Sir.“
„Dann erwarte ich Sie in einer halben Stunde, Baron, und Valentine wird fertig sein.«
Franz verneigte sich und verließ den Raum. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, als Monsieur de Villefort nach Valentine schickte, sie solle sich in einer halben Stunde im Salon bereithalten, da er den Notar und Monsieur d'Épinay und seine Zeugen erwartete. Die Nachricht erregte im ganzen Haus großes Aufsehen; Madame de Villefort wollte es nicht glauben, und Valentine war wie vom Donner gerührt. Sie sah sich hilfesuchend um und wäre in das Zimmer ihres Großvaters hinuntergegangen, aber auf der Treppe traf sie Herrn de Villefort, der sie am Arm nahm und sie in den Salon führte. Im Vorzimmer begegnete Valentine Barrois und sah den alten Diener verzweifelt an. Einen Augenblick später betrat Madame de Villefort mit ihrem kleinen Edward den Salon. Es war offensichtlich, dass sie den Kummer der Familie geteilt hatte, denn sie war blass und sah müde aus. Sie setzte sich, nahm Edward auf ihre Knie.
Bald hörte man zwei Kutschen in den Hof einfahren. Einer war der des Notars; der andere, der von Franz und seinen Freunden. Im Nu war die ganze Gesellschaft versammelt. Valentine war so blass, dass man die blauen Adern von ihren Schläfen, um ihre Augen und über ihre Wangen verfolgen konnte. Franz war tief betroffen. Château-Renaud und Albert sahen sich verwundert an; die soeben zu Ende gegangene Zeremonie war nicht trauriger erschienen als die, die beginnen sollte. Madame de Villefort hatte sich hinter einem Samtvorhang in den Schatten gestellt, und da sie sich ständig über ihr Kind beugte, war es schwierig, ihren Gesichtsausdruck zu lesen. Herr de Villefort war wie gewöhnlich ungerührt.
Der Notar, nachdem er nach der üblichen Methode die Papiere auf dem Tisch geordnet, sich in einen Lehnstuhl gesetzt und seine Brille gehoben hatte, wandte sich Franz zu:
„Sind Sie M. Franz de Quesnel, Baron von Épinay?“ fragte er, obwohl er es genau kannte.
„Ja, mein Herr“, antwortete Franz. Der Notar verbeugte sich.
„Dann muss ich Ihnen auf Bitten von M. de Villefort mitteilen, mein Herr, dass Ihre geplante Heirat mit Mademoiselle de Villefort die Gefühle von M. Noirtier gegenüber seiner Enkelin verändert hat und dass er ihr das gesamte Vermögen enterbt er hätte sie verlassen. Lassen Sie mich schnell hinzufügen“, fuhr er fort, „dass der Erblasser, der nur das Recht hat, einen Teil seines Vermögens zu veräußern, und nachdem er alles veräußert hat, das Testament keiner Prüfung standhält und für null und nichtig erklärt wird.“
„Ja." sagte Villefort; "aber ich warne M. d'Épinay, dass der Wille meines Vaters zu meinen Lebzeiten niemals in Frage gestellt werden soll, da meine Position jeden Zweifel verbietet."
„Sir“, sagte Franz, „ich bedauere sehr, dass eine solche Frage in Gegenwart von Mademoiselle Valentine gestellt wurde. Ich habe mich nie nach der Höhe ihres Vermögens erkundigt, das, so begrenzt es auch sein mag, meins übersteigt. Meine Familie hat in diesem Bündnis mit M. de Villefort Rücksicht gesucht. Alles, was ich suche, ist Glück.“
Valentine dankte ihm unmerklich, während zwei stille Tränen über ihre Wangen liefen.
„Außerdem, Sir“, sagte Villefort und wandte sich an seinen zukünftigen Schwiegersohn, „außer dem Verlust eines Teils Ihrer Hoffnungen, wird Sie dieses Unerwartete nicht persönlich verletzen müssen. Die Geistesschwäche von M. Noirtier erklärt es hinreichend. Nicht weil Mademoiselle Valentine Sie heiraten wird, ist er wütend, sondern weil sie heiraten wird, hätte ihm eine Verbindung mit einer anderen den gleichen Kummer bereitet. Das Alter ist egoistisch, Sir, und Mademoiselle de Villefort war M. Noirtier eine treue Begleiterin, was sie nicht sein kann, wenn sie Baroness d'Épinay wird. Der melancholische Zustand meines Vaters hindert uns daran, mit ihm über irgendwelche Themen zu sprechen, die er aufgrund seiner Geistesschwäche nicht verstehen könnte, und ich bin fest davon überzeugt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl er weiß, dass seine Enkelin heiraten wird, M . Noirtier hat sogar den Namen seines Wunschenkels vergessen.“ Herr von Villefort hatte dies kaum gesagt, als die Tür aufging und Barrois erschien.
„Meine Herren“, sagte er in einem für einen Diener, der unter solch feierlichen Umständen zu seinen Herren spricht, seltsam festen Ton – „Meine Herren, M. Noirtier de Villefort möchte sofort mit M. Franz de Quesnel, Baron d'Épinay, sprechen.“ Er und der Notar vermachten alle seine Titel dem auserwählten Bräutigam, damit es keinen Irrtum in der Person gebe.
Villefort zuckte zusammen, Madame de Villefort ließ ihren Sohn von den Knien gleiten, Valentine erhob sich, blass und stumm wie eine Statue. Albert und Château-Renaud tauschten einen zweiten Blick, voller Erstaunen als der erste. Der Notar sah Villefort an.
„Das ist unmöglich“, sagte der Prokurist. "M. d'Épinay kann den Salon derzeit nicht verlassen.“
„In diesem Moment“, erwiderte Barrois mit der gleichen Bestimmtheit, „möchte M. Noirtier, mein Herr, über wichtige Themen mit M. Franz d’Épinay sprechen.“
„Dann kann Opa Noirtier jetzt sprechen,“ sagte Edward mit seiner gewohnten Schnelligkeit. Seine Bemerkung brachte Madame de Villefort jedoch nicht einmal zum Lächeln, so sehr waren alle beschäftigt und so feierlich war die Situation.
„Sagen Sie M. Nortier“, fuhr Villefort fort, „dass das, was er verlangt, unmöglich ist.“
„Dann teilt Monsieur Nortier diesen Herren mit,“ erwiderte Barrois, „dass er den Befehl geben wird, in den Salon getragen zu werden.“
Das Erstaunen war auf dem Höhepunkt. Auf Madame de Villeforts Gesicht war etwas wie ein Lächeln wahrzunehmen. Valentine hob instinktiv die Augen, als wollte sie dem Himmel danken.
„Bitte, gehen Sie, Valentine,“ sagte; M. de Villefort, "und sehen Sie, was diese neue Phantasie Ihres Großvaters ist." Valentine erhob sich schnell und eilte freudig zur Tür, als Herr von Villefort seine Absicht änderte.
„Höre auf,“ sagte er; "Ich werde mit dir gehen."
„Entschuldigen Sie, mein Herr“, sagte Franz, „da Herr Noirtier nach mir geschickt hat, bin ich bereit, seinem Wunsch nachzukommen. Außerdem werde ich ihm gerne meine Aufwartung machen, da ich noch nicht die Ehre hatte, dies zu tun.“
„Bitte, Sir“, sagte Villefort mit deutlichem Unbehagen, „stören Sie sich nicht daran.“
„Verzeihen Sie, mein Herr“, sagte Franz in entschlossenem Ton. „Ich würde diese Gelegenheit nicht verpassen, Herrn Noirtier zu beweisen, wie falsch es von ihm wäre, Gefühle der Abneigung gegen mich zu fördern, die ich entschlossen bin, durch meine Hingabe zu überwinden, was auch immer sie sein mögen.“
Und ohne auf Villefort zu hören, stand er auf und folgte Valentine, die mit der Freude eines Schiffbrüchigen, der einen Felsen findet, an dem er sich festhalten kann, die Treppe hinunterlief. Herr von Villefort folgte ihnen. Château-Renaud und Morcerf tauschten einen dritten Blick immer größer werdender Verwunderung aus.
Kapitel 75. Eine unterschriebene Erklärung
Noirtier war bereit, sie zu empfangen, in Schwarz gekleidet und in seinem Sessel untergebracht. Als die drei erwarteten Personen eingetreten waren, blickte er zur Tür, die sein Kammerdiener sofort schloss.
„Hören Sie“, flüsterte Villefort Valentine zu, die ihre Freude nicht verbergen konnte, „Wenn M. Noirtier irgendetwas mitteilen möchte, was Deine Ehe verzögern würde, verbiete ich Dir, ihn zu verstehen.“
Valentin errötete, antwortete aber nicht. Villefort, näherte sich Noirtier.
„Hier ist M. Franz d'Épinay," sagte er; „Du hast darum gebeten, ihn zu sehen. Wir alle haben uns dieses Gespräch gewünscht, und ich hoffe, es wird Dich davon überzeugen, wie unbegründet Deine Einwände gegen Valentinas Hochzeit sind.“
Noirtier antwortete nur mit einem Blick, der Villefort das Blut gefrieren ließ. Er bedeutete Valentine, näher zu kommen. Dank ihrer Gewohnheit, sich mit ihrem Großvater zu unterhalten, verstand sie sofort, dass er nach einem Schlüssel verlangte. Dann blieb sein Blick auf der Schublade einer kleinen Truhe zwischen den Fenstern hängen. Sie öffnete die Schublade und fand einen Schlüssel und als er verstand, dass er das wollte, beobachtete er wieder seine Augen, die sich auf einen alten Sekretär richteten, der seit vielen Jahren vernachlässigt worden war und nichts als nutzlose Dokumente enthalten sollte.
„Soll ich den Sekretär aufmachen?“ fragte Valentin.
„Ja“, sagte der alte Mann.
„Und die Schubladen?“
„Ja."
„Die an der Seite?“
„Nein."
„Die mittlere?"
„Ja."
Valentine öffnete es und zog ein Bündel Papiere heraus. „Ist es das, was du dir wünschst?“ fragte sie.
„Nein."
Sie nahm nacheinander alle anderen Papiere heraus, bis die Schublade leer war. „Aber es gibt keine mehr“, sagte sie. Noirtiers Blick war auf das Wörterbuch gerichtet.
„Ja, ich verstehe, Großvater“, sagte das junge Mädchen.
Sie zeigte auf jeden Buchstaben des Alphabets. Beim Buchstaben S hielt der alte Mann sie auf. Sie öffnete und fand das Wort „geheim“.
„Ah! Gibt es eine geheime Quelle?“ sagte Valentin.
„Ja“, sagte Noirtier.
"Und wer weiß es?" Noirtier blickte zur Tür, wo der Diener hinausgegangen war.
„Barrois?" sagte sie.
„Ja."
"Soll ich ihn hereinrufen?"
"Ja."
Valentine ging zur Tür und rief Barrois an. Villeforts Ungeduld bei dieser Szene ließ ihm den Schweiß von der Stirn rollen, und Franz war sprachlos. Der alte Diener kam.
„Barrois“, sagte Valentine, „mein Großvater hat mir aufgetragen, diese Schublade im Sekretär zu öffnen, aber da ist eine geheime Feder drin, wie du weißt – wirst du sie öffnen?“
Barrois sah den alten Mann an. „Gehorche“, sagte Noirtiers intelligentes Auge. Barrois berührte eine Feder, der doppelte Boden kam heraus, und sie sahen ein Bündel Papiere, die mit einer schwarzen Schnur zusammengebunden waren.
„Ist es das, was Sie sich wünschen?“ sagte Barrois.
"Ja."
„Soll ich diese Papiere Herrn de Villefort geben?“
„Nein."
„Für Mademoiselle Valentine?“
„Nein."
„An M. Franz d'Épinay?“
„Ja."
Erstaunt trat Franz einen Schritt vor. „Für mich, Herr?“ sagte er.
"Ja."
Franz nahm sie aus Barrois und warf einen Blick auf das Cover und las:
„'Nach meinem Tod an General Durand zu übergeben, der das Päckchen seinem Sohn vermacht, mit der einstweiligen Verfügung, es als wichtiges Dokument aufzubewahren.'
„Nun, mein Herr“, fragte Franz, „was soll ich mit diesem Papier machen?“
„Zweifellos, um es so zu versiegeln, wie es ist“, sagte der Procureur.
„Nein“, antwortete Noirtier eifrig.
„Willst du, dass er es liest?“ sagte Valentin.
„Ja“, antwortete der alte Mann.
„Sie verstehen, Baron, mein Großvater möchte, dass Sie diese Dokumente lesen“, sagte Valentine.
„Dann setzen wir uns“, sagte Villefort ungeduldig, „denn es wird einige Zeit dauern.“
„Setz dich“, sagte der alte Mann. Villefort nahm einen Stuhl, aber Valentine blieb neben ihrem Vater stehen und Franz vor ihm, der das geheimnisvolle Papier in der Hand hielt. „Lies“, sagte der alte Mann. Franz band es auf und las inmitten des tiefsten Schweigens:
„‚ Auszug aus dem Bericht einer Versammlung des Bonapartistenclubs in der Rue Saint-Jacques, abgehalten am 5. Februar 1815. '“
Franz blieb stehen. „5. Februar 1815!“ sagte er; „Es ist der Tag, an dem mein Vater ermordet wurde.“ Valentine und Villefort waren stumm, nur das Auge des alten Mannes schien deutlich zu sagen: „Weiter.“
„Aber als ich diesen Club verließ“, sagte er, „ist mein Vater verschwunden.“
Noirtiers Auge sagte weiterhin: „Lies.“ Er fuhr fort:—
„Die Unterzeichneten Louis-Jacques Beaurepaire, Oberstleutnant der Artillerie, Étienne Duchampy, Brigadegeneral, und Claude Lecharpal, Wächter von Wäldern und Wäldern, erklären, dass am 4. Februar ein Brief von der Insel Elba eingetroffen ist, mit der Freundlichkeit und dem Vertrauen des bonapartistischen Klubs, General Flavien de Quesnel zu empfehlen, der, nachdem er dem Kaiser von 1804 bis 1814 gedient hatte, sich trotz des Barontitels, den Ludwig XVIII. hatte ihm gerade mit seinem Nachlass von Épinay gewährt.
„'Infolgedessen wurde eine Notiz an General de Quesnel gerichtet, in der er gebeten wurde, bei der Sitzung am nächsten Tag, dem 5., anwesend zu sein. Die Notiz enthielt weder die Straße noch die Hausnummer, in der die Versammlung abgehalten werden sollte; es trug keine Unterschrift, aber es kündigte dem General an, dass jemand nach ihm rufen würde, wenn er um neun Uhr fertig wäre. Die Versammlungen fanden immer von dieser Zeit bis Mitternacht statt. Um neun Uhr stellte sich der Präsident des Klubs vor; Als der General bereit war, teilte ihm der Präsident mit, dass eine der Bedingungen für seine Einführung darin bestehe, dass er den Ort des Treffens auf ewig nicht kenne und dass er sich die Augen verbinden lasse und schwöre, dass er nicht versuchen würde, abzuhauen der Verband. General de Quesnel akzeptierte die Bedingung und versprach bei seiner Ehre, nicht zu versuchen, den Weg zu entdecken, den sie genommen hatten. Der Wagen des Generals war bereit, aber der Präsident sagte ihm, er könne ihn nicht benutzen, da es zwecklos sei, dem Kapitän die Augen zu verbinden, wenn der Kutscher wisse, durch welche Straßen er fahre. "Was muss dann getan werden?" fragte der General. „Ich habe meine Kutsche hier“, sagte der Präsident.
„Hast du denn so viel Vertrauen zu deinem Diener, dass du ihm ein Geheimnis anvertrauen kannst, das du mir nicht verraten willst?“
„‚„Unser Kutscher ist Mitglied des Clubs“, sagte der Präsident; „Wir werden von einem Staatsrat gefahren.“
,,Dann laufen wir wieder Gefahr", sagte der General lachend, ,,dass wir uns aufregen." Wir fügen diesen Witz ein, um zu beweisen, dass der General nicht im geringsten gezwungen war, an der Sitzung teilzunehmen, sondern dass er freiwillig kam. Als sie in der Kutsche Platz nahmen, erinnerte der Präsident den General an sein Versprechen, seine Augen verbinden zu lassen, wogegen er keinen Widerspruch einlegte. Unterwegs glaubte der Präsident zu sehen, wie der General versuchte, das Taschentuch zu entfernen, und erinnerte ihn an seinen Eid. „Natürlich“, sagte der General. Die Kutsche hielt an einer Gasse, die aus der Rue Saint-Jacques herausführte. Der General stieg aus, stützte sich auf den Arm des Präsidenten, dessen Würde er nicht kannte, und betrachtete ihn einfach als Mitglied des Clubs; sie gingen durch die Gasse, stiegen eine Treppe hinauf und betraten den Versammlungsraum.
„‚Die Beratungen hatten bereits begonnen. Die Mitglieder, die über die Art der Präsentation informiert waren, die an diesem Abend gehalten werden sollte, waren alle anwesend. Als der General in der Mitte des Zimmers aufgefordert wurde, seinen Verband zu entfernen, tat er dies sofort und war überrascht, so viele bekannte Gesichter in einer Gesellschaft zu sehen, von deren Existenz er bis dahin nichts gewusst hatte. Sie fragten ihn nach seinen Gefühlen, aber er begnügte sich mit der Antwort, dass die Briefe von der Insel Elba sie hätten informieren müssen –“
Franz unterbrach sich mit den Worten: „Mein Vater war ein Royalist; sie hätten ihn nicht nach seinen wohlbekannten Gefühlen fragen müssen.“
„Und daraus“, sagte Villefort, „erwachte meine Zuneigung zu Ihrem Vater, mein lieber Herr Franz. Gemeinsame Meinungen sind ein festes Band der Vereinigung.“
„Lesen Sie einmal weiter“, sagte der alte Mann.
Franz fuhr fort:
„‚Der Präsident versuchte dann, ihn deutlicher zum Sprechen zu bringen, aber Herr de Quesnel antwortete, dass er zuerst wissen wollte, was sie von ihm wollten. Dann wurde ihm der Inhalt des Schreibens von der Insel Elba mitgeteilt, in dem er dem Club als Mann empfohlen wurde, der geeignet sei, die Interessen ihrer Partei zu fördern. Ein Absatz sprach von der Rückkehr Bonapartes und versprach einen weiteren Brief und weitere Einzelheiten über die Ankunft de Pharao des Schiffbauers Morrel aus Marseille, dessen Kapitän ganz dem Kaiser ergeben war. Während dieser ganzen Zeit zeigte der General, auf den sie sich wie auf einen Bruder verlassen zu haben glaubten, offensichtliche Anzeichen von Unzufriedenheit und Abneigung. Als die Lesung zu Ende war, schwieg er mit zusammengezogenen Brauen.
„Nun“, fragte der Präsident, „was sagen Sie zu diesem Brief, General?“
„'„Ich sage, dass es zu früh ist, nachdem ich mich für Ludwig XVIII. erklärt habe, mein Gelübde zugunsten des Ex-Kaisers zu brechen.“ Diese Antwort war zu klar, um irgendeinen Irrtum über seine Gefühle zuzulassen. „General“, sagte der Präsident, „wir erkennen keinen König Ludwig XVIII. oder einen Ex-Kaiser an, sondern Seine Majestät, den Kaiser und König, der durch Gewalt und Verrat aus Frankreich, seinem Königreich, vertrieben wurde.“
„‚„Entschuldigen Sie, meine Herren“, sagte der General; „Sie können Ludwig XVIII. nicht anerkennen, aber ich tue es, da er mich zum Baron und Feldmarschall ernannt hat, und ich werde nie vergessen, dass ich diese beiden Titel seiner glücklichen Rückkehr nach Frankreich zu verdanken habe.“
„‚„Sir“, sagte der Präsident und erhob sich mit Ernst, „seien Sie vorsichtig, was Sie sagen; Ihre Worte zeigen uns deutlich, dass sie auf der Insel Elba über Sie getäuscht wurden und uns getäuscht haben! Die Mitteilung erfolgt aufgrund des in Sie gesetzten Vertrauens und ehrt Sie. Jetzt entdecken wir unseren Irrtum; ein Titel und eine Beförderung binden Sie an die Regierung, die wir stürzen wollen. Wir werden Sie nicht dazu zwingen, uns zu helfen; wir nehmen niemanden gegen sein Gewissen auf, aber wir werden Sie zwingen, großzügig zu handeln, auch wenn Sie dazu nicht bereit sind.“
„'„Sie würden es nennen, großzügig zu handeln, Ihre Verschwörung zu kennen und nicht gegen Sie zu informieren, das würde ich nennen, Ihr Komplize zu werden. Sie sehen, ich bin offener als Sie.“‘“
„Ach, mein Vater!“ sagte Franz und unterbrach sich. „Ich verstehe jetzt, warum sie ihn ermordet haben.“ Valentin konnte nicht umhin, einen Blick auf den jungen Mann zu werfen, dessen kindlicher Enthusiasmus entzückend anzusehen war. Villefort ging hinter ihnen auf und ab. Noirtier beobachtete den Ausdruck eines jeden und bewahrte seine würdevolle und gebieterische Haltung. Franz wandte sich wieder dem Manuskript zu und fuhr fort:
„'„Sir“, sagte der Präsident, „Sie wurden eingeladen, an dieser Versammlung teilzunehmen – Sie wurden nicht hierher gezwungen; es wurde Ihnen vorgeschlagen, mit verbundenen Augen zu kommen – Sie haben zugesagt. Als Sie dieser doppelten Bitte nachkamen, wussten Sie wohl, dass wir den Thron Ludwigs XVIII. nicht sichern wollten, oder wir sollten uns nicht so sehr darum kümmern, der Wachsamkeit der Polizei zu entgehen. Es wäre ein zu großes Zugeständnis, Ihnen zu erlauben, eine Maske aufzusetzen, um Ihnen bei der Entdeckung unseres Geheimnisses zu helfen, und sie dann abzunehmen, damit Sie diejenigen ruinieren könnten, die sich Ihnen anvertraut haben. Nein, nein, Sie müssen zuerst sagen, ob Sie sich zum König eines Tages erklären, der jetzt regiert, oder zu Seiner Majestät, dem Kaiser.“
„'„Ich bin ein Royalist,“ antwortete der General. „Ich habe Ludwig XVIII. den Treueid geleistet und werde mich daran halten.“ Diesen Worten folgte ein allgemeines Gemurmel, und es war offensichtlich, dass einige der Mitglieder darüber diskutierten, ob es angebracht sei, den General dazu zu bringen, seine Unbesonnenheit zu bereuen.
„‚Der Präsident erhob sich wieder, und nachdem er Schweigen auferlegt hatte, sagte er: ‚Sir, Sie sind ein zu ernsthafter und zu vernünftiger Mann, um die Folgen unserer gegenwärtigen Situation nicht zu verstehen, und Ihre Offenheit hat uns bereits die verbleibenden Bedingungen diktiert uns, Ihnen anzubieten.“ Der General legte seine Hand auf sein Schwert und rief aus: „Wenn Sie von Ehre sprechen, fangen Sie nicht damit an, ihre Gesetze zu verleugnen, und erzwingen Sie nichts mit Gewalt.“
„Und Ihnen, Sir“, fuhr der Präsident mit einer Ruhe fort, die noch schrecklicher war als der Zorn des Generals, „ich rate Ihnen, Ihr Schwert nicht anzufassen.“ Der General sah sich mit leichtem Unbehagen um; aber er gab nicht nach, sondern rief all seine Kraft auf und sagte: „Ich werde nicht schwören.“
„‚„Dann müssen Sie sterben“, erwiderte der Präsident ruhig. M. d'Épinay wurde sehr blass; er sah sich ein zweites Mal um, mehrere Mitglieder des Clubs flüsterten und zogen die Arme unter ihren Mänteln hervor. „General“, sagte der Präsident, „beunruhigen Sie sich nicht; Sie gehören zu den Ehrenmännern, die alle Mittel einsetzen werden, um Sie zu überzeugen, bevor sie zum letzten Äußersten greifen, aber wie Sie gesagt haben, gehören Sie zu den Verschwörern, Sie sind im Besitz unseres Geheimnisses, und Sie müssen es uns zurückgeben.“ Ein bedeutungsvolles Schweigen folgte diesen Worten, und da der General nicht antwortete: „Schließen Sie die Türen“, sagte der Präsident zum Türhüter.
„‚Auf diese Worte folgte dieselbe tödliche Stille. Dann trat der General vor und bemühte sich heftig, seine Gefühle zu beherrschen: „Ich habe einen Sohn,“ sagte er, „und ich sollte an ihn denken, während ich mich unter Mördern befinde.“
„››General‹, sagte der Versammlungsleiter, ›ein Mann kann fünfzig beleidigen – das ist das Privileg der Schwäche. Aber er tut falsch, wenn er sein Privileg ausnutzt. Folge meinem Rat, schwöre und beleidige nicht.“ Der General, wieder eingeschüchtert durch die Überlegenheit des Häuptlings, zögerte einen Moment; dann zum Schreibtisch des Präsidenten vorrückend, – „Was ist das für ein Dokument, sagte er.
„'„Es ist dies:—'Ich schwöre bei meiner Ehre, niemandem zu offenbaren, was ich am 5. Februar 1815 zwischen neun und zehn Uhr abends gesehen und gehört habe; und ich bekenne mich des Todes schuldig, sollte ich jemals diesen Eid brechen.'“ Der General schien von einem nervösen Zittern befallen zu sein, das ihn für einige Momente daran hinderte zu antworten; dann überwand er seinen offenkundigen Widerwillen und sprach den erforderlichen Eid aus, aber in einem so leisen Ton, dass er für die Mehrheit der Mitglieder kaum hörbar war, die darauf bestanden, dass er ihn klar und deutlich wiederholte, was er auch tat.
„‚„Darf ich mich jetzt zurückziehen?“ sagte der General. Der Präsident erhob sich, ernannte drei Mitglieder zu seiner Begleitung und stieg mit dem General in die Kutsche, nachdem er ihm die Augen verbunden hatte. Einer dieser drei Mitglieder war der Kutscher, der sie dorthin gefahren hatte. Die anderen Mitglieder gingen schweigend auseinander. „Wo möchten Sie hingebracht werden?“ fragte der Präsident. - "Irgendwo außerhalb Ihrer Anwesenheit," antwortete M. d'Épinay. „Vorsicht, mein Herr“, erwiderte der Präsident, „Sie sind nicht mehr in der Versammlung und haben nur mit Einzelpersonen zu tun; beleidige sie nicht, es sei denn, du möchtest dafür verantwortlich gemacht werden.“ Aber anstatt zuzuhören, fuhr M. d'Épinay fort: "Sie sind in Ihrem Wagen immer noch so tapfer wie in Ihrer Versammlung, weil Sie immer noch vier gegen einen sind." Der Präsident hielt die Kutsche an. Sie befanden sich an der Stelle des Quai des Ormes, wo die Stufen zum Fluss hinabführen. „Warum hören Sie hier auf?“ fragte d'Épinay.
„Weil Sie, Sir“, sagte der Präsident, „einen Mann beleidigt haben und dieser Mann keinen Schritt weiter gehen wird, ohne eine ehrenhafte Wiedergutmachung zu fordern.“
„‚„Eine andere Methode der Ermordung?“ sagte der General und zuckte mit den Schultern.
„‚„Machen Sie keinen Lärm, Sir, es sei denn, Sie möchten, dass ich Sie als einen der Männer betrachte, von denen Sie soeben als Feiglinge sprachen, die ihre Schwäche für einen Schild halten. Sie sind allein, einer allein wird Ihnen antworten. Sie haben ein Schwert an Ihrer Seite, ich habe eins in meinem Stock. Sie haben keinen Zeugen, einer dieser Herren wird Ihnen dienen. Jetzt bitte, nehmen Sie Ihre Binde ab.“ Der General riss sich das Taschentuch von den Augen. „Endlich“, sagte er, „werde ich wissen, mit wem ich es zu tun habe.“ Sie öffneten die Tür und die vier Männer stiegen aus.'“
Franz unterbrach sich wieder und wischte sich die kalten Tropfen von der Stirn; es war entsetzlich, den Sohn in zitternder Blässe diese bis dahin geheimnisvollen Einzelheiten über den Tod seines Vaters vorlesen zu hören. Valentine faltete ihre Hände wie im Gebet. Noirtier sah Villefort mit einem fast erhabenen Ausdruck von Verachtung und Stolz an.
Franz fuhr fort:
„‚Es war, wie gesagt, der fünfte Februar. Seit drei Tagen lag das Quecksilber bei fünf oder sechs Grad unter dem Gefrierpunkt, und die Stufen waren mit Eis bedeckt. Der General war kräftig und groß, der Präsident bot ihm die Seite des Geländers an, um ihm beim Abstieg zu helfen. Die beiden Zeugen folgten. Es war eine dunkle Nacht. Der Boden von den Stufen zum Fluss war mit Schnee und Raureif bedeckt, das Wasser des Flusses sah schwarz und tief aus. Einer der Sekundanten suchte eine Laterne in einem Kohlenkahn in der Nähe, und bei ihrem Licht untersuchten sie die Waffen. Das Schwert des Präsidenten, das, wie er gesagt hatte, einfach in seinem Gehstock getragen wurde, war fünf Zoll kürzer als das des Generals und hatte keine Parierstange. Der General schlug vor, das Los zu ziehen, aber der Präsident sagte, er habe die Provokation gegeben, und als er es gegeben hatte, hatte er angenommen, dass jeder seine eigenen Arme benutzen würde. Die Zeugen bemühten sich, darauf zu bestehen, aber der Präsident bat sie, zu schweigen. Die Laterne wurde auf den Boden gestellt, die beiden Kontrahenten nahmen ihre Stellungen ein und das Duell begann. Das Licht ließ die beiden Schwerter wie Blitze erscheinen; die Männer waren kaum wahrnehmbar, so groß war die Dunkelheit.
„'General d'Épinay galt als einer der besten Schwertkämpfer der Armee, aber er wurde zu Beginn so eng bedrängt, dass er sein Ziel verfehlte und stürzte. Die Zeugen dachten, er sei tot, aber sein Gegner, der wusste, dass er ihn nicht geschlagen hatte, bot ihm seine Hand an, um aufzustehen. Der Umstand irritierte den General, statt ihn zu beruhigen, und er stürzte sich auf seinen Gegner. Aber sein Gegner ließ nicht zu, dass seine Deckung gebrochen wurde. Er empfing ihn auf seinem Schwert und dreimal wich der General zurück, weil er sich zu eng verlobt sah, und kehrte dann zum Angriff zurück. Beim dritten stürzte er wieder. Sie dachten, er sei ausgerutscht, wie zuerst, und die Zeugen, als sie sahen, dass er sich nicht bewegte, näherten sich und versuchten, ihn aufzurichten, aber derjenige, der seinen Arm um die Leiche legte, stellte fest, dass sie mit Blut benetzt war. Der General, der fast in Ohnmacht gefallen war, lebte wieder auf. „Ach“, sagte er, "Sie haben einen Fechtmeister geschickt, um mit mir zu kämpfen." Der Präsident näherte sich, ohne zu antworten, dem Zeugen, der die Laterne hielt, hob seinen Ärmel und zeigte ihm zwei Wunden, die er in seinem Arm bekommen hatte; dann öffnete er seinen Mantel und knöpfte seine Weste auf und zeigte seine Seite, die von einer dritten Wunde durchbohrt war. Immer noch hatte er nicht einmal einen Seufzer ausgesprochen. General d'Épinay starb fünf Minuten später.'“
Franz las diese letzten Worte mit so erstickter Stimme, dass sie kaum hörbar waren, und hielt dann inne und fuhr sich mit der Hand über die Augen, als wolle er eine Wolke vertreiben; aber nach einem Moment des Schweigens fuhr er fort:
„‚Der Präsident ging die Stufen hinauf, nachdem er sein Schwert in seinen Stock gesteckt hatte; eine Blutspur im Schnee markierte seinen Kurs. Er war kaum oben angekommen, als er im Wasser ein heftiges Plätschern hörte – es war die Leiche des Generals, die die Zeugen gerade in den Fluss geworfen hatten, nachdem sie festgestellt hatten, dass er tot war. Der General fiel also in einem loyalen Duell und nicht in einem Hinterhalt, wie man hätte sagen können. Als Beweis dafür haben wir dieses Papier unterzeichnet, um die Wahrheit der Tatsachen festzustellen, damit nicht der Moment kommt, in dem einer der Schauspieler in dieser schrecklichen Szene des vorsätzlichen Mordes oder der Verletzung der Ehrengesetze angeklagt wird.
„'Unterzeichnet, Beaurepaire, Duchampy und Lecharpal.'“
Als Franz diese für einen Sohn so schreckliche Erzählung zu Ende gelesen hatte; als Valentine, bleich vor Rührung, eine Träne weggewischt hatte; als Villefort, zitternd und in einer Ecke kauernd, versucht hatte, den Sturm zu mildern, indem er dem unerbittlichen alten Mann flehende Blicke zuwarf.“
„Sir“, sagte d'Épinay zu Noirtier, „da Sie alle diese Einzelheiten gut kennen, die durch ehrenvolle Unterschriften bezeugt sind, – da Sie ein gewisses Interesse an mir zu haben scheinen, obwohl Sie es bisher nur dadurch bekundet haben, dass Sie mich veranlasst haben Kummer, verweigere mir nicht eine letzte Genugtuung – sag mir den Namen des Präsidenten des Clubs, damit ich wenigstens weiß, wer meinen Vater getötet hat.“
Villefort tastete mechanisch nach dem Türgriff. Valentine, die die Antwort ihres Großvaters am ehesten verstand und die oft zwei Narben auf seinem rechten Arm gesehen hatte, wich ein paar Schritte zurück.
„Mademoiselle“, sagte Franz und wandte sich Valentin zu, „vereinigen Sie Ihre Bemühungen mit meinen, um den Namen des Mannes herauszufinden, der mich mit zwei Jahren zur Waise gemacht hat.“ Valentine blieb stumm und regungslos.
„Moment, Sir“, sagte Villefort, „verlängern Sie diese schreckliche Szene nicht. Die Namen wurden absichtlich verschleiert; mein Vater selbst weiß nicht, wer dieser Präsident war, und wenn er es weiß, kann er es Ihnen nicht sagen. Eigennamen sind nicht im Wörterbuch.“
„O Elend“, rief Franz, „die einzige Hoffnung, die mich stärkte und bis zu Ende lesen ließ, war die, wenigstens den Namen dessen zu kennen, der meinen Vater getötet hat! Sir, Sir“, rief er und wandte sich an Noirtier, »tun Sie, was Sie können – machen Sie es mir irgendwie klar!“
„Ja“, antwortete Noirtier.
„Ach, Fräulein, Fräulein!“ rief Franz, „dein Großvater sagt, er kann die Person angeben. Hilf mir – hilf mir!“
Noirtier sah ins Wörterbuch. Franz nahm es mit nervösem Zittern und wiederholte nacheinander die Buchstaben des Alphabets, bis er zu M kam. Bei diesem Buchstaben bedeutete der alte Mann „Ja“.
„M“, wiederholte Franz. Der Finger des jungen Mannes glitt über die Worte, aber bei jedem antwortete Noirtier mit einem negativen Zeichen. Valentine versteckte ihren Kopf zwischen ihren Händen. Endlich kam Franz zum Wort MICH.
"Ja!"
"Sie!" rief Franz, dem die Haare zu Berge standen; „Sie, M. Noirtier – Sie haben meinen Vater getötet?“
"Ja!" antwortete Noirtier, einen majestätischen Blick auf den jungen Mann heftend. Franz fiel kraftlos auf einen Stuhl; Villefort öffnete die Tür und entkam, denn ihm war die Idee gekommen, das wenige Leben im Herzen dieses schrecklichen alten Mannes zu ersticken.
Kapitel 76. Fortschritte von Cavalcanti dem Jüngeren
Inzwischen war Herr Cavalcanti der Ältere in seinen Dienst zurückgekehrt, nicht in die Armee Seiner Majestät des Kaisers von Österreich, sondern an den Spieltisch der Thermen von Lucca, wo er einer der eifrigsten Höflinge war. Als Belohnung für die majestätische und feierliche Art und Weise, in der er seinen vermeintlichen Vatercharakter bewahrt hatte, hatte er jeden Pfennig ausgegeben, der ihm für seine Reise zugestanden worden war.
M. Andrea erbte bei seiner Abreise alle Papiere, die bewiesen, dass er tatsächlich die Ehre hatte, der Sohn des Marquis Bartolomeo und der Marchesa Oliva Corsinari zu sein. Er wurde jetzt ziemlich in diese Pariser Gesellschaft eingeführt, die Ausländern so bereitwilligen Zugang gewährt und sie nicht so behandelt, wie sie wirklich sind, sondern wie sie berücksichtigt werden möchten. Außerdem, was wird von einem jungen Mann in Paris verlangt? Seine Sprache einigermaßen zu sprechen, einen guten Auftritt zu haben, ein guter Spieler zu sein und bar zu bezahlen. Bei einem Ausländer sind sie sicher weniger wählerisch als bei einem Franzosen. Andrea hatte also in vierzehn Tagen eine sehr schöne Stellung erlangt. Er wurde Graf genannt, er soll 50.000 Livres im Jahr besessen haben; und die immensen Reichtümer seines Vaters, begraben in den Steinbrüchen von Saravezza, waren ein ständiges Thema. Ein gelehrter Mann.
Dies war der Zustand der Gesellschaft in Paris zu der Zeit, die wir unseren Lesern vorführen, als Monte Cristo eines Abends kam, um Herrn Danglars einen Besuch abzustatten. M. Danglars war nicht da, aber der Graf wurde gebeten, die Baronin aufzusuchen, und er nahm die Einladung an. Seit dem Abendessen in Auteuil und den Ereignissen, die darauf folgten, verlief Madame Danglars nie ohne nervöses Schaudern, als Monte Cristos Name verkündet wurde. Wenn er nicht kam, wurde die schmerzhafte Empfindung am intensivsten; erschien er im Gegenteil, so zerstreuten sein edles Antlitz, seine strahlenden Augen, seine Liebenswürdigkeit, seine höfliche Aufmerksamkeit auch Madame Danglars gegenüber bald jeden Eindruck von Angst. Es schien der Baronin unmöglich, dass ein Mann von so entzückend angenehmen Manieren böse Pläne gegen sie hegen sollte.
Als Monte Cristo das Boudoir betrat, das wir unseren Lesern schon einmal vorgestellt haben, und wo die Baronin einige Zeichnungen prüfte, die ihre Tochter ihr übergab, nachdem sie sie mit M. Cavalcanti betrachtet hatte, entfaltete seine Anwesenheit bald die übliche Wirkung, und mit einem Lächeln empfing die Baronin den Grafen, obwohl sie bei der Bekanntgabe seines Namens ein wenig aus der Fassung gebracht worden war. Letztere erfasste die ganze Szenerie auf einen Blick.
Die Baronin lag teilweise auf einem Sofa. Eugénie saß neben ihr und Cavalcanti stand. Cavalcanti, schwarz gekleidet wie einer von Goethes Helden, mit lackierten Schuhen und weißen, durchbrochenen Seidenstrümpfen, fuhr sich mit einer weißen, ziemlich hübschen Hand durch sein helles Haar und zeigte so einen funkelnden Diamanten, der trotz des Monte Cristos Rat, der eitle junge Mann hatte nicht widerstehen können, seinen kleinen Finger aufzustecken. Diese Bewegung wurde von tödlichen Blicken auf Mademoiselle Danglars begleitet und von Seufzern, die in die gleiche Richtung gingen.
Mademoiselle Danglars war immer noch dieselbe – kalt, schön und satirisch. Keiner dieser Blicke, kein Seufzer entging ihr. Man könnte sagen, dass sie auf den Schild von Minerva fielen, von dem einige Philosophen behaupten, dass er manchmal die Brust von Sappho schützte. Eugénie verneigte sich kalt vor dem Grafen und nutzte den ersten Moment, als das Gespräch ernst wurde, um in ihr Arbeitszimmer zu flüchten, wo sehr bald zwei fröhliche und lärmende Stimmen in Verbindung mit gelegentlichen Klaviertönen zu hören waren, die Monte Cristo versicherten, dass Mademoiselle Danglars sie bevorzugte zu seiner Gesellschaft und zu der von M. Cavalcanti die Gesellschaft von Mademoiselle Louise d'Armilly, ihrer Gesangslehrerin.
Dann bemerkte der Graf, besonders während er sich mit Madame Danglars unterhielt und offensichtlich von dem Charme des Gesprächs absorbiert war, die Besorgnis von Herrn Andrea Cavalcanti, seine Art, der Musik an der Tür zu lauschen, an der er nicht vorbeizugehen wagte, und seine Art zu zeigen Bewunderung.
Der Bankier kehrte bald zurück. Sein erster Blick galt sicher Monte Christo, der zweite jedoch Andrea. Was seine Frau betrifft, so verneigte er sich vor ihr, wie es manche Ehemänner vor ihren Frauen tun, aber auf eine Weise, die Junggesellen niemals begreifen werden, bis ein sehr umfangreicher Kodex über das Eheleben veröffentlicht wird.
„Haben Sie die Damen nicht eingeladen, mit ihnen ans Klavier zu gehen?“ sagte Danglars zu Andrea.
„Leider nein, Herr“, antwortete Andrea mit einem noch bemerkenswerteren Seufzer als die vorigen. Danglars ging sofort auf die Tür zu und öffnete sie.
Die beiden jungen Damen saßen auf demselben Stuhl am Klavier und begleiteten sich, jede mit einer Hand, eine Phantasie, an die sie sich gewöhnt hatten, und spielten bewundernswert. Mademoiselle d'Armilly, die sie dann durch die offene Tür erblickten, bildete mit Eugénie eines der Tableaux vivants, das die Deutschen so lieben. Sie war ziemlich schön und exquisit geformt – eine kleine feenhafte Gestalt, mit großen Locken, die auf ihren Hals fielen, der etwas zu lang war, wie Perugino manchmal seine Jungfrauen macht, und ihre Augen stumpf vor Müdigkeit. Sie soll eine schwache Brust haben, und wie Antonia in der Cremona-Violine würde sie eines Tages beim Singen sterben.
Monte Cristo warf einen raschen und neugierigen Blick in dieses Allerheiligste; es war das erste Mal, dass er Mademoiselle d'Armilly sah, von der er viel gehört hatte.
„Nun“, sagte der Bankier zu seiner Tochter, „sind wir denn alle auszuschließen?“
Dann führte er den jungen Mann ins Studierzimmer, und entweder durch Zufall oder durch ein Manöver wurde die Tür hinter Andrea teilweise geschlossen, so dass von dem Platz, wo sie saßen, weder der Graf noch die Baronin etwas sehen konnten; aber da der Bankier Andrea begleitet hatte, schien Madame Danglars davon keine Notiz zu nehmen.
Der Graf hörte bald Andreas Stimme, die ein korsisches Lied sang, begleitet vom Klavier. Während der Graf bei diesem Lied lächelte, wodurch er Andrea in der Erinnerung an Benedetto aus den Augen verlor, prahlte Madame Danglars vor Monte Cristo mit der Geistesstärke ihres Mannes, der an diesem Morgen drei- oder vierhunderttausend Francs durch einen verloren hatte Misserfolg in Mailand. Das Lob war wohlverdient, denn hätte der Graf es nicht von der Baronin gehört oder auf eine der Weisen, durch die er alles wusste, hätte ihn das Antlitz des Barons nicht vermuten lassen.
„Hm“, dachte Monte Cristo, „er beginnt, seine Verluste zu verbergen; einen Monat, seit er sich ihrer rühmte.“
Dann laut: „Oh, Madame, Herr Danglars ist so geschickt, er wird bald an der Börse wiedererlangen, was er anderswo verliert.“
„Wie ich sehe, beteiligen Sie sich an einem weit verbreiteten Irrtum“, sagte Madame Danglars.
„Was ist es?" sagte Monte Christo.
„Dass M. Danglars spekuliert, was er aber nie tut.“
„Wahrlich, Madame, ich erinnere mich, dass M. Debray mir erzählt hat – apropos, was ist aus ihm geworden? Ich habe in den letzten drei oder vier Tagen nichts von ihm gesehen.“
„Ich auch nicht“, sagte Madame Danglars; „Aber Sie haben einen Satz begonnen, mein Herr, und ihn nicht beendet.“
„Welchen?"
„M. Debray hatte Ihnen gesagt …«
„Ah ja; er hat mir gesagt, Sie waren es, der dem Dämon der Spekulation geopfert hat.“
„Ich habe es einmal sehr gemocht, aber ich gönne es mir jetzt nicht."
„Dann irren Sie sich, Madame. Das Vermögen ist unsicher; und wenn ich eine Frau wäre und das Schicksal mich zur Frau eines Bankiers gemacht hätte, wie auch immer mein Vertrauen in das Glück meines Mannes sein mag, Sie wissen doch, dass die Spekulation ein großes Risiko darstellt. Nun, ich würde mir unabhängig von ihm ein Vermögen sichern, selbst wenn ich es erworben hätte, indem ich meine Interessen in ihm unbekannte Hände gelegt hätte.“ Madame Danglars errötete trotz all ihrer Bemühungen.
„Bleiben Sie“, sagte Monte Cristo, als hätte er ihre Verwirrung nicht bemerkt, „ich habe von einem Glückstreffer gehört, der gestern bei den neapolitanischen Anleihen gemacht wurde.“
„Ich habe keine – noch habe ich je eine besessen; aber wir haben wirklich lange genug über Geld geredet, Graf, wir sind wie zwei Börsenmakler; haben Si gehört, wie das Schicksal die armen Villeforts verfolgt?“
„Was ist passiert?" sagte der Graf und täuschte völlige Unwissenheit vor.
„Sie wissen, dass der Marquis von Saint-Méran wenige Tage, nachdem er seine Reise nach Paris angetreten hatte, gestorben ist, und die Marquise wenige Tage nach ihrer Ankunft?“
„Ja“, sagte Monte Cristo, „das habe ich gehört; aber, wie Claudius zu Hamlet sagte, „es ist ein Naturgesetz; ihre Väter starben vor ihnen, und sie betrauerten ihren Verlust; sie werden vor ihren Kindern sterben, die ihrerseits um sie trauern werden.'“
„Aber das ist noch nicht alles.“
„Nicht alles!"
"Nein; sie wollten ihre Tochter verheiraten …“
„An Monsieur Franz d'Épinay. Ist es abgebrochen?“
„Gestern morgen hat Franz die Ehrung abgelehnt.“
„In der Tat? Und ist der Grund bekannt?“
„Nein."
„Wie außergewöhnlich! Und wie erträgt es Herr von Villefort?“
„Wie gewöhnlich. Wie ein Philosoph.“
Danglars kehrte in diesem Moment allein zurück.
„Nun“, sagte die Baronin, „lassen Sie Herrn Cavalcanti bei Ihrer Tochter?“