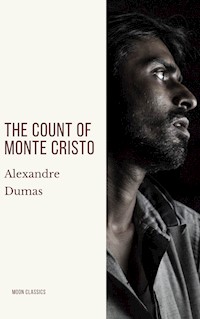3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Hand Gottes
- Sprache: Deutsch
Der junge Edmond Dantès ist glücklich verlobt mit der schönen Mercedes, und ihm wird vom Reeder Morell die Position des Kapitäns eines Segelschiffs in Aussicht gestellt. Alle seine Wünsche scheinen sich zu erfüllen. Doch er wird vom höchsten Glück in den tiefsten Abgrund geschleudert, als es zu einem hinterhältigen Komplott gegen ihn kommt. Jeder der Verschwörer hat einen anderen Grund, Dantès aus dem Weg räumen zu wollen. Durch einen schnellen und willkürlichen Prozess wird er zu Einzelhaft im Inselgefängnis Château d´If veruteilt. Alles scheint verloren. Doch im Kerker lernt er durch Zufall den alten Geistlichen und Mitgefangenen Abbé Faria kennen, der zu seinem Lehrmeister wird und ihm das Versteck eines enormen Schatzes verrät. Schließlich, nach vierzehn Jahren unverschuldeter Kerkerhaft, gelingt es Dantès, durch Glück und eigene Entschlossenheit, von der Gefängnisinsel zu flüchten. Einige Monate später erscheint in der französischen Gesellschaft ein mysteriöser Graf von sagenhaftem Reichtum, der schnell ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerät. Hinter seiner undurchsichtigen Fassade verfolgt dieser jedoch nur ein Ziel: Vergeltung zu üben an den Schuldtragenden, die einst Edmond Dantès um sein Glück brachten. Er ist die Hand Gottes, die gekommen ist, um Rechenschaft zu fordern… Der mehrfach verfilmte Abenteuer-Klassiker liegt hier in einer fünfbändigen und reichhaltig illustrierten Neuausgabe in der ungekürzten Übertragung von August Zoller vor. Dieses ist der dritte Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Graf von Monte Christo
Roman
in fünf Bänden
Überarbeitete und illustrierte Neuausgabe
der ungekürzten Übertragung
aus dem Französischen
von August Zoller
Band 3
DER GRAF VON MONTE CHRISTO wurde im französischen Original Le Comte de Monte-Cristo zuerst veröffentlicht zwischen 1844 und 1846 in der Zeitschrift Le Journal des débats.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von: apebook
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.1
Anmerkungen zur Transkription: Der Text der vorliegenden ungekürzten Ausgabe ist die Übersetzung von August Zoller (1773-1858) der deutschen Ausgabe aus dem Jahr 1846.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band 3
ISBN 978-3-96130-571-1
Buchherstellung & Gestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2023
Books made in Germany with
Die fünf Bände der Reihe
Der Graf von Monte Christo
im Überblick
BAND 1 | BAND 2 | BAND 3 | BAND 4 | BAND 5
Klicke auf die Cover oder auf die Textlinks oben!
Möchtest du anschließend wissen, wie die Geschichte des Grafen von Monte Christo weitergeht? - Dann lies die Fortsetzung:
Dumas Le Prince
Die Totenhand
BAND 1 | BAND 2 | BAND 3 | GESAMTAUSGABE
Klicke auf die Cover oder auf die Textlinks oben!
***
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
Der Graf von Monte Christo. Band 3
Impressum
Der Graf von Monte Christo. Band 3
Dritter Band.
I. Ideologie.
II. Hayde.
III. Die Familie Morrel.
IV. Pyramoz und Thisbe.
V. Toxicologie.
VI. Robert der Teufel.
VII. Steigen und Fallen.
VIII. Der Major Cavalcanti.
IX. Andrea Cavalcanti.
X. Das Luzernengehege.
XI. Herr Noirtier von Villefort.
XII. Das Testament.
XIII. Der Telegraph.
XIV. Das Mittel, einen Gärtner von den Murmeltieren zu befreien, die seine Pfirsiche fressen.
XV. Die Gespenster.
XVI. Das Mittagsmahl.
XVII. Der Bettler.
XVIII. Eheliche Szene.
XIX. Heiratspläne.
XX. Das Kabinett des Staatsanwaltes.
XXI. Ein Sommerball.
XXII. Die Erkundigungen.
XXIII. Der Ball.
XXIV. Brot und Salz.
XXV. Frau von Saint Meran.
XXVI. Das Versprechen.
Die Bände im Überblick
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Festlegung der Verabreichung des Gifts
Dritter Band.
Bist Du nicht mein Master
I. Ideologie.
Hätte der Graf von Monte Christo seit langer Zeit in der Pariser Welt gelebt, so würde er den Schritt von Herrn von Villefort seinem ganzen Werte nach zu schätzen gewußt haben.
Wohlgelitten bei Hofe, ob der regierende König der älteren oder der jüngeren Linie angehörte, ob der erste Minister doktrinär, liberal oder konservativ war, überall wegen seiner Gewandtheit gerühmt, wie man überhaupt diejenigen Leute gewandt nennt, welche nie eine politische Niederlage erlitten haben; von Vielen gehaßt, aber von Einigen warm beschützt, ohne jedoch von irgend Jemand wirklich geliebt zu sein, nahm Herr von Villefort eine von den hohen Stellungen des Beamtenstandes ein und erhielt sich auf dieser Höhe wie ein Harlay oder Molé. Durch eine junge Frau und durch eine kaum achtzehn Jahre alte Tochter aus erster Ehe wiederverjüngt, war sein Salon nichtsdestoweniger einer von jenen strengen Salons in Paris, in denen man den Kultus der Überlieferungen und die Religion der Etiquette bewahrt. Kalte Höflichkeit und unumschränkte Anhänglichkeit an die Grundsätze der Regierung, tiefer Haß gegen die Ideologen, dies waren die von Herrn von Villefort zur Schau gestellten Elemente seines inneren und öffentlichen Lebens.
Herr von Villefort war nicht allein ein Staatsbeamter, sondern beinahe auch ein Diplomat. Seine Beziehungen zu dem alten Hofe, von dem er stets mit Würde und Ehrfurcht sprach, machten ihn bei dem neuen geachtet, und er wußte so viele Dinge, daß man ihn nicht nur beständig schonte, sondern auch bisweilen zu Rate zog. Vielleicht wäre dem nicht so gewesen, wenn man sich seiner hätte entledigen können, aber Herr von Villefort bewohnte, wie jene gegen ihren Oberherrn rebellischen Lehensträger, eine unüberwindliche Feste. Diese Feste war sein Amt als Staatsanwalt, dessen Vorteile er insgesamt vortrefflich auszubeuten wußte, und das er nur aufgegeben hätte, um sich zum Deputierten wählen zu lassen und die Neutralität durch die Opposition zu ersetzen.
Herr von Villefort machte in der Regel wenig Besuche und gab auch wenige zurück. Seine Frau besuchte für ihn; es war dies einmal in der Welt so angenommen, wo man ernsten und zahlreichen Geschäften des öffentlichen Beamten das zuschrieb, was in Wirklichkeit nur eine Berechnung des Stolzes, eine Quintessenz von Aristokratie, die Anwendung des Axioms endlich war: Gib dir den Anschein, als schätztest du dich, und man wird dich schätzen, ein Axiom, welches in unserer Gesellschaft tausendmal nützlicher ist, als das der Griechen: Lerne dich selbst kennen, denn das letztere ersetzt sich in unseren Tagen durch die minder schwierige und viel vorteilhaftere Kunst, Andere kennen zu lernen.
Für seine Freunde war Herr von Villefort ein mächtiger Beschützer, für seine Feinde ein stummer und dumpfer, aber erbitterter Gegner: für die Gleichgültigen war er die Statue des als ein Mensch erscheinenden Gesetzes: das Wesen seines Empfangs hochmütig, Physiognomie unempfindlich, Blick matt und glanzlos oder unverschämt durchdringend und forschend, so war der Mensch, dessen Piedestal vier geschickt auf einander gehäufte Revolutionen von Anfang aufgebaut und dann fest und dauerhaft gemacht hatten.
Herr von Villefort stand im Rufe des am mindesten neugierigen Mannes von Frankreich; seine Ungezwungenheit wurde von allen Seiten gerühmt; er gab jedes Jahr einen Ball und erschien dabei nur eine Viertelstunde, das heißt fünfundvierzig Minuten weniger, als dies der König bei den seinigen tut; niemals sah man ihn in den Theatern oder in den Concerten, noch an irgend einem andern öffentlichen Orte; zuweilen, jedoch selten, machte er eine Partie Whist, und man war dann besorgt, seiner würdige Spieler für ihn zu wählen: irgend einen Botschafter, einen Erzbischof, einen Fürsten, einen ersten Präsidenten, oder eine verwitwete Herzogin.
So war der Mann beschaffen, dessen Wagen vor der Türe des Grafen von Monte Christo hielt.
Der Kammerdiener meldete Herrn von Villefort in dem Augenblick, wo der Graf, über einen großen Tisch gebeugt, auf einer Landkarte den Weg von St. Petersburg nach China verfolgte.
Der Staatsanwalt trat mit demselben ernsten, abgemessenen Schritte ein, mit welchem er im Tribunal erschien; es war derselbe Mensch oder vielmehr die Fortsetzung desselben Menschen, den wir einst als Substitut in Marseille gesehen haben. In ihren Grundsätzen folgerecht, hatte die Natur bei ihm nichts an dem Laufe verändert, den sie sich vorgezeichnet. Von schlank war er mager, von bleich gelb geworden; seine tiefliegenden Augen waren hohl und seine Brille mit der goldenen Fassung schien, auf der Augenhöhle liegend, nunmehr einen Teil seines Gesichtes zu bilden; mit Ausnahme seiner weißen Halsbinde war sein ganzer Anzug schwarz, und diese Trauerfarbe wurde nur durch den leichten Streifen eines roten Bandes unterbrochen, der unmerklich durch sein Knopfloch ging und eine mit dem Pinsel gezogene Blutlinie zu sein schien.
Madame de Villefort
So sehr Monte Christo seiner Herr war, so prüfte er doch mit sichtbarer Neugierde, seine Begrüßung erwidernd, den Beamten, welcher, aus Gewohnheit mißtrauisch und besonders in sehr geringem Grade gläubig in Beziehung aus gesellschaftliche Wunder, mehr geneigt war, in dem edlen Fremden, so nannte man bereits Monte Christo, einen zur Ausbeutung eines neuen Theaters nach Paris gekommenen Industrieritter oder einen bannbrüchigen Missetäter, als einen Fürsten des heiligen Stuhles oder einen Sultan aus Tausend und eine Nacht zu erblicken.
»Mein Herr«, sprach Villefort mit dem kreischenden Tone, welchen öffentliche Beamte bei ihren rednerischen Perioden anzunehmen pflegen, und von dem sie sich auch im Gespräch nicht losmachen können oder wollen, »mein Herr, der ausgezeichnete Dienst, den Sie gestern meiner Frau und meinem Sohne geleistet haben, macht es mir zur Pflicht, Ihnen zu danken. Ich komme daher, um mich dieser Pflicht zu entledigen und Ihnen meine ganze Erkenntlichkeit auszudrücken.«
Während der Staatsbeamte sprach, verlor sein strenges Auge nichts von seiner gewöhnlichen Anmaßung. Er artikulierte seine Worte mit seiner Staatsanwalts-Stimme, mit jener unbiegsamen Steifheit von Hals und Schultern, welche, wir müssen es wiederholen, seine Schmeichler zu dem Aussprache veranlaßte, er wäre die lebendige Bildsäule des Gesetzes.
»Mein Herr.« erwiderte der Graf ebenfalls mit einer eisigen Kälte, »ich fühle mich sehr glücklich, daß ich im Stande gewesen bin, einen Sohn seiner Mutter zu erhalten, denn man sagt, das Gefühl der Mütterlichkeit sei das mächtigste von allen, wie es auch das heiligste von allen ist, und das Glück, welches mir begegnet, mein Herr, überhob Sie der Verbindlichkeit, einer Pflicht nachzukommen, deren Erfüllung mich allerdings ehrt, denn ich weiß, daß Herr von Villefort nicht verschwenderisch mit der Gunst ist, die er mir erzeigt, welche jedoch, so kostbar sie auch sein mag, für mich nicht den Wert der inneren Befriedigung hat.«
Erstaunt über diesen Ausfall, auf den er durchaus nicht gefaßt war, bebte Villefort wie ein Soldat, der den Schlag fühlt, welchen man ihm versetzt, obgleich ihn eine eherne Rüstung bedeckt, und ein verächtliches Zucken seiner Lippe deutete an, daß er den Grafen von Monte Christo nicht für einen sehr artigen Edelmann hielt.
Er schaute umher, um an irgend einen Gegenstand das Gespräch anzuknüpfen, das gefallen war und bei seinem Falle sich zerbrochen zu haben schien.
Er sah die Karte, welche Monte Christo im Augenblick seines Eintrittes betrachtet hatte und sprach:
»Sie beschäftigen sich mit Geographie, mein Herr. Das ist ein reiches Studium, für Sie besonders, der Sie, wie man mich versichert, so viele Länder gesehen haben, als in diesem Atlas sich gezeichnet finden.«
»Ja, mein Herr«, antwortete der Graf, »ich wollte an dem Menschengeschlechte in Masse genommen das machen, was Sie täglich an Ausnahmen treiben, nämlich ein physiologisches Studium. Ich dachte, es wäre mir dann leichter, vom Ganzen auf den Teil herab, als vom Teile zu dem Ganzen hinaufzusteigen. Ein algebraisches Axiom verlangt, daß man vom Bekannten zum Unbekanntem und nicht vom Unbekannten zum Bekannten fortschreite . . . Aber setzen Sie sich doch, mein Herr, ich bitte Sie.«
Monte Christo bezeichnete dem Staatsanwalt ein Fauteuil, das dieser selbst vorzurücken sich die Mühe nehmen mußte, während sich der Graf nur in demjenigen niederlassen durfte, worauf er bei dem Eintritte des Staatsanwaltes gekniet hatte. Auf diese Art fand sich der Graf halb seinem Besuche zugewendet; um dem Rücken war er an das Fenster und mit dem Ellbogen auf die geographische Karte gelehnt, welche für den Augenblick den Gegenstand des Gespräches bildete.
»Ah! Sie philosophieren«, versetzte Villefort nach einem kurzen Stillschweigen, während dessen er, wie ein Athlet, der einen mächtigen Gegner trifft, Vorrat an Kräften gesammelt hatte. »Nun, mein Herr, bei meinem Ehrenworte, wenn ich, wie Sie, nichts zu tun hätte, so würde ich mir wenigstens eine minder traurige Beschäftigung suchen.«
»Es ist wahr«, erwiderte Monte Christo. »der Mensch ist eine häßliche Raupe für denjenigen. welcher ihn unter dem Sonnenmikroskope betrachtet. Doch Sie sagten, glaube ich, ich hätte nichts zu tun; . . . denken Sie zufällig, Sie hätten etwas zu tun, mein Herr? oder um deutlicher zu sprechen, wähnen Sie was Sie tun, sei der Mühe wert, sich etwas zu nennen?«
Das Erstaunen von Herrn von Villefort verdoppelte sich bei diesem zweiten, von seinem seltsamen Gegner auf eine so harte Weise geführten Schlage; seit langer Zeit hatte der Staatsbeamte nicht gehört, daß ihm irgend Jemand eine so starke Paradoxe gesagt, oder vielmehr, um uns schärfer auszudrücken, es war das erste Mal, daß er es hörte.
Der Staatsanwalt schritt auch sogleich zum Werke und erwiderte:
»Mein Herr, Sie sind ein Fremder und haben, wie ich glaube, nach Ihrer eigenen Äußerung, einen Teil Ihres Lebens im Orient zugebracht, Sie wissen also nicht, welch einen klugen abgemessenen Gang bei uns die in barbarischen Ländern so hurtige Justiz hat.«
»Doch, mein Herr, doch, es ist das alte pede claudo. Ich weiß alles Dies, denn ich habe mich hauptsächlich mit der Justiz aller Länder beschäftigt, ich habe das kriminelle Verfahren aller Nationen mit der natürlichen Justiz verglichen und hierbei gefunden, mein Herr, daß das Gesetz der Urväter, nämlich das Gesetz der Wiedervergeltung immerhin dasjenige ist, welches am meisten dem Herzen Gottes entspricht.«
»Würde dieses Gesetz eingeführt, mein Herr«, entgegnete der Staatsanwalt, »so müßte es unsere Codices ungemein vereinfachen, und die Beamten hätten sodann, wie Sie so eben sagten, allerdings nicht mehr viel zu tun.«
»Das kommt vielleicht.« sprach Maule Christo; »Sie wissen, daß die menschlichen Erfindungen vom Zusammengesetzten zum Einsachen fortschreiten, und daß das Einfache stets die Vollkommenheit ist.«
»Mittlerweile, mein Herr«, sagte der Staatsbeamte, »bestehen unsere Gesetzbücher mit ihren den gallischen Sitten, den römischen Gesetzen, den fränkischen Gebräuchen entnommenen kontradiktorischen Artikeln; aber die Kenntnis aller dieser Gesetze erwirbt sich, wie Sie zugestehen werden, nicht ohne lange Arbeiten, und es bedarf zur Erringung dieser Kenntnis ausgedehnter Studien, und ist sie einmal errungen, großer Kraft des Kopfes, um sie nicht zu vergessen.«
»Ich bin auch dieser Meinung; doch Alles, was Sie in Beziehung auf das französische Gesetzbuch wissen, weiß ich nicht nur hinsichtlich des letzteren, sondern auch hinsichtlich der Gesetzbücher aller Nationen; die englischen, die türkischen, die japanesischen, die hinduistischen Gesetze sind mir ebenso genau bekannt, als die französischen: und ich hatte also Recht, wenn ich behauptete, bezüglich (Sie wissen, mein Herr, daß Alles bezüglich ist) daß bezüglich auf das, was ich getan, Sie nur sehr wenig zu tun haben, und daß, bezüglich auf das, was ich gelernt, Sie noch sehr viel zu lernen haben.«
»In welcher Absicht haben Sie dies Alles gelernt?« fragte Villefort erstaunt.
Monte Christo lächelte und sprach:
»Mein Herr, ich sehe. daß Sie, obgleich Sie im Rufe eines erhabenen Mannes stehen, alle Dinge aus dem materiellen, gewöhnlichen Gesichtspunkte der Gesellschaft betrachten. das heißt, aus dem beschränktesten, engsten Gesichtspunkte. welchen zu umfassen dem menschlichen Geiste gestattet ist.«
»Wollen Sie sich näher erklären, mein Herr.« sagte Villefort immer mehr erstaunt; »ich verstehe Sie nicht ganz.«
»Ich sage, mein Herr, daß Sie, die Augen auf die gesellschaftliche Organisation der Nationen geheftet, nur die Federn der Maschine sehen und nicht den erhabenen Arbeiter, welcher dieselbe in Tätigkeit setzt; ich sage, daß Sie vor Ihnen und um Sie her nur die Titelträger der Plätze erkennen, deren Patente von den Ministern oder von einem König unterzeichnet worden sind, und daß die Menschen, welche Gott über die Titelträger, die Minister und die Könige stellte, indem er ihnen eine Sendung zu verfolgen, statt eine Stelle auszufüllen gab, ich sage, daß diese Ihrem kurzen Gesichte entgehen. Es ist dies die Eigenschaft der menschlichen Schwäche bei gebrechlichen und unvollständigen Organen. Tobias hielt den Engel, der ihm das Gesicht zurückgegeben hatte, für einen gewöhnlichen jungen Menschen. Die Nationen hielten Attila, der sie vernichten sollte, für einen Eroberer, wie alle Eroberer, und Beide mußten ihre göttlichen Sendungen offenbaren, damit man sie erkannte; der Eine mußte sagen: ›Ich bin der Engel des Herrn,‹ und der Andere: ›Ich bin der Hammer Gottes,‹ damit das göttliche Wesen von Beiden erkannt wurde.«
»Also«, sagte Villefort, der, immer mehr erstaunt, mit einem Erleuchteten oder mit einem Narren zu sprechen glaubte, »also betrachten Sie sich als eines von den außerordentlichen Wesen, deren Sie so eben erwähnt haben?«
»Warum nicht?« entgegnete kalt Monte Christo.
»Entschuldigen Sie, mein Herr«, versetzte Villefort beinahe bestürzt, »entschuldigen Sie mich, wenn ich Ihnen erscheinend nicht wußte, daß ich zu einem Manne kam, dessen Kenntnisse und geistige Fähigkeiten so weit die gewöhnlichen Kenntnisse und geistigen Fähigkeiten der Menschen überragen. Bei uns, den unglücklichen Verdorbenen der Zivilisation, ist es nicht gebräuchlich, daß Edelleute, wie Sie, im Besitze eines unermeßlichen Vermögens, wenigstens wie man mich versichert, bemerken Sie wohl, ich frage nicht, sondern wiederhole nur, ist es nicht gebräuchlich, sage ich. daß diese Bevorzugten des Reichtums ihre Zeit mit gesellschaftlichen Spekulationen, mit philosophischen Träumen verlieren, welche höchstens dazu geeignet sind, die Menschen zu trösten, die das Schicksal der Güter der Erde enterbt hat.«
»Ei! ei! mein Herr«, versetzte der Graf, »sind Sie denn zu der hohen Stellung, welche Sie einnehmen, gelangt, ohne Ausnahmen zuzulassen oder sogar getroffen zu haben; üben Sie nie Ihren Blick, der doch der Schärfe und Sicherheit so sehr bedürfte, um mit einem Schlage zu erraten, aus wen eben dieser Blick gefallen ist? Müßte nicht ein öffentlicher Beamter, nicht der beste Anwender des Gesetzes, nicht der schlaueste Ausleger der Dunkelheiten der Chicane. sondern eine stählerne Sonde sein, um die Herzen zu prüfen, ein Probirstein, um das Gold zu untersuchen, von welchem jede Seele stets mit mehr oder weniger Legierung gemacht ist?«
»Mein Herr, Sie setzen mich ganz in Verwirrung; bei meinem Worte, ich habe nie Jemand sprechen hören, wie Sie es tun.«
»Dies ist der Fall, weil Sie stets in den Kreis allgemeiner Bedingungen eingeschlossen geblieben sind und es nie wagten, sich mit einem Flügelschlage in die höheren Sphären zu erheben, welche Gott mit unsichtbaren und ausnahmsweisen Wesen bevölkert hat.«
»Und Sie geben zu, mein Herr, daß diese Sphären bestehen. daß die ausnahmsweisen und unsichtbaren Wesen sich mit uns vermischen?«
»Warum nicht! Erblicken Sie die Luft, welche Sie einatmen und ohne die Sie nicht leben könnten?«
»Wir sehen also die Wesen nicht, von denen Sie sprechen?«
»Doch wohl, Sie sehen dieselben, wenn es Gott gestattet, daß sie sich verkörpern; Sie berühren sie, Sie stoßen auf sie, Sie sprechen mit denselben, sie antworten ihnen.«
»Ah!« rief Villefort lächelnd, »ich gestehe, ich möchte wohl davon in Kenntnis gesetzt sein, wenn ein solches Wesen mit mir in Berührung kommt.«
»Sie sind nach Ihrem Wunsch bedient worden, mein Herr, denn man hat Sie so eben davon in Kenntnis gesetzt, und ich wiederhole dies.«
»Also Sie selbst? . . . «
»Ich bin eines von diesen exzeptionellen Wesen, . . . ja, mein Herr, und ich glaube, daß sich bis auf den heutigen Tag noch kein Mensch in einer Stellung befunden hat, welche der meinigen ähnlich gewesen wäre. Die Reiche der Könige sind begrenzt, entweder durch Gebirge, oder durch Flüsse, oder durch den Wechsel der Sitten, oder durch eine Veränderung der Sprache. Mein Reich ist groß wie die Welt. denn ich bin weder Italiener, noch Franzose, noch Hindu, noch Amerikaner, noch Spanier: ich bin Kosmopolit. Kein Land kann sagen, ich gehöre ihm durch die Geburt an. Gott allein weiß, in welchem Lande ich sterben werde. Ich befolge alle Gebräuche, spreche alle Sprachen. Nicht wahr, Sie halten mich für einen Franzosen? denn ich spreche Französisch mit derselben Leichtigkeit und derselben Reinheit, wie Sie. Wohl! Ali, mein Nubier, hält mich für einen Araber; Bertuccio, mein Intendant, glaubt, ich sei ein Römer, und Hayde, meine Sklavin, meint, ich sei ein Grieche. Sie begreifen also: da ich von keinem Lande bin, von keiner Regierung Schutz verlange, keinen Menschen als meinen Bruder anerkenne, so vermag auch keine von den Bedenklichkeiten, welche die Mächtigen zurückhalten, oder keines von den Hindernissen, welche die Schwachen lähmen, mich zu lähmen oder zurückzuhalten. Ich habe nur zwei Gegner; ich sage nicht zwei Besieger, denn durch Beharrlichkeit unterwerfe ich sie: diese Gegner sind die Entfernung und die Zeit. Der dritte und furchtbarste ist mein Zustand als sterblicher Mensch. Dieser allein kann mich auf dem Wege, auf welchem ich fortschreite, und ehe ich das Ziel erreicht habe, nach welchem ich strebe, aufhalten: alles Übrige habe ich berechnet. Alles, was die Menschen die Wechselfälle des Schicksals nennen, habe ich vorhergesehen, und vermag mich auch einer derselben zu treffen, so kann er mich doch nicht niederwerfen. Sterbe ich nicht, so werde ich immer das sein, was ich bin: deshalb sage ich Ihnen Dinge, die Sie nie gehört haben, selbst nicht einmal aus dem Munde der Könige, denn die Könige, bedürfen Ihrer, und die andern Menschen haben Furcht vor Ihnen. Wer sagt sich nicht in einer Gesellschaft, welche so lächerlich organisiert ist, wie die unsere:›Vielleicht werde ich eines Tages mit dem Staatsanwalt zu tun haben.‹«
»Aber, mein Herr, können Sie dies nicht selbst sagen? denn sobald Sie in Frankreich wohnen, sind Sie natürlich den französischen Gesetzen unterworfen.«
»Ich weiß es, mein Herr«, erwiderte Monte Christo, »doch wenn ich in ein Land gehen muß, fange ich damit an, daß ich durch Mittel, die nur mir eigentümlich sind, alle Menschen studiere, von denen ich etwas zu fürchten oder zu hoffen haben kann, und es gelingt mir, sie eben so gut oder vielleicht noch besser kennen zu lernen, als sie sich selbst kennen. Das Resultat hiervon ist, daß der Staatsanwalt, welcher es auch sein mag, wenn ich mit ihm zu tun habe, mehr in Verlegenheit sein wird, als ich.« .
»Damit wollen Sie sagen«, versetzte Villefort zögernd, »daß bei der Schwäche der menschlichen Natur jeder Mensch, Ihrer Ansicht nach, . . . Fehler begangen hat?«
»Fehler oder Verbrechen,« sprach Monte Christo mit gleichgültigem Tone.
»Und daß Sie allein unter den Menschen, welche Sie, wie Sie selbst sagten, nicht als Ihre Brüder anerkennen«, versetzte Villefort mit leicht bebender Stimme, . . . »und daß Sie allein vollkommen sind?«
»Nein, nicht Vollkommen, sondern nur undurchdringlich. Doch genug hiervon, mein Herr; wenn Ihnen das Gespräch mißfällt, so bin ich eben so wenig durch Ihre Justiz bedroht, als Sie durch mein doppelten Gesicht.«
»Nein! nein! mein Herr«, entgegnete rasch Herr von Villefort, der ohne Zweifel befürchtete, es könnte scheinen, als wollte er das Terrain aufgeben. »Durch Ihr glänzendes und beinahe erhabenen Gespräch haben Sie mich über die gewöhnlichen Niveaux erhoben; wir plaudern nicht mehr, wir sind in Abhandlungen begriffen. Sie wissen aber, welche grausame Wahrheiten die Theologen auf ihrem Lehrstühle in der Sorbonne oder die Philosophen bei ihren Disputationen sich oft sagen: nehmen wir an, wir treiben soziale Theologie oder theologische Philosophie, so werde ich Ihnen ganz einfach bemerken: ›Mein Bruder, Sie fröhnen dem Stolze, Sie stehen über Andern, aber Gott steht über Ihnen.‹«
»Über Allen«, erwiderte Monte Christo mit so tiefer Bewegung, daß Villefort unwillkürlich schauerte. »Ich habe meinen Stolz für die Menschen, für diese Schlangen, welche stets bereit sind, sich gegen denjenigen zu erheben, der sie mit der Stirne überragt, ohne sie mit dem Füße zu zertreten. Doch vor Gott, der mich aus dem Nichts hervorgezogen hat, um mich zu dem zu machen, was ich bin, lege ich diesen Stolz ab.«
›Dann bewundere ich Sie, mein Herr Graf«, sprach Villefort, welcher zum ersten Male bei der seltsamen Unterredung sich dieser aristokratischen Form dem Fremden gegenüber bediente, den er bis dahin nur »mein Herr« genannt hatte. »Ja, ich sage Ihnen, wenn Sie wirklich stark, wirklich erhaben, wirklich heilig oder undurchdringlich sind, was, Sie haben Recht, am Ende auf dasselbe herauskommt, so seien Sie stolz, es ist das Gesetz der Herrschaften . . . Aber Sie haben doch irgend einen Ehrgeiz?«
»Ich hatte einen, mein Herr.«
»Welchen?«
»Auch ich bin, wie dies allen Menschen einmal im Leben begegnet, von Satan aus den höchsten Berg der Erde erhoben worden; hier angelangt, zeigte er mir die ganze Welt und sagte zu mir, wie er einst zu Christus gesagt hatte: ›Sprich, Menschenkind, was willst du, wenn du mich anbeten sollst?‹ Ich sann lange nach, denn seit geraumer Zeit zehrte wirklich ein furchtbarer Ehrgeiz an meinem Herzen; dann antwortete ich ihm: ›Ich habe stets von der Vorsehung sprechen hören, und dennoch habe ich sie nie erschaut, noch irgend etwas, was ihr gleicht, und das bringt mich auf den Glauben, sie bestehe gar nicht; ich will die Vorsehung sein, denn das Schönste, das Größte, das Erhabenste, was ich kenne, ist belohnen und strafen.‹ Aber Satan neigte das Haupt, stieß einen Seufzer aus und erwiderte: ›Du irrst Dich, die Vorsehung besteht; nur siehst du sie nicht, weil sie, eine Tochter Gottes, unsichtbar ist, wie ihr Vater. Du hast nichts gesehen, was ihr gleicht, weil sie mit verborgenen Federn zu Werke geht und auf dunkeln, unbekannten Wegen wandelt. Alles, was ich für dich tun kann, besteht darin, daß ich dich zu einem der Werkzeuge der Vorsehung mache.‹ Der Handel wurde abgeschlossen, ich verliere dabei vielleicht meine Seele; doch gleichviel, wäre der Handel noch einmal zu machen, ich machte ihn auch noch einmal.«
Villefort schaute Monte Christo mit dem höchsten Erstaunen an und fragte:
»Haben Sie Verwandte, Herr Graf?«
»Nein, mein Herr, ich bin allein auf der Welt.«
»Desto schlimmer.«
»Warum?«
»Weil Sie ein Schauspiel hätten sehen können, das geeignet gewesen wäre, Ihren Stolz zu brechen. Sie sagen, Sie fürchten nur den Tod?«
»Ich sage nicht, daß ich ihn fürchte, ich sage nur, er könne mich aufhalten.«
»Und das Alter?«
»Meine Sendung wird vollendet sein, ehe ich alt bin.«
»Und den Wahnsinn?«
»Ich bin beinahe wahnsinnig geworden, und Sie kennen das Axiom von bis idem; es ist ein strafrechtliches Axiom und gehört folglich zu Ihrem Ressort.«
»Mein Herr«, versetzte Villefort, »es gibt noch etwas Anderes zu fürchten, als den Tod, das Alter oder den Wahnsinn: zum Beispiel den Schlagfluß, diesen Wetterstrahl, der Sie trifft, ohne Sie zu zerstören, und wonach dennoch Alles vorbei ist. Sie sind es immer noch, und dennoch sind Sie nicht mehr Sie. Sie der Sie, wie Ariel, zunächst dem Engel standen, sind nur noch eine träge Masse, welche, wie Caliban, an das Tier grenzt; das nennt man ganz einfach in der menschlichen Sprache, wie ich Ihnen sagte, Schlagfluß. Beliebt es Ihnen, dieses Gespräch in meinem Hause fortzusetzen, Herr Graf, so kommen Sie, wenn Sie einmal Lust haben, einen Gegner zu treffen, der fähig ist, Sie zu begreifen, und begierig, Sie zu widerlegen, und ich zeige Ihnen meinen Vater, Herrn Noirtier von Villefort, einen der heftigsten Jakobiner der französischen Revolution, das heißt, die glänzendste Kühnheit im Dienste der kräftigsten Organisation, einen Mann, der vielleicht nicht, wie Sie, alle Reiche der Erde gesehen, aber zum Umsturz den einem der mächtigsten beigetragen hat; einen Mann, der sich für einen der Abgesandten, nicht Gottes, sondern des höchsten Wesens, nicht der Vorsehung, sondern des Verhängnisses hielt; nun mein Herr, das Zerspringen eines Blutgefäßes in einem Gehirnlappen hat dies Alles zerstört, und zwar nicht an einem Tage, nicht in einer Stunde, sondern in einer Sekunde. Herr Noirtier, gestern noch ein ehemaliger Jakobiner, ein ehemaliger Senator, ein ehemaliger Carbonaro, lachend über die Guillotine, lachend über die Kanone, lachend über den Dolch, Herr Noirtier, der mit Revolutionen spielte, Herr Noirtier, der Frankreich nur noch als ein großes Schachbrett betrachtete, von dem Bauern, Türme, Ritter und Königin verschwinden mußten, weil der König matt war, Herr von Noirtier, der so furchtbare und so gefürchtete, war am andern Tage nur der arme Herr Noirtier, ein unbeweglicher Greis, dem Willen des schwächsten Wesens vom ganzen Hause, seiner Enkelin Valentine, anheim gegeben; ein stummer, erkalteter Körper, der nur noch ohne Freuden und, ich hoffe, auch ohne Leiden lebt, um der Materie Zeit zu lassen, ohne einen äußern Anstoß zur völligen Auflösung zu gelangen.«
»Ah! dieses Schauspiel ist weder meinen Augen, noch meinem Geiste fremd«, entgegnete Monte Christo, »ich bin ein wenig Arzt und habe, wie meine Collegen, wiederholt die Seele in der lebendigen oder in der toten Materie gesucht, und sie ist, wie die Vorsehung, obgleich meinem Herzen gegenwärtig, doch für meine Augen unsichtbar geblieben. Hundert Schriftsteller haben seit Sokrates, seit Seneca, seit dem heiligen Augustin, seit Gall die Vergleichung gemacht, welche Sie machten, aber dennoch begreife ich, daß die Leiden eines Vaters große Veränderungen in dem Geiste eines Sohnes hervorbringen können. Da Sie mich dazu auffordern, mein Herr so werde ich zum Nutzen meiner Demut dieses furchtbare Schauspiel betrachten, das Ihr Haus sehr betrüben muß.«
»Es wäre dies ohne Zweifel der Fall, hätte mir Gott nicht eine reiche Entschädigung gegeben. Dem sich nach dem Grabe schleppenden Greise gegenüber stehen zwei Kinder, welche in das Leben eintraten: Valentine, eine Tochter aus meiner ersten Ehe mit Fräulein Renée von Saint-Meran, und Eduard, der Sohn, dem Sie das Leben gerettet haben.«
»Und was schließen Sie aus dieser Entschädigung, mein Herr?« fragte Monte Christo.
»Ich schließe daraus, daß mein Vater, durch die Leidenschaften irre geführt, eines von jenen Versehen begangen hat, welche der menschlichen Gerechtigkeit entgehen, aber von der Gerechtigkeit Gottes wahrgenommen werden! . . . und daß Gott, der nur eine Person treffen wollte, auch nur eine geschlagen hat.«
Ein Lächeln aus den Lippen, stieß Monte Christo in der Tiefe seines Herzens ein Gebrülle aus, das Villefort in die Flucht getrieben haben würde, wenn Villefort es hätte hören können!
»Leben Sie wohl, mein Herr«, sagte Villefort, welcher schon seit einiger Zeit aufgestanden war und stehend sprach; »indem ich Sie verlasse, trage ich ein Andenken der Hochachtung mit mir fort, das Ihnen hoffentlich angenehm sein wird, wenn Sie mich näher kennen, denn ich bin nichts weniger, als ein Mensch vom Alltagsschlage. Überdies haben Sie sich Frau von Villefort für ewige Zeit zur Freundin gemacht.«
Der Graf verbeugte sich und begleitete Herrn von Villefort nur bis an die Türe seines Kabinetts; der Staatsanwalt kehrte zu seinem Wagen zurück, wobei zwei Lackeien voraus eilten, welche ihm auf den Wink ihres Herrn den Schlag öffneten.
Als Villefort verschwunden war, sprach Monte Christo, mit aller Anstrengung einen Seufzer aus seiner gepreßten Brust ausstoßend:»Auf, auf, genug des Giftes, und nun, da mein Herz voll davon ist, wollen wir das Gegengift suchen.«
Und er schlug ein Mal aus das Glöckchen und sagte zu dem eintretenden Ali:
»Ich gehe zu Madame hinauf; in einer halben Stunde muß der Wagen bereit sein.
II. Hayde.
Man erinnert sich, wer die neuen oder vielmehr alten Bekannten des Grafen Monte Christo waren, welche in der Rue Meslay wohnten: Maximilian, Julie und Emmanuel.
Die Hoffnung auf den angenehmen Besuch, den er zu machen gedachte, auf die paar glücklichen Augenblicke, die er zubringen würde, auf den Schimmer des Paradieses, welcher in die Hölle gleiten sollte, in die er sich freiwillig versetzt hatte, verbreitete von der Minute, wo er Villefort aus dem Gesichte verlor, die reizendste Heiterkeit über das Antlitz des Grafen, und als Ali, der bei dem Klange des Glöckchens herbeigelaufen war, dieses von einer so seltenen Freude strahlende Gesicht erblickte, zog er sich auf der Fußspitze und mit gehemmtem Atem zurück, als wollte er die guten Gedanken nicht scheu machen, die er seinen Gebieter umschweben zu sehen glaubte.
Es war Mittag: der Graf hatte sich eine Stunde vorbehalten, um zu Hayde hinaufzugehen; man hätte glauben sollen, die Freude könnte nicht mit einem Schlage in diese so lange gebrochene Seele zurückkehren, und sie müßte sich auf die sanften Bewegungen vorbereiten, wie sich andere Seelen auf heftige Erschütterungen vorbereiten müssen.
Die schöne Griechin befand sich erwähnter Maßen in einer Wohnung, welche von der des Grafen völlig getrennt war. Ihre Gemächer hatte man ganz auf orientalische Weise ausgeschmückt, das heißt die Böden waren mit dicken türkischen Teppichen bedeckt, Brokatstoffe fielen an den Wänden herab, und in jedem Zimmer breitete sich ein großer Divan rings umher mit Haufen von Kissen aus, die sich nach der Willkür derjenigen, welche davon Gebrauch machten, von einer Stelle zur andern versetzen ließen.
Hayde hatte drei französische Kammerfrauen und eine griechische. Die drei französischen Kammerfrauen verweilten im ersten Zimmer, bereit auf den Ton eines goldenen Glöckchens herbeizulaufen und den Befehlen der romaischen Sklavin zu gehorchen, welche hinreichend Französisch sprach, um den Willen ihrer Gebieterin diesen drei Frauen zu verdolmetschen, die nach der Vorschrift von Monte Christo Hayde mit der Rücksicht zu behandeln hatten, die man nur gegen eine Königin beobachtet.
Die Griechin befand sich in dem hintersten Zimmer ihrer Wohnung, in einer Art von rundem, nur von oben beleuchteten Boudoir, in welches das Licht durch Scheiben von rosenfarbigem Glase drang. Sie lag auf dem Boden auf Kissen von blauen, mit Silber durchwirktem Atlaß, halb zurückgelehnt auf den Divan, den Kopf mit ihrem weich gerundeten rechten Arme umrahmend, während sie mit der Linken an ihre Lippen die Korallenspitze hielt, in welche das biegsame Rohr einer persischen Pfeife eingefügt war, die den Dampf in ihren Mund nur durch das Benzoewasser parfümiert gelangen ließ, durch das ihn ihr sanfter Atem zu ziehen zwang.
Ihre Lage, obgleich ganz natürlich für eine Frau aus dem Orient, wäre vielleicht für eine Französin von einer zu sehr gesuchten Koketterie gewesen.
Ihr Anzug war der der epirotischen Frauen; sie trug nämlich Beinkleider von weißem, mit rosenfarbigen Blumen broschiertem Atlaß, welche zwei Kinderfüße entblößt ließen, von denen man hätte glauben sollen, sie wären von parischem Marmor, hätte man sie nicht mit zwei kleinen, mit Gold und Perlen gestickten Sandalen mit aufwärts gebogenen Spitzen spielen sehen; eine blau und weiß gestreifte Jacke mit weiten, unten geschlitzten Ärmeln, mit silbernen Knopflöchern und Knöpfen von Perlen; endlich eine Art von Leibchen, das durch seinen herzförmigen Schnitt den Hals und den ganzen oberen Teil der Brust sehen ließ und unterhalb des Busens mit drei Diamantknöpfen geschlossen wurde. Der untere Teil des Leibchens und der obere des Beinkleides verschwanden unter einem von jenen Gürteln mit den lebhaften Farben und den langen seidenen Fransen, aus deren Besitz unsere eleganten Pariserinnen so stolz sind.
Auf dem Kopfe hatte sie ein mit Gold und Perlen gesticktes, auf die Seite geneigtes Mützchen, und unter dem Mützchen auf der Seite, auf welche sich dasselbe herabneigte, trat eine schöne, natürliche, purpurrote Rose, vermischt mit Haaren, so schwarz, daß sie blau zu sein schienen, hervor.
Die Schönheit dieses Gesichtes war die griechische Schönheit in der ganzen Vollendung ihres Typus, mit ihren großen, schwarzen, samtartigen Augen, mit ihrer marmornen Stirne, mit ihrer geraden Nase, ihren Korallenlippen und ihren Perlzähnen.
Dann war über dieses reizende Ganze die Jugend mit all ihrem Schimmer, mit all ihrem Wohlgeruch ausgebreitet; Hayde mochte kaum neunzehn bis zwanzig Jahre alt sein.
Monte Christo rief der griechische Kammerfrau und ließ Hayde um Erlaubnis bitten, bei ihr eintreten zu dürfen.
Statt jeder Antwort hieß Hayde ihre Zofe den Vorhang zurückschlagen, welcher an der Türe angebracht war, deren Simswerk das junge Mädchen wie ein reizendes Gemälde umrahmte.
Monte Christo trat ein.
Hayde erhob sich auf den Ellenbogen, reichte dem Grafen ihre Hand, lächelte ihm freundlich entgegen und sagte in der wohlklingenden Sprache der Töchter von Sparta und Athen:
»Warum läßt Du mich um Erlaubnis bitten, bei mir eintreten zu dürfen? Bist Du nicht mehr mein Gebieter, bin ich nicht mehr Deine Sklavin?«
Monte Christo lächelte ebenfalls und erwiderte:
»Hayde, Sie wissen . . . «
»Warum sagst Du nicht mehr Du zu mir, wie gewöhnlich?« unterbrach ihn die junge Griechin; »habe ich denn irgend ein Versehen begangen? Dann mußt Du mich bestrafen und nicht mehr Sie nennen.«
»Hayde«, entgegnete der Graf, »Du weißt, daß wir in Frankreich sind, und daß Du folglich frei bist.«
»Frei, was zu tun?« fragte das Mädchen.
»Es steht Dir frei, mich zu verlassen.«
»Dich verlassen! . . . Und warum sollte ich Dich verlassen?«
»Was weiß ich? Wir werden die Welt sehen.«
»Ich will Niemand sehen.«
»Und wenn Du unter den jungen Leuten, denen Du begegnen wirst, einen träfest, der Dir gefiele, so wäre ich nicht so ungerecht . . . «
»Ich habe keinen schöneren Mann, als Du bist, gesehen, und nie einen andern geliebt, als meinen Vater und Dich.«
»Armes Kind«, sagte Monte Christo, »Du hast beinahe Niemand gesprochen, außer mir und Deinem Vater.«
»Wohl! was brauche ich mit Anderen zu sprechen? Mein Vater nannte mich seine Freude, Du nennst mich Deine Liebe, und Ihr Beide nennt mich Euer Kind.«
»Du erinnerst Dich Deines Vaters, Hayde?«
Das junge Mädchen lächelte.
»Er ist da und da«, sprach die Griechin, ihre Hand auf ihre Augen und auf ihr Herz legend.
»Und ich, wo bin ich?« fragte lächelnd Monte Christo.
»Du«, erwiderte sie, »Du bist überall.«
Monte Christo nahm die Hand von Hayde, uni sie zu küssen. aber das naive Kind entzog ihm seine Hand und bot ihm die Stirne dar.
»Nun weißt Du, Hayde«, sprach der Graf, »daß Du frei, daß Du Gebieterin, daß Du Königin bist; Du kannst Deine Tracht beibehalten oder nach Deiner Laune aufgeben. Du bleibst hier, wenn Du bleiben willst, Du fährst aus, wenn Du ausfahren willst; es wird stets ein Wagen für Dich angespannt sein, Ali und Myrtho begleiten Dich überallhin und sind zu Deinem Befehl; nur bitte ich Dich um Eines.«
»Sprich.«
»Bewahre das Geheimnis Deiner Geburt, sage kein Wort über Deine Vergangenheit, nenne bei keiner Veranlassung den Namen Deines erhabenen Vaters oder den Deiner armen Mutter.«
»Herr, ich habe Dir bereits gesagt, daß ich Niemand sehen werde.«
»Höre mich, Hayde: diese orientalische Abgeschlossenheit wird Dir in Paris vielleicht unmöglich werden, fahre fort, das Leben in unsern nördlichen Ländern kennen zu lernen, wie Du dies in Rom, in Florenz, in Mailand und in Madrid getan hast; dies wird Dir immerhin nützlich sein, magst Du nun beständig hier leben oder nach dem Orient zurückkehren.«
Das Mädchen schlug seine großen, feuchten Augen zu dem Grafen auf und erwiderte:
»Oder ob wir nach dem Orient zurückkehren, willst Du sagen, nicht wahr, Herr?«
»Ja, meine Tochter, Du weißt wohl, daß ich Dich nie verlassen werde. Es ist nicht der Baum, der die Blüte verläßt, sondern die Blüte, die sich vom Baume trennt.«
»Ich werde Dich auch nicht verlassen, Herr, denn ich weiß, daß ich ohne Dich nicht leben konnte.«
»Armes Kind! in zehn Jahren bin ich alt, und in zehn Jahren bist Du noch ganz jung.«
»Mein Vater hatte einen langen, weißen Bart; das hinderte mich nicht, ihn zu lieben; mein Vater zählte sechzig Jahre und er kam mir schöner vor, als alle junge Leute, welche ich sah.«
»Doch sage mir, glaubst Du, daß Du Dich hier angewöhnen wirst?«
»Werde ich Dich sehen?«
»Jeden Tag.« .
»Nun! warum fragst Du mich dann, Herr?«
»Ich befürchte, Du langweilst Dich.«
»Nein, Herr, denn am Morgen denke ich, daß Du kommen wirst, und am Abend erinnere ich mich, daß Du gekommen bist; überdies habe ich, wenn ich allein bin, noch andere große Erinnerungen, ich erblicke wieder ungeheure Gemälde, große Horizonte mit dem Pindus und dem Olymp in der Ferne; dann habe ich im Herzen drei Gefühle, mit denen man sich nie langweilt: die Traurigkeit, die Liebe und die Dankbarkeit.«
»Du bist eine würdige Tochter des Epirus, Hayde, Du Anmutige, Du Poetische, und man sieht, daß Du von der in Deinem Lande geborenen Familie von Göttinnen abstammst. Sei also unbesorgt, meine Tochter, ich werde es so machen, daß Deine Schönheit nicht verloren geht, denn wenn Du mich wie Deinen Vater liebst, so liebe ich Dich wie mein Kind.«
»Du täuschest Dich, Herr, ich liebte meinen Vater nicht, wie ich Dich liebe, meine Liebe für Dich ist eine andere Liebe: mein Vater ist tot und ich bin nicht tot, während ich sterben müßte, wenn Du sterben würdest.«
Der Graf reichte Hayde die Hand mit einem Lächeln voll tiefer Zärtlichkeit; sie druckte wie gewöhnlich ihre Lippen darauf.
Und so gestimmt für die Zusammenkunft, die er mit Morrel und seiner Familie haben sollte, entfernte er sich, folgende Verse von Pindar murmelnd:
»Die Jugend ist eine Blüte, deren Frucht die Liebe ist . . . Glücklich der Leser, der sie pflückt, nachdem er sie langsam hat reifen sehen.«
Der Wagen war seinen Befehlen gemäß bereit. Er stieg ein und die Pferde führten ihn wie immer im Galopp fort.
III. Die Familie Morrel.
Der Graf gelangte in wenigen Minuten in die Rue Meslay Nro. 7. Das Haus war weiß, lachend und vor demselben ein Hof, in welchem man zwei kleine Gartenstücke mit schönen Blumen erblickte.
In dem Concierge, der ihm die Türe öffnete, erkannte der Graf den alten Cocles. Da dieser aber, wie man sich erinnert, nur ein Auge hatte und dieses Auge seit neun Jahren bedeutend geschwächt worden war, so erkannte Cocles den Grafen nicht wieder.
Wenn die Wagen vor dem Eingang anhalten wollten, mußten sie eine Wendung machen, um einen Wasserstrahl zu vermeiden, der aus einem grottenartigen Bassin hervorsprang . . . ein Prachtwerk, das viel Eifersucht in dem Quartiere veranlaßt hatte und die Ursache war, warum man dieses Haus »Klein-Versaille« nannte.
Es bedarf nicht der Erwähnung, daß in dem Bassin rote und gelbe Fische in großer Anzahl sich lustig umhertrieben.
Über einem Stockwerke aus Küchen und Kellern stehend, hatte das Haus, außer dem Erdgeschoße, noch zwei volle Stockwerke, die jungen Leute hatten es, mit dem was dazu gehörte, nämlich mit einer ungeheuren Werkstätte, zwei Pavillons im Hintergrunde eines Gartens und in dem Garten selbst gekauft. Emmanuel sah mit dem ersten Blicke, daß bei dieser Anordnung der Gebäulichkeiten eine Spekulation zu machen war; er behielt für sich das Haus, die Hälfte des Gartens und zog eine Linie, das heißt er erbaute eine Mauer zwischen sich und den Werkstätten und vermietete diese nebst den zwei Pavillons und den dazu gehörigen Gartenteilen: hierdurch wohnte er um eine sehr mäßige Summe und ebenso gut für sich abgeschlossen, wie der ängstlichste Eigentümer eines Hotel im Faubourg Saint-Germain.
Das Speisezimmer war von Eichenholz, der Salon von Mahagoni und blauem Sammet. das Schlafzimmer von Zitronenholz und grünem Damast, überdies fanden sich hier ein Arbeitscabinet für Emmanuel, der nichts arbeitete, und ein Musikzimmer für Julie, welche durchaus keine Tonkünstlerin war.
Den ganzen zweiten Stock hatte man Maximilian zur Verfügung gestellt. Man sah hier eine genaue Wiederholung der Zimmer seiner Schwester, nur hatte man den Speisesaal in ein Billardzimmer verwandelt, in das er seine Freunde zu führen pflegte.
Er überwachte selbst die Wartung seiner Pferde und rauchte eine Zigarre am Eingang des Gartens, als der Wagen des Grafen vor der Türe anhielt.
Cocles öffnete, wie gesagt; Baptistin sprang von seinem Bocke und fragte, ob Herr und Madame Herbault und Herr Maximilian Morrel für den Grafen von Monte Christo sichtbar wären.
»Für den Grafen von Monte Christo!« rief Morrel seine Zigarre wegwerfend und dem Besuche entgegen eilend: »ich glaube wohl, ich glaube wohl, daß wir für ihn sichtbar sind. Ah! Dank, tausendmal Dank, Herr Graf, daß Sie Ihr Versprechen nicht vergessen haben.«
Und der Junge Offizier drückte dem Grafen so innig die Hand, daß dieser sich in der Treuherzigkeit seiner Kundgebung nicht täuschen konnte und mit dem erstere Blicke sah, daß er mit Ungeduld erwartet worden war und die wärmste Ausnahme fand.
»Kommen Sie, kommen Sie«, sprach Maximilian, »ich will Ihnen als Einführer dienen; ein Mann, wie Sie sind, darf nicht durch Bedienten gemeldet werden; meine Schwester ist in ihrem Garten und bricht ihre verwelkten Rosen ab; mein Schwager liest seine zwei Zeitungen sechs Schritte von ihr, denn überall, wo man Madame Herbault sieht, darf man nur im Umkreise einer Rute umherschauen, und Herr Emmanuel wird sich finden, und so gegenseitig, wie man in der polytechnischen Schule sagt.«
Bei dem Geräusche der Tritte hob eine junge Frau von fünfundzwanzig biet dreißig Jahren in einem seidenen Hauskleide den Kopf. Diese Frau, welche mit besonderer Sorgfalt von einem herrlichen Rosenstock die Blumen abklaubte, war unsere kleine Julie, nunmehr, wie dies der Mandatar des Hauses Thomson und French vorhergesagt hatte, Frau Emmanuel Herbault.
Sie stieß einen leichten Schrei aus, als sie einen Fremden erblickte, Maximilian aber sprach lachend:
»Laß Dich nicht stören, meine Schwester; der Herr Graf befindet sich erst seit zwei bis drei Tagen in Paris, weiß aber bereits, was eine Rentière des Marais ist, und wenn er es nicht weiß, so wirst Du es ihn lehren.«
»Ah! mein Herr.« sprach Julie, »Sie so hierherzuführen, ist ein Verrat von meinem Bruder, der nicht die geringste Eitelkeit für seine arme Schwester besitzt . . . Penelon! . . . Penelon! . . . «
Ein Greis, der eine Rabatte mit bengalischen Rosenstöcken umgrub, steckte seinen Spaten in die Erde und näherte sich die Mütze in der Hand, während er so gut als möglich den Kautaback verbarg, den er für den Augenblick in die Tiefen seiner Backen zurückgeschoben hatte. Einige weiße Büschel versilberten sein noch dickes Haupthaar, indes seine bronzefarbige Gesichtshaut und sein kühnes, lebhaftes Auge den alten, unter der Sonne des Äquators gebräunten und vom Hauche der Stürme geschwärzten Seemann verrieten.
»Ich glaube, Sie haben mich gerufen«, Fräulein Julie, sagte er, »hier bin ich.«
Penelon hatte die Gewohnheit beibehalten, die Tochter seines Patrons Fräulein Julie zu nennen, und war nie im Stande gewesen, sich daran zu gewöhnen, ihr den Namen Madame Herbault zu geben.
»Penelon«, sagte Julie, »melde Herrn Emmanuel den angenehmen Besuch, der uns zu Teil wird, während Maximilian den Herrn Grafen in den Salon führt.«
Dann sich an Monte Christo wendend:
»Sie werden mir wohl erlauben, auf eine Minute zu entfliehen?«
Und ohne die Einwilligung des Grafen abzuwarten, eilte sie hinter eine Baumgruppe und erreichte das Haus durch eine Seitenallee.
»Ah! mein lieber Herr Morrel«, sprach Monte Christo, »ich bemerke zu meinem Schmerze, daß ich einen Aufruhr in Ihrer Familie veranlasst.«
»Sehen Sie«, erwiderte Maximilian lachend, »sehen Sie dort unten den Mann, der ebenfalls sein Wamms gegen einen Oberrock zu vertauschen im Begriffe ist? O! man kennt Sie, glauben Sie mir, Sie waren angekündigt.«
»Sie scheinen mir hier eine glückliche Familie zu haben, mein Herr«, sagte der Graf seinen eigenen Gedanken beantwortend.
»O ja! dafür stehe ich Ihnen, Herr Graf; es fehlt ihnen nichts zu ihrem Glücke, sie sind jung, sie sind heiter, sie lieben sich, und mit ihren fünfundzwanzigtausend Franken Rente bildete sie sich ein, sie besitzen den Reichtum der Rothschilds.«
»Fünfundzwanzigtausend Franken Rente ist übrigens wenig.« sprach Monte Christo mit einer Weichheit, welche in Maximilians Herz drang, wie es nur die Stimme eines zärtlichen Vaters hätte tun können; »doch sie werden nicht hierbei stehen bleiben, unsere jungen Leute, sie werden ebenfalls Millionäre werden. Ihr Herr Schwager ist Advokat . . . Arzt? . . . «
»Er war Kaufmann, mein Herr Graf, und hatte das Haus meines armen Vaters übernommen. Herr Morrel starb mit Hinterlassung eines Vermögens von fünfmal hunderttausend Franken; ich bekam die eine Hälfte und meine Schwester die andere, denn wir waren nur zwei Kinder, Ihr Gatte. der sie ohne ein anderes Erbgut als seine Redlichkeit, seinen scharfen Verstand und seinen fleckenlosen Ruf geheiratet hatte, wollte ebenso Viel besitzen als seine Frau. Er arbeitete bis er zweimal hundert fünfzigtausend Franken zusammen gebracht hatte; hier genügten sechs Jahre. Ich schwöre Ihnen, Herr Graf, sie boten ein rührendes Schauspiel, diese zwei so fleißigen, so einigen Kinder, welche, durch ihre Fähigkeiten zum höchsten Vermögen bestimmt, dennoch nichts an den Gewohnheiten des väterlichen Hauses verändern wollten und sechs Jahre dazu verwendetem um das zu tun, was Neuerer in zwei bis drei hätten tun können; Marseille widerhallt auch noch heute von Lobeserhebungen, welche man so viel mutiger Verleugnung nicht verweigern konnte.«
Eines Tags suchte Emmanuel seine Frau auf und sprach zu ihr:
›Julie, Cocles hat mir so eben eine Rolle von hundert Franken zugestellt, welche die Summe von zweimal hundertfünfzig tausend Franken voll macht, die wir als Grenze unseres Gewinnes feststellen. Wirst Du mit dem Wenigen, womit wir uns fortan begnügen müssen, zufrieden sein? Höre, das Haus macht jährlich für eine Million Geschäfte und kann einen Nutzen von vierzigtausend Franken abwerfen. Wir verkaufen, wenn wir wollen, die Kundschaft in einer Stunde für dreimal hunderttausend Franken, denn hier ist ein Brief von Herrn Delaunay, der uns dieselben für unsern Fonds anbietet, welchen er mit dem seinigen verbinden will. Was meinst Du, daß zu tun sei?‹
›Mein Freund,‹ erwiderte meine Schwester, ›das Haus Morrel kann nur durch einen Morrel gehalten werden. Ist es nicht dreihunderttausend Franken wert, den Namen unseres Vaters für immer vor schlimmem Wechsel des Schicksals zu schützen?‹
›Ich dachte es‹, erwiderte Emmanuel, ›wollte jedoch Deine Ansicht wissen.‹
›Wohl, mein Freund, hier hast Du sie. Alle unsere Ausstände sind eingezogen, alle unsere Wechsel sind bezahlt; wir können einen Strich unter den letzten des Monats ziehen und unsere Comptoirs schließen; ziehen wir diesen Strich und schließen wir sie;‹ was auch auf der Stelle geschah, Es war drei Uhr: um ein Viertel auf vier Uhr zeigte sich ein Kunde, um die Fahrt von zwei Schiffen versichern zu lassen; hierbei ließ sich ein reiner Gewinn von fünfzehntausend Franken erwarten.
›Mein Herr,‹ sprach Emmanuel, ›wollen Sie sich wägen dieser Versicherung an Herrn Delaunay wenden. Wir haben das Geschäft aufgegeben.‹
›Seit wann?‹ fragte der erstaunte Kunde.
Madame Emanuel Herbaut
›Seit einer Viertelstunde.‹
»Und auf diese Art haben meine Schwester und mein Schwager nur fünfundzwanzig tausend Franken Rente«, fügte Maximilian lächelnd bei.
Maximilian hatte kaum seine Erzählung, während der sich das Herz des Grafen immer mehr ausdehnte, vollendet, als Emmanuel, aufgefrischt durch einen Hut und einen Oberrock wieder erschien; er grüßte wie ein Mann, der den Wert des Besuches kennt, ließ den Grafen das kleine Luftstück umgehen und führte ihn in das Haus.
Der Salon war bereits von Blumen durchduftet, welche nur mit großer Mühe in einer ungeheuren japanesischen Vase mit natürlichen Handhaben zusammengehalten wurden. Hübsch gekleidet und zierlich frisiert (sie hatte dieses große Werk in zehn Minuten vollendet), trat Julie hervor, um den Grafen bei seinem Eintritt zu empfangen.
Man hörte die Vögel in einer benachbarten Voliére zwitschern; die Zweige von Bohnenbäumen und Akazien dienten mit ihren hereinhängenden Blütenbüscheln den blauen Sammetvorhängen als Stickerei. Alles atmete in diesem kleinen Winkel Ruhe, von dem Gesange des Vogels bis zu dem Lächeln der Gebieter.
Der Graf hatte seit dem Eintritte in das Haus die ganze Fülle dieses Glückes in sich aufgenommen; er blieb auch stumm und träumerisch, und vergaß, daß man ihn anschaute und von ihm die Wiederaufnahme des nach den ersten Komplimenten unterbrochenen Gespräches zu erwarten schien.
Endlich bemerkte er dieses beinahe unschicklich gewordene Stillschweigen, entriß sich mit aller Anstrengung seiner Träumerei und sprach:
»Madame, verzeihen Sie mir eine Gemütsbewegung, welche Sie, die Sie an den Frieden und an das Glück, das ich hier treffe, gewöhnt sind, in Erstaunen setzen muß; doch für mich ist die Zufriedenheit auf einem menschlichen Antlitz etwas so Neues, daß ich nicht müde werden kann, Sie und Ihren Gatten anzuschauen.«
»Wir sind in der Tat sehr glücklich«, versetzte Julie; »aber wir hatten lange zu leiden, und wenige Menschen mußten ihr Glück so teuer erkaufen, wie wir.«
Die Neugierde prägte sich in den Zügen des Grafen aus.
»Oh! das ist eine ganze Familiengeschichte, wie Ihnen neulich Chateau-Renaud sagte.« sprach Maximilian; »für Sie, mein Herr Graf, der Sie gewohnt sind, erhabenes Unglück und glänzende Freuden zu sehen, dürfte wenig Interesse in diesem häuslichen Gemälde zu finden sein. Jeden Falls haben wir, wie Ihnen Julie so eben sagt, heftige Schmerzen ausgestanden, obgleich dieselben in diesen kleinen Rahmen eingeschlossen waren.«
»Und Gott hat Ihnen, wie er es bei Allen tut, den Balsam des Trostes aus das Leiden gegossen?« fragte Monte Christo.
»Ja, mein Herr Graf«, antwortete Julie; »wir können dies wohl sagen, denn er hat für uns getan, was er nur für seine Auserwählten tut; er schickte uns einen von seinen Engeln.«
Die Röte stieg dem Grafen in die Wangen, und er hustete, um ein Mittel zu haben, seine Aufregung, ein Sacktuch an den Mund haltend, zu verbergen.
»Diejenigen, welche in einer purpurnen Wiege geboren sind und nie etwas zu wünschen gehabt haben.« sprach Emmanuel, »wissen nicht, was das Glück, zu leben, heißt; wie diejenigen den Wert eines reinen Himmels nicht kennen, welche nie ihr Leben der Gnade von vier auf ein wütendes Meer geschleuderten Brettern preisgegeben haben.«
Monte Christo stand auf und ging, ohne etwas zu erwidern, denn am Zittern seiner Stimme hatte man die Erschütterung zu erkennen vermocht, Schritt für Schritt durch den Salon.
»Sie lächeln über unsere Herrlichkeit, Herr Graf.« sprach Maximilian, der ihm mit den Augen folgte.
»Nein, nein«, entgegnete Monte Christo, äußerst bleich und mit einer Hand die Schläge seines Herzens zurückdrängend, während er mit der andern auf eine kristallene Kugel deutete, unter welcher eine seidene Börse, kostbar gelagert auf einem Kissen von schwarzem Sammet, ruhte. »Ich fragte mich nur, wozu diese Börse diene, welche, wie mir scheint, auf der einen Seite ein Papier, und auf der andern einen ziemlich schönen Diamant enthält.«
Maximilian nahm eine ernste Miene an und erwiderte:
»Dieses, mein Herr Graf, ist der köstlichste von unseren Familienschätzen.«
»Ja der Tat, der Diamant ist ziemlich hübsch«, wiederholte Monte Christo.
»Oh! mein Bruder spricht nicht von dem Werte des Steines, obgleich er zu hunderttausend Franken geschätzt wird, er will Ihnen nur sagen, daß die Gegenstände, welche diese Börse enthält, Reliquien von dem, Engel sind, von welchem vorhin die Rede war.«
»Ich begreife das nicht und darf auch nicht fragen, Madame«, erwiderte Monte Christo sich verbeugend; »verzeihen Sie mir, ich wollte nicht indiskret sein.«
»Indiskret, sagen Sie? oh! wie glücklich machen Sie uns im Gegenteil dadurch, daß Sie uns Gelegenheit bieten, uns des Breiteren über diesen Gegenstand auszusprechen. Wollten wir als ein Geheimnis die schöne Handlung verbergen, an welche diese Börse erinnert, so würden wir sie nicht auf eine solche Art den Blicken aussetzen. Oh! wie gern möchten wir sie der ganzen Welt mitteilen, damit uns irgend eine Bewegung unseres unbekannten Wohltäters seine Gegenwart enthüllte.«
»Ah! wirklich?« versetzte Monte Christo mit gepreßter Stimme.
»Mein Herr«, sprach Maximilian, die Kristallkugel aufhebend und gleichsam mit religiöser Verehrung die seidene Börse küssend, »dieses hat die Hand eines Mannes berührt, der meinen Vater vom Tode, uns vom Untergang und unsern Namen Von der Schande errettete; ein Mann, dem wir es zu verdanken haben, daß wir armen, bereits dem Elend und den Tränen bloßgestellten Kinder hören können, wie Menschen über unser Glück in Begeisterung geraten. Dieser Brief«, Maximilian zog einen Brief aus der Börse und reichte ihn dem Grafen, »dieser Brief wurde von ihm an einem Tage geschrieben, wo mein Vater einen Verzweiflungsvollen Entschluß gefaßt hatte, diesen Diamant gab der edelmütige Unbekannte meiner Schwester als Mitgift.«
Monte Christo nahm den Brief und las ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke von Glück; es war das unsern Lesern bekannte Billett, adressiert an Julie und unterschrieben von Simbad dem Seefahrer.
»Der Unbekannte, sagen Sie? Also ist der Mann, der Ihnen diesen Dienst geleistet hat, für Sie unbekannt geblieben?«
»Ja, mein Herr, nie haben wir das Glück gehabt, ihm die Hand zu drücken; doch nicht als hätten wir Gott nicht um diese Gunst gebeten«, sprach Maximilian: »in diesem ganzen Abenteuer waltete eine geheimnisvolle Leitung, welche wir noch nicht begreifen können; Alles wurde von einer unsichtbaren, mit der Macht eines Zauberers ausgerüsteten Hand geordnet.«
»Oh!« rief Julie, »ich habe noch nicht jede Hoffnung verloren, eines Tags diese Hand zu küssen, wie ich die Börse küsse, welche dieselbe berührt hat. Vor vier Jahren war Penelon in Triest: Penelon, Herr Graf, ist der brave Seemann, den Sie mit dem Spaten in der Hand gesehen haben; vom Hochbootsmann ist er Gärtner geworden. Penelon war also in Triest und sah auf dem Kai einen Engländer, der sich in einer Yacht einzuschiffen im Begriffe war; sogleich erkannte er denjenigen, welcher am 5. Juni 1829 meinen Vater aufgesucht und mir am 5. September dieses Billett geschrieben hatte. Es war, wie er versichert, derselbe Mann, doch er wagte es nicht, ihn anzureden.«
»Ein Engländer!« versetzte Monte Christo träumerisch, aber mit einer gewissen Unruhe jeden Blick von Julie beobachtend: »ein Engländer, sagen Sie?«
»Ja«, erwiderte Maximilian, »ein Engländer, der bei uns als Mandatar des Hauses Thomson und French in Rom erschien. Deshalb sahen Sie mich beben, als Sie neulich bei Herrn von Morcerf bemerkten, Thomson und French in Rom wären Ihre Bankiers. Dieses ereignete sich im Jahre 1829, wie wir Ihnen sagten, und ich frage Sie im Namen des Himmels, haben Sie diesen Engländer gekannt?«
»Doch sagten Sie mir nicht, es sei von dem Hause Thomson und French beständig in Abrede gezogen worden, daß es Ihnen diesen Dienst geleistet?«
»Ja.«
»Sollte denn dieser Engländer nicht ein Mensch sein, der, dankbar gegen Ihren Vater für irgend eine gute Handlung, die der letztere selbst vergessen, diesen Vorwand ergriffen hätte, um ihm einen Dienst zu leisten?«
»Unter solchen Umständen ist Alles zu vermuten, selbst ein Wunder.«
»Wie hieß er?« fragte Monte Christo.
»Er hat keinen andern Namen zurückgelassen.« sprach Julie, den Grafen mit einer tiefen Aufmerksamkeit betrachtend, »als den, mit welchem er das Billett unterzeichnete, Simbad der Seefahrer.«
»Was offenbar kein Name, sondern ein Pseudonym ist.«
Und als ihn Julie immer aufmerksamer anschaute und einige Töne seiner Stimme gleichsam im Fluge aufzufangen und zu sammeln suchte, fuhr er fort:
»Sagen Sie, ist es nicht ein Mann ungefähr von meinem Wachse, vielleicht etwas größer, etwas schlanker, in eine hohe Halsbinde eingezwängt, am Leibe eingeknöpft, gegürtet, und beständig den Bleistift in der Hand?«
»Oh! Sie kennen ihn also?« rief Julie mit Freude strahlenden Augen.
»Nein, ich habe nur eine Vermutung. Ich kannte einen Lord Wilmore, der auf diese Art Handlungen des Edelmuts aussäte.«
»Ohne sich zu erkennen zu geben?«
»Es war ein bizarrer Mensch: er glaubte nicht an Dankbarkeit.«
»Oh, mein Gott!« rief Julie mit einem erhabenen Ausdruck und die Hände faltend, »woran glaubt denn der Unglückliche?«
Penelon
»Er glaubte wenigstens nicht daran zur Zeit, wo ich ihn kannte.« sprach Monte Christo, den diese aus der Tiefe der Seele kommende Stimme bis in die letzte Fiber erschüttert hatte; »seit jener Zeit hat er jedoch vielleicht einen Beweis erhalten, daß es eine Dankbarkeit gibt.«
»Und Sie kennen diesen Mann, mein Herr?« fragte Emmanuel.
»Oh! wenn Sie ihn kennen.« rief Julie, »sprechen Sie, vermögen Sie ihn zu uns zu führen, ihn uns zu zeigen, uns zu offenbaren, wo er ist? Sage, Maximilian, sage Emmanuel, wenn wir ihn je wieder finden würden, müßte er wohl an das Andenken des Herzens glauben!«
Monte Christo fühlte, wie zwei Tränen in seine Augen traten; er machte noch ein paar Schritte im Salon.
»Im Namen des Himmels, mein Herr«, sprach Maximilian, »wenn Sie etwas von diesem Manne wissen, so teilen Sie es uns mit.«
»Ach«, erwiderte Monte Christen die Erschütterung seiner Stimme bewältigend, »ach! wenn Lord Wilmore Ihr Wohltäter ist, so befürchte ich, daß Sie ihn nie finden werden. Ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren in Palermo verlassen: er reiste damals nach den fabelhaftesten Ländern und sich zweifle sehr an seiner Rückkehr.«
»Ah! mein Herr, Sie sind grausam«, rief Julie voll Schrecken.
Und es entstürzten Tränen den Augen der jungen Frau.
»Madame«, sprach mit ernstem Tone Monte Christo während er mit seinen Blicken die zwei flüssigen Perlen verschlang, welche über die Wangen von Julie herabrollten, »wenn Lord Wilmore gesehen hätte, was ich hier sehe, so würde er das Leben noch lieben, denn die Tränen, die Sie vergießen, müßten ihn mit dem Menschengeschlechte aussöhnen.«
Und er reichte Julie die Hand und diese gab ihm die ihrige, hingezogen, wie sie sich fühlte, durch den Blick und den Ton des Grafen.
»Doch dieser Lord Wilmore«, sprach sie, sich an eine letzte Hoffnung anklammernd, »er hatte wohl ein Vaterland, Verwandte, eine Familie, er war bekannt? Könnten wir nicht? . . . «
»Oh! suchen Sie nicht, Madame, bauen Sie keine Chimären auf das Wort, das mir entschlüpft ist. Nein, Lord Wilmore ist wahrscheinlich nicht der Mann, den Sie suchen, er war mein Freund, ich kannte seine Geheimnisse, er hätte mir auch dieses mitgeteilt.«
»Und er sagte Ihnen nichts davon«, rief Julie.
»Nichts.«
»Nicht ein Wort, das Sie auf die Vermutung bringen könnte? . . . «
»Nie.«
»Sie nannten ihn aber doch sogleich?«
»Sie wissen, bei solchen Fällen stellt man Mutmaßungen auf.«
»Meine Schwester«, sagte Maximilian, Monte Christo zu Hilfe kommend, »der Herr Graf hat Recht. Erinnere Dich dessen, was unser guter Vater uns so Oft sagte, ›Es ist kein Engländer gewesen der Mann, der unser Glück machte.‹«
Monte Christo zitterte und sprach lebhaft:
»Ihr Vater sagte Ihnen dies, Herr Morrel?«
»Mein Vater, Herr Graf, erblickte in dieser Handlung ein Wunder. Mein Vater glaubte an einen für uns aus dem Grabe erstandenen Wohltäter. Oh! welch ein rührender Aberglaube, mein Herr! . . . während ich selbst ihm nicht beipflichtete, war ich doch weit entfernt, diesen Glauben in seinem Herzen zerstören zu wollen. Wie oft träumte er davon und sprach ganz leise dabei den Namen eines geliebten Freundes, eines verlorenen Freundes aus, und als er nur noch einen Schritt vom Tode entfernt war und das Herannahen der Ewigkeit seinem Geiste etwas von der Erleuchtung des Grabes gegeben hatte, da wurde dieser Gedanke, welcher bis dahin eine dunkle Vermutung gewesen, war, zur Überzeugung, und die letzten Worte, welche er sterbend aussprach, lauteten: ›Maximilian, es war Edmond Dantes.‹«
Die seit ein paar Sekunden immer mehr zunehmende Blässe des Grafen wurde bei diesen Worten furchtbar. All sein Blut war nach dem Herzen zurückgeströmt. Er konnte kaum mehr sprechen, zog seine Uhr, als hätte er die Stunde vergessen, nahm feinen Hut, machte eine ungestüme, verlegene Verbeugung vor Madame Herbault, drückte Emmanuel und Maximilian die Hand, und stammelte: