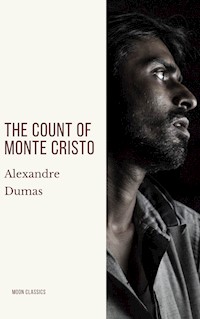3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Hand Gottes
- Sprache: Deutsch
Der junge Edmond Dantès ist glücklich verlobt mit der schönen Mercedes, und ihm wird vom Reeder Morell die Position des Kapitäns eines Segelschiffs in Aussicht gestellt. Alle seine Wünsche scheinen sich zu erfüllen. Doch er wird vom höchsten Glück in den tiefsten Abgrund geschleudert, als es zu einem hinterhältigen Komplott gegen ihn kommt. Jeder der Verschwörer hat einen anderen Grund, Dantès aus dem Weg räumen zu wollen. Durch einen schnellen und willkürlichen Prozess wird er zu Einzelhaft im Inselgefängnis Château d´If veruteilt. Alles scheint verloren. Doch im Kerker lernt er durch Zufall den alten Geistlichen und Mitgefangenen Abbé Faria kennen, der zu seinem Lehrmeister wird und ihm das Versteck eines enormen Schatzes verrät. Schließlich, nach vierzehn Jahren unverschuldeter Kerkerhaft, gelingt es Dantès, durch Glück und eigene Entschlossenheit, von der Gefängnisinsel zu flüchten. Einige Monate später erscheint in der französischen Gesellschaft ein mysteriöser Graf von sagenhaftem Reichtum, der schnell ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerät. Hinter seiner undurchsichtigen Fassade verfolgt dieser jedoch nur ein Ziel: Vergeltung zu üben an den Schuldtragenden, die einst Edmond Dantès um sein Glück brachten. Er ist die Hand Gottes, die gekommen ist, um Rechenschaft zu fordern… Der mehrfach verfilmte Abenteuer-Klassiker liegt hier in einer fünfbändigen und reichhaltig illustrierten Neuausgabe in der ungekürzten Übertragung von August Zoller vor. Dieses ist der vierte Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Graf von Monte Christo
Roman
in fünf Bänden
Überarbeitete und illustrierte Neuausgabe
der ungekürzten Übertragung
aus dem Französischen
von August Zoller
Band 4
DER GRAF VON MONTE CHRISTO wurde im französischen Original Le Comte de Monte-Cristo zuerst veröffentlicht zwischen 1844 und 1846 in der Zeitschrift Le Journal des débats.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von: apebook
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.1
Anmerkungen zur Transkription: Der Text der vorliegenden ungekürzten Ausgabe ist die Übersetzung von August Zoller (1773-1858) der deutschen Ausgabe aus dem Jahr 1846.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band 4
ISBN 978-3-96130-572-8
Buchherstellung & Gestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2023
Books made in Germany with
Die fünf Bände der Reihe
Der Graf von Monte Christo
im Überblick
BAND 1 | BAND 2 | BAND 3 | BAND 4 | BAND 5
Klicke auf die Cover oder auf die Textlinks oben!
Möchtest du anschließend wissen, wie die Geschichte des Grafen von Monte Christo weitergeht? - Dann lies die Fortsetzung:
Dumas Le Prince
Die Totenhand
BAND 1 | BAND 2 | BAND 3 | GESAMTAUSGABE
Klicke auf die Cover oder auf die Textlinks oben!
***
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
Der Graf von Monte Christo. Band 4
Impressum
Der Graf von Monte Christo. Band 4
Vierter Band
I. Die Gruft der Familie Villefort.
II. Das Protokoll.
III. Die Fortschritte von Herrn Cavalcanti Sohn.
IV. Hayde.
V. Man schreibt uns von Janina.
VI. Die Limonade.
VII. Anklage.
VIII. Das Zimmer des zurückgezogenen Bäckers.
IX. Der Einbruch.
X. Die Hand Gottes.
XI. Beauchamp.
XII. Die Reise.
XIII. Das Urteil.
XIV. Die Herausforderung.
XV. Die Beleidigung.
XVI. Die Nacht.
XVII. Das Duell.
XVIII. Die Mutter und der Sohn.
XIX. Der Selbstmord.
XX. Valentine.
XXI. Das Geständnis.
XXII. Der Vater und die Tochter.
Die Bände im Überblick
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Das Duell im Schnee
Vierter Band
Caderousse reitet mit Andres Cavalcanti
I. Die Gruft der Familie Villefort.
Zwei Tage nachher versammelte sich eine beträchtliche Menge Menschen, gegen zehn Uhr Morgens, vor der Türe von Herrn von Villefort, und man sah eine Reihe von Trauerwagen und Privatgefährten den Faubourg Saint-Honoré und die Rue de la Pépiniére entlang ziehen.
Unter diesen Wagen war einer von sonderbarer Form, der eine lange Reise gemacht zu haben schien. Es war eine Art von schwarz angemaltem Fourgon und er hatte sich unter den ersten auf dem Versammlungsorte des Leichenbegängnisses eingefunden.
Man erkundigte sich und erfuhr, daß dieser Wagen-durch ein seltsames Zusammentreffen von Umständen den Körper des Herrn Marquis von Saint-Meran enthielt, und daß diejenigen, welche wegen eines einzigen Leichenbegängnisses gekommen waren, zwei Leichnamen folgen sollten. Die Zahl der Anwesenden war sehr groß. Der Herr Marquis von Saint-Meran, einer der eifrigsten und getreuesten Würdenträger von König Ludwig XVIII. und König Carl X., hatte sich eine große Schar von Freunden erhalten, die im Verein mit den Personen, welche durch die gesellschaftlichen Konvenienzen mit Villefort verbunden waren, eine beträchtliche Truppe bildeten.
Man benachrichtigte auch die Behörden, und es wurde erlaubt, diese zwei Leichenbegängnisse zu gleicher Zeit stattfinden zu lassen. Ein zweiter Wagen, mit derselben Pracht geschmückt, wurde vor die Türe von Herrn von Villefort geführt und der Sarg von dem Postfourgon auf den Leichenwagen gebracht.
Die zwei Toten sollten in dem Friedhofe des Père la Chaise bestattet werden, wo seit langer Zeit Herr von Villefort das für das Begräbnis seiner ganzen Familie bestimmte Gewölbe hatte errichten lassen. In diesem Gewölbe ruhte bereits der Leichnam der armen Renée, mit der sich ihr Vater und ihre Mutter nach einer zehnjährigen Trennung wieder vereinigten.
Stets neugierig, stets bewegt durch Leichengepränge, sah Paris mit religiösem Stillschweigen den glänzenden Zug, welcher nach ihrer letzten Ruhestätte zwei von den, hinsichtlich des traditionellen Geistes, der Sicherheit des Handels und der hartnäckigsten Anhänglichkeit an die Prinzipien, berühmtesten Namen der alten Aristokratie begleitete.
Mit einander in demselben Trauerwagen unterhielten sich Beauchamp. Debray und Chateau-Renaud über diesen so plötzlichen Tod.
»Ich habe Frau von Saint-Meran bei meiner Rückkehr von Algerien im vorigen Jahre in Marseille gesehen«, sagte Chateau-Renaud; mit ihrer vollkommenen Gesundheit, mit ihrer Geistesgegenwart und ihrer wunderbaren Tätigkeit schien sie zu einem Leben von hundert Jahren bestimmt. Wie alt war die Marquise?«
»Sechs und sechzig Jahre«, wenigstens wie mich Franz versicherte«, antwortete Albert. »Doch das Alter ist es nicht, was sie getötet, sondern der Kummer über den Tod des Marquis; es scheint, daß sie seit diesem Tode, der sie auf das Heftigste erschütterte, nicht mehr völlig zur Vernunft gekommen ist.«
»Doch, woran ist sie denn gestorben?« fragte Debray.
»An einer Hirncongestion, wie es scheint, oder an einem Schlagflusse. Ist das nicht dasselbe?«
»So ungefähr.«
»Schlagfluß«, versetzte Beauchamp, »das ist schwer zu glauben. Frau von Saint-Meran, die ich ebenfalls ein oder zweimal in meinem Leben gesehen habe, war klein, von schwächlicher Gestalt und von mehr nerviger, als sanguinischer Konstitution; die Schlagflüsse, durch den Kummer auf einen Körper wie der von Frau von Saint-Meran hervorgebracht, sind selten.«
»Wie dem sein mag«, sagte Albert, »hat sie der Arzt oder die Krankheit getötet: Herr von Villefort oder Fräulein Valentine, oder vielmehr unser Freund Franz ist nun im Besitze einer herrlichen Erbschaft, achtzig tausend Franken Rente, glaube ich.«
»Eure Erbschaft, welche bei dem Tod des alten Jakobiners Noirtier beinahe verdoppelt wird.«
»Das ist ein hartnäckiger Großvater«, versetzte Beauchamp. »Tanacem propositi virum«, Er hat, glaube ich, gegen den Tod gewettet, er würde alle seine Erben beerdigen, und es wird ihm, meiner Treue, gelingen. Er ist das alte Konventsmitglied von 93, das im Jahr 1814 zu Napoleon sagte:
›Sie sinken, weil Ihr Kaiserreich ein junger, durch sein Wachsen ermüdeter Stamm ist; nehmen Sie die Republik zum Vormund; lassen Sie uns mit einer guten Konstitution auf die Schlachtfelder zurückkehren, und ich verspreche Ihnen fünfmal hundert tausend Soldaten, ein anderes Marengo und ein zweites Austerlitz. Die Ideen sterben nicht, Sire, sie schlummern zuweilen, aber sie erwachen stärker, als sie vor dem Entschlafen gewesen.‹
»Es scheint, für ihn sind die Menschen, wie die Ideen; nur Eines beunruhigt mich, ich möchte wissen, wie sich Franz d’Epinay in einen Großschwiegervater fügen wird, der seine Frau nicht entbehren kann; doch wo ist Franz?«
»In dem ersten Wagen mit Herrn von Villefort, der ihn bereits als zur Familie gehörig betrachtet.«
In jedem von den Wagen, welche dem Leichenbegängnis folgten, fand ungefähr dasselbe Gespräch statt; man staunte über diese zwei so plötzlichen und so rasch hinter einander eingetretenen Todesfälle; doch in keinem ahnte man das furchtbare Geheimnis, das Herr d’Avrigny bei seinem nächtlichen Spaziergang Herrn von Villefort mitgeteilt hatte.
Nach einem Marsche von ungefähr einer Stunde gelangte man an das Thor des Friedhofes: es war ein ruhiges, aber düsteres Wetter, das folglich mit der eben stattfindenden Trauerfeierlichkeit im Einklange stand. Unter den Gruppen, die sich nach dem Familiengrabgewölbe wandten, erkannte Chateau-Renaud Morrel, der ganz allein und im Cabriolet gekommen war; er ging, sehr bleich und schweigsam, auf dem schmalen, mit Eibenbäumen eingefaßten Pfade.
»Sie hier?« sagte Chateau-Renaud, seinen Arm unter den des jungen Kapitäns legend; »Sie kennen also Herrn von Villefort? Wie kommt es denn, daß ich Sie nie bei ihm gesehen habe?«
»Ich kenne nicht Herrn von Villefort«, entgegnete Morrel, »sondern ich kannte Frau von Saint-Meran.«
In diesem Augenblick trat Albert mit Franz zu ihnen.
»Der Ort ist für eine Vorstellung schlecht gewählt«, sagte Albert; »doch gleichviel, wir sind nicht abergläubisch. Herr Morrel, erlauben Sie mir, Ihnen Herrn Franz d’Epinay, einen vortrefflichen Reisegesellschafter, vorzustellen, mit welchem ich eine Wanderung durch Italien gemacht habe. Mein lieber Franz, Herr Maximilian Morrel, ein vortrefflicher Freund, den ich mir in Deiner Abwesenheit erworben, und dessen Namen Du in meiner Unterhaltung so oft hören wirst, als ich von Geist, Herz und Liebenswürdigkeit zu sprechen habe.«
Morrel war einen Augenblick unentschieden. Er fragte sich, ob er nicht als eine verdammenswerte Heuchelei den freundschaftlichen Gruß an einen Mann gerichtet, den er im Verborgenen bekämpfte, zu betrachten hätte: doch sein Schwur und die ernste Bedeutung der Umstände stellten sich vor seinen Geist: er bemühte sich, nichts auf seinem Gesichte durchblicken zu lassen, und grüßte auf eine ruhige Weise.
»Fräulein von Villefort ist wohl sehr trauriges«, sagte Debray zu Franz.
»Oh! mein Herr, sie ist unaussprechlich traurig; diesen Morgen war sie so entstellt, daß ich sie kaum erkannte.«
Die scheinbar so einfachen Worte brachen Morrel das Herz. Dieser Mensch hatte also Valentine gesehen, er hatte mit ihr gesprochen!
Der junge brausende Offizier bedurfte seiner ganzen Kraft, um dem Verlangen, seinen Schwur zu brechen, zu widerstehen.
Er nahm Chateau-Renaud beim Arm und zog ihn rasch nach dem Grabgewölbe fort, vor welchem die mit den Zeremonien des Leichenbegängnisses Beauftragten die zwei Särge niedergesetzt hatten.
»Eine herrliche Wohnung«, sprach Beauchamp, das Mausoleum betrachtend, »ein Sommerpalast, ein Winterpalast. Sie werden ebenfalls hier wohnen, mein lieber d’Epinay, denn Sie gehören nun bald zu der Familie. Ich als Philosoph will ein Landhäuschen, eine Hütte dort unter jenen Bäumen, und nicht so viele Quadersteine auf meinem armen Körper haben. Sterbend werde ich zu denen, welche mich umgeben, sagen, was Voltaire an Piron schrieb: Eo rus, und Alles wird vorbei sein . . . Vorwärts, Mut gefaßt, Franz, Ihre Frau erbt!«
»In der Tat, Beauchamp, Sie sind unerträglich«, versetzte Franz. »Die politischen Angelegenheiten verleihen Ihnen die Gewohnheit, über Alles zu lachen, und die Menschen, welche diese Angelegenheiten lenken, die Gewohnheit, nichts zu glauben. Doch, mein lieber Beauchamp, wenn Sie die Ehre haben, mit gewöhnlichen Menschen zusammen zu sein, und das Glück, sich einen Augenblick von der Politik zu trennen, so suchen Sie Ihr Herz wieder aufzunehmen, das Sie gewöhnlich indem Stöckeaufbewahrungs-Bureau der Kammer der Abgeordneten oder der Kammer der Pairs lassen.«
»Ei, mein Gott!« versetzte Beauchamp, »was ist das Leben? ein Halt im Vorzimmer des Todes.«
Der Friedhof von Père la Chaise
»Beauchamp wird mir widerwärtig«, sagte Albert, zog sich vier Schritte mit Franz zurück und überließ es Beauchamp, seine philosophischen Abhandlungen mit Debray fortzusetzen.
Das Familienbegräbnis von Villefort bildete ein Gevierte von weißen Steinen und war etwa zwanzig Fußhoch; eine innere Trennung schied in zwei Abteilungen die Familie Saint-Meran und die Familie Villefort, und jede Abteilung hatte ihre eigene Türe.
Man sah nicht, wie in den andern Gräbern, die gemeinen, über einander gelegten Schubladen, in welcher eine sparsame Verteilung die Toten mit einer Inschrift einschließt, welche einer Etiquette gleicht; Alles, was man Anfangs durch die Bronzetüre erblickte, war ein strenges, ernstes, durch eine Mauer von dem wahren Grabe getrenntes Vorgemach.
Mitten in dieser Mauer öffneten sich die zwei von uns so eben erwähnten Türen, welche mit den Begräbnissen Villefort und Saint-Meran in Verbindung standen.
Hier konnten sich die Schmerzen frei aushauchen, ohne daß leichtfertige Spaziergänger, welche aus einem Besuche auf dem Père la Chaise eine Landpartie oder eine Liebeszusammenkunft machen, durch ihren Gesang, durch ihr Geschrei oder durch ihr Geläufe die stumme Betrachtung oder das von Tränen überströmte Gebet stören.
Die zwei Sarge kamen in das Grabgewölbe rechts: es war das der Familie Saint-Meran; sie wurden auf Gestelle gesetzt, welche der Toten harrten. Villefort, Franz und einige nahe Verwandte traten allein in das Allerheiligste.
Da die religiösen Zeremonien vor der Türe vollzogen worden waren, und man keine Rede zu halten hatte, so trennten sich die Anwesenden als bald; Chateau-Renaud, Albert und Morrel gingen auf der einen Seite ab, Debray und Beauchamp auf der andern.
Franz blieb mit Herrn von Villefort; an dem Thore des Friedhofes stand Morrel unter dem nächsten dem besten Vorwand stille; er sah Franz in einem Trauerwagen mit Herrn von Villefort herausfahren und es erfaßte ihn eine schlimme Ahnung, als er dieses Zusammensein unter vier Augen wahrnahm. Er kehrte daher nach Paris zurück, und obgleich er in demselben Wagen mit Chateau-Renaud und Albert fuhr, hörte er doch nicht ein Wort von dem, was die zwei jungen Leute sprachen.
Als Franz Herrn von Villefort zu verlassen im Begriffe war, hatte dieser gesagt:
»Mein Herr Baron, wann werde ich Sie wiedersehen?«
»Wann Sie wollen«, hatte Franz erwidert.
»Sobald als möglich.«
»Ich bin zu Ihren Befehlen, mein Heer; ist es Ihnen genehm, daß wir zusammen zurückkehren?«
»Wenn es Sie nicht belästigt«,
»Keines Wegs.«
So stiegen der zukünftige Schwiegervater und der zukünftige Schwiegersohn in einen Wagen, und Morrel wurde, als er sie vorüberfahren sah, mit Recht von einer Unruhe erfaßt.
Villefort und Franz kehrten nach dem Faubourg Saint-Honoré zurück.
Ohne bei Jemand einzutreten, ohne mit seiner Frau oder seiner Tochter zu sprechen, ließ der Staatsanwalt den jungen Mann in sein Kabinett gehen, bezeichnete ihm einen Stuhl und sprach:
»Mein Herr d’Epinay, ich muß Sie daran erinnern, und der Augenblick ist nicht so schlecht gewählt, als man von Anfang glauben dürfte, denn der Gehorsam gegen die Toten ist das erste Opfer, das man auf ihren Sarg zu legen hat; ich muß Sie also daran erinnern, daß nach dem von Frau von Saint-Meran auf ihrem Sterbebette vorgestern ausgedrückten Wunsche die Heirat von Valentine keinen Aufschub duldet. Sie wissen, daß die Angelegenheiten der Hingeschiedenen vollkommen in Ordnung sind; daß ihr Testament Valentine das ganze Vermögen der Saint-Meran sichert; der Notar hat mir gestern die Akten gezeigt, welche auf eine bestimmtes Weise den Ehevertrag abzufassen gestatten. Sie können den Notar besuchen und sich in meinem Auftrage die Akten mitteilen lassen. Der Notar ist Herr Deschamps, Place Beauveau, Faubourg Saint-Honoré.«
Villefort und Valentine
»Mein Herrn«, entgegnete d’Epinay, »es ist vielleicht für Fräulein Valentine bei ihrem heftigen Schmerze nicht der Augenblick, um an einen Gatten zu denken; ich würde in der Tat befürchten . . . «
»Valentine«, unterbrach ihn Herr von Villefort, »Valentine wird kein lebhafteres Verlangen haben, als das, den letzten Willen ihrer Großmutter zu erfüllen; die Hindernisse werden somit, dafür stehe ich Ihnen, nicht von ihrer Seite kommen.«
»Da sie in diesem Falle auch nicht von meiner Seite kommen«, erwiderte Franz, »so mögen Sie nach Ihrem Gutdünken handeln; mein Wort ist gegeben, und es gereicht mir nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zum Glück, es zu halten.«
»Es steht also nichts im Wege«, versetzte Villefort; »der Vertrag sollte vor drei Tagen unterzeichnet werden, wir finden ihn völlig bereit, und man kann ihn heute unterzeichnen.«
»Doch die Trauer?« sagte Franz zögernd.
»Seien Sie unbesorgt, mein Herr: der Wohlanstand wird in meinem Hause nicht vernachlässigt werden. Fräulein von Villefort kann sich für die drei vorgeschriebenen Monate auf ihr Gut Saint-Meran zurückziehen; ich sage ihr Gut, denn heute ist es ihr Eigentum. Dort wird in acht Tagen, wenn Sie wollen, ohne Geräusch, ohne Gedränge, die bürgerliche Heirat vollzogen. Es war ein Wunsch von Frau von Saint-Meran, daß ihre Enkelin sich auf diesem Gute verheiraten möchte. Ist der Ehebund geschlossen, so können Sie nach Paris zurückkehren, während Ihre Frau die Trauerzeit mit ihrer Stiefmutter zubringt.«
»Ganz nach Ihrem Belieben«, sprach Franz.
»So haben Sie die Güte, eine halbe Stunde zuwarten: Valentine wird in den Salon herabkommen. Ich lasse Herrn Deschamps rufen, wir lesen und unterzeichnen den Vertrag auf der Stelle, und noch diesen Abend führt Frau von Villefort Valentine auf ihr Gut, wohin wir Ihnen in acht Tagen nachfolgen.«
»Mein Herr, ich habe Sie nur um Eines zu bitten«, sagte Franz.
»Um was?«
»Ich wünschte, daß Albert von Morcerf und Raoul von Chateau-Renaud bei dieser Unterzeichnung gegenwärtig sein möchten, Sie wissen, sie sind meine Zeugen.«
»Eine halbe Stunde genügt, um sie in Kenntnis zu setzen; soll ich sie holen lassen, oder wollen Sie diese Herren selbst holen?«
»Ich ziehe es vor, sie selbst zu holen.«
»Ich erwarte Sie in einer halben Stunde, und in einer halben Stunde wird auch Valentine bereit sein.«
Franz verbeugte sich und verließ das Zimmer.
Kaum hatte sich die Türe des Hauses hinter dem jungen Manne geschlossen, als Villefort Valentine sagen ließ, sie sollte in einer halben Stunde in den Solon herabkommen, weil der Notar und die Zeugen von Herrn d’Epinay erscheinen werden.
Diese unerwartete Kunde brachte einen mächtigen Eindruck in dem Hause hervor. Frau von Villefort wollte nicht daran glauben, und Valentine war wie von einem Donnerschlage niedergeschmettert.
Sie schaute umher, als ob sie suchen wollte, von wem sie Hilfe verlangen könnte.
Sie gedachter ihrem Großvater hinabzugehen; doch sie begegnete auf der Treppe Herrn von Villefort, der sie beim Arme nahm und in den Salon führte.
In dem Salon traf Valentine Barrois, sie warf dem alten Diener einen verzweifelten Blick zu.
Einen Augenblick nach Valentine trat Frau von Villefort mit dem kleinen Eduard in den Salon. Die junge Frau hatte sichtbar ihren Teil an dem Kummer der Familie gehabt; sie war bleich und schien furchtbar ermattet.
Frau von Villefort nahm Eduard auf ihren Schoß und drückte von Zeit zu Zeit mit beinahe krampfhaften Bewegungen diesen Kind an ihre Brust, auf welches sich ihr ganzen Leben zusammenzudrängen schien.
Bald hörte man das Geräusch von zwei Wagen, welche in den Hof fuhren.
Der eine war der des Notars, der andere der von Franz.
In einem Augenblick hatten sich Alle im Solon versammelt.
Valentine war so bleich, daß man die blauen Adern ihrer Schläfe um ihre Augen sich abzeichnen und ihre Wangen entlang laufen sah.
Chateau-Renaud und Albert schauten sich erstaunt an; die so eben vollzogene Zeremonie kam ihnen nicht trauriger vor, als die, welche nun beginnen sollte.
Frau von Villefort hatte sich hinter einen Sammetvorhang in den Schatten gesetzt, und da sie sich beständig über ihren Sohn neigte, so konnte man nur schwer auf ihrem Gesichte lesen, was in ihrem Herzen vorging.
Herr von Villefort war, wie immer, unempfindlich.
Nachdem der Notar, nach der gewöhnlichen Methode der Leute des Gesetzes, seine Papiere auf dem Tische geordnet, in seinem Lehnstuhle Platz genommen und seine Brille etwas in die Höhe gehoben hatte, wandte er sich gegen Franz und fragte ihn, obgleich er es vollkommen wußte:
»Sie sind Herr Franz von Quesnel, Baron d’Epinay?«
»Ja, mein Herr«, antwortete Franz.
Der Notar verbeugte sich und fuhr fort:
»Ich muß Sie davon in Kenntnis setzen, mein Herr, und zwar im Auftrage von Herrn von Villefort, daß Ihre mit Fräulein von Villefort beabsichtigte Heirat die Gesinnung des Herrn von Noirtier gegen seine Enkelin völlig verändert hat, und daß er auf Andere das Vermögen übergehen läßt, welches er ihr hätte vermachen sollen. Ich muß indes sogleich beifügen, daß, insofern der Erblasser nur berechtigt ist, ihr einen Teil seines Vermögens zu entziehen, während er ihr das ganze entzogen hat, daß, sage ich, das Testament einem Angriffe nicht widerstehen und für null und nichtig erklärt werden wird.«
»Ja«, sprach Villefort; »nur setze ich Herrn d’Epinay zum Voraus davon in Kenntnis, daß zu meinen Lebzeiten das Testament meines Vaters nie angegriffen werden wird, in Betracht, daß ich bei meiner Stellung den Skandal bis zum Schatten zu vermeiden habe.«
»Mein Herr«, sagte Franz, »es tut mir leid, daß eine solche Frage in Gegenwart von Fräulein Valentine erhoben worden ist. Ich habe mich nie nach der Summe ihres Vermögens erkundigt, welches, so beschränkt es auch sein mag, immerhin beträchtlicher sein wird, als das meinige. Meine Familie suchte in der Verbindung mit Herrn von Villefort das Ansehen, ich suche darin das Glück.«
Valentine machte ein unmerkliches Zeichen des Dankes, während zwei stille Tränen über ihre Wangen flossen.
»Abgesehen jedoch«, sprach Villefort sich an seinen zukünftigen Schwiegersohn wendend, »abgesehen von einem teilweisen Verluste Ihrer Hoffnungen hat dieses unerwartete Testament nichts, was Sie persönlich verletzen dürfte. Es erklärt sich durch die Geistesschwäche von Herrn Noirtier. Meinem Vater mißfällt es nicht, daß Fräulein von Villefort sich mit Ihnen verbindet, sondern daß Valentine heiratet. Ein Ehebund mit jedem Anderen hätte ihm denselben Kummer eingeflößt. Das Alter ist selbstsüchtig, mein Herr, und Fräulein von Villefort war für Herrn Noirtier eine treue Gesellschafterin, was die Baronin d’Epinay nicht mehr wird sein können. Der unglückliche Zustand meines Vaters macht, daß man selten mit ihm über ernste Gegenstände spricht, welche die Schwäche seines Geistes zu verfolgen ihm nicht gestatten würde, und ich bin fest überzeugt daß Herr Noirtier, während er die Erinnerung an den Umstand der Verheiratung seiner Nichte bewahrt, denjenigen, welcher sein Enkel werden soll, bis auf den Namen vergessen hat.«
Kaum vollendete Villefort diese Worte, welche Franz durch eine Verbeugung erwiderte, als die Türe des Salon sich öffnete und Barrois erschien.
»Meine Herren«, sagte er mit einer für einen Diener, der unter so feierlichen Umständen mit seinen Gebietern spricht, seltsam festen Stimme, »meine Herren Herr Noirtier von Villefort wünscht auf der Stelle Herrn Franz von Quesnel, Baron d’Epinay zu sprechen.«
Wie der Notar, gab er, damit kein Irrtum entstehen könnte, dem Verlobten alle seine Titel.
Villefort bebte, Frau von Villefort ließ ihren Sohn über ihren Schoß hinab gleiten Valentine erhob sich bleich und stumm tote eine Bildsäule.
Albert und Chateau-Renaud schauten sich abermals und noch mehr erstaunt als das erste Mal an.
Der Notar heftete seine Blicke auf Villefort.
»Es ist unmöglich«, sprach der Staatsanwalt; »Herr d’Epinay kann den Solon in diesem Augenblick nicht verlassen.«
»Gerade in diesem Augenblick wünscht Herr Noirtier, mein Gebieter, Herrn Franz d’Epinay in wichtigen Angelegenheiten zu sprechen«, versetzte Barrois mit derselben Festigkeit.
»Der gute Papa Noirtier spricht also jetzt?« Fragte Eduard mit seiner gewöhnlichen Frechheit.
Doch dieser Witz machte nicht einmal Frau von Villefort lächeln, so sehr waren die Geister in Anspruch genommen, so feierlich erschien die Lage der Dinge.
»Antworten Sie Herrn Noirtier. daß das, was er verlangt, nicht sein könne«, sagte Villefort.
»Dann läßt Herr Noirtier die Herren benachrichtigen, daß er sich werde in diesen Salon tragen lassen«, sprach Barrois.
Das Erstaunen erreichte den höchsten Grad.
Ein gewisses Lächeln trat auf das Antlitz von Frau von Villefort. Valentine schlug unwillkürlich die Augen zum Plafond auf, um dem Himmel zu danken.
»Valentine«, sagte Herr von Villefort, »ich bitte Dich, erkundige Dich ein wenig, was diese neue Phantasie Deines Großvaters bedeuten soll.«
Valentine machte rasch einige Schritte, um sich zu entfernen, doch Herr von Villefort besann sich eines Anderen und rief:
»Warte, ich begleite Dich.«
»Verzeihen Sie, mein Herr«, sprach Franz, »da Herr Noirtier nach mir verlangt, so habe ich mich, wie es scheint, vor Allem seinen Wünschen zu fügen; überdies werde ich mich glücklich fühlen, ihm meine Achtung zu bezeigen, da ich noch nicht Gelegenheit gehabt habe, mir diese Ehre zu erbitten.«
»Oh! mein Gott! bemühen Sie sich nicht««, rief Villefort mit sichtbarer Unruhe
»Entschuldigen Sie mich, mein Herr«, entgegnete Franz mit dem Tone eines Mannes, der seinen Entschluß gefaßt hat. »Ich wünsche diese Gelegenheit nicht zu versäumen, um Herrn Noirtier zu beweisen, wie sehr er Unrecht hätte, einen Widerwillen gegen mich zu hegen, welchen durch meine tiefe Ergebenheit zu besiegen mein inniges Verlangen ist.«
Und ohne sich länger durch Villefort zurückhalten zu lassen, stand Franz ebenfalls auf und folgte Valentine, welche bereits mit der Freude eines Schiffbrüchigen, der die Hand an einen Felsen legt, die Treppe hinabstieg.
Herr von Villefort folgte Beiden.
Chateau-Renaud und Morcerf schauten sich zum dritten Male, und zwar noch erstaunter als die beiden ersten Male an.
II. Das Protokoll.
Noirtier wartete, schwarz gekleidet, in seinem Lehnstuhle.
Als die drei Personen, die er kommen zu sehen hoffte, eingetreten waren, blickte er nach der Türe, welche sein Kammerdiener sogleich wieder schloß.
»Merke wohl auf«, sagte leise Villefort zu Valentine, die ihre Freude nicht verbergen konnte, »wenn Herr Noirtier Dinge mitteilen will, welche Deine Heirat verhindern, so verbiete ich, Dir dieselben zu verstehen.«
Valentine errötete, antwortete aber nicht.
Villefort näherte sich Noirtier und sagte zu ihm:
»Hier ist Herr Franz d’Epinay; Sie haben nach ihm verlangt, mein Herr, und er fügt sich Ihrem Verlangen. Allerdings wünschten wir diese Zusammenkunft seit geraumer Zeit, und ich werde entzückt sein, wenn Ihnen dieselbe beweist, wie wenig Ihr Widerstreben gegen die Heirat von Valentine begründet war.«
Noirtier antwortete nur durch einen Blick, bei dem ein Schauer die Adern von Villefort durchlief.
Er bedeutete Valentine durch ein Zeichen mit dem Auge, sie möge sich nähern.
Durch die Mittel, deren sie sich in ihren Unterhaltungen mit ihrem Großvater zu bedienen pflegte, hatte sie in einem Augenblick das Wort Schlüssel gefunden.
Dann befragte sie den Blick des Gelähmten, der sich auf die Schublade eines kleinen, zwischen zwei Fenstern stehenden Schrankes heftete.
Als sie diesen Schlüssel herausgenommen und der Greis ihr durch ein Zeichen kundgegeben hatte, daß es wirklich der verlangte war, wandten sich die Augen des Gelähmten nach einem alten, seit Jahren vergessenen Sekretär, von dem man glaubte, er enthielte nur unnütze Wische.
»Soll ich den Sekretär öffnen?« fragte Valentine.
»Ja«, machte der Greis.
»Soll ich die Schubladen öffnen?«
»Ja.«
»Die von den Seiten?«
»Nein.«
»Die mittlere?«
»Ja.«
Valentine öffnete und zog ein Bündel heraus.
»Ist es das, was Sie wünschen, guter Vater?« fragte sie.
»Nein.«
Sie zog nach und nach alle andere Papiere heraus, bis durchaus nichts mehr in der Schublade blieb.
»Aber die Schublade ist nun leer«, sprach sie.
Die Augen von Noirtier hefteten sich auf das Wörterbuch.
»Ja, guter Vater, ich begreife Sie«, sprach das Mädchen.
Und sie wiederholte einen nach dem andern die Buchstaben des Alphabets; bei dem Buchstaben G hielt sie Noirtier an.
Sie öffnete das Wörterbuch und suchte bis zu dem Wort geheim.
»Ah! es gibt ein geheimes Fach?«
»Ja«, machte Noirtier.
»Und wer kennt es?«
Noirtier schaute nach der Türe, durch welche der Bediente weggegangen war.
»Barrois?« sagte sie.
»Ja«, machte Noirtier.
»Soll ich ihm rufen?«
»Ja.«
Valentine ging an die Türe und rief Barrois.
Während dieser Zeit floß der Schweiß der Ungeduld von der Stirne von Villefort, und Franz war im höchsten Maße erstaunt.
Der alte Diener erschien.
»Barrois«, sagte Valentine, »mein Großvater hat mir befohlen, diesen Schlüssel aus dem Schranke zu nehmen, diesen Sekretär zu öffnen und diese Schublade herauszuziehen; nun ist ein Geheimnis bei dieser Schublade, das Sie, wie es scheint, kennen, öffnen Sie.«
Barrois schaute den Greis an.
»Gehorche«, sprach das gescheite Auge von Noirtier.
Barrois gehorchte; ein doppelter Boden öffnete sich und zeigte mehre mit schwarzem Band umwickelte Papiere.
»Ist es das, was Sie wünschen, mein Herr?« fragte Barrois.
»Ja«, machte Noirtier.
»Wem soll ich diese Papiere übergeben, Herrn von Villefort?«
»Nein.«
»Fräulein Valentine?«
»Nein.«
»Herrn Franz d’Epinay?«
»Ja.«
Franz machte erstaunt einen Schritt vorwärts und sagte:
»Mir, mein Herr?«
»Ja.«
Franz empfing die Papiere aus den Händen von Barrois und las, die Augen auf den Umschlag werfend:
»Nach meinem Tode bei meinem Freunde, dem General Durand, zu deponieren, der dieses Paquet sterbend seinem Sohne mit der Einschärfung vermachen wird, dasselbe, da es ein Papier von der größten Wichtigkeit enthält, aufzubewahren.«
»Nun, mein Herr?« fragte Franz, »was soll ich mit diesem Papier machen?«
»Sie sollen es ohne Zweifel versiegelt, wie es ist, behalten«, sprach der Staatsanwalt.
»Nein, nein«, erwiderte der Greis lebhaft.
»Sie wünschen vielleicht, daß es der Herr lesen möge?« fragte Valentine.
»Ja«, antwortete der Greis.
»Sie hören, mein Herr Baron? mein Großvater bittet Sie, dieses Papier zu lesen«, sagte Valentine.
»So setzen wir uns«, sprach Villefort voll Ungeduld, »wenn das wird lange dauern.«
»Setzt Euch«, machte das Auge des Greises.
Villefort setzte sich, aber Valentine blieb neben ihrem Großvater, auf seinen Lehnstuhl gestützt, stehen, und Franz stand vor ihr,
Er hielt das geheimnisvolle Papier in der Hand.
»Lesen Sie«, sagten die Augen des Greises.
Franz machte den Umschlag los, und es trat eine tiefe Stille in dem Zimmer ein.
Mitten unter dieser Stille las er:
»Auszug aus den Protokollen einer Sitzung des bonapartistischen Clubbs der Rue Saint-Jacques, gehalten am 5. Febr. 1815.
Franz hielt inne.
»Am S. Februar 1815«, sagte er, »das ist der Tag, an welchem mein Vater ermordet wurde!«
Valentine und Villefort blieben stumm: nur das Auge des Greises sprach klar: »Fahren Sie fort.«
»Doch mein Vater ist verschwunden, als er diesen Clubb verließ«, sagte Franz.
Der Blick von Noirtier sprach abermals: »Lesen Sie.«
Er fuhr fort.
»Die Unterzeichneten, Louis Jacques Beauregard, Generallieutenant der Artillerie, Etienne Duchampy, Brigadegeneral, und Claude Lecharpale Direktor der Forsten:
»Erklären, daß am 4. Febr. 1815 ein Brief von der Insel Elba ankam, der dem Wohlwollen und dem Vertrauen der Mitglieder des bonapartistischen Clubbs den General Flavier von Quesnel empfahl, welcher dem Kaiser von 1804 bis 18l4 gedient hatte und der Napoleonischen Dynastie trotz des Baronentitels, den Ludwig XVIII. so eben seinem Landgute d’Epinay angehängt, völlig ergeben sein mußte.
»Dem zu Folge wurde ein Billett an den General von Quesnel gerichtet, worin man ihn bat, der Sitzung am fünften beizuwohnen. Das Billett gab weder die Straße, noch die Hausnummer an, wo die Versammlung stattfinden sollte; es hatte keine Unterschrift und sagte nur dem General, wenn er sich bereit halten wollte, so würde man ihn um neun Uhr Abends abholen.
»Die Sitzungen fanden von neun Uhr Abends bis Mitternacht statt.
»Um neun Uhr Abends erschien der Präsident des Clubbs bei dem General: der General war bereit. Der Präsident bemerkte ihm, es wäre eine der Bedingungen seiner Einführung, daß er nie den Ort der Zusammenkunft wüßte, daß er sich die Augen verbinden ließe und schwüre, er werde die Binde nicht abzunehmen suchen.
»Der General von Quesnel nahm die Bedingung an und machte sich bei seinem Ehrenwort anheischig, nicht sehen zu wollen, wohin man ihn führte.
»Der General hatte seinen Wagen anspannen lassen, aber der Präsident erklärte ihm, man könnte sich unmöglich desselben bedienen, insofern es sich nicht der Mühe lohnte, die Augen des Herrn zu verbinden, wenn dem Kutscher die Augen offen blieben, und er zu er kennen vermöchte, durch welche Straßen man käme. ›Was ist dann zu tun?« fragte der General. ›Ich habe meinen Wagen bei mir.‹ sagte der Präsident.
›Sind Sie Ihres Kutschers so sicher, daß Sie ihm ein Geheimnis anvertrauen, welches Sie dem meinigen anzuvertrauen für unklug halten?‹
›Unser Kutscher ist ein Mitglied des Clubbs,‹ erwiderte der Präsident, ›wir werden von einem Staatsrate geführt.‹
›Dann sind wir einer andern Gefahr ausgesetzt, der, umzuwerfen,‹ sagte der General lachend.
»Wir bezeichnen diesen Scherz als einen Beweis, daß der General nicht entfernt gezwungen war, der Sitzung beizuwohnen, und daß er dieselbe durchaus freiwillig besuchte.
»Sobald man in den Wagen gestiegen war, erinnerte der Präsident den General an sein Versprechen, sich die Augen verbinden zulassen. Der General machte keine Einwendung gegen diese Förmlichkeit: mit einem zu diesem Behufe im Wagen liegenden seidenen Tuche wurde die Sache abgemacht.
»Unter Weges glaubte der Präsident zu bemerken, daß der General unter seiner Binde zu sehen suchte, er erinnerte ihn an seinen Schwur.
›Ah! es ist wahr«, sagte der General.
»Der Wagen hielt vor einem Hause der Rue Saint Jacques. Der General stieg aus und stützte sich dabei auf den Arm des Präsidenten, er kannte dessen Würde nicht und hielt ihn für ein einfaches Mitglied des Clubbs: man durchschritt den Gang, stieg einen Stock hinauf und trat in das Zimmer der Beratungen.
»Die Sitzung hatte begonnen. Von der Vorstellung benachrichtigt, welche an diesem Abend stattfinden sollte, waren die Mitglieder des Clubbs vollzählig versammelt. Als der General die Mitte des Saales erreicht hatte, wurde er aufgefordert, seine Binde abzunehmen. Er entsprach sogleich dieser Aufforderung und schien sehr erstaunt, eine so große Anzahl von bekannten Gesichtern in einer Gesellschaft zu finden, von deren Dasein er bis dahin nicht einmal eine Ahnung gehabt hatte.
»Man befragte ihn über seine Gesinnung, doch er begnügte sich, zu antworten, der Brief von der Insel Elba habe dieselbe bekannt machen müssen . . . «
Franz unterbrach sich mit den Worten:
»Mein Vater war Royalist, man hatte nicht nötig, ihn um seine Gesinnung zu befragen, sie war bekannt.«
»Und daher rührte meine Verbindung mit Ihrem Vater, mein lieber Herr Franz«, sagte Villefort; »man verbindet sich so leicht, wenn man dieselben Meinungen teilt.«
»Lesen Sie«, sprach abermals das Auge des Greises.
Franz fuhr fort:
»Der Präsident nahm nun das Wort und forderte den General auf, sich deutlicher zu erklären: doch Herr von Quesnel antwortete, er wünschte vor Allem zu wissen, was man von ihm verlange.
»Es wurde nun dem General eben dieser Brief von der Insel Elba mitgeteilt, der ihn dem Clubb als einen Mann empfahl, auf dessen Mitwirkung man zählen könnte. Ein ganzer Paragraph setzte die wahrscheinliche Rückkehr von der Insel Elba auseinander und versprach einen neuen Brief mit umfassenderen Einzelheiten bei der Ankunft der Pharao, eines dem Reeder Morrel in Marseille gehörenden Schiffes, dessen Kapitän dem Kaiser ganz und gar ergeben wäre.
»Während dieses Vorlesens gab der General, auf den man wie auf einen Bruder zählen zu können glaubte, im Gegenteil Zeichen der Unzufriedenheit und sichtbaren Wiederstrebens von sich.
»Als der Brief zu Ende gelesen war, verharrte der General stillschweigend und mit gerunzelter Stirne.
›Nun!‹ fragte der Präsident, ›was sagen Sie zu diesem Briefe, Herr General?‹
›Ich sage, es ist sehr kurz, daß man dem König Ludwig XVIII. einen Eid geleistet hat, um ihn bereits zu Gunsten des Exkaisers zu verletzen,‹ erwiderte er.
»Diese Antwort war zu klar, als daß man sich über seine Gesinnung täuschen konnte.
›General,‹ sprach der Präsident, ›es gibt für uns ebenso wenig einen König Ludwig XVIII., als es einen Exkaiser gibt; es gibt nur Seine Majestät den Kaiser und König, der seit zehn Monaten aus Frankreich, seinem Staate, durch die Gewalt und den Verrat entfernt worden ist.‹
›Verzeihen Sie, meine Herren,‹ sprach der General, ›es ist möglich, daß es für Sie keinen Ludwig XVIII. gibt, aber es gibt einen für mich, in Betracht, daß er mich zum Baron und zum Feldmarschall gemacht, und daß ich nie vergessen werde, ich habe seiner glücklichen Rückkehr nach Frankreich diese zwei Titel zu verdanken.‹
›Mein Herr,‹ sprach der Präsident mit äußerst strengem Tone, während er sich erhob, ›geben Sie wohl Acht auf das, was Sie reden; Ihre Worte sagen uns deutlich, daß man sich auf der Insel Elba in Ihnen getäuscht und daß man uns getäuscht hat! Die Mitteilung, die man Ihnen gemacht, ist Folge des Vertrauens, das man in Sie setzte, und somit eines Gefühles, das Sie ehrt. Wir waren in einem Irrtum begriffen, ein Titel und ein Grad haben Sie mit der neuen Regierung ausgesöhnt, die wir umstürzen wollen. Wir werden Sie nicht zwingen, uns Ihren Beistand zu leihen, wir reihen Niemand wider sein Gewissen und wider seinen Willen ein; doch wir werden Sie zwingen als ein ehrenhafter Mann zu handeln, selbst wenn Sie nicht dazu geneigt wären.‹
›Sie nennen als ein ehrenhafter Mann handeln, Ihre Verschwörung kennen und sie nicht enthüllen! Ich nenne das Ihr Mitschuldiger sein. Sie sehen, daß ich noch offenherziger bin, als Sie . . . «
»Ah! mein Vater«, sprach Franz sich unterbrechend, »ich begreife nun, warum sie Dich ermordet haben.«
Valentine konnte sich nicht enthalten, einen Blick auf Franz zu werfen; der junge Mann war wirklich schön in der Begeisterung des Sohnes.
Villefort ging im Zimmer auf und ab.
Noirtier folgte mit den Augen dem Ausdrucke eines Jeden und beobachtete seine würdige, strenge Haltung.
Franz kehrte zu der Handschrift zurück und fuhr fort:
›Mein Herr,‹ sprach der Präsident, ›man hat Sie gebeten, sich in den Schoß dieser Versammlung zu begeben und schleppte Sie durchaus nicht mit Gewalt in dieselbe; man forderte von Ihnen, Sie sollten Ihre Augen verbinden, und Sie willigten ein. Als Sie diesem doppelten Verlangen entsprachen, wußten Sie vollkommen, daß wir uns nicht damit beschäftigten, Ludwig XVIII. den Thron zu sichern, sonst wären wir nicht so bemüht gewesen, uns vor der Polizei zu verbergen. Sie begreifen, es wäre nur zu bequem, eine Maske vorzunehmen, mit deren Hilfe man die Geheimnisse der Leute erforscht und dann ganz einfach die Maske abzulegen, um diejenigen zu Grunde zu richten, deren Vertrauen man genossen hat. Nein, nein, Sie werden uns vor Allem offenherzig sagen, ob Sie für den Zufallskönig sind, der in diesem Augenblick regiert, oder für Seine Majestät den Kaiser.‹
›Ich bin Royalist,‹ antwortete der General, ›ich habe Ludwig XVIII. einen Eid geschworen und werde ihn halten.‹
»Auf diese Worte erfolgte ein allgemeines Gemurmel, und man konnte aus den Blicken einer großen Anzahl von Mitgliedern des Clubbs ersehen, daß sie in ihrem Innern die Frage verhandelten, ob sie nicht Herrn d’Epinay diese unklugen Worte bereuen lassen sollten.
»Der Präsident stand abermals auf und gebot Stillschweigen.
›Mein Herr,‹ sagte er, ›Sie sind ein zu ernster und zu verständiger Mann, um nicht die Folgen der Lage zu begreifen, in der wir uns einander gegenüber befinden, und Ihre Offenherzigkeit gerade dictirt uns die Bedingungen, welche wir stellen müssen: Sie werden uns schwören, nichts von dem zu enthüllen, was Sie gehört haben.‹
»Der General fuhr mit der Hand nach seinem Degen und rief:
›Wenn Sie von Ehre sprechen, so fangen Sie damit an, daß Sie die Gesetze nicht mißkennen und nichts durch Gewalt auferlegen.‹
›Und Sie, mein Herr,‹ fuhr der Präsident mit einer Ruhe fort, die vielleicht furchtbarer war, als der Zorn des Generals, ›berühren Sie Ihren Degen nicht, das rate ich Ihnen.‹
»Der General warf Blicke umher, die einen Anfang von Unruhe verrieten.
»Er beugte sich jedoch noch nicht, sondern sprach, seine ganze Kraft sammelnd:
›Ich schwöre nicht.‹
›Dann müssen Sie sterben,‹ erwiderte ruhig der Präsident.
»Herr d’Epinay wurde sehr bleich: er schaute einen Augenblick umher; mehrere Mitglieder des Clubbs wisperten und suchten Waffen unter ihren Mänteln.
›General,‹ sprach der Präsident, ›seien Sie unbesorgt, Sie sind unter Männern von Ehre, welche jedes Mittel versuchen werden, um Sie zu überzeugen, ehe Sie zum Äußersten gegen sie schreiten; doch Sie sind auch unter Verschworenen; Sie besitzen unser Geheimnis und müssen es uns zurückgeben.‹
»Ein bedeutungsvolles Schweigen folgte auf diese Worte, und als der General nicht antwortete, sagte der Präsident zu den Huissiers:
›Schließt die Türen.‹
»Abermals trat eine Todesstille ein.
»Da schritt der General vor und sprach mit einer heftigen Anstrengung:
›Ich habe einen Sohn, und muß, da ich mich unter Mördern befinde, an ihn denken.‹
›General,‹ sagte voll Adel das Haupt der Versammlung, ›ein einziger Mensch hat immer das Recht, fünfzig zu beleidigen; es ist dies die Befugnis der Schwäche. Nur hat er Unrecht, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Glauben Sie mir, General, schwören Sie und beleidigen Sie nicht.‹
»Abermals bezähmt durch die Hoheit des Hauptes der Versammlung, zögerte der General einen Augenblick; doch endlich schritt er bis zu dem Tische des Präsidenten und fragte:
»Wie lautet die Formel?«
›Hören Sie:
›Ich schwöre bei meiner Ehre, nie irgend einem Menschen auf der Welt zu enthüllen, was ich am 5. Februar 1815, Abends zwischen neun und zehn Uhr, gesehen und gehört habe, und ich erkläre, daß ich den Tod verdiene, wenn ich meinen Schwur verletze.‹
»Der General schien von einem Nervenzittern ergriffen zu werden, das ihn einige Sekunden lang zu antworten verhinderte; endlich aber sprach er, ein sichtbares Widerstreben überwindend, den verlangten Eid, doch so leise, daß man es kaum hörte; es begehrten auch mehrere Mitglieder, daß er ihn mit lauterer Stimme und deutlicher wiederhole, was geschah.
›Nun wünsche ich mich entfernen zu dürfen,‹ sagte der General, ›bin ich endlich frei?‹
»Der Präsident stand auf, bezeichnete drei Mitglieder der Versammlung, um ihn zu begleiten, und stieg mit dem General in den Wagen, nachdem er ihm die Augen verbunden hatte.
»Unter den drei Mitgliedern war der Kutscher, der sie gebracht hatte.
»Die anderen Mitglieder des Clubbs trennten sich in der Stille.
›Wohin sollen wir Sie führen?‹ fragte der Präsident.
›Überallhin, wo ich von Ihrer Gegenwart befreit werden kann,‹ antwortete d’Epinay.
›Mein Herr,‹ versetzte der Präsident; ›nehmen Sie sich in Acht, Sie sind hier nicht mehr in der Versammlung, Sie haben es mit einzelnen Menschen zu tun; beleidigen Sie dieselben nicht, wenn Sie nicht für die Beleidigung verantwortlich gemacht werden wollen.‹
»Doch statt diese Sprache zu verstehen, erwiderte d’Epinay:
›Sie sind immer noch so mutig in Ihrem Wagen, wie in Ihrem Clubb, aus dem einfachen Grunde, mein Herr, weil vier Männer stets stärker sind, als ein einziger.‹
»Der Präsident ließ den Wagen halten.
»Man war gerade an der Stelle des Quai des Ormes, wo sich die Treppe findet, welche zu dem Flusse hinabführt.
›Warum lassen Sie hier halten?‹ fragte der General d’Epinay.
›Weil Sie einen Mann beleidigt haben, mein Herr,‹ antwortete der Präsident, ›und weil dieser Mann keinen Schritt mehr tun will, ohne auf eine loyale Weise Genugtuung von Ihnen zu verlangen.‹
›Abermals eine Art, zu morden,‹ sprach der General, die Achseln zuckend.
›Keinen Lärmen, mein Herr,‹ entgegnete der Präsident, ›wenn ich Sie nicht als einen von den Menschen betrachten soll, die Sie so eben bezeichneten, nämlich für einen Feigen, der seine Schwäche zum Schilde nimmt. Sie sind allein, ein Einziger wird Ihnen antworten; Sie haben einen Degen an der Seite, ich habe einen in meinem Stocke; Sie haben keinen Zeugen, einer von diesen Herren ist der Ihrige. Nun mögen Sie die Binde abnehmen, wenn es Ihnen beliebt.‹
»Der General riß auf der Stelle das Sacktuch von den Augen.
›Endlich,‹ sprach er, ›endlich werde ich erfahren, mit wem ich es zu tun habe.‹
»Man öffnete den Wagen: die vier Männer stiegen aus.
Franz unterbrach sich abermals, und wischte den kalten Schweiß ab, der von seiner Stirne floß; er war furchtbar anzuschauen, der Sohn, wie er, bleich und zitternd, mit lauter Stimme die bis dahin unbekannten Umstände von dem Tode seines Vaters las.
Valentine faltete die Hände, als ob sie betete.
Noirtier schaute Villefort mit einem erhabenen Ausdruck der Verachtung und des Stolzes an.
Franz fuhr fort:
»Es war, wie wir gesagt haben, der 5. Februar; seit drei Tagen fror es bei fünf bis sechs Graden; die Treppe war ganz starr von Eis; der General war groß und dick, der Präsident bot ihm die Seite des Geländers an, um hinabzugehen.
»Die zwei Zeugen folgten.
»Es war eine finstere Nacht, der Boden von der Treppe bis zum Fluß war feucht von Schnee und Rauhreif; man sah das Wasser schwarz, tief und Eisschollen treibend hinfließen.
»Einer von den Zeugen suchte eine Laterne in einem Kohlenschiffe, und bei dem Scheine dieser Laterne prüfte man die Waffen.
»Der Degen des Präsidenten, ein einfacher Stockdegen, war fünf Zoll kürzer, als der seines Gegners und Hatte kein Stichblatt.
»Der General d’Epinay machte den Vorschlag, das Los über diese zwei Degen zu ziehen; doch der Präsident erwiderte, er habe herausgefordert, und bei der Herausforderung sei es seine Absicht gewesen, daß Jeder sich seiner Waffe bediene.
»Die Zeugen wollten Einsprache tun, doch der Präsident gebot ihnen Stillschweigen.
»Man setzte die Laterne auf den Boden; die zwei Gegner stellten sich einander gegenüber; der Kampf begann.
»Das Licht machte aus den zwei Degen zwei Blitze. Die Männer gewahrte man kaum, so dicht war der Schatten.
»Der Herr General d’Epinay galt für eine der besten Klingen der Armee. Aber er wurde bei den ersten Stößen so lebhaft bedrängt, daß er aus der Lage wich und hierbei fiel.
»Die Zeugen hielten ihn für tot, doch sein Gegner wußte, daß er ihn nicht berührt hatte, und bot ihm die Hand, um ihm aufstehen zu helfen. Statt ihn zu beschwichtigen, brachte den General dieser Umstand so sehr auf, daß er ebenfalls auf seinen Gegner eindrang.
»Doch sein Gegner wich nicht eine Linie. Zu nahe von dem Degen des Präsidenten bedrängt, zog sich der General dreimal zurück und griff dann immer wieder an.
»Bei dem dritten Male fiel er abermals.
»Man glaubte, er wäre ausgeglitscht, wie das erste Mal; da ihn jedoch die Zeugen nicht wieder aufstehen sahen, näherten sie sich ihm und versuchten es, ihn auf die Beine zu bringen; doch derjenige, welcher ihn um den Leib gefaßt hatte, fühlte unter seiner Hand eine feuchte Wärme.
»Es war Blut.
»Der General, der beinahe ohnmächtig war, kam wieder zu sich und rief:
›Ah! man hat einen Raufer, einen Regimentsfechtmeister gegen mich abgeschickt.‹
»Ohne zu antworten, näherte sich der Präsident demjenigen von den zwei Zeugen, welcher die Laterne hielt, schlug seinen Ärmel zurück und zeigte seinen von zwei Degenstichen durchbohrten Arm; dann öffnete er seinen Rock, knöpfte seine Weste auf und ließ an seiner Seite eine dritte Wunde sehen.
»Er hatte indessen keinen Seufzer ausgestoßen. »Bei dem General d’Epinay trat der Todeskampf ein, und fünf Minuten nachher war er verschieden.«
Franz las diese letzten Worte mit so gepreßter Stimme, daß man sie kaum hören konnte, und als er sie gelesen, fuhr er mit der Hand über seine Augen, als wollte er eine Wolke vertreiben. Nach einem kurzen Stillschweigen las er fort:
»Der Präsident stieg wieder die Treppe hinauf, nachdem er zuvor seinen Degen in den Stock gestoßen hatte; eine Blutspur bezeichnete seinen Weg auf dem Schnee. Er hatte noch nicht die oberste Stufe der Treppe erreicht, als er ein dumpfes Geplatsche im Wasser hörte: es war der Körper des Generals, den die Zeugen, nachdem sie sich über seinen Tod versichert, in den Fluß gestürzt hatten.
»Der General ist folglich einem redlichen Duell und nicht einem Hinterhalte unterlegen, wie man sagen könnte.
»Zur Beglaubigung dessen haben wir Gegenwärtiges unterzeichnet, um die Wahrheit der Tatsachen zu begründen, befürchtend, es könnte ein Augenblick kommen, wo eine von den handelnden Personen dieser furchtbaren Szene des Mordes mit Vorbedacht oder der Verletzung der Gesetze der Ehre beschuldigt werden würde.
»Unterzeichnet Beauregard, Duchampy und Lecharpal.
Als Franz diese für einen Sohn so schreckliche Schrift gelesen, als Valentine, bleich vor Erschütterung, eine Träne getrocknet, als Villefort, zitternd und in einen Winkel gekauert, durch flehende, an den unversöhnlichen Greis gerichtete Blicke den Sturm zu beschwören versucht hatte, sagte d’Epinay zu Noirtier:
»Da Sie diese furchtbare Geschichte in allen ihren Einzelheiten kennen, da Sie dieselbe durch ehrenwerte Unterschriften haben bezeugen lassen, da Sie sich für mich zu interessieren scheinen, obgleich sich Ihr Interesse bis jetzt nur durch den Schmerz kundgegeben hat, so verweigern Sie mir nicht eine letzte Genugtuung. nennen Sie mir den Namen des Präsidenten, damit ich endlich denjenigen kenne, welcher meinen armen Vater getötet hat.«
Villefort suchte wie verwirrt den Drücker der Türe; Valentine, welche vor allen Anderen die Antwort des Greises begriffen und oft auf seinem Vorderarme die Spur von zwei Degenstichen wahrgenommen hatte, wich einen Schritt zurück.
»Ich beschwöre Sie, mein Fräulein«, sprach Franz, sich an seine Braut wendend, »verbinden Sie sich mit mir, daß ich den Namen des Mannes erfahre, der mich mit zwei Jahren zur Waise gemacht hat.«
Valentine blieb stumm und unbeweglich.
»Ich bitte Sie, mein Herr«, sagte Villefort, »verlängern Sie diese Szene nicht; die Namen sind überdies absichtlich verborgen worden. Mein Vater kennt selbst diesen Präsidenten nicht, und wenn er ihn auch kennt, so vermag er ihn nicht zu nennen, insofern sich die Eigennamen nicht in dem Wörterbuch finden.«
»Oh wehe! die einzige Hoffnung, welche mich, während ich diese Schrift las, aufrecht erhalten und mir die Kraft, bis zum Schlüsse zu gehen, gegeben hat, war, wenigstens den Namen desjenigen, welcher meinen Vater getötet, kennen zu lernen! Mein Herr!« rief er, sich gegen den Greis umwendend, »im Namen des Himmels! tun Sie, was Sie können, bemühen Sie sich, ich flehe Sie an, mir begreiflich zu machen . . . «
»Ja«, antwortete Noirtier.
»Oh! mein Fräulein«, rief Franz, »Ihr Großvater bedeutet mir durch ein Zeichen, er könne mir diesen Mann angeben, . . . Helfen Sie mir, . . . Sie verstehen ihn . . . leihen Sie mir Ihren Beistand.«
Noirtier schaute das Wörterbuch an.
Franz nahm es mit einem Nervenzittern, und sprach hinter einander die Buchstaben des Alphabets bis zum I aus.
Bei diesem Buchstaben machte der Greis ein bejahendes Zeichen.
»I?« wiederholte Franz.
Der Finger des jungen Mannes glitt über die Wörter hin, bei mehren antwortete Noirtier durch ein verneinendes Zeichen.
Valentine verbarg ihren Kopf in ihren Händen.
Bald gelangte Franz zu dem Worte: Ich.
»Ja!« machte der Greis.
»Sie?« rief Franz. dessen Haare sich auf seinem Haupte sträubten; »Sie, Herr Noirtier, Sie haben meinen Vater getötet!«
»Ja«, antwortete Noirtier, einen majestätischen Blick auf den jungen Mann heftend.
Franz fiel gelähmt auf einen Stuhl, Villefort öffnete die Türe und entfloh, denn es kam ihm der Gedanke, das Wenige von Dasein, das noch in dem Herzen des furchtbaren Greises übrig blieb, zu ersticken.
III. Die Fortschritte von Herrn Cavalcanti Sohn.
Herr Cavalcanti Vater war indessen abgereist, um seinen Dienst wieder anzutreten, nicht in der Armee Seiner Majestät des Kaisers von Österreich, sondern an der Roulette der Bäder von Lucca, zu deren eifrigsten Höflingen er gehörte. Es versteht sich von selbst, daß er mit der gewissenhaftesten Pünktlichkeit bis auf den letzten Paol die Summe, die ihm für seine Reisen und als Belohnung für die majestätische Art und Weise, wie er seine Vaterrolle gespielt, angewiesen wurde, mitgenommen hatte.
Andrea erbte bei dieser Abreise alle Papiere, welche bestätigten, daß er wirklich die Ehre hatte, der Sohn des Marchese Bartolomeo und der Marchesa Oliva Corsinari zu sein.
Er hatte also gleichsam geankert in dieser Pariser Gesellschaft, welche so leicht die Fremden aufnimmt und sie nicht nach dem behandelt, was sie sind, sondern nach dem, was sie sein wollen.
Was verlangt man übrigens von einem jungen Manne in Paris? Daß er so ungefähr seine Sprache spricht, anständig gekleidet ist, gut spielt und in Gold bezahlt.
Es versteht sich, daß man noch minder schwierig ist gegen einen Fremden, als gegen einen Pariser.
Andrea nahm also nach vierzehn Tagen eine ziemlich hübsche Stellung ein; man nannte ihn den Herrn Grafen, man sagte, er hätte fünfzigtausend Franken Rente, und sprach von den ungeheuren Schätzen seines Vaters, welche in den Steinbrüchen von Saravezza vergraben sein sollten.
Ein Gelehrter, in dessen Gegenwart man des letzteren Umstandes als einer Tatsache erwähnte, erklärte, er habe die fraglichen Steinbrüche gesehen, was ein großes Gewicht den bis dahin im Zweifel schwebenden Behauptungen verlieh, die nun die Kraft der Wirklichkeit erhielten.
Man war so weit in dem Kreise der Pariser Gesellschaft, in welche wir unsere Leser eingeführt haben, als Monte Christo eines Abends einen Besuch bei Herrn Danglars machte. Herr Danglars war ausgegangen, ober man schlug dem Grafen vor, ihn bei der Baronin einzuführen, welche sichtbar wäre, was er annahm.
Seit dem Mittagsmahle in Auteuil und den Ereignissen in Folge davon, hörte Madame Danglars den Namen Monte Christo nie ohne ein gewisses Nervenzittern aussprechen. Folgte die Gegenwart des Grafen nicht auf das Geräusch seines Namens, so wurde die schmerzliche Empfindung noch viel heftiger; erschien der Graf im Gegenteil, so zerstreuten sein offenes Gesicht, seine glänzenden Augen, seine Liebenswürdigkeit, seine Höflichkeit bald bei Madame Danglars den letzten Eindruck von Furcht; es kam der Baronin unmöglich vor, daß ein auf seiner Oberfläche so freundlicher, so liebreicher Mann schlimme Absichten gegen sie hegen sollte; überdies können die verdorbensten Herzen nur an das Böse glauben, wenn sie es auf irgend einem Interesse beruhen lassen; das unnütze Böse, das Böse ohne Ursache widerstrebt als eine Anomalie.
Als Monte Christo in das Boudoir trat, in das wir bereits einmal unsere Leser eingeführt haben, und wo die Baronin mit unruhigem Auge Zeichnungen betrachtete, welche ihr von ihrer Tochter dargeboten wurden, nachdem sie dieselben mit Herrn Cavalcanti Sohn beschaut hatte, brachte seine Gegenwart die gewöhnliche Wirkung hervor, und die Baronin empfing, Anfangs durch seinen Namen ein wenig erschüttert, den Grafen mit einem Lächeln.
Dieser umfaßte seinerseits die ganze Szene mit einem Blicke.
Neben der Baronin, halb auf einer Causeuce liegend, war Eugenie, Cavalcanti stand vor ihr.
Schwarz gekleidet wie ein Held von Goethe, mit gefirnißten Schuhen und durchbrochenen seidenen Strümpfen, fuhr Cavalcanti mit einer ziemlich weißen und gepflegten Hand in seine blonden Haare, unter denen ein Diamant funkelte, denn trotz des Rates von Monte Christo, hatte der eitle junge Mann dem Verlangen, einen kostbaren Ring an seinen Finger zu stecken, nicht widerstehen können.
Diese Bewegung war begleitet von mörderischen Blicken auf Fräulein Danglars geworfen, und von Seufzern an dieselbe Adresse abgeschickt, wie die Blicke.
Fräulein Danglars war immer gleich, das heißt, schön, kalt und spöttisch. Keiner von diesen Blicken, keiner von diesen Seufzern entging ihr; doch man hätte glauben sollen, sie glitten an dem Panzer der Minerva ab, an dem Panzer, welcher, wie einige Philosophen behaupten, zuweilen die Brust von Sapho bedeckt,
Eugenie begrüßte den Grafen kalt, und benützte das erste Geräusch der Unterhaltung, um sich in ihr Studierzimmer zurückzuziehen, wo bald zwei lachend und klangvoll sich ausströmende Stimmen, vermischt mit den ersten Accorden eines Piano, dem Grafen von Monte Christo andeuteten, daß Fräulein Danglars seiner Gesellschaft und der von Herrn Cavalcanti die von Fräulein Louise d’Armilly, ihrer Gesangslehrerin, vorgezogen hatte.
Während der Graf mit Madame Danglars plauderte und ganz von den Reizen der Unterhaltung eingenommen schien, bemerkte er doch die Unruhe von Herrn Andrea Cavalcanti und die Art, wie er, um auf die Musik zu horchen, an die Türe ging, deren Schwelle er nicht zu überschreiten wagte, und wie er seine Bewunderung äußerte.
Bald kehrte der Bankier zurück. Sein erster Blick galt allerdings Monte Christo, doch sein zweiter Andrea.
Seine Frau grüßte er auf die Weise, wie gewisse Ehemänner ihre Frauen grüßen, wovon sich Junggesellen nur einen Begriff machen können, wenn einmal ein sehr umfassender Codex über die Verhältnisse des Ehestands erschienen ist.
»Haben Sie die Fräulein nicht eingeladen, Musik mit ihnen zu machen?« fragte Danglars Andrea.
»Ach! nein, mein Herr«, antwortete Andrea mit einem Seufzer, der noch merkwürdiger war, als die andern.
Danglars ging sogleich nach der Zwischentüre und öffnete sie.
Man sah nun die zwei Mädchen auf demselben Sitze neben einander vor dem Piano. Sie accompaguirten jede mit einer Hand, eine Übung, an welche sie sich aus Laune gewöhnt hatten, und worin sie eine merkwürdige Stärke besaßen.