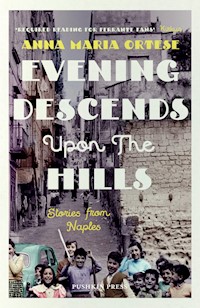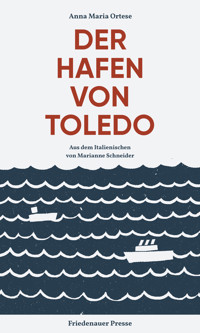
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die dreizehnjährige Damasa und ihre Geschwister leben in einem heruntergekommenen Haus im düsteren Hafenviertel von Toledo. Ihre vermeintliche Teilnahmslosigkeit verschleiert die glühende und rebellische Natur des Mädchens, das mit zehn Jahren den Schulunterricht ablehnt, sich von der Kirche abwendet und nach dem tragischen Tod seines Bruders auf See Rettung in der Literatur findet. Die dunklen Schriften Damasas, in denen sie versucht, die flüchtigen Visionen ihres Geistes festzuhalten, ziehen uns in eine fesselnde Welt des Unsichtbaren und der Träume, eine »zweite, unwirkliche Realität«. Aus dem Geheimnis dieser wundersam lyrischen Seiten entspringt ein Alltag voller Armut und Entbehrungen, während sich am Himmel das Schreckensgespenst des Krieges abzeichnet. In Der Hafen von Toledo webt Anna Maria Ortese eine eindringlich dichte, traumwandlerische Atmosphäre, die den Roman zu einem unvergesslichen Leseerlebnis macht. 1975 erstmals veröffentlicht, ist das rätselhafte und von einer geheimnisvollen Schönheit erfüllte Buch heute ein Klassiker der modernen Literatur – ein Meisterwerk, das es auch hierzulande unbedingt zu entdecken gilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 869
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Maria Ortese
DER HAFEN VON TOLEDO
Erinnerungen an ein unwirkliches Leben
Roman
Aus dem Italienischen von Marianne Schneider
Mit einem Vorwort von Tiziano Gianotti
FRIEDENAUER PRESSE
Inhalt
Anna Maria Orteses unbekanntes Meisterwerk
ANNE, NACHTRAG UND WANDLUNG
NATÜRLICH UND NICHT NATÜRLICH
APASISCHE ODER MEERESMAUERN: DIE ERSTE WELT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
ZWEITE ERINNERUNGEN AN TOLEDO: ZERSPLITTERT VOM LÄRM DER NAHENDEN MEERESZEIT
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
SIE ERINNERT SICH AN DAS UNAUFHÖRLICHE FLIESSEN DES LEBENS. MORGAN
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
NOTIZ
Übersetzungen der fremdsprachlichen Zitate
Anna Maria Orteses unbekanntes Meisterwerk
Der Hafen von Toledo – Roman eines Lebens und für die Autorin der Roman des Lebens – ist ein unbekanntes Meisterwerk, und zwar aus denselben geheimnisvollen Gründen wie das Bild in Honoré de Balzacs gleichnamiger Erzählung. Man kann ihn lesen, den Roman Anna Maria Orteses; und doch wäre zutreffender zu sagen, dass man in ihn eintritt wie in einen Bild-Kosmos: Wie von der Autorin wird auch von uns verlangt, Interpreten zu sein, Leser und Übersetzer einer Verwandlung. Wenn es uns aber gelingt, in das Bild einzutreten, beginnt das Wunder: die Intimität der Form. In Balzacs Erzählung stellt sich Frenhofers Bild in den Augen von Poussin und Porbus als ein Chaos von Farben und Tönen dar, in dem sich die Idealfigur verbirgt und aus dem ein Fuß von beispielloser Vollkommenheit hervortritt; der Roman Anna Maria Orteses präsentiert sich mit den Worten der Autorin in seiner Komposition als »versiegelt, chiffriert, zugleich unbesonnen und chaotisch«: ein Bild-Kosmos, aus dem wie durch ein Wunder eine Figur von unerhörtem Widerhall hervorsticht: Toledana, die Protagonistin und Erzählerin von Der Hafen von Toledo. Vollkommenheit der Form, und also Wahrheit: Toledana ist eine der großen Figuren des italienischen und europäischen Romans, die es durchaus verdient, neben den Protagonisten der Romane Elsa Morantes aufgeführt zu werden – und unter diesen noch herauszuragen. Genau dort hätte man Orteses unbekanntes Meisterwerk zu verorten.
Ich möchte sogleich einen Zweifel zerstreuen: Gewiss ist der Roman versiegelt und chiffriert, wie es allen wahren und unbekannten Meisterwerken gemein ist; unbesonnen und chaotisch aber ist Toledo allein im letzteren seiner beiden Teile, und zwar aus gutem Grund. Und doch bleibt die aus schmerzhafter Notwendigkeit geborene höchste Einfachheit des Buches erhalten, die nur aufgrund einer Verwandlung möglich ist, um es so von sich zu entfernen. Toledo ist ein Buch der Erinnerung und der Vision, visionärer Bericht und Liebesroman, wie ihn ein revoltierender Dichter der Romantik hätte schreiben können, der nach Neapel versetzt worden ist und dort zwischen Elend und Träumerei zu leben hat: ein hispanisiertes und in das Toledo von El Greco verwandeltes Neapel, des geliebten Malers mithin, der die Wirklichkeit durch einen »Trauerschleier« sah; ein von Regen getrübtes und vom Wind gepeitschtes Neapel; ein Roman, der geschrieben wurde, indem »ich in die Tage des Glaubens an die Welt zurückkehrte«, wie Ortese auf dem Umschlag der Erstausgabe von 1975 vermerkt – eben dies ist im Aufruhr der Tage und im Licht der Nacht Der Hafen von Toledo. Nichts allzu Kompliziertes also: ein Roman von Liebe und von Verlust.
(Gewiss, Liebe ist hier in der Bedeutung der romantischen Dichter-Philosophen zu verstehen – als amour-passion: Essenz und Destillat ad personam einer universellen Liebe, wie sie aus dem Staunen über die Welt und all ihre im Lichte gesehenen Geschöpfe hervorgehen kann. Es handelt sich um jene Liebe, von der die Visionäre mit ihren Werken Zeugnis ablegen: Anna Maria Ortese gehört – durch Geburt und Wahl – zu deren geistigen Familie und darin zu den ganz wenigen Italienern, da ihre Brüder zwischen dem Westen und dem Norden wohnen; und die Visionäre kennen keinerlei Praxis einer anderen Liebe, ebenso wenig der Roman).
Die hispanische und toledanische Verwandlung Neapels ist mit Sicherheit eine Hommage an die literarische Jugendleidenschaft Orteses sowie ein eindeutiger Verweis auf die Geschichte der parthenopeischen Stadt und einstmaligen bourbonischen Hauptstadt; in gleichem Maße ist sie jedoch ein starkes Signal für die romantische Empfindsamkeit, die sie belebt. Spanien ist eine Entdeckung der französischen Romantik des 19. Jahrhunderts; und so auch die Feier der Malerei El Grecos, den Théophile Gautier als romantischen Heroen schlechthin betrachtete. Wenn es nun einen Künstler aus dem Zeitalter des Humanismus gibt, der die Bezeichnung Visionär verdient, dann ist es El Greco; Ortese bewunderte schon früh einige Hauptwerke des Malers aus Candia, seit sie 1939 eine Genfer Ausstellung von Meisterwerken aus dem Prado besuchte. Sie bewundert ihn so sehr, dass eine der beiden Hauptfiguren des Romans, der Literat Giovanni Conra, der – wir werden noch sehen, warum – Waffenmeister genannt wird, ein Graf D’Orgaz ist: nichts weniger also als die zentrale Figur des berühmten Entierro del conde de Orgaz, ein Meisterwerk El Grecos und der Malerei aller Zeiten. Mehr noch: El Greco ist der Maler von Toledo. Es erübrigt sich, das großartige Vista de Toledo zu erwähnen, das in gewisser Hinsicht eine Vorwegnahme des Toledos im Roman darstellt; und dann gewisse Porträts sowie das von Priestern und Soldaten bevölkerte Entierro. Élie Faure schreibt in seiner Histoire de l’art, der endgültigen Summa des romantischen Geschmacks: »Soldaten oder Priester, dies ist die letzte Anstrengung der katholischen Tragödie. Sie trauern bereits« – und Trauer ist ein wesentlicher Begriff in der Sprache des Romans Toledo. Grecos fiebrige Klarheit, seine Vorliebe für ungewöhnliche Proportionen sowie seine halluzinierenden Grautöne stehen der empfindsamen figurativen Einbildungskraft Orteses am nächsten: Beide scheinen mit dem Genie der Vorahnung begabt zu sein, und ihre Werke bewegen sich abseits der klassischen rationalen Perspektive; zudem sind beide sublime Physiognomiker. Aber das ist noch nicht alles: Die Verbindungen zwischen den wenigen obskuren Mitgliedern der Familie der Visionäre sind eng. Noch einmal Élie Faure über die Figuren El Grecos: »Man folgt dem Blick nach innen, er führt bis zum unerbittlichen Herzen«. Ein unerbittliches Herz: Es gibt keinen anderen Ausdruck, der Anna Maria Ortese – wie auch El Greco sie porträtiert hätte – und ihre Brüder im Geiste besser zu beschreiben vermöchte: die Maler, Dichter und Erzähler, die zum Staunen geboren worden sind. Der Hafen von Toledo lebt, atmet und brennt von und für die Poetik des Wunderbaren.
*
Die Erzählerin des Buches ist eine erwachsene Frau, die in ihre Jugendzeit zurückkehrt, die sie in einer winzigen Vierzimmerwohnung für Vater, Mutter und sechs Kinder verbracht hat: eine Wohnung, ganz oben in einem Haus vor den Hafentoren einer Stadt gelegen, die »bourbonisch« genannt wird und eben das in Toledo verwandelte Neapel darstellt; der Leser sollte sich dabei vor Augen halten, dass die Hauptverkehrsader der parthenopeischen Stadt aus dem 16. Jahrhundert nach dem damaligen Vizekönig Pedro Álvarez de Toledo den Namen »Via Toledo« trägt. Wir befinden uns in den 1930er Jahren, in der Zeit, in der sich Europa auf den Weg in den Tod begibt. Hier findet die Initiation in das Leben und die Kunst des Schreibens der Protagonistin Damasa, genannt Dasa, statt, die sich jedoch lieber Toledana nennt. Um der Klarheit willen, sage ich es besser gleich: Die Eckdaten der Erzählung sind diejenigen von Orteses Biografie, mit Ausnahme der Namen, die allesamt erfunden sind; sie wurden jedoch durch das Sieb der Fantasie gepresst und sind so in diesem Anderswo, das der Roman oder die Vision ist, vorgezeichnet worden. Toledana trägt die Charakterzüge von Ortese und wird von ihr als ein anderes Selbst bezeichnet, und zwar mit einigem Nachdruck: »Eine Figur, die ich zu Anfang nicht vorausgesehen hatte, hatte mein wirkliches Ich ersetzt – dasjenige, das jetzt diese Anmerkung verfasst – und führte die Geschichte in einer Art und Weise, die ich ebenso wenig vorausgesehen hatte, bis zu ihrem Ende«, schreibt sie im Klappentext von 1975. Und damit nicht genug: In der Notiz, die der Neuausgabe von 1985 vorangestellt ist, heißt es: »Und wie ich es [das Buch] dachte, kam diese Damasa zum Vorschein, eine mir Unbekannte. Alles andere von Toledo war mir bekannt: Aber diese Damasa hatte ich nie gesehen. Sie nahm meinen Platz ein im Hause des Pilar und beschrieb alles, wie es mir nie hätte geschehen können. Bestürzt schaute ich sie an.« Abgesehen von der Absicht, die Aufmerksamkeit des Lesers abzuziehen und zu verlagern, kommt darin klar und deutlich das erste Motiv der Poetik zum Ausdruck: Das Datum der Wirklichkeit besitzt für Ortese keinen Kurs und Wert, außer als Materie einer Vision, die für sie die Literatur und Kunst im Ganzen ist – und dies gilt natürlich auch für sie selbst, die Autorin. Für Anna Maria Ortese und die ihrigen ist die Wirklichkeit nicht von dieser Welt.
In der ersten sowie in der sogenannten »neuen überarbeiteten Ausgabe« des Buches zehn Jahre später erscheint ein Untertitel: Erinnerungen an ein unwirkliches Leben. In der dritten und endgültigen Ausgabe von 1998, an der sich auch die vorliegende Übersetzung orientiert, ist dieser Untertitel unterdrückt (er taucht jedoch im ersten der beiden Bände der 2002 erschienenen Gesamtausgabe der Romane wieder auf). Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Und doch ist der Untertitel von grundlegender Bedeutung: Er ist wie eine Vertragsklausel, gibt den Ton vor und verstärkt den Sinn des Titels (denn Toledo liegt bekanntlich nicht am Meer). Wir befinden uns im Reich der Vision, der Rêverie: Der Roman wird geboren und lebt von einer Beschwörung. Das ist jedoch noch nicht alles, es liegt ein weiterer Punkt darin, nämlich das zweite poetologische Motiv: Er verweist auf ein unwirkliches Leben, an das sich die Autorin erinnert und in das sie zurückkehren möchte. In der zweiten Auflage stellt Ortese dem Text eine Notiz vom 3. Mai 1983 voran, in der sie mitteilt, dass sie Toledo habe schreiben wollen, um in eine Zeit zurückzukehren, die »finster« war, und fährt fort: »Fast immerwährender Regen und Wind, und es gab keinen Ausweg, um in diese Zeit zu kommen, die damals den Namen Zukunft hatte. Das – man verstehe dieses immerwährende Dunkel, Wind und Regen – ereignete sich nur in gewissen Teilen der Welt, nicht überall; es ereignete sich, wo die Armen, die Wirklichkeitsfremden [Hervorhebung von mir, T. G.] waren; diejenigen, die mit der Materie, mit dem eigentlichen Wirklichen keinen Kontakt aufgenommen hatten.« Genau dies ist der Sinn davon, der sogenannten »Wirklichkeit« keinen Raum zu geben: Das Wirkliche ist Materie, und zwar in beiden Bedeutungsspektren des Begriffs: Materie als Sache und Angelegenheit des Politischen und des Sozialen, das damit vernachlässigt wird, und Materie als Dinge, die für die Armen, wie Toledana und ihre Familie, unerreichbar sind. Und so sind sie dazu bestimmt, Wirklichkeitsfremde, Visionäre zu sein; dies ist und wird für Ortese jedoch kein Ort der Gefangenschaft, sondern der Wahl. Darin liegt eine Ambivalenz: Einerseits beklagt Ortese die Distanz des Hafens zur »Lichtstadt«, der Stadt des kultivierten und aufgeklärten Bürgertums; andererseits aber bekennt sie stolz, zur Unwirklichkeit des Hafens und seiner traumverlorenen Bewohner zu gehören: Das Hafenhaus ist der Ort, von dem aus man auch das große Blau sehen kann: das Meer, das – wie wir sehen werden – ein metaphorischer Ort und Begriff ist.
(Hören wir hier Ortese in einem in der Essaysammlung Corpo Celeste veröffentlichten Gespräch: »Ein Bild des Lebens – mithin von etwas, das Leben und zugleich Symbol des Lebens ist – gibt Joseph Conrad, wenn er über das Meer schreibt: unsterbliches Meer. Ich sehe das Leben als ein Meer; und dieses Meer ist in meinen Augen unsterblich.« Und dies ist nicht die einzige metaphorische Verwendungsweise: Auch Lemano, eine Figur der amour-passion, wird als ein »Meer« dargestellt.)
Roman eines Lebens also: Roman ihres, Toledanas, unwirklichen Lebens in dem Haus vor den Gittertoren des Hafens, dem »Meereshaus«, wie sie es nennt (in der neuen toledanischen Sprache steht »marine« im Original für »Meer-«, »See-«, »Seemann«). Hier, vor dem Hafen, den Gittertoren, dem Meer, beginnt die Zeit des desengaño: und zwar in der Doppelbedeutung von Enttäuschung und Entzauberung; von hier aus begibt sich Toledana auf lange, anstrengende Märsche, die sie zu den Hügeln führen, auf denen die lichtvollen Orte der bourbonischen Stadt liegen; ein »Junge« mit windzerzausten Sohlen auf der Suche nach Linderung eines Schreckens, der eine jugendliche Intuition der Unermesslichkeit der Welt ist (»Himmelskörper«, würde Ortese sagen), um sich dann wieder in der Notwendigkeit zu verengen. Es ist die erste Wahrnehmung dessen, was das menschliche Schicksal ausmacht, das für die von der Materie Ausgeschlossenen nur umso härter ist: die Distanz. Ein natürliches Hindernis, das Ortese zum Sinnbild erheben wird. Es lohnt sich, hier das eindrucksvolle Incipit des Romans wiederzugeben: »Ich bin niemands Tochter. Das heißt, dass die Gesellschaft, als ich geboren wurde, nicht da war oder nicht für alle Menschenkinder da war. Und weil ich ohne Gesellschaft und ohne Güte geboren wurde, wurde ich in gewissem Sinne gar nicht geboren, alles, was ich sah und erfuhr, war illusorisch, wie die nächtlichen Träume, die sich am Morgen verflüchtigen, und dasselbe galt für alle, die mich umgaben.« (Wobei die Ambivalenz der Konjunktion zwischen »Gesellschaft« und »Güte« vielsagend ist: Kommt ihr eine rein disjunktive oder aber eine erklärende – im Sinne der Ortese’schen Utopie einer zur Güte fähigen Gesellschaft – Bedeutung zu?). Im weiteren Verlauf erzählt O. von dem »Engpass«, in dem sich die 13-jährige Toledana befindet: von der Last, in einer Zeit geboren worden zu sein, die »unter dem Fuß« eines Jahrhunderts, dem zwanzigsten, darniederlag, das sie naturgemäß als fremd empfindet; sowie vom Fehlen einer Sprache, die in der Lage ist, das Staunen über die Welt, den »AZUR« (die Unermesslichkeit) und den »Meeres-«Charakter des Lebens auszudrücken, das sich in Wellen bewegt und somit »ganz rätselhaft und wechselnd« ist. Und auch dies ist noch nicht alles. Toledana, Orteses Alter Ego und ihre Seele, sagt, dass sie daher »ein hastiges, ekstatisches Toledanisch [sprach], aber nicht so kraftvoll, wie ich wollte, da mein wahres Wesen zwar toledanisch, aber nach Westen gewandt ist, wo sich die Sonne vor jedem ihrer Abende sammelt«. Es handelt sich um eine grundlegende Passage. Anna Maria Ortese drückt darin ihre Fremdheit gegenüber dem 20. Jahrhundert und der es beherrschenden Literatur aus, und zwar aufgrund ihrer angeborenen Distanz: Sie stellt fest, dass die onomastische und historische, topografische und toponomastische Verwandlung zwar iberisch ist, dass sie jedoch aufgrund ihrer Natur als Frau und als Schriftstellerin – und damit ihrer Poetik – nach Westen blickt: gen Romantik.
Tout se tient, und zwar kraft der Sprache. Die Sprache der wirklichkeitsfremden Anna Maria Ortese ist die Sprache der Vision, die Sprache der großen romantischen Visionäre: Und Visionäre ahmen bekanntlich nicht nach, sie imitieren nicht, sondern interpretieren, und mehr noch, sie verwandeln; für sie ist die Wirklichkeit und ihre soziale und politische Materie, das ist zu unterstreichen, nur ein Ausgangspunkt. So auch bei Ortese, und zwar immer und überall: Für diejenigen, die ein offenes Ohr haben, ist dies bereits in den in La lente scura versammelten Reisereportagen, in dem Stich à la Piranesi, dem »Die Stadt wider Willen« gleichkommt, sowie in den eines Goya würdigen Porträts von »Das Schweigen der Vernunft« vernehmbar, beides Prosastücke, die in dem kleinen, großen Buch Neapel liegt nicht am Meer versammelt sind: Und nur diejenigen, die taub für die Sprache sind, konnten es ein Meisterwerk des Neorealismus nennen. Ein Charakteristikum der Visionäre, das wir bei Ortese ausgeprägt vorfinden, ist der Horror vacui: Ihre Texte nehmen den ganzen Raum ein, so wie sie den gesamten Raum eines Briefes oder einer Postkarte ausfüllte und beschrieb. Mit großem Erfindungsreichtum kümmert sie sich wirklich um alles: daher die Aufmerksamkeit für Gebrauchstexte, Klappentexte, einführende Bemerkungen und nicht nur dies: Kapitelüberschriften, die sich zu Zwischentexten ausweiten, und Inhaltsverzeichnisse, die zu Zusammenfassungen werden. Nichts in der Zeit wird ausgespart: So wie die Gebrauchstexte den Stand der Kunst einer Arbeit am Text erzählen, die – wie wir sehen werden – niemals ein Ende findet, so auch die Arbeit an den Zwischentiteln, ein romantisches Erbe des 19. Jahrhunderts, das dem Leser wie auf Händen getragen dargeboten wird, und dies keineswegs aus einer Laune heraus: Wer mit der Lektüre bei ihnen beginnen möchte, wird ein essenzielles und in den dargestellten Bezügen unausschöpfliches Stichwortverzeichnis des Romans griffbereit finden, beinahe so, als hätte man es mit einer Synthese der Poetik zu tun. So auch bei Anna Maria Ortese, die das Unwirkliche/Nichts des Lebens der Notwendigkeit durch ein neues Unwirkliches/Nichts ersetzen will: »Weil, mein Leser (oder unaussprechliches Nichts, das du die Himmel gegründet hast und mir zuhörst), die Ausdrucksfähigkeit [das literarische Werk] eine Waffe gegen das Nichts war, für den Aufbau – Auge um Auge! – eines anderen, eines goldenen und glühenden Nichts, nämlich dieses Ausdruckswerks.« Was könnte dies sein, wenn nicht der Aufschrei des romantischen Künstlers?
Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: die Unwirklichkeit des Lebens (als von der Notwendigkeit beherrschtes). Es findet sich, nebenbei bemerkt, ein Postskriptum zum Brief an Giulio Einaudi von August 1981, an den sich Ortese gewandt hatte, um eine Neuauflage von Der Hafen von Toledo vorzuschlagen – ein grundlegendes Dokument für das Verständnis der Geschichte des Buches und von O. selbst, wie wir später noch sehen werden. In diesem Postskriptum kommt sie nun auf den Titel zurück und öffnet damit ein Fenster: »Dieses Toledo könnte, wenn es denn angenommen wird, auch einen anderen Titel tragen: Das unwirkliche Leben der Damasa Figuera würde mir eigentlich passender erscheinen. Unwirklich: im Sinne von getragen, unbeweglich, ohne Entscheidungsfreiheit, nur um zu verstehen zu versuchen, welches meine ›geschichtliche‹ Verfassung war, und nicht nur meine.« Das Leben als von der Notwendigkeit getragenes und bestimmtes also. Dieses Misstrauensvotum gegenüber der Materie des Lebens, der Notwendigkeit, die vom Sozialen und Politischen beherrscht wird, die Existenz einengt und den Atem versagt, kann nicht genug betont werden: die negative Seite der doppelgesichtigen Figur, die diese zusammen mit der Freiheit bildet, die Ortese und ihr Alter Ego Toledana zu Beginn der Jugend als ekstatische Erfahrung des Wunderbaren (des »Himmelskörpers«, des »AZUR«, des »Windes«) verstanden; und die der Schub des Lebens (»das Meer«) und seine Wogen in das »Boot« des Ausdrucks hievt. Hier liegt also der Grund, warum Ortese/Toledana in jene Zeit und zu den ersten literarischen Übungen – den »rhythmischen Kompositionen« (Gedichte) und den »Berichten« (Erzählungen) – zurückkehrt, nämlich nicht, um sie ins Rampenlicht einer amtlichen und verlegerischen Autobiografie zu rücken, sondern als wesentliches Korpus des Romans, um das sich die dichte Vegetation der Erinnerung rankt: die Vision und ihr Werden zum Roman. Anna Maria Ortese publiziert im Roman unveröffentlichte Jugendgedichte und zögert nicht, sie »schulmäßig« zu nennen, und viele von ihnen sind es im buchstäblichen Sinne; vor allem schreibt sie die Erzählungen aus der damaligen Zeit neu, ohne ihre Erzählstruktur zu verändern (nämlich neun der zwölf Erzählungen, die in der 1937 erschienenen ersten Sammlung Angelici dolori enthalten waren). Sie verteidigt ihren Entschluss gegenüber dem Verleger, der die Gedichte streichen wollte, und erklärte ihre Wahl Sergio Pautasso, einem begabten Schriftsteller und Lektor, der damals bei Rizzoli arbeitete und mit der Betreuung von Orteses Werk beauftragt war. Sie schreibt an Pautasso, dass sie es aufgegeben habe, eine neue Fassung (die dritte) nach den vereinbarten Vorschlägen zu schreiben, denn jedes Mal, wenn sie daranging, »diese Erinnerungen zu bearbeiten, veränderte sich ihr Stil – von reinen Tatsachen –, und ich sah mich einer maßvolleren und kultivierteren Stimme gegenüber, die eine gewisse Unversehrtheit oder grundsätzliche Fremdheit der Erzählperson (Fremdheit oder Traumzustand) zunichte machte.« Wobei Unversehrtheit und Fremdheit alles entscheidende Worte sind: So erinnert sich Ortese an Toledana; Unversehrtheit und Fremdheit sind Widerstände gegen den Hebel der Unwirklichkeit, die für beide die umgebende Materie darstellt, das Soziale und das Politische. Dafür ist keinerlei Platz: Es kann keine Zuständigkeit beanspruchen. Fremdheit als Traumzustand, Rêverie: das dritte Motiv der Poetik.
(Eine letzte Bemerkung zum Titel. Unter den von Ortese hinterlassenen Aufzeichnungen, die für die Romanausgabe in der Reihe »La Nave Argo« bei Adelphi herangezogen wurden, finden sich einige, die sich auf für den Titel erdachte Varianten beziehen. Und unter diesen sticht der schönste und treffendste hervor: das klangvolle und gewaltige Toledana, mit der schlichten Nennung des Namens der Protagonistin wie aus dem 19. Jahrhundert, gefolgt von dem Untertitel Schriften und Erinnerungen einer Tochter des Vizekönigtums. Also gut: Ersetzen wir letzteren durch den später gewählten, unverzichtbaren Untertitel und wir erhalten: Toledana. Erinnerungen an ein unwirkliches Leben. Sprich, die Vollkommenheit. Das ist keine müßige Spielerei: Ich bin überzeugt, dass der glückliche Anachronismus des Titels sowie der explizite autobiografische Bezug dem Roman besser getan hätten: zu den Gründen später mehr.)
Ortese ist eine Nachtschriftstellerin wie kaum eine andere, sie leuchtet die Figuren des Romans und seine Landschaft in Form von Worten aus. Alles erscheint uns als ein Konstrukt einer anderen Ordnung: Es ist dies das Kennzeichen der Visionäre, gewiss, und für Ortese die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erschließen. Nicht die klimpernde Melodie des veristischen Erzählers oder das römische Klagelied des Leierkastens der Neorealisten, sondern fiebrige Beschwörung durch Resonanz, die das Bewusstsein öffnet. Die Schriftstellerin Ortese ist eine Dichterin. Das ist der Grund für Toledanas literarische Berufung: Ortese sucht nach einer Sprache, um die Welt, das Staunen und die Furcht zu erzählen, und findet sie wie durch Geisterhand – gewiss, mit einer naiven Aura und bisweilen feierlich: aber doch, eine wahre Sprache. Anderes berührt und geht sie nicht an: nicht die Mimesis desjenigen, was sie als Unwirklichkeit erkennt und bezeichnet, der »vergängliche Rückstand« des Wirklichen, für die ergriffene Partei einer Ideologie; und auch nicht die erzählerische Peripetie, um den bequemen Beifall und Lohn des Publikums einzuheimsen. Stattdessen die Sprache des Romans der Erinnerung und der Vision: eine Sprache, die Formen ordnet, im Lichte der Revolte gegen die wahre konstituierte Ordnung, diejenige einer vom Bösen gezeichneten Schöpfung, die zwischen Licht und Schatten gedeiht. Ich meine das Licht der Vernunft und des Spiels, das Vorrecht der privilegiert Geborenen, die Stadt der toledanischen Hügel, und demgegenüber der hispanische Schatten des Barrios der »Lazzarillos«, das triste Asfalfa der Elendshütten und der »dunklen, wunderbaren Kirchen«, ein Auswuchs von Mauern, der sich den Hügel hinaufzieht und im Rücken des Hafens liegt: der Ort und das Zuhause von Toledana. Wo die Gittertore die Distanz zum Meer, zum Leben markieren. Ein Hafen-Haus, das dem wimmelnden Barrio der Lazzarillos die Schultern zeigt: schon wieder Distanz, jedoch nicht so einschneidend wie die der »Sonnenmauer«, die Asfalfa und den Hafen von der Stadt der wenigen Erleuchteten trennt: eine glückliche Fügung, die den Blick auf das Meer und den Himmel freigibt. Die Sprache von Ortese ist die Sprache des Hafens und des Himmels (des AZUR).
Der Leser wird verstehen: Es war nur natürlich, dass Ortese in einem Moment, in dem sie ihre Arbeit neu überdachte, zu den Erzählungen ihres Anfangs zurückkehrte. Ortese verspürte das dringende Bedürfnis, den Hafen wiederzufinden: das Haus des Pilar, die Eltern, die Geschwister und vor allem die beiden Verlorenen, die Schatten also – ein weiterer wesentlicher Begriff ihrer Poetik –, die im Roman Rassa und Albe García genannt werden: Ersterer mit seinem Meerestod das Motiv des ersten Textes, der 1933 in der Zeitschrift L’Italia Letteraria veröffentlicht wurde, Letzterer im wirklichen Leben ihr Zwilling und durch tiefe Seelenverwandtschaft mit ihr verbunden. Der Hafen ist eine Figur des Ursprungs: die wahre Heimat des Seejungen Toledana, der auf das Lebens-Meer und den Welt-Himmel blickt – und in deren Lichte nimmt die Literatur der jungen Ortese in Gedanken Gestalt und ihren Atem an. Und möge sich der Leser nicht wundern, wenn ich immer wieder zwischen Toledana und Ortese hin- und herwechsle: Genau dies ist das geheime Spiel und beherrschende Motiv von Anna Maria Ortese, und nichts anderes. Es versteht sich also von selbst, dass die Erzählungen in dem Buch ihres jugendlichen Debüts – wie wir sehen werden ein aufsehenerregendes und umstrittenes Debüt – einerseits ein Talisman sind, und in dem Augenblick, da sie diese wieder aufgreift, eine neue Offenbarung. Es lohnt sich, hier Ortese selbst das Wort zu überlassen: »[Die Erzählungen] waren das Schulmäßige von gestern und das Jenseits-der-Normalzeit von heute. Ich bemerkte, dass ich gestern völlig schulmäßig gewesen war; und jenseits der Normalzeit immer sein würde. Ich hatte in mir eine große Verneinung des Wirklichen (ich sah es als Trug und Flucht), und heute war dieses Wirkliche alles. Trug und Flucht waren alles. Und ich dachte: Wo wird etwas wirklich Wirkliches sein? Ein Kontinuum, wie die Philosophen sagen? Und ich sah, dass es die Erinnerung war.« Diese entscheidenden Worte sind der Notiz zur »neuen überarbeiteten Ausgabe« von Toledo aus dem Jahr 1985 entnommen und beziehen sich auf den Zeitpunkt, da sie mit dem Schreiben des Romans begann. Es sind Worte von beängstigender und furchtbarer Klarheit: Ortese sieht ihr Schicksal als Schriftstellerin im Italien des Trugs (die ausgestellte römische Rohheit des Realismus von Moravia) und der Flucht (Calvinos ariostische Geschwindigkeit und Leichtigkeit) jenseits der Normalzeit zurückbleiben. Gleichzeitig sieht sie wie blitzartig und ihrer Zeit voraus, wie die einzig mögliche Antwort der Literatur lauten muss: die Erinnerung. Nur unter einer Bedingung jedoch, die sich O. auf Anhieb zu eigen macht: Wenn es denn ein Erinnerungsroman sein soll, dann wird er von reiner Vision und Beschwörung in voller Schönheit sein. In einem äußerst ungünstigen historischen Moment, in dem die Literatur auf dem Weg in die Marginalität ist und das Verlagswesen sich den Versprechungen des Marktes beugt, setzt Ortese ohne Netz und doppelte Böden alles aufs Spiel. Die kraftvollste Ortese hat das Licht der Welt erblickt: die des unbekannten Meisterwerks.
*
Als sie 1969 mit dem Schreiben von Toledo begann, befand sich Ortese an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben als Schriftstellerin. Die Zeitungen und Wochenzeitschriften kauften keine literarischen Reportagen mehr wie diejenigen, die in Neapel liegt nicht am Meer (1953) eingeflossen waren und ihr den schillernden Ruf der Bitterkeit und das Willkommen der Redaktionen eingebracht hatten: Fast zwanzig Jahre lang hatte Ortese nun schon mit den bescheidenen Einnahmen aus den von ihr veröffentlichten Reportagen und Erzählungen ihren Unterhalt bestritten. Damals lebte sie zusammen mit ihrer Schwester Maria in beschwerlichen Verhältnissen von den Vorschüssen, die sie in Form einer kleinen Monatsrate von ihrem Verlag Vallecchi erhielt. 1965 veröffentlichte sie eine lange Erzählung »des Spottes und Protests«, Iguana, mit der sie sich am Märchen des 18. Jahrhunderts versuchte und die von der Kritik zwar gelobt, von der Öffentlichkeit jedoch gleichgültig aufgenommen wurde, und sodann 1967 ihren ersten Roman, Poveri e semplici, in dem sie einen sieben Jahre zuvor in Mailand entworfenen Text wieder aufnahm: ein sentimentalischer Roman, den sie ironisch verstanden wissen und das Publikum damit in Versuchung führen wollte. In Wahrheit: ein äußerst dünnes und nicht sehr persönliches Werk. Da das Leben spöttisch ist und Literaturjurys das, was sie nun einmal sind, gewinnt der kleine Roman auf Anhieb den Premio Strega, den berühmtesten und umstrittensten italienischen Literaturpreis. Auf die Auszeichnung sollten hohe Auflagen mit hervorragendem Absatz folgen. Auf der Welle des Erfolges besorgt Vallecchi eine Neuauflage von Neapel liegt nicht am Meer und in der Folgezeit zwei Sammlungen von Erzählungen, die allesamt bereits veröffentlicht vorlagen und in anderer Gestalt neu aufgelegt werden: 1968 La luna sul muro und im Jahr darauf L’alone grigio. Kurzum: Ortese ist wie schon nach Neapel liegt nicht am Meer erneut eine prominente Autorin, die von den Verlagen publiziert und umworben wird. Sie ist jedoch alles andere als mit sich zufrieden. Die erhaltene Auszeichnung und der kommerzielle Erfolg ihres wohlgemerkt ersten Romans verschaffen ihr einige Monate der Ruhe in dem gewohnten, ermüdenden Kampf gegen die Notwendigkeit: Sie weiß jedoch, dass sie nachgegeben, dass sie die ihr in die Wiege gelegte Poetik verraten und schließlich der Sprache abgeschworen hat, die ganz allein die ihre ist. Diese letzte Tatsache ist unverzeihlich. In »Dove il tempo è un altro«, einem sich zur existenziellen Erzählung ausweitenden Gelegenheitstext aus dem Jahr 1980, erinnert sie sich an das preisgekrönte Buch, das, wie sie sagt, in einem »schulmäßigen Stil« geschrieben ist, um von geringfügigen und traurigen Ereignissen zu berichten, und ruft aus: »Ich glaubte nicht mehr an die Seite!« Betrübt fügt sie hinzu, dass Poveri e semplici als »sehr leicht zu lesendes« Buch einen gewissen Erfolg erzielt und einen Preis erhalten hatte: Sie verschweigt dabei das Ausmaß des kommerziellen Erfolgs und die Bedeutung des Preises.
Das »toledanische« Extrem der Sprache des Romans hat genau hier seinen Ursprung. Auf die Entdeckung der Unausweichlichkeit ihres Abseits-Stehens und die Frustration darüber, dass ein Buch, das sie »verkleidet« nennt, mit einem Preis bedacht wird, reagiert sie wie Toledana angesichts des sozialen Ausschlusses: Sie macht sich diese zu eigen und betont die Entscheidung, sie macht sie zu einem Emblem und hisst dieses wie eine Fahne. Es wird ein Roman der Vision: Nicht mehr durch die Anforderungen der literarischen Reportage beschränkt, kann sie ihre Spuren zurückverfolgen, um die Schritte ihres Alter Ego Toledana neben sich zu hören. Der Schmerz dieser Rückkehr ist groß. Die Visionärin muss die rechte Distanz einziehen: Es wird daher um Toledo und nicht um Neapel gehen – und eine neue und zugleich alte Sprache wird nötig sein.
Ortese sucht nach einer Sprache, um das zu sagen, was für sie das wahrhaft Wirkliche ist, das Wirkliche des Denkens und des Fühlens: eine Sprache, ein Wort, das Waffe und Ausdruckskraft zugleich ist und das sie gemäß der Poetik des Wunderbaren deklinieren will. Ein doppeltes Wagnis also. Es ist keine Wahl der reinen Konsequenz – zumindest nicht nur: Vielmehr ist es ihre Art, auf die Verstümmelung der italienischen Sprache und Literatur zu reagieren, die innerhalb der narrativen Fiktion nicht mehr zum Diskurs, sondern nur mehr zum Fabulieren fähig ist, und sich auf andere Weise als ebenso unfähig in der essayistischen Reflexion zeigt: diesem alten italienischen Stolz. Die Intuition von der zentralen Bedeutung der Erinnerung als Seele und treibende Kraft der Literatur im Zeitalter der Massenmedien entspringt einem präzisen und entscheidenden Gedanken: »Sprache und Rede; und Erinnerung der Sprache und Redeweisen der Vergangenheit; und der Gefühle, Gedanken und Schmerzen vergangener Generationen sind, wie wir wissen, nichts anderes als die Identität einer Nation. Und daher nationale Freiheit.« So schreibt sie 1980 nach der Veröffentlichung von Toledo in dem bitteren Bericht »Attraversando un paese sconosciuto«: Und es ist ebenso der Gedanke, der sie in jenem schicksalhaften Jahr bewegt, in dem sie beginnt, den großen Roman von Toledana zu schreiben. Da ist sie, die politische Ortese: Bürgerin der italienischen Sprache. Mit einer entschlossenen Geste macht sie Tabula rasa: Sie nimmt die toledanischen Erzählungen ihres Debüts – sowie ein geheimes Heft, von dem ich später noch erzählen werde – wieder zur Hand, liest sie erneut und stellt fest, dass sich darin nicht nur ein Roman, sondern »der« Roman verbirgt: Das Buch, das sie jetzt schreiben kann und will, in der neuen, alten italienischen Sprache; und nicht in dem verkleideten Italienisch der marktgängigen Groschenromane. Jene zwanzig Jahre voller Nachtzüge und Bahnhöfe in der Morgendämmerung, voller Verzauberung und Erschütterungen, Entflammungen und Enttäuschungen, die ihr Leben als literarische Gelegenheitsreporterin ausmachten, sind nicht umsonst verstrichen: Sie haben die Distanz zu einer nie genügenden Vernunft verschärft und die gestohlene Zeit für diejenigen Lektüren geboten, die Bestätigung bringen. Nicht nur das: Sie hatte Gelegenheit, ihre dunkle Linse besser zu justieren, eine Paraphrase jenes »Trauerschleiers«, von dem sie sagte, er habe den Blick ihres geliebten El Greco gefiltert. »Meine dunkle Linse – Melancholie und Protest – wurde immer wieder auf Distanz gebracht und den Dingen angenähert«, wird sie etliche Jahre später schreiben. Und aus Melancholie und Protest wird auch der vorherrschende Ton von Toledo bestehen, jedoch im Lichte einer Verwandlung, die vermittels der Sprache alles und in Fülle berührt. Als sie mit dem Schreiben ihres Buches beginnt, glaubt Anna Maria Ortese trotz ihrer Desillusionierung noch immer an die rettende Kraft der Literatur: Mehr noch, sie investiert alles, was ihr an Seelenkraft und Energie geblieben ist, um ihre Intuition von der Bedeutung der Erinnerung zu verfolgen, von der sie glaubt, dass sie eine Arche für die Literatur und damit für die Sprache und die Freiheit sein kann.
»Altes Wort, das Italienische, alter Diskurs« – wie könnte man die Bedeutung als Diskurs, die der Prosa zukommt, besser ausdrücken: die Tradition des Italienischen und sein ganzer Stolz. Ortese weiß dies aus der Praxis. Ihre Erzählungen, ob Reiseerzählungen oder fiktionale Texte (und so auch später das Märchen), sind stets ein Instrument der Erkenntnis: ein Diskurs eben; erstaunlicherweise trifft dies sogar noch gesteigert auf Toledo zu, wo Verwandlung und visionäre Distanz dank der Sprachgewandtheit ihre wahre Vollendung finden (zumindest im ersten der beiden Teile des Romans; im zweiten verliert sich die Sprachgewandtheit und der Diskurs wird fieberhaft und krampfartig, mit Ausnahme des letzten Kapitels, das mit anschaulicher Evidenz großartig zu nennen ist). Eine Sprachgewandtheit und Beredsamkeit, die den edelsten Ursprung hat: Giacomo Leopardi. Vorbei sind die jugendhaften Zeiten der großen spanischen Lyriker (Góngora, Manrique, Quevedo), und was bleibt und jetzt Früchte trägt, sind die Canti Leopardis, wie bereits aus den im Roman wiedergegebenen jugendlichen »rhythmischen Kompositionen« klar hervorgeht; und gewiss sodann auch die Operette morali – zusammen mit den Briefen Leopardis der schönste italienische Prosatext der gesamten Neuzeit. Von einer vertieften Lektüre Alessandro Manzonis finden sich indes keine Spuren. Ortese schreibt 1980 – es handelt sich um ein Bekenntnis der Verbundenheit und Zugehörigkeit: »Man könnte sagen, dass Leopardi nach Dante die einzige wirkliche Stimme der italienischen Literatur ist. Wahrscheinlich ist er sogar noch größer als Dante, da er an das sogenannte Wirkliche nicht mehr glaubt. Die Natur erscheint ihm in ihrer gewohnten Ordnung als Trug; das Wirkliche (der Natur und des Menschen) ist zerstört […]. Mit ihm zusammen zerstört Manzoni im Roman, indem er die Geschichte neu erfindet und sich dennoch als untadeliger Historiker inszeniert, die Wahrheit des Natürlichen und die Festigkeit des Wirklichen, um sie neu zusammenzusetzen.« Mit den besten Grüßen an die Feldwebel des römischen Realismus und die Verfechter von Spiel und Leichtigkeit! Der romanhafte Atem kommt, wie könnte es anders sein, von der Lektüre der französischen Romantiker Victor Hugo und Alexandre Dumas, sodann von den biblischen Vätern der amerikanischen Renaissance, Hawthorne, Melville und Poe, dem Ausgestoßenen, um seine Krönung darin zu finden, was als perfektes Match zu Ortese erscheint: Charlotte Brontës Jane Eyre. Als letzter Horizont schließlich die Romane von Joseph Conrad: Und ich meine damit jene »Appetitlosigkeit auf das Moderne«, die Cesare Garboli für Elsa Morante diagnostizierte und die noch gesteigert auf Anna Maria Ortese zutrifft, eine Autodidaktin mit sicherem und festem Geschmack. (Es lohnt sich, en passant daran zu erinnern, dass der Originaltitel von Brontës Meisterwerk Jane Eyre: An Autobiography lautete.) Die Sprachgewandtheit des Italienischen und der Atem des Romans; zudem die beschwörende Kraft des visionären Malers – eine im Sinne der Poetik des Wunderbaren wahrhaft explosive Mischung.
Das Wunderbare, wie es dem romantischen Visionär zu eigen ist, wird von Ortese gemäß den bereits erwähnten Motiven auf zwei sich ergänzende Weisen dekliniert: als italienischer Diskurs, der ebenso gefühlsbetont wie in seinen Gründen entschieden ausfällt, in den erzählenden Teilen, wie immer diese gestaltet sein mögen; und als eine synkopisch zusammengezogene Sprache in den Dialogen, als gesprochenes Wort. (Mit einer bemerkenswerten Ausnahme: das Sprechen von Apa, der Mutter, einer Frau des Glaubens und der Schmerzen. Bei ihr ist die Rede klar und frisch, locker, in volles Licht getaucht und überdeutlich. Außer in der Zeit der Trostlosigkeit, die auf den Tod ihres Sohnes folgt: Dort schweift sie ins Delirium ab. Die Worte der Mutter sind durchweg Worte des Glaubens, im Guten wie im Schlechten.) Insbesondere Toledanas Sprechen ist durch einen Bruch zwischen Entschlossenem und Zögerlichem gekennzeichnet: Und am Ende wird es zum widerwilligen und schreckerfüllten Stottern und zu Entsetzen über die Entdeckung des erotischen Begehrens, über das Schauspiel des Männlichen und die Gewalt der Gesten, minimal und angestrengt bis zur Erschöpfung. Alles spricht von Beanspruchung und Verlust. Im ersten der beiden Teile verschmelzen der Diskurs der Prosa und die Worte der Dialoge vollkommen im fließenden Einfall der Erinnerung. Ein guter Komplize dabei ist der rechtzeitige Rückblick aus dem Fenster einer zukünftigen Gegenwart der Erzählerin Ortese, die nicht zögert, sich emphatisch an die Leser zu wenden; und so ist es ein Fließen in Schönheit und Fülle. Im zweiten Teil gerät das Gleichgewicht zwischen Diskurs und Dialogen aus den Fugen: Der Diskurs der Erzählerin Ortese über das Leben von Toledana verliert den Boden der Erinnerung unter den Füßen. Alles ist wie auf eine andere Bühne übertragen, so als hätte die Erzählerin den Ort gewechselt und die Stimme sich gewandelt. Der Roman wird dem Leser gegenüber undankbar. Der Grund der Fabel ist die Qual, die auf die Begegnung mit Lemano folgt, einer Figur der amour-passion für Toledana, die in ihn vernarrt und ihrem dunklen Wesen nach hingegen eine Jüngerin der amour-goût ist. Die lebensweltlichen Gründe werden von Ortese offengelegt, die sagen wird, dass sie von Qual und Pein überwältigt wurde: der Lärm der Renovierungsarbeiten an dem Haus, in dem sie lebte, »der Lärm«, der sie von Mailand nach Rom verfolgen wird, wohin sie aus den gewohnten Gründen wirtschaftlicher Not wird umziehen müssen. Es ist jedoch müßig, auf biografischen Einzelheiten zu beharren: Viel, wenn überhaupt etwas, bringen sie nicht. Als ich Der Hafen von Toledo 1985 zum ersten Mal las – es handelte sich um die vom Verlag Rizzoli herausgegebene »neue überarbeitete Ausgabe« –, wusste ich nichts von Orteses zahlreichen Missgeschicken: Und doch sprang mir die Zäsur zwischen den beiden Teilen ins Auge, die Vollkommenheit des ersten und der Bruch derselben im zweiten, um diese dann im großartigen Finale wiederzufinden – und mein späteres Wissen darum fügte dem nichts hinzu. Es gibt aber noch einen weiteren Grund: das Sich-Entzünden des Diskurses der Liebe – und die darauffolgende Kälte.
Der Diskurs über die Liebe ist bei Ortese sehr hoch angesiedelt, erhaben in seiner empfindsamen Sprachgewandtheit. Alles bestürmt und überwältigt, wie es dem romantischen Roman eigen ist: Es ist ein ekstatischer Diskurs, der bis ins Äußerste getrieben wird. Dennoch ist die Wahrnehmung der Gewalt der Erotik und das Staunen darüber auch hier nah und beständig, vibrierend vor Klarheit; und so auch die Qual der wehr- und hilflosen Toledana. Die entscheidende Ambivalenz zwischen der zur Schau gestellten physischen Präsenz des Geliebten und dem Mysterium der Unzugänglichkeit seines Wesens, das fremd und fern bleibt, wird sofort und vollständig erfasst: Lemano ist sowohl Erscheinung (»Hinter ihm war ein sehr rosaroter Himmel. […] Viele Bäume fingen Feuer«) als auch Trennung (»Als wäre nie etwas zwischen uns gesagt worden, ging er weg. […] Und als er verschwand an der Ecke, war alles wieder Regen, Ruhe, Schlaf, stillster Glanz«). Zwischen dem jungen Bürger und Libertin, der die Verse von Paul Valérys Cimetière Marin und die des Andalusiers Fernando Villalón deklamiert, und dem leidenschaftlichen jungen »Seemädchen«, das nach dem Absoluten strebt, herrscht eine unüberbrückbare Distanz: Es kann dort nur wechselseitige Schwärmerei geben, sein Spiel und das Sichverlieren Toledanas. Ortese verzichtet auf kein Element der romantischen erotischen Grammatik: Toledana ist der Grund der Gewalt und der Wut durchaus klar (»Aber seit einiger Zeit war mir nichts auf der Welt lieber als diese Empfindung: dass ich spürte, er wollte mich ergreifen, zu Schaum machen, wie es die Klippe mit der Welle macht. Mich auslöschen«), und doch nimmt dies der Reinheit ihrer Gefühle nichts: Der Seejunge wird in der Aufruhr und Qual zur Frau. Ortese verzichtet wirklich auf gar nichts, daher die Hyperbeln (»Sie denkt wieder an Lemano und sieht, dass die ganze Welt seinen Namen hat«), die rhetorischen Fragen, die Anrufung des Namens des Geliebten; und dann die Appellative (»der Finne«, Erbe jenes »blonden Meeresmannes«, mit dem das damalige junge Mädchen von der Flucht in das weite Land der Biblischen Väter träumt, und »der letzte Espartero«) und insbesondere das aufschlussreiche Attribut: »Professor der Ozeane« – Ozean und damit eine solche Weite wie der AZUR, und nicht einfach Meer: ein weiteres Leben also, beinahe schon die Unermesslichkeit des erträumten und beschworenen. Solcherart ist für Toledana die Liebe. Ganz und gar fieberhaft ist die traumgleiche Entfaltung der Verführung: Toledanas übersteigerte und wehrlose Empfindsamkeit zieht den dunklen und zweideutigen Lemano über die Maßen an; und nichts kann dies treffender sagen als das klassischste aller erotischen Motive, der Kuss oberhalb des Knies: »Ich spürte aufs Neue seinen Kuss auf meinem Bein, wo der Strumpf aufhörte und ein wenig mein Sein begann«, so Toledana; und dieses wo mein Sein begann ist denkwürdig ob der erotischen und glühenden Beschwörung. So hoch und himmelweit ist Orteses Diskurs der Liebe.
Lemano nähert sich Toledana, die ihn beim Verlassen des Meereshauses erblickt, nachdem er in einer Zeitschrift, der Literaria Gazeta, ihre Komposition gelesen hat: Er war gekommen, um ein Briefchen zu hinterlassen, mit dem er sich an die »Sehr traurige Toledana« (mit dem Namen also, mit dem sie sich selbst gerne bezeichnet) wendet und sagt, er sei »ein Freund Ihrer Zeit (und von D’Orgaz)«. Von Beginn an ist das Gleis ein doppeltes: Und der Leser wird entdecken, welche Weichen die Züge der erotischen Leidenschaft und des literarischen »Ausdrucksvermögens« einschlagen, was hier keinesfalls vorwegzunehmen ist. Wichtig ist jedoch, dass die Begegnung auf zwei Ebenen stattfindet. So war es auch schon bei D’Orgaz, dem Waffenmeister: dort nur eine natürliche Schwärmerei des jungen Mädchens für den faszinierenden jungen Mann von spanischer Maskulinität, einen Grafen der »Lichtstadt«, der sie erkennt und ihr die Welt der Literatur eröffnet – und ein erotisches Detail, das ein Vorspiel zum Wesentlichen ist. Es ist keine Kleinigkeit, dass sich die Leidenschaften hier kreuzen. Wonach Toledana sich in der Natürlichkeit ihres Charakters sehnt – darin eine der Romantik ganz und gar würdige Tochter – ist ein Freund, ein Liebhaber nicht nur des Bettes und erfüllt von Sehnsüchten. Sie erkennt in Lemano eine »Bläue« und entdeckt eine Übereinstimmung im geteilten Verstehen der schwebenden Drohung »einer Welt, die gegen das Meer« war, und »einer Zeit, die gegen alles war, in der (und dieses Gefühl war blitzartig) die Ausdruckswelt verloren oder für immer gewandelt wäre«; aber sie versteht auch und fürchtet (und schreckt davor zurück), was ihr an dem Geliebten ins Auge sticht: »etwas Furchtbares, eine Süße, die kein bisschen ermutigte, ein grauer Blick, aus dem jede Güte verschwinden kann, um kalten Entschlüssen Platz zu machen.« Es sind diese kalten Entschlüsse, die Toledana Frostigkeit vermitteln: ein Wechselspiel von Glut und plötzlicher Kälte. Lemano ist wie von einer numinosen und unheilvollen Aura umgeben: dort, wo seine Seele eine Einöde ist und abstrakte Wut als Blendwerk erscheint. Er wird denn auch derjenige sein, der das Wort ausspricht, das Toledana am meisten schmerzt: ein Wort, das ein anderer, der ihr lieb ist, bereits an sie gerichtet hatte: wer, wird der Leser sehen und sodann ihre Kälte, ihren Schmerz verstehen. Ignorantin – so lautet das Urteil. Und nicht nur in der Welt der Literatur: im Leben, so der Professor. Hier ist eine Kluft: auf der einen Seite der Intellektuelle des 20. Jahrhunderts und auf der anderen Seite die Schriftstellerin, die aus dem Hafen und einem erhabenen Anachronismus herstammt; mit dem Waffenmeister war es, wenn auch in anderer Form und Großzügigkeit, dasselbe gewesen: Sie sind wie zwei durch das Meer/Leben getrennte Kontinente. Lemano und D’Orgaz sind unterschiedlich im Temperament und Brüder im Geiste, so sieht es Toledana: »Und beide erschienen mir wie Länder, die sich entfernen oder erheben und die nahe an uns vorbeikommen und sich verflüchtigen, während andere sichtbar werden« – ein fulminantes Gleichnis des Gefühlslebens: »Und ich erkannte, wie alles in der Welt sich immerwährend wandelte und ersetzt wurde und wie Länder, die man lange Zeit für Festland gehalten hatte, kein solches sind und eines gewissen Tages verschwinden«. Die Idylle ist gerade erst erblüht und das Begehren brennt lichterloh. Und schon versteht Toledana dessen wesentliches Gesetz: die Wandlung. Geheimnis und Wandlung: die beiden Motive der erotischen Leidenschaft und das Leben.
Dort, wo die Träumerei, die der Fremdheit gegenüber dem Wirklichen der Materie einen Sinn verleiht und damit die Distanz aufhebt, ihre Erfüllung und Vollendung finden sollte, entdeckt Toledana die Ambivalenz des Eros: den geheimnisvollen und unerkennbaren Ursprung seines Erscheinens sowie seines Erwählens einer Person anstelle einer anderen; und die doppelte Bewegung der erotischen Leidenschaft, die die Distanz der Körper verkürzt und sich dabei als gewaltsame und bestürzende Notwendigkeit erweist und nicht als die begehrte Freiheit davon: nicht der AZUR. Der Diskurs der Liebe ist ein Klagelied auf die erotische Freundschaft, ihr Phantom.
*
Toledo ist, so sagte ich zu Beginn, das Buch eines Lebens: und ein solches ist es im buchstäblichen Sinne. Im ersten Kapitel des Romans erzählt Toledana, sie habe zwei Jahre lang ein Tagebuch geführt – »bis meine wahre Jugendzeit begann« –, das sie dann jedoch verloren oder zerrissen habe, genau weiß sie es nicht mehr. Als Monica Farnetti sich für die erwähnte Gesamtausgabe der Romane an die Manuskripte machte, fand sie die Blätter einer maschinengeschriebenen Transkription dieses Heftes, das von November 1928 bis September 1929 reicht, also vom vierzehnten bis zum fünfzehnten Lebensjahr. (Das Tagebuch ist im Anhang des ersten Bandes der Gesamtausgabe veröffentlicht worden.) Es handelt sich um einen überaus wichtigen Fund: Dieses Tagebuch ist ein wahrhaftes Ur-Toledo und der ursprüngliche Kern des Romans: Die Elemente und Figuren des ersten Teils von Toledo sind darin allesamt präsent, die bereits erfundenen Namen und die schon ins Grau gewendeten Orte, die frühzeitige Infragestellung der Existenz, die Berufung zur Einsamkeit (»Ich mag keine Gemeinschaften. Ich möchte allein sein. Oder alleine gehen«), die in den Fresken entdeckte Leidenschaft für »die vergangene Zeit«, die Idealisierung der amerikanischen Ureinwohner, die Indianer, die ausschweifenden Märsche als Heilmittel und Ermunterung zur Vision; und die Pflock-Wörter, von denen aus die Welt anvisiert wird: Meer, Wind, Schmerz, Grau, Stille: einschließlich desjenigen, das wie eine Verurteilung wiegt – Ignorantin – und von jenen geschleudert wird, von denen man es am wenigsten hören möchte. Vor allem aber gibt es eine Passage, die auf die Erklärung folgt, dass sie allein sein will, dass sie das Handwerk selbst erlernen und dem, was sie als Notwendigkeit bezeichnet, einen Sinn geben will: »Ich muss durch meine persönlicheArbeit [Hervorhebung von mir, T. G.] diese grandiose Tatsache zum Ausdruck bringen: dass ich geboren wurde, dass ich Licht, dass ich Schiffe sehe, dass ich Mana heiße und dass ich Schmerzen habe. Alles andere scheint mir nutzlos zu sein.« Der Poetik des Wunderbaren könnte nicht besser Ausdruck verliehen werden: Anna Maria Ortese und ihr großer Roman. Siebzig Jahre später, im Jahr 1998, ist Ortese zu Gast bei Adelphi in Mailand, um die Korrekturfahnen der endgültigen Ausgabe von Toledo durchzusehen, an der sie mitgewirkt und für die sie eine neue Einführung verfasst hat. Nach Abschluss der Arbeit begleitet man sie in ihr Haus nach Rapallo zurück; sie stirbt kurz darauf, am 9. März, zwei Wochen vor der Neuausgabe ihres Lebensbuchs.
Die Veröffentlichungsgeschichte und die kritische Rezeption von Toledo markieren einen weiteren Wendepunkt in ihrem Leben und literarischen Werk. Hier ist nicht der Ort, dies zu vertiefen, und es lohnt wohl auch nicht weiter: Es muss jedoch gesagt werden, dass die sechsjährige Arbeit am toledanischen Roman von grundlegenden Meinungsverschiedenheiten mit dem Verlag und seinen Funktionären geprägt war, die außer durch deren Rückzug nie geheilt wurden, sowie von Orteses ständigen, inzwischen chronisch gewordenen Aufschüben und Verzögerungen: nicht der beste Weg für ein Buch von literarischer Extremität und ausgestellter poetischer Distanz, das so sehr der überzeugten Unterstützung des Verlegers und der kritischen Rückmeldung bedarf wie kein anderes. Das Buch erscheint schließlich und ist ein Misserfolg: Es wird nicht verstanden, man versagt ihm die Anerkennung. Für Ortese ist dies ein schwerer Schlag. Toledo ist das Buch ihres Lebens: Sie hat sich als Schriftstellerin und Autorin voll und ganz exponiert; und sie ist vom Wert des Buches überzeugt, das sie gegen alles und jeden und ohne irgendwelche Zugeständnisse schreiben wollte. Die Ablehnung durch die breite Öffentlichkeit hätte sie vielleicht noch akzeptieren können; was ihr wirklich zusetzt, ist das verdrossene Schweigen der Kritiker, der literarischen Welt: Selbst die wenigen Freunde gehen nicht über Floskeln der Unverbindlichkeit und der bisweilen verlegenen bloßen Fürsorge hinaus. (Das Schweigen war nicht ganz so umfassend: Es erschienen ein paar Rezensionen, die man jedoch vergessen konnte.) Die Wahrheit ist, dass der Roman durchweg abgelehnt wurde. Ortese beschuldigt den Verleger zunächst wütend und dann immer weniger überzeugt, das Buch nicht unterstützt, wenn nicht gar boykottiert zu haben: Sie kennt jedoch den wahren Grund und kann ihn nicht akzeptieren. Ortese ist gedemütigt, und ein mächtiges Wort sticht hervor: Sie nennt Toledo, das Buch ihres Lebens, einen Absturz: nicht nur als Schriftstellerin, sondern als Mensch. Es lohnt sich, hier auf ihren Brief an Giulio Einaudi aus dem Jahr 1981 zurückzukommen: »Diesem Buch und seiner Veröffentlichung verdanke ich einen wahren Absturz meines Lebens als Schriftstellerin und damit als Mensch. Ich verdanke ihm alles, was auf solche Abstürze folgt: die allmähliche Isolierung, den Schmerz und die unterschiedlichsten Schwierigkeiten. Aber ich bedaure es nicht: Denn dieses Buch bleibt, und dieser Preis war angemessen.« Ortese zieht einen Schlussstrich unter die Zeit der Trauer und stellt mit Stolz klar: »Es handelt sich um ein wertvolles Buch«, so bekräftigt sie nachdrücklich. Die Zeit des Schmerzes war nicht umsonst. Es bleibt die Tatsache der Ablehnung durch die literarische Welt und damit neue Distanz.
Jahre später, 1990, nennt Ortese in einem Brief an den österreichischen Literaturwissenschaftler Franz Haas Toledo »das einzige Buch«, das sie geschrieben habe. Einfach so, ohne jede Umschweife: das einzige Buch. Das Buch wurde abgelehnt und sie lange Zeit wegen ihres großen toledanischen Traums an den Rand gedrängt und ins Abseits gestellt: Es kümmert sie nicht mehr. »Der Hafen von Toledo« ist das einzige Buch, das ich geschrieben habe. Punkt.
Um die Ablehnung und Verärgerung der Literaten über Toledo zu verstehen, muss man sich zwei zusammenfallende Tatsachen vor Augen halten: zum einen die Fremdheit, wenn nicht gar Abscheu der italienischen Literaten vor der vollkommen gotischen und westlichen Poetik des Wunderbaren; und zum anderen den ganz und gar besonderen Weg von Ortese als Autorin. Was die erste Tatsache betrifft, so lohnt es sich hier nicht, über die Evidenz der Tradition hinauszugehen: klassisch und humanistisch in jedem Bereich, und so auch in der Literatur, die – von Ariosto bis Calvino – der Fabel und dem Märchen alle Ehre erweist, welche etwas völlig anderes sind als die Literatur der Vision. Auf der anderen Seite war Ortese sich dessen bewusst, und zwar so sehr, dass sie an Franz Haas über Toledo schrieb: »Hier in Italien ist mein Fall schon längst abgeschlossen und archiviert. Ja, gerade der Fall von TOLEDO. Und was kann man machen? […] Es wird gehasst, und das ist alles. Die Sprache der extremen Gefühle und Visionen wird gefürchtet wie die Grammatik der Kinder.« So ist es. Die von Ortese verwendete Formulierung »mein Fall« führt direkt zur zweiten Tatsache, die entscheidend ist. Anna Maria Ortese war schon immer ein »Fall«: Vom frühen Debüt in Zeitschriften und der Veröffentlichung von Angelici dolori der vor Hispanidad vibrierenden jungen Autodidaktin an, die von Corrado Pavolini entdeckt und von Massimo Bontempelli lanciert wurde; um dann sogleich zur »traumverlorenen Zigeunerin« – wie Elio Vittorini sie im Klappentext nennt – von Neapel liegt nicht am Meer zu werden, ihrem ersten Erfolg, der ihr den Hass der neapolitanischen Literaten einbrachte, die in einer der Reportagen, »Das Schweigen der Vernunft«, porträtiert werden; und schließlich mit der Verleihung des Premio Fiuggi für Kultur und der lebenslangen Rente, die sie nach dem großen Schweigen, das auf die Veröffentlichung von Toledo folgte, erneut als geniale und unglückliche Schriftstellerin ins Rampenlicht stellten: ein neues Licht, das nicht unabhängig von der Neulancierung ist, die Pietro Citati dem Verleger von Adelphi, Roberto Calasso, vorgeschlagen hatte und die in dem großen Erfolg von Die Klage des Distelfinken gipfeln wird. Pietro Citati und Cesare Garboli waren in jenen Jahren die beiden Stars der Literaturkritik: Widersacher und doch keine Gegner, gegensätzlich und doch nie in Opposition zueinander. Garboli hatte Elsa Morante schon früh unter seine Fittiche genommen; Pietro Citati begann 1978 einen Briefwechsel mit Ortese, spät also und auf der Grundlage einer begeisterten Lektüre von Iguana: der Ortese des Märchens also. (Es ist kein Zufall, dass dies sodann das erste Buch war, das mit einem Nachwort von Citati 1986 von Adelphi neu aufgelegt wurde.) Er nahm sich Orteses Werk zu Herzen, verhalf ihm zu einigem Erfolg und unterstützte sie zusammen mit Adelphi in ihrem neuen literarischen Leben. Nach dem Erscheinen des Distelfinken publizierte er eine sehr ausführliche und symphonische Rezension, die zugleich eine gehobene Lobrede auf das Märchen darstellte: Sie war dem großen Erfolg des Buches alles andere als ungünstig. Und er räumte mit dem Missverständnis auf, das auf Neapel liegt nicht am Meer lastete, indem er argumentierte, es sei kein Buch gegen Neapel, als das es die üblichen Gehörlosen heute noch immer darstellen wollen. Stattdessen: »ein außergewöhnlicher Abstieg in die Unterwelt, in das Reich der Dunkelheit und der Schatten« – eine Vision also. Und er schrieb im Zuge der Neuauflage der Erzählungen von L’Infanta sepolta ein wunderschönes Porträt von ihr. Aber: Wo bleibt in alledem Der Hafen von Toledo? Ich habe noch keine vollständige Antwort auf diese Frage gefunden.
Wir haben Pietro Citati dennoch dankbar zu sein, dass er Ortese dort angesiedelt hat, wo sie hingehört, nämlich unter die repräsentativen Schriftsteller des italienischen 20. Jahrhunderts – und zwar aufgrund eines glücklichen Anachronismus gegenüber der vorherrschenden Poetik. Und doch bleibt die Privilegierung der Ortese des Märchens und des Tageslichts gegenüber der Ortese der Vision und des Nächtlichen eine kritische Entstellung, die so nicht haltbar ist. Das Schweigen in Bezug auf Der Hafen von Toledo ist wie die Auslassung von Lüge und Zauberei für Elsa Morante zugunsten von Arturos Insel. (Es gibt einen sehr italienischen Grund dafür: Es ist derselbe Grund, warum Die grässliche Bescherung in der Via Merulana auf Händen getragen wird und nicht Die Erkenntnis des Schmerzes, ein weitaus besseres Werk Carlo Emilio Gaddas. Es ist derselbe Grund, warum Leopardi ein Dichter zu sein hat und sonst nichts: nicht der hohe Denker, nicht der Prosaist der Operette morali, nicht der Literat der Crestomazia italiana.) Die ist jedoch nicht der Punkt und bei Citati auch nicht der Fall. Die Wahrheit ist, dass die literarische Welt den Erfolg des Distelfinken, des schönen Märchens aus dem 18. Jahrhundert, mit einem Stoßseufzer der Erleichterung begrüßte: Jetzt konnte sie der Schriftstellerin ersten Ranges, die Ortese war, endlich die gebührende Ehre erweisen und das Feld von diesem sperrigen, unbekannten Meisterwerk räumen – oder besser gesagt: einem, dem sie nie begegnet ist und das sie daher nie gesehen hat. Nun aber konnte man es ganz vergessen oder elegant gesprochen eine unglückliche Abschweifung nennen: Denn jetzt endlich gibt es das Märchen, das den »schönen Tag« nicht verdirbt. Die endgültige Ausgabe des Romans bei Adelphi im Jahr 1998 sowie die Gesamtausgabe der Romane zwischen 2002 und 2005 werden daran nichts mehr ändern: Der erste der beiden Bände, der seinen Schwerpunkt in Toledo hat, wird von einem leidenschaftlichen und intelligenten Essay eingeleitet, der Ortese jedoch als vermeintliche Vertreterin einer weiblichen »Wissenschaft der Trauer« unter der Ägide der unvermeidlichen Virginia Woolf darstellt und auf diese Rolle festlegt – es ist dies nur die jüngste Frucht der stets wiederkehrenden Missverständnisse, welche die akademischen Studien bestimmen, und nicht nur diese. Es macht aber nichts weiter: Orteses großer Roman, »das einzige Buch«, ist unversehrt.
Nun endlich erreicht Der Hafen von Toledo in der Übersetzung von Marianne Schneider, der es gelungen ist, in das Buch-Bild, das unbekannte Meisterwerk Anna Maria Orteses einzutreten, die deutschsprachige Leserschaft. Die Hoffnung – tief im Inneren: die Gewissheit – zielt darauf, dass sie es aufnimmt und ihm aufmerksamer zuhört, als es in Italien geschehen ist, einem Land des Glanzes und der Leidenschaft für die dort Geborenen, und, beinahe als Vergeltung dafür, ein ewiges Vizekönigreich in der Geschichte der Moderne und damit eine Strafe für das Italienische.
Tiziano Gianotti, 30. Dezember 2022
DER HAFEN VON TOLEDO
ANNE,NACHTRAG UND WANDLUNG
Ende des 18. Jahrhunderts befleckte sich in London ein Mädchen von dreiundzwanzig Jahren mit einem schweren Verbrechen und wurde auf der Stelle bestraft. Davon berichtet Benjamin Constant in seinen Tagebüchern. Anne lebte in einem ausweglosen, unendlichen Elend. Das war ihre Rolle auf der Welt. Eines Tages suchte ihr Geist, vielleicht vom Dunkel geschwächt, nach einer Rettung. Dies war das Geld. Sie hatte keines, bemühte sich, welches herzustellen. Während des Prozesses verteidigte sie sich nie. Sie wusste, nicht wiedergutzumachen war ihr Verstoß gegen das Gesetz, nach dem sie im Dunkel bleiben sollte, an ihrem natürlichen Platz. Und sie hatte keine Stimme, um sich zu verteidigen. Sie blieb immer still. Nur als sie es sah – das Denkmal für die Reinheit des Lebens sah –, stieß sie einen langen Schrei aus, den einzigen Schrei ihres Lebens. So schlief sie ein.
Von Anfang an war dieses Buch Anne gewidmet. Ich habe es mit Anne geschrieben. Anne war immer bei mir. Sie wurde von der Welt ihres kleinen Lebens beraubt. Man musste ihr etwas zurückgeben, eine Form von Gerechtigkeit, auch wenn sie auf die Stimmen der Welt nichts mehr erwiderte. Ich dachte, fühlte vielleicht nur, dass man ihr nahesein, ihre Bürde mittragen musste. Wie? Ein Verbrechen war – auch für mich – durch Nachtrag und Wandlung unerlässlich. Der Ort konnte kein anderer sein als der der Bücher. Ich würde etwas schreiben zugunsten einer Literatur als Verbrechen, Verbrechen durch Nachtrag und Wandlung. So begann ich an die Herausforderung der möglichen Leser von Toledo zu denken. Ich hatte eine falsche Autobiografie eingeleitet, aber das war noch das Geringste. Ich hatte vor allem eine Diskussion über Wandel und Nachträge in Gang gebracht. (Das war der Teil mit Anne.) Die alte Natur der Dinge passte mir nicht. Ich erfand daher ein Ich, das einen Nachtrag zur Welt wollte, das gegen die optimale Planung des Lebens aufschrie. Das in der Normalität nur Lüge sah. Das gegen die Beklemmung der Grenze protestierte, eine reine Gewaltsamkeit und einen neuen Horizont verlangte. Denn die neue Kultur (der Welt) war nicht neu. Sie war eine Viruszüchtung. Unbeweglichkeit und Befriedigung waren allgegenwärtig. Es wimmelte nur so von Gemeinplätzen über die Vorteile des Lebens, und dieses Leben war nur mehr ein Nest von Ungeheuern. Keine Taube zum Zeichen, dass die Sintflut vorüber sei, sah ich am Horizont erscheinen. Dadurch kann ich ein klein wenig erklären, warum die Dasa dieser Geschichte sich so sehr mit der Unsterblichkeit derer beschäftigt, die nicht zur Kultur gehören, ausgeschlossen bleiben. Damasas Drama ist nämlich der Ausschluss der Lebenden – derer, die sich nicht im Ausdruck retten – aus der Seligen Literatur. Sie, Dasa, möchte, dass alle gerettet, alle selig werden, selig vor Schönheit, vor Freude, und alle ihre Diskussionen mit dem unnatürlichen Grafen D’Orgaz zielen dahin, bis das Leben beschließt, dass sie der doppelten menschlichen Natur mit Rausch und Verlust begegnen soll. Da erfüllt sich in Ermattung ihr Schicksal.
Toledo ist also keine wahre Geschichte, ist keine Autobiografie, ist Rebellion und »Verbrechen« angesichts der menschlichen Planung, der einzigen menschlichen Dimension, die man uns gelassen hat.
NATÜRLICH UND NICHT NATÜRLICH
Manches Mal habe ich schon gesagt, was ich vom reinen Natürlichen denke. Es ist Betrug und Versteinerung des Menschen. Ohne einen Wandel seines Gemüts und seiner Sprache ist der Mensch nur Widerspruch. In der Kunst ist die Dimension des Natürlichen nichts als tiefste Veralterung. Das reine Natürliche ist das Tote. Und darin ist nur der tote Mensch.
Toledo ist somit keine wahre Geschichte und will es nicht sein, sondern ein »Nachtrag« zu den Dingen der Welt. Toledo ist keine wahre Stadt, auch wenn Bilder des Wahren auftauchen, und die Leute dort sind nicht wirklich. Apa, Damasa, Aurora, die kleinen Schüler, die mit ihrer abstrakten Sprache in diese falschen Memoiren eingehen, sind nicht wirklicher als die Straßen, die Gassen, die Ruas der mondenen Stadt, von der ich spreche. Die Mondstürme und die Windklagen sind falsche Fährten. Toledo gibt es nicht, aber die Herausforderung, mit der ich diese abwegigen, stilistisch grauenhaften (gegen das Natürliche) Seiten schrieb, bleibt bestehen. Herausforderung der Anhänger einer anderen Wahrheit als jener der Verdammnis und des Verbrechens, in der die Kultur das Wirkliche überschwemmt, das als Vernunft und Schönheit gegeben wird. Aber es ist keine Schönheit, es ist Täuschung. Gibt es etwas Wahres, das nicht der unsinnige Zustand des Lebens ist? Nein. Und Toledo, obschon es zugibt, dass Orte und Augenblicke existieren, in denen andere Kräfte auf wohltuende Weise wirken, lässt spüren, dass das nicht alle Lebenden und nicht alle Augenblicke betrifft. Für einen großen Teil der Menschen herrschen Regen und Dunkel, und die Macht der Unvernunft marschiert auf ihren Köpfen.
Trotzdem ist Gutes im Aberwitz, in der Anstrengung, ein anderes Wahres zu fördern: den Himmel für Apa, für andere die Liebe als etwas Nicht-Erkennbares und die Künste.
Zuletzt ist doch nicht alles Traum, glaube ich, etwas – die Herausforderung und die Brüderlichkeit – bleibt