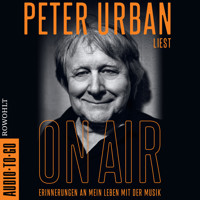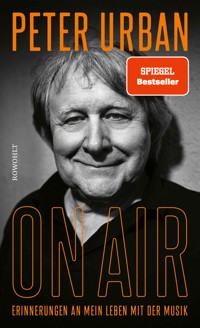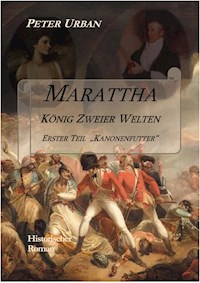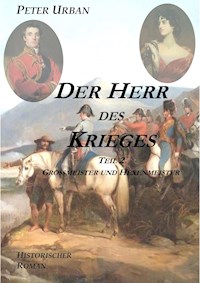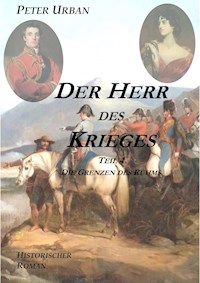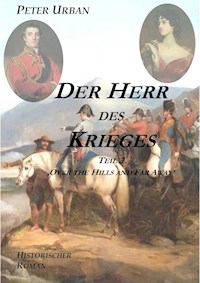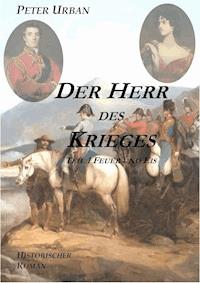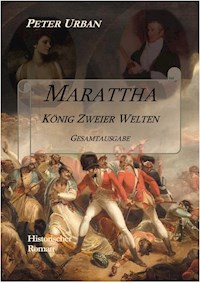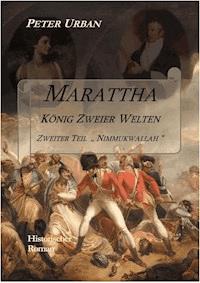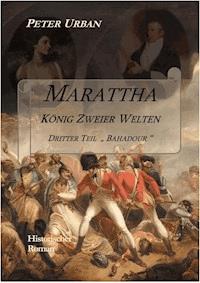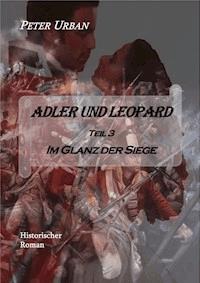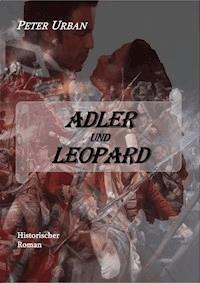Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Warlord
- Sprache: Deutsch
Arthur Wellesley hat sich entgegen aller Erwartungen und Unkenrufe aus London gegen seinen härtesten Gegner, den französischen Marschall Massena durchgesetzt. Doch Talavera war auch ein Phyrrus-Sieg und er muss sich mit seiner Armee wieder nach Portugal zurückziehen. Die Kriegskassen sind leer, die Soldaten erschöpft und seine Feinde in London gönnen ihm keinen Aufschub. Wenn er das Kommando behalten will, dann muß er Erfolge bringen...und sein größter Gegner Napoleon kocht vor Wut und schwört dass er ihm "jeden Knochen im Leib brechen wird" und anschließend die Engländer zurück ins Meer schmeißt. Eine schlecht geplante britische Expedition in Nordeuropa endet mit einem gewaltigen Reinfall. Arthur baut mit Hilfe der Portugiesen heimlich eine gewaltige Befestigungsanlage, um wenigstens Lissabon vor den Franzosen und ihre Verbündeten zu schützen und seine Rückzugslinie zu sichern. Gleichzeitig kämpft er mit dem Mut der Verzweiflung gegen eine Überzahl von Feinden. Sein Chefspion Pater Jack Robertson und das " Quartett " brauchen die Zeit um in einer gefährlichen und streng geheimen Nacht-und-Nebel Operation das Terrain für eine grosse Offensive nach Spanien vorzubereiten. Der Weg über die Grenze und nach Frankreich ist weit, gefährlich und blutig, doch Arthur und seine Kampfgefährten fangen langsam an daran zu glauben, dass sie das "Monster" Napoleon am Ende vielleicht doch besiegen können, um so diesen endlos langen Krieg zu beenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1369
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1 Mit dem Mut der Verzweiflung
Kapitel 2 Libertad
Kapitel 3 Mondegos Tochter
Kapitel 4 Das Testament von Robert the Bruce
Kapitel 5 Der Code von Paris
Kapitel 6 Hindernisse
Kapitel 7 Die Ehre Portugals und Englands Ruhm
Kapitel 8 Winkelzüge
Kapitel 9... durch die Hölle
Kapitel 10 Unter den Feuern von Beltaine
Kapitel 11 Fuentes de Onoro
Kapitel 12 Die Schatten von Albuera
Kapitel 13 Wieder in Spanien
Kapitel 14 Winter in den Bergen
Kapitel 15 „... seine eigenen Söhne wählen!”
Kapitel 16 1812
Kapitel 17 Der Feuersturm
Kapitel 18 Die bitteren Tränen des Sieges
Kapitel 19 Eine Aprilnacht in Andalusien
Kapitel 20 Der Hexenmeister
Kapitel 21 Gestutzte Schwingen
Kapitel 22 Triumphzüge
Kapitel 23 Rückschläge
Kapitel 24 Freneida
Kapitel 25 Partisanenkrieg in Navarra
Kapitel 26 Tief hinter den feindlichen Linien
Kapitel 27 Glorreiches Vitoria
Kapitel 28 Das Schwert des Königs
Kapitel 29 Über die Grenze
Kapitel 30 Der Anfang vom Ende
Kapitel 31 Tief im Herzen des Feindes
Kapitel 32 Orthez
Kapitel 33 Fleur de Lys und Bordeaux
Kapitel 34 Nacht ohne Ende
Kapitel 35 Un Adieu aux Armes
Kapitel 35 Historisches Nachwort
Kapitel 1 Mit dem Mut der Verzweiflung
Arthur Wellesley hatte sich bereits Anfang Oktober heimlich aus Badajoz nach Lissabon verabschiedet; er wollte endlich die Arbeiten zur Verteidigung Portugals organisieren, ohne dabei dauernd von irgendwelchen Hiobsbotschaften aus Sevilla oder London abgelenkt zu werden. Einerseits gefiel die ‚Höchste Junta‘ Spaniens sich nach dem Sieg von Talavera in einem gefährlichen Zustand zwischen Euphorie und Größenwahn und bedrängte ihn mit haarsträubenden Plänen für noch haarsträubendere Kriegszüge gegen die Adler, andererseits zerfleischten Whitehall und die Commons sich leidenschaftlich in einem sinnlosen Streit um eine mißglückte Operation in Nordeuropa, die außer dem Verlust zehntausender britischer Soldaten nichts eingebracht hatte. Und er befand sich irgendwo in der Mitte und bekam von beiden Seiten Prügel, die er mit knapp 300.000 französischen Soldaten auf der Iberischen Halbinsel einfach nicht brauchen konnte. Walcheren war ein Fiasko gewesen, denn die Planer in den Horse Guards hatten in ihre Rechnung nicht einkalkuliert, daß der Sommer in den holländischen Sümpfen Stechfliegen, schales Wasser und tödliches Fieber mit sich brachte. Die Spanier drängten auf eine Entscheidungsschlacht gegen die Marschälle Bonapartes, besaßen dafür aber weder die Kompetenz noch die Truppen noch die nötige Weitsicht. Er selbst verfügte lediglich über ein kaum 30.000 Mann starkes Expeditionskorps, das nach dem Sommerfeldzug 1809 und einer grauenhaften Schlacht, die zwei Tage gedauert hatte, an den Grenzen seiner Belastbarkeit angelangt war. Seine Entscheidung, als Oberkommandierender dieser müden Truppe ein paar Wochen lang unauffindbar zu bleiben, entsprach den Geboten des gesunden Menschenverstandes und denen der Kriegslist! Das alles seinen wüst streitenden Herren in London klarzumachen schien ihm in diesem Augenblick ein sinnloses Unterfangen. Und mit der ‚Höchsten Junta‘ vernünftig reden zu wollen, war unmöglich! Auf die Entsendung zweier spanischer Armeen unter Areizagos und Del Paques hatte er noch mit einem trockenen Memorandum nach Sevilla reagiert, in dem er den Herren Generälen und den Anführern des politischen Widerstandes ausführlich erklärte, was sie von den Franzosen erwarten konnten, wenn sie sich auf einen großen Zusammenstoß in Zentralspanien einließen. Sie hatten ihm nicht zuhören wollen, also hatte er Kopenhagen gesattelt und war auf die andere Seite der Grenze verschwunden, ohne sich weiter um das Schicksal seiner uneinsichtigen Verbündeten zu kümmern.
Auf der Höhe von Torres Vedras war Portugal nur etwa 40 Meilen breit. Es galt hier drei Befestigungsringe zu errichten, bevor Bonaparte seine Aufmerksamkeit wieder auf das kleine Land am Atlantik richtete. Der Ire wußte, daß ihm nicht mehr viel Zeit blieb! Sobald die Marschälle Areizagos und Del Paques zerschmettert hatten, würden sie gegen die Grenze ziehen und damit gegen sein kleines Expeditionskorps und eine Handvoll portugiesischer Verbündeter, die zwar allen Mut der Welt besaßen, aber damit nicht die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners wettmachen konnten: Der erste Verteidigungsring würde landeinwärts vom Atlantik, entlang des südlichen Ufers des Zizandre bis nach Torres Vedras verlaufen und dann, in südöstlicher Richtung, über Land bis Alhandra und zum Tejo. Der zweite Ring war parallel zum ersten geplant, nur ungefähr sechs Meilen weiter südlich. Der dritte Wall schließlich mußte westlich der Hauptstadt Lissabon liegen und ein halbkreisförmiges Areal am Atlantik einschließen, von dem aus er im Falle einer verheerenden Katastrophe seine Truppenreste wieder nach Großbritannien evakuieren könnte.
Das Verteidigungssystem, das General Sir Arthur Wellesley, der sich seit seinem Sieg über die Franzosen bei Talavera Lord Wellington nennen durfte, erdacht hatte, war komplex und ziemlich kompliziert. Obwohl er sich ganz genau vorstellen konnte, wie alles am Ende funktionieren und zusammenpassen würde, fiel es ihm nicht leicht, auf einem Blatt Papier seine ‚Wälle von Torres Vedras‘ zu erklären: Römisch-maurisch-portugiesische Burgen, Burgklöster und Wachtürme thronten auf Bergen, beherrschten die Hügel der Halbinsel, schmiegten sich an sanfte Höhen oder klebten an schroffen Felsen. Einst, in längst vergangener Zeit, wachten sie über das gesamte Umland Lissabons und über die Estremadura bis zur spanischen Grenze. Manchmal waren nur noch traurige Ruinen übriggeblieben; oft jedoch hatte man die Gemäuer über die Jahrhunderte sorgsam erhalten und sie strahlten immer noch Wehrhaftigkeit aus. Um die Hauptstadt des Landes zu beschützen, mußte nur noch jemand die Energie finden und diese manchmal düsteren Festungen, oft aber auch romantischen Märchenschlösser mit kastenförmigen, eng stehenden Türmen ohne Spitzen, mit den sonderbaren Wehranlagen ohne Burg, aber mit gewaltigen, kubischen Mauermassen, miteinander zu verbinden. Flüsse mußten mit Dämmen gebändigt werden, um im Falle eines Angriffs durch die Franzosen kurzfristig künstliche Überschwemmungen zu schaffen, die den Armeen der Adler den Übergang unmöglich machen würden. Die Dämme selbst wollte der Ire zum Schutz vor feindlichen Übergriffen stark befestigen. Die Zitadelle von Torres Vedras und ähnliche steinerne Trutzburgen aus dem Mittelalter würden mit zusätzlichen Schutzwällen modernisiert. Jeder unbebaute Hügel bekam seine Verteidigungsanlage, sowohl entlang des ersten Ringes, als auch entlang des zweiten Walles. Das Gelände selbst war zerklüftet und kaum zugänglich. Tausende von Portugiesen arbeiteten unter Aufsicht der wenigen, britischen Militäringenieure, über die Arthur verfügte, frenetisch an der Verteidigung von Lissabon. Sein gesamtes Konzept beruhte darauf, soviel Land wie nur irgend möglich, mit so wenigen Männern wie unbedingt nötig zu halten, um größtmögliche eigene und portugiesische Truppenreserven bereitzuhaben, die im Rücken eines frustrierten oder geschwächten Feindes manövrieren und kämpfen konnten.
All diese Arbeiten verliefen unter dem Siegel strengster Geheimhaltung! Der portugiesische Kronrat schwieg, die portugiesischen Arbeiter schwiegen und Wellington selbst ließ trotz der immer härteren Angriffe aus London und dem brutalen Druck, den die Regierung und die öffentliche Meinung seines Landes auf ihn ausübten, kein Wort zu seiner Verteidigung oder Rechtfertigung laut werden. Er konnte und durfte in diesem Augenblick niemanden von den Bauarbeiten zwischen Arruda und Torres Vedras erzählen. Zu groß war die Gefahr, daß ein geltungssüchtiger Politiker zuhause den Plan preisgab, alles in die Presse gelangte und damit ebenfalls zu den Franzosen. Der Erfolg der Wälle von Torres Vedras in Arthurs Gesamtstrategie auf der Iberischen Halbinsel lag nur in ihrer vollständigen Geheimhaltung. Lediglich in einem privaten Brief an Robert Castlereagh ließ der General durchblicken, daß er etwas vorhatte. Doch was, das wollte er auch dem Freund nicht sagen. Robert war zu sehr Politiker, als daß der Soldat Wellington ihm in dieser schwierigen Lage noch sein Vertrauen schenken konnte. Nur an Henry Paget schrieb er: „Besorge dir eine Karte, sieh genau hin und du wirst verstehen, was ich gerade unternehme!“ Dann löste er sich für weitere vier Wochen in Luft auf, ohne irgend jemanden zu informieren, wohin oder warum. Er wurde nur noch von Oberst Richard Fletcher begleitet, dem Chefingenieur seines Feldheeres. Don Antonio Maria Osario Cabral de Castro und Pater Robertson mit seinem Quartett verschwanden ebensomysteriös in den Weiten der Iberischen Halbinsel.
Napoleons ‚Grande Armée‘ hatte im Jahr 1809 wieder eine ihrer verblüffenden Siegesserien gehabt: Bei Tengen, Abensberg, Landeshut, Eckmühl, Ratisbon, Ebersberg und Znaim hatten die Adler die Österreicher geschlagen. Bei Wagram hatte der Kaiser der Franzosen einen großen Sieg errungen. Als Arthur präzise Informationen über diesen 5. und 6. Juli in Händen hielt, erschauderte er. Das kleine Dorf Wagram befand sich nur wenige Meilen von Wien entfernt. Nachdem der Kaiser in einem verzweifelten Zusammenstoß bei Aspern-Esslingen, unter grausamem Blutzoll versucht hatte, die Donau zu überwinden und dabei seinen engsten Waffengefährten, Marschall Jean Lannes, den Herzog von Montebello, verlor, überschritt er in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli den Fluß ohne dieses Mal auf österreichischen Widerstand zu stoßen. Erzherzog Karl hatte sich noch nicht mit den Truppen von Erzherzog Johann vereinigen können. Sein Versuch, den Korsen von seinem Brückenkopf abzuschneiden und wieder über den Fluß zu vertreiben, um die Hauptstadt der Donaumonarchie zu retten, schlug fehl. Napoleon gelang es, einen Keil ins Zentrum des österreichischen Heeres zu treiben. Karls Situation war ausweglos, seine Niederlage vollständig! Die Franzosen besetzten Wien, der Kaiser schlug sein Hauptquartier in Schönbrunn auf. Rußland hatte sich der Koalition gegen Bonaparte dieses Mal nicht angeschlossen. Niemand konnte der Donaumonarchie mehr zu Hilfe eilen, und der Habsburger mußte am 10. Juli 1809 den ehemaligen Jakobinergeneral und Revolutionär um Frieden anflehen. Er wurde gezwungen, im Vertrag von Schönbrunn unermeßlich große Teile seines Hoheitsgebietes abzutreten und dem französischen Kontinentalsystem beizutreten. Als Dreingabe forderte Napoleon noch die Hand Marie-Louises von Habsburg! Josephine Beauharnais – seine Kaiserin – hatte ihm keine Söhne schenken können, doch der Korse wollte eine Dynastie gründen. Nach dem Tag von Wagram beschloß er, sein Revolutionärsblut mit dem ältesten Hochadel des europäischen Kontinents zu veredeln – Habsburg! Der Kaiser der Franzosen hatte sich damit zum unangefochtene Herrscher über Europa gemacht.
Während die Portugiesen Tausende von Palisaden und Reisigbündel für die Befestigung der Wälle von Torres Vedras schleppten oder mühsam Straßen durch die Berge bauten, um schwerer Artillerie Bewegungsmöglichkeiten zu geben, wo vormals kaum ein Maultier vorankam, befand Don Antonio Maria Osario Cabral de Castro sich tief im Landesinneren von Spanien. Sein erster Weg hatte ihn in das Bergmassiv des Guadarrama geführt. Dort verbarg sich in der einsamen Schönheit von La Mancha, unweit von Segovia und hoch in den Bergen, ein Mann vor den französischen Häschern, dessen Ruf bereits den Weg über die Grenzen nach Portugal gemacht hatte: Juan Martin Diez. Seine Anhänger und auch seine Feinde nannten ihn nur „El Empecinado“ – den Mann vom Strom. Diez führte eine große Bande von Guerilleros an, die den Franzosen mit waghalsigen Übergriffen das Leben zur Hölle machten. Niemand, der eine blaue Uniform trug, war nachts oder in den Wäldern vor den gnadenlosen und flinken Messern der Gefolgsleute von El Empecinado sicher. Don Antonio gelang es, diesen Partisanenführer für die Sache der Briten zu gewinnen. Diez versprach, alle abgefangenen Franzosen sorgfältig auf Depeschen und andere nachrichtendienstlich wertvolle Schriftstücke abzusuchen und peinlichst zu befragen, wenn dies noch möglich war. Alle Informationen würde er Lord Wellingtons Nachrichtendienst zukommen lassen. Nachdem die Männer der Guadalajara-Region fest auf Seite der Alliierten standen, machte Don Antonio sich auf den Weg nach Kastilien, um sich dort der Unterstützung des berühmten Don Julian Sanchez zu versichern, eines Großgrundbesitzers, dessen gesamte Familie auf grauenvolle Weise von den Franzosen abgeschlachtet worden war, weil er sich geweigert hatte, dem Feind Pferde und Proviant zur Verfügung zu stellen. Auch Don Julian erklärte sich schließlich einverstanden, auf Seiten der Briten für die Freiheit seines Landes zu kämpfen. Und er tat noch mehr für Don Antonio: Er versprach dem Portugiesen, alle anderen Guerilleros ebenfalls für die Sache der Alliierten zu gewinnen. Boten galoppierten nach Osten, Westen, Norden und Süden los, und kurze Zeit später fanden sich die Führer sämtlicher Widerstandsgruppen aller spanischer Provinzen um ein Feuer, hoch in den Bergen der Sierra de Gredos versammelt. Dieser mächtigste Gebirgszug westlich von Madrid war nicht nur die Heimat der Steinböcke und Greifvögel, sondern auch der einzige Ort dieses besetzten Landes, zu dem die Franzosen sich nicht vorwagten. Die unwirtliche Nordflanke des Massives trug vorwiegend Granitfelder und dürftiges, niedriges Strauchwerk. Niemand konnte sich nähern, ohne sofort gesehen zu werden. Auf dem fast unzugänglichen Pico Almanzor, der sich mehr als 2500 Meter über den Meeresspiegel erhob, war die illustre Versammlung vor jeglichem feindlichen Zugriff sicher.
El Minas, ein Guerillero aus Navarra hatte dem jungen Portugiesen aufmerksam zugehört, doch er war skeptisch, ob es sich am Ende lohnen würde, mit den Briten zusammenzuarbeiten: „Don Antonio, was haben wir davon, diesem irischen Aristokraten Informationen zuzutragen? Er, die Franzosen oder ein spanischer Großgrundbesitzer, sie sind doch alle Unterdrücker, die uns einfache Bauern nur ausbeuten! Was kann er uns geben, wenn wir ihm helfen?”
„Spaniens Freiheit, Amigo!”
„Freiheit? Wenn die Franzosen weg sind, dann werden unsere eigenen Grundbesitzer uns wieder bis aufs Blut aussaugen! Was macht es für mich für einen Unterschied, wer mich bestiehlt?”
Der junge Portugiese sah den bärtigen Alten aus Navarra lange an. Es fiel ihm unendlich schwer, auf diese Äußerungen eines einfachen Mannes aus dem Volke eine Antwort zu geben, denn El Minas hatte im Grunde recht: Wenn die Franzosen fort waren, dann würde die spanische Grandezza die Bauern wieder plündern, so wie sie es seit Jahrhunderten tat. Doch dieses Problem konnte ein alliiertes Feldheer nicht lösen. Er beschloß, dem Navarener gegenüber einfach ehrlich zu sein: „Du hast richtig erkannt, daß es für euch keinen Unterschied macht, wer euch bestielt. Es ist auch richtig, daß der Ire ein Aristokrat und sein Ziel in diesem Kampfe nicht die Befreiung der spanischen Bauern ist. Dabei kann und wird er euch nicht helfen! Er ist von seiner Regierung auf die Iberische Halbinsel geschickt worden, um die Franzosen zu vertreiben. Wenn ihm dies gelingt, wird er in sein Land zurückkehren. Wenn er versagt, wird er auf spanischem Boden sterben! Er ist nur ein Soldat und ich bin mir selbst nicht einmal sicher, ob er überhaupt so etwas wie eine politische Überzeugung hat. Der General wird sich nicht in die inneren Angelegenheiten Spaniens einmischen. Alles, was ich zu seiner Verteidigung sagen kann, ist folgendes: Lord Wellington ist ein mutiger und aufrechter Mann! Er wird euch nicht benutzen und er wird euch nie anlügen. Wenn ihr ihm etwas gebt, dann wird er es euch auf die eine oder andere Art zurückzahlen. Sag mir deine Bedingungen! Was willst du von ihm, um gemeinsam mit uns gegen die Franzosen zu kämpfen?”
El Minas hatte diese direkte Antwort nicht erwartet. Er blickte den Portugiesen beschämt an. Verlegen kratzte er seinen langen Bart: „Ja, was will ich eigentlich? Meine Freiheit kann er mir nicht geben! Die spanischen Großgrundbesitzer kann er nicht vertreiben und die Gesetze dieses Landes wird er nicht ändern! Sag deinem irischen Generalissimo, daß die Männer Navarras ihm trotzdem helfen werden! Wir haben gesehen, wie er sich bei Talavera mit den Franzosen geschlagen hat, obwohl der Feind mehr als doppelt so stark war. Unsere Armee ist davongelaufen. Seine nicht! Die roten Röcke haben gekämpft, wie die Löwen und ihr Generalissimo hat sich vor den Kugel des Feindes auch nicht versteckt. Er ist verwundet worden und hat trotzdem sein Schlachtfeld nicht verlassen. Ich vermag einen Mann für seinen persönlichen Mut zu achten, selbst dann wenn er ein verdammter Aristokrat und Ausbeuter ist!”
El Minas Entscheidung bewegte auch die letzten, noch ein wenig wankelmütigen Guerilleros, sich auf die Seite der Alliierten zu schlagen. Don Antonio Maria Osorio Cabral de Castro versprach allen, daß die Briten sie mit Waffen und, wenn notwendig, mit Ausbildern versorgen würden. Wie auch den portugiesischen Widerstand, so hatte Lord Wellington seinem Adjutanten aufgetragen, so würde er die spanischen Guerillero in das alliierte Feldheer integrieren, sobald ausreichend Männer vorhanden waren um eigene Regimenter zu formen. Nach einem anstrengenden Monat kehrte der junge Portugiese müde, aber zufrieden nach Badajoz zurück. Er war der erste der kleinen Gruppe, der heimkehrte. Gespannt wartete er auf die anderen und darauf, welche Resultate und Neuigkeiten sie mitbrachten.
Kurze Zeit später erreichte dann ein ebensomüdes wie zufriedenes Quartett das britische Hauptquartier an der Landesgrenze zwischen Spanien und Portugal. Doch sie durften und konnten sich dem neugierigen Don Antonio noch nicht anvertrauen! Das einzige, was Hauptmann Cabral de Castro aus Pater Robertson und Oberst Grant bei einem gemeinsamen Abendessen in der Zitadelle herausbekam, war ein fröhliches Augenzwinkern. Obwohl Wellington wußte, daß auf all diese Männer, die er in geheimer Mission losgeschickt hatte, absoluter Verlaß war und niemand den anderen je verraten würde, hatte er doch beschlossen, daß außer ihm in diesem Moment keiner mit dem gesamten Plan vertraut gemacht werden sollte. Es stand zuviel auf dem Spiel, als daß er auch nur bereit war, das geringste Risiko einzugehen.
Während der Portugiese dem Benediktiner noch einmal Wein nachschenkte, in der Hoffnung vielleicht so seine Zunge zu lösen, stand Colquhoun Grant vom Tisch auf und holte Bleistift und Papier. Er schrieb ein paar Sätze nieder und streckte sie Don Antonio hin: „Anstatt uns auszufragen, wie ein altes Fischweib, mein Freund, solltest du dich lieber nützlich machen. Sag mir, was das ist?”
Der Portugiese betrachtete das Blatt, seine Stirn legte sich nachdenklich in Falten. Dann schüttelte er unzufrieden den Kopf: „Es ist verschlüsselt, irgendein Code! Doch was das bedeuten kann ... Granto, ich weiß es nicht! Darf ich den Fetzen behalten?” Der Husarenoberst nickte: „Wir haben es alle reihum versucht, aber keiner kann’s verstehen! Nicht einmal die klugen Padres von Braga, Tomar oder Santa Clara können sich einen Reim darauf machen. Mal sehen, was Sir Arthur selbst davon hält! Der hat in Indien ja offenbar die ganze Zeit mit Codes, Chiffres und Spionagenetzen gespielt. Wo der Chef nur steckt?”
Obwohl es ihm schwerfiel, nicht herauszuplatzen, zuckte Don Antonio nur die Schultern. Seit dem Abend in der Posada wußte er um die Wälle von Torres Vedras, doch Arthur hatte ihn als Freund gebeten, den Mund zu halten. Der Portugiese vermutete, daß der Ire angefangen hatte, an seinem Traum zu bauen, denn seit einiger Zeit schon gingen überall Gerüchte um, daß nun, nach dem Sieg über Österreich und dem Friedensschluß von Schönbrunn, Bonaparte selbst das Kommando über die französischen Armeen auf der Iberischen Halbinsel übernehmen würde und daß er es sich zum Ziel gemacht hatte, den schleichenden englischen Leoparden zurück ins Meer zu treiben und dem aufrührerischen Sepoy-General alle Knochen im Leib zu brechen. Der Kaiser hatte an den östlichen Grenzen seines Reiches Frieden erzwungen, seine Alte Garde marschierte auf Bayonne und es hieß, daß seine Wagen bereits auf dem Weg nach Madrid waren, um dort sein Hauptquartier vorzubereiten. Während eines ganzen Jahres mindestens, würde der Korse jetzt seine gesammelten Kräfte auf Spanien und Portugal richten können. Wellington mußten in seinem Versteck die gleichen Schreckensmeldungen zu Ohren gekommen sein!
Der bewährte Rowland Hill wartete genausoungeduldig wie die Männer des Quartetts und Don Antonio auf Arthurs Rückkehr. Er fühlte sich mit jedem Tag unwohler in seiner Haut. Der Ire hatte ihm einen großen Stoß unterschriebener, weißer Blätter in Badajoz zurückgelassen und ihn beauftragt – wie er es nannte –, Oberkommandierender zu spielen! Hill brachte täglich bange Stunden damit zu, Kuriere der Junta aus Sevilla hinzuhalten und negative Antworten seines Chefs auf Operationspläne zu erfinden. Die spanische La Mancha-Armee befand sich nun am Vorabend einer großen Aktion gegen die Adler und in den Augen Rowland Hills sicher auch am Vorabend ihrer totalen Zerstörung durch einen überlegenen und gerissenen Feind. General Areizago hatte sich ausgerechnet Marschall Soult als Gegner ausgewählt und marschierte auf Oçaña. Eine spanische Armee aus Galizien unter Del Parque bewegte sich durch die Ebenen von Leon auf Salamanca. Er würde General Marchand und das 6. Französische Armeekorps auf seinem Weg finden. Und unweit von Salamanca, in Alt-Kastilien, trieben sich die gefürchteten Dragoner des finsteren Generals Kellermann herum, zusammen mit drei Schweizer und vier oder fünf französischen Infanteriebataillonen, die General Marchand jederzeit verstärken konnten.
Auch Arthur Wellesley kannte diese Gerüchte: Sie waren ihm bis in die Berge zwischen Arruda und Torres Vedras zugetragen worden, obwohl er sich nie länger als einen Tag am selben Ort aufhielt. Kaum einer, der mit seinen geheimnisvollen Befestigungsarbeiten zu tun hatte, gleich ob einfacher Arbeiter oder Marschall Sir John Beresford, verstand, was er eigentlich plante. Doch der General strahlte in diesen Augenblicken soviel Selbstvertrauen aus, daß niemand seine sonderbaren Forderungen oder Ansprüche zu hinterfragen wagte. Zehn Tage lang war er kreuz und quer über Land geritten. Über steinige Bergpfade, hinunter in enge Täler, gelegentlich durch eine Ebene, entlang jedes Flusses und Flüßchens, hatte er jeden Stein, jedes alte Mauerwerk, jedes solide Bauernhaus und jeden Signalturm aus der Römerzeit in Augenschein genommen. Im Anschluß an diesen Erkundungsritt wußte nicht einmal mehr Oberst Fletcher, der Ingenieur, der Arthur begleitet hatte, wo der Oberkommandierende sich aufhielt. Fletcher hatte eines Morgens lediglich ein ellenlanges Memorandum in einem Umschlag vorgefunden, aus dem exakt hervorging, was er zu bauen hatte. Der General selbst war wieder einmal einfach vom Erdboden verschwunden.
Arthur hatte sich in diesen Tagen an das einfache Landgasthaus bei Arruda dos Vinhos, hoch in den Bergen erinnert, wo die Idee der Wälle von Torres Vedras geboren worden war. Doch dieser Ort lag gleichzeitig zu nahe an seinen geheimnisvollen Bauarbeiten und zu weit von sicheren Nachrichten über das Treiben der Spanier und der Franzosen. Er beschloß aus diesem Grunde, nach Tomar zu reiten und den dortigen Prior um Unterschlupf und ein wenig Diskretion zu bitten: Seit er auf der Iberischen Halbinsel gelandet war, hatten die Männer Gottes ihn noch nie enttäuscht, und ein Kloster war genau der richtige Ort, um von niemanden beim Nachdenken gestört zu werden oder auch um einfach zu vermeiden, daß irgendein störender Befehl aus London ihn doch irgendwie erreichen konnte.
Schon von weitem konnte der Ire den großen Felshügel erkennen, auf dem das Convento do Cristo stand, das erst Templer-, dann Christusritterburg und nun Refugium der mächtigen Jesuiten war. Die Stadt Tomar selbst lag ausreichend weit vom Kloster entfernt, am rechten Ufer des Rio Nabao, einem Nebenfluß des Tejo, in der Nähe der ehemaligen, römischen Siedlung Nabantia, von der nur noch Grundmauern und verwitterte Mosaike erhalten geblieben waren.
Der General war schon die halbe Höhe zum Burghügel hinaufgeritten, als er seinen Fuchs-Hengst unweit der schlichten Igreija de Nossa Senhora da Conceicao, einem Meisterwerk der Renaissance, dessen auffällige ionische Eckpfeiler und giebelgekrönten Fenster ihn bereits bei seinem ersten Besuch in dieser Gegend beeindruckt hatten, zügelte: Versonnen betrachtete er das Tonnengewölbe, das auf korinthischen Säulen mit geradem Gebälk ruhte. An diesem stillen, geschichtsträchtigen Ort fiel es ihm irgendwie leichter nachzudenken! Arthur konnte es sich nicht logisch erklären, aber er spürte genau, wie die Spanier in diesem Augenblick irgendwo im Herzen ihres Landes einer französischen Nemesis begegneten. Er wollte nicht, daß sein kleines Feldheer, das sich nun langsam, aber sicher von der Schlacht bei Talavera und dem Rückzug durch das Guadiana-Tal erholte, plötzlich zwischen die Fronten geriet und aufgerieben wurde, nur weil irgendein Politiker ihn dazu zwang nachzugeben!
Der Prior von Tomar empfing den Iren herzlich und versprach, ausnahmsweise auch einmal seinen Freund Pater Jack Robertson im Dunkeln zu lassen. Der General verbrachte drei ruhige Wochen in der klösterlichen Stille, hauptsächlich in der großen, alten Bibliothek über Karten Spaniens gebeugt. Das Jahr 1810 würde der Wendepunkt des Feldzuges auf der Iberischen Halbinsel werden. Arthur hatte eingesehen, daß es unmöglich war, die spanische Höchste Junta, was militärische Fragen anbetraf, zur Vernunft zu bringen. Die mehr als 50.000 Mann starke La Mancha-Armee unter General Areizaga wußte er verloren, noch bevor es zu einem Zusammenstoß mit Soult gekommen war, und auch für den Duque Del Parque hatte er jede Hoffnung aufgegeben. Sollten die Spanier doch ihre große Schlacht in einer weiten, deckungslosen Ebene im Frontalangriff schlagen und anschließend im französischen Kanonenfeuer verbluten. Sie waren so oder so nicht in der Lage, aus der Geschichte des Krieges zu lernen: Niemand schien sich in diesem stolzen Land je die Mühe gemacht zu haben, aus Fehlern der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen! Doch er hatte aus seinem gemeinsamen Sommerfeldzug mit diesen unruhigen Verbündeten viel gelernt. Er würde sich jetzt einfach darauf konzentrieren, die französischen Streitkräfte, die auf der Iberischen Halbinsel ins Unermeßliche zu wachsen schienen und bereits auf fast 300.000 Mann aufgestockt worden waren mit einer Politik der kleinen Nadelstiche zu zermürben. Wenn Don Antonio die Guerilla hatte überreden können – und Wellington war sich des Erfolges der Mission seines portugiesischen Freundes sicher –, dann würden alleine die Guerilleros und ihre erbarmungslosen, langen Messer gut die Hälfte aller französischen Truppen im Land binden und tagtäglich beschäftigen. Diese Aktionen würden ebenfalls die Kommunikationslinien der Adler untereinander und mit dem Kaiser so stören, daß ein geregelter Fluß an Informationen unmöglich gemacht wurde. Übrig blieben dann noch etwa 150.000 Franzosen gegen knapp 30.000 Briten und Portugiesen. Wellington wußte, daß diese 1:5-Ratio militärisch unmöglich war. Aber er hoffte, daß sich die uneinigen Marschälle wieder, wie schon so oft zuvor, mehr um ihre eigenen Belange kümmern würden als um die gemeinsame Sache. Nur wenn der Kaiser selbst in Spanien auftauchen sollte, dann konnte seine Lage wirklich hoffnungslos werden, denn Napoleon Bonaparte würde es gelingen, seine zerstrittene und selbstsüchtige Bande zu einen und gemeinsam gegen die Briten und Portugiesen zu führen. Aus diesem Grund existierte auch Arthurs dritter Wall von Torres Vedras, direkt um Lissabon und den Hafen. Wenn der Kaiser wirklich kommen sollte, dann würde er, der Sepoy-General, wohl kampflos aufgeben müssen. Sollte Napoleon sich aber nicht bemühen, dann konnte er einfach mit Frankreichs Marschällen so lange Verstecken spielen, bis irgendeiner von ihnen einen Fehler machte!
Arthur hatte sich hoch und heilig geschworen, erst dann wieder eine Schlacht zu schlagen, wenn er absolut sicher war, einen totalen Sieg über seinen Gegner davonzutragen! Nach Talavera hatte er geschworen, sich nie wieder von irgend jemand zu einem Waffengang drängen zu lassen, und wenn es Englands Schutzpatron, der Heilige Georg selbst sein sollte. Nur wenn er alleine Herr des Krieges war, dann würde seine dünne, rote Linie feuern!
Am 23. November 1809 erreichte Lord Wellington in Tomar endlich die schreckliche und trotzdem so ersehnte Nachricht einer totalen Niederlage General Areizagos. Es war die schlimmste Demütigung, die je eine Armee auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet hatte hinnehmen müssen: Mehr als 56.000 Spanier waren von einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus 30.000 Franzosen, Polen und Deutschen bei Oçaña, wenige Meilen vor Aranjuez aufgerieben worden. Spanien hatte 18.000 Mann Verluste zu beklagen, viele durch Desertion und Flucht vor dem Feinde. Del Parque, der in der Zwischenzeit mit mehr Glück als Verstand Salamanca genommen hatte, konnte die Stadt einfach nicht halten und wurde nur wenige Tage nach Oçaña verheerend bei Alba geschlagen. Spanien hatte seine beiden letzten, großen Feldheere durch eigenes Verschulden völlig aufgerieben. Nun war das Land verloren und dem französischen Kaiser auf Gedeih und Verderb ausgeliefert! Nun endlich hatte Arthur Wellesley den ersehnten Vorwand, um sein eigenes Feldheer aus Badajoz und Merida über die Grenze nach Portugal verschwinden zu lassen. Die Adler bedrohten endlich wieder frontal Englands ältesten Verbündeten. Nicht einmal die Zwietracht in Whitehall, der Krieg in den Commons und das Fiasko Chathams und Strachans in Hollands Sümpfen konnte einen 400 Jahre alten Vertrag zwischen zwei Nationen vergessen machen!
Wegen des Wintereinbruches beschützte nun die Natur Lissabon und gab Wellington eine weitere Verschnaufpause bis März oder April 1810. Der Tejo führte Hochwasser und war völlig unpassierbar für den französischen Feind geworden. Lediglich der schmale Korridor zwischen Ciudad Rodrigo und Almeida entlang des Douro bis Viseu, durch das Mondego-Tal über Coimbra und Pombal bis hinunter nach Lissabon mußte geschützt werden. Die letzte Stellung in dieser langgezogenen Verteidigungsposition war – Torres Vedras! Seine 30.000 Mann reichten hierfür aus. Das neue Hauptquartier der Briten sollte bis zum Frühjahr Viseu werden, eine alte Stadt, die spektakulär auf einem Hochplateau in den Bergen der Beira lag: Ein Adlernest, von dem aus man alles sehen und beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden, eine unangreifbare Position.
Am 1. Dezember tauchte Arthur überraschend aus dem Nichts in Badajoz auf. Auf die aufgeregten Fragen seiner Freunde und Untergebenen, wo er so lange gewesen sei, gab er keine Antwort. Rowland Hill, der in der Zitadelle ausgeharrt und tagtäglich einen Spießrutenlauf durch die Gänge der Politik im fernen London und im nicht ganz so fernen Sevilla unternommen hatte, fiel Wellington vor Erleichterung fast um den Hals. Auf dem Arbeitstisch des Generals lag ein gigantischer Haufen Post aus England, Lissabon und Sevilla. Hill hatte versucht, soviel er konnte im Namen und im Sinne seines Freundes zu beantworten, doch vor den pikanteren Schriftstücken hatte der General aus Shropshire kapituliert. Arthur sah sich den Schriftverkehr kurz an und winkte dann nach Somerset: „So, Rowland! Jetzt werden wir den Rest dieser wichtigen Fragen regeln! Somerset, bringen Sie mir bitte einen großen Papierkorb!” Der General griff sich den ganzen Stapel und warf ihn schwungvoll in das angeforderte Behältnis. Dann zeigte er mit dem Finger auf das Feuer im offenen Kamin: „Klassifizieren Sie’s, Somerset! Sofort und endgültig!”
Der erstaunte, junge Offizier wollte etwas erwidern, doch bevor er den Mund auch nur öffnen konnte, fauchte Arthur ihn an: „Tun Sie, was ich Ihnen befehle, Sir!”
Die Schriftstücke gingen in Flammen auf: „So, jetzt fühlen wir uns alle wieder besser, nicht war! Also, meine Herren, an die Arbeit!“ Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch und schrieb in weniger als zehn Minuten vor den erstaunten Augen aller Anwesenden 20 Marschbefehle für das britische Feldheer aus: „Somerset, Campbell, Don Antonio, Sie verteilen diese Dinger jetzt sofort. Morgen früh rücken die ersten Einheiten ab, nächste Woche will ich keinen einzigen britischen Soldaten mehr innerhalb der Grenzen Spaniens sehen! Und Craufurd soll in spätestens einer Stunde hier bei mir aufkreuzen! Wie er das anstellt, ist mir egal! Los, verschwindet!”
Die drei Offiziere waren so von ihrem Kommandeur überrumpelt worden, daß sie aus dem Arbeitszimmer stoben wie aufgeregte Hühner. Schwungvoll warf der General hinter ihnen die Tür ins Schloß. Hill und Robertson sahen sich verwundert an. Dann nahm Hill seinen ganzen Mut zusammen: „Bist du völlig übergeschnappt, Wellesley! Du hast gerade sämtliche Befehle aus London verbrannt und Gott weiß wie viele Briefe von Bart Frere und Henry Wellesley aus Sevilla, von deinem Bruder Mornington, von Castlereagh etc.”
„Welche Befehle? Ich habe keine gesehen! Das britische Feldheer zieht sich nach der vernichtenden Niederlage von General Areizago bei Oçaña blitzartig vor der französischen Übermacht nach Portugal zurück. Da geht schon mal was verloren. Selbst bei einem ordnungsliebenden Menschen wie mir!“
„Willst du uns nicht endlich erzählen, was du in den letzten zwei Monaten getrieben hast und was du jetzt vorhast? Ich glaube, auch wir haben ein Recht zu erfahren, was gespielt wird!” Hill war fürchterlich wütend auf seinen Freund, weil dieser ihn nicht nur schrecklich überrumpelt hatte, sondern auch, weil Arthur ihn acht lange Wochen mit allem Ärger und dem gesamten Feldheer alleine gelassen hatte. Er malte sich in seinem Inneren schon in den schlimmsten Farben aus, wie Whitehall und die Horse Guards alle Beteiligten in Stücke reißen würden. Robertson schwieg sich aus, denn der lange Arm der katholischen Kirche hatte dieses Mal nicht ausgereicht, um ihn mit dem zu versorgen, was für ihn so notwendig war, wie die Luft um zu Atmen: Informationen. Er hatte die dumpfe Befürchtung, daß das Schwert mit dem Schild spielte. Der Priester haßte dieses Gefühl, denn er erkannte, daß die Fäden ihm entglitten und er nur noch eine Schachfigur war, wo er sich zuvor als Spieler gesehen hatte. Es kratzte grauenvoll an seinem Selbstwertgefühl.
Der Ire strahlte seine beiden Freunde an: „Könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten?”
Robertson und Hill nickten eifrig. „Ich auch!“
Eine Woge der Enttäuschung ging über beide Gesichter.
„Spaß beiseite! Also, ich habe Lissabon befestigen lassen. In diesem Augenblick konstruieren unsere portugiesischen Verbündeten unter der Leitung meines braven Oberst Fletcher und unserer 45 Militäringenieure drei Befestigungslinien zwischen dem Tejo und dem Atlantik. Alles, was vor den Wällen von Torres Vedras liegt, für die Franzosen nützlich sein könnte und nicht transportabel ist, wird in Schutt und Asche gelegt. Den ganzen Rest und soviel Bevölkerung wie möglich verlagern wir hinter die Befestigungen. Und dann warten wir einfach ab! Irgendwann werden die Franzosen schon auftauchen!”
„Du willst dich mit ihnen schlagen?”
Der General schüttelte den Kopf: „Die werden sich selbst schlagen! Verbrannte Erde! Wer Lissabon anzugreifen versucht, braucht entweder ein verdammt gutes Nachschubsystem, oder er verhungert in der Estremadura. Wenn wir Lissabon verteidigen können, dann halten wir im Prinzip ganz Portugal. Diesen Winter haben wir noch eine Galgenfrist von den Franzosen bekommen! Sie können nicht über den Tejo. Der führt jetzt bis mindestens März oder April einfach zuviel Wasser. Im Frühjahr wissen wir, ob Bonaparte selbst uns die Ehre gibt. Sollte er das tun, verschwinden wir von der Iberischen Halbinsel. Wenn nicht, dann nehmen wir uns jeden seiner Marschälle einzeln vor, aber zu unseren Bedingungen! Ich werde nie wieder eine Schlacht wie Talavera schlagen. Wenn wir noch einmal ein Viertel unseres Feldheeres verlieren, um die Franzosen irgendwo zu besiegen, dann brauchen wir gar nicht erst weiterzumachen. Ich schlage mich nur noch, wenn ich sicher bin, mit wenigen Mitteln viel zu erreichen. Wenn nicht, dann manövrieren wir, bis die Franzosen sich müde laufen, oder bis sie einen Fehler machen.
Robertson pfiff durch die Zähne: „Da haben Sie sich aber viel vorgenommen, mein Junge! Inzwischen stehen 300.000 Franzosen in Spanien und weitere 20.000 hat der Kaiser in Marsch auf die Pyrenäen gesetzt. Sie werden die nächsten 20 Jahre kreuz und quer über die Halbinsel rennen müssen, um Bonny müde zu bekommen.“
Wellington zog die Augenbrauen hoch: „Priester, Sie enttäuschen mich! Sie müssen weiter denken! Diese verdammte Iberische Halbinsel ist doch nicht alles. Wir haben es mit Bonaparte zu tun, mit dem besten Feldherrn aller Zeiten. Glauben Sie etwa, der gibt sich unendlich lange mit mir und meiner Handvoll Rotröcken ab. Bonny hat Größeres vor, als ein stures, irisches Maultier ins Meer zurückzutreiben. Warten Sie! Spanien wird ihn schnell langweilen. Die Weiten Europas locken den Korsen doch viel mehr als dieser kleine, unwirtliche und von Guerilla verseuchte Südzipfel der Alten Welt. Rußland, Österreich-Ungarn, da kann er Beute machen und die Grenzen des Ruhms überschreiten. Er wird sich irgendwann an seiner eigenen Gier überfressen! Er hat doch schon lange jedes Maß verloren. Und in diesem Augenblick wird er sich daran erinnern, daß ein paar verlotterte Spanier und Portugiesen und eine Handvoll Briten hier sechs Marschälle und 300.000 Adler binden. Frankreich ist nicht unerschöpflich. Auch Bonny gehen irgendwann die Soldaten aus.” Langsam fing der Benediktiner an zu begreifen: „Das kann Jahre dauern, mein Sohn! Haben Sie das Rückgrat, so lange alleine gegen unsere eigene Regierung in Whitehall, eine bösartige Opposition im Unterhaus, geifernde britische Zeitungen und uneinsichtige Verbündete anzutreten?” Arthur hob die Augen zum Himmel und seufzte leise: „Das ist alles, was ich noch habe, Jack! Geduld, ein bißchen Hoffnung und den Mut der Verzweiflung.“
Kapitel 2 Libertad
Die Soldaten des britischen Feldheeres zogen sich langsam, aber stetig über die Grenze nach Portugal zurück. Lord Wellington und sein gesamter Stab waren in diesen Tagen vollauf damit beschäftigt, die Offiziere und die Männern der einzelnen Regimenter, soweit wie möglich bei der Bevölkerung ihres Verbündeten einzuquartieren, damit sie sich einige Wochen völlig von den Anstrengungen des Sommer-Feldzuges erholen konnten. Die Wälle von Torres Vedras machten trotz strengster Geheimhaltung gute Fortschritte im Bau.
Bereits am ersten Abend nach seiner Ankunft in Badajoz hatte Arthur Black Bob Craufurd in sein Hauptquartier beordert, um dem energischen Kommandeur der Leichten Brigade seine Rolle im neuen Vabanquespiel gegen die Adler zu erklären. Nur General Hill und Pater Robertson hatte er gestattet, während dieses Gespräches im Raum zu bleiben. Er erklärte Black Bob, daß die Leichte Brigade nun zu einer richtigen Division aufgestockt werden sollte, indem Craufurd sowohl portugiesische als auch britische Bataillone miteinander vereinigen würde, wobei er die Portugiesen britischen Offizieren unterstellen sollte. Don Antonio Maria Osario Cabral de Castros Partisanenregimenter waren die ersten Einheiten, die er auf diese Weise zu General Craufurd abkommandierte, um das 88. Regiment – die Connaught Rangers – als Aufklärer und Scharfschützen zu verstärken. Dazu kamen noch das 1. und das 3. Regiment der portugiesischen Caçadores. Damit verfügte Black Bob nun über insgesamt 4000 Mann.
Die Augen des Schotten leuchteten, als sein Oberkommandierender ihm diese Befehle erteilte. Arthur konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, obwohl er in diesem Augenblick zu General Craufurd nicht als Freund, sondern als Vorgesetzter sprach: „Sir, Sie verstehen, daß ich Ihnen hiermit in gewissem Sinne ein eigenständiges Kommando übertragen habe. Ich bitte Sie, mich nicht zu enttäuschen!” Craufurds neue Leichte Division sollte als einziger Kampfverband nicht ins Winterlager ziehen. Wellington unterstellte ihm noch zusätzlich Ross’ Batterie Feldartillerie und ein deutsches Kavallerieregiment der King’s German Legion. Die Soldaten bezogen Posten hinter dem Agueda, einem südlichen Nebenarm des Douro. Drei Brücken führten über diesen Fluß und er war an verschiedenen Stellen sogar zu Pferd oder zu Fuß furtbar, wenn er kein Hochwasser führte. Wellington hatte dank seines gut funktionierenden Nachrichtendienstes herausfinden können, daß die Flüsse auf der Iberischen Halbinsel eine Eigenart von erheblicher militärischer Bedeutung besaßen: Innerhalb nur weniger Stunden konnte ihr Wasserstand – ohne erkennbaren Grund – um mehrere Fuß steigen oder fallen. Insbesondere der Agueda war von diesem Phänomen betroffen und konnte es damit einem geschickten, französischen Angreifer gestatten, über Salamanca, Ciudad Rodrigo und Fuentes d’Onoro Portugal auch im Winter überraschend anzugreifen und den nördlichen Teil Portugals, die Beira, zu bedrohen. Robert Craufurd sollte diese Bedrohung durch die Präsenz seiner Leichten Division nicht nur vermindern, er sollte auch zusätzlich Informationen der spanischen Guerilla an der Grenze übernehmen und Späher zum Auskundschaften französischer Truppenbewegungen bei Niedrigwasser über den Agueda in die spanische Provinz Leon schicken. Seitdem es Don Antonio gelungen war, die gesamte Guerilla für die Sache der Alliierten zu gewinnen, hatten sie sich erheblich in Kampfkraft und Mobilität verbessert. Britische Waffen und eine Gruppe britischer Offiziere und Unteroffiziere als Ausbilder waren ihnen beigestellt worden. Da diese Mission nicht ungefährlich war – die Soldaten mußten ihre Uniformen und damit den Schutz der Gesetze des Krieges hinter sich lassen – hatte der bewährte Colquhoun Grant nur Freiwillige ausgewählt. Sollten diese Männer in französische Hände fallen, so waren sie des Todes. Doch ihr Wagemut wurde belohnt. Der Informationsfluß aus Spanien steigerte sich täglich. Französische Depeschen, die die Widerstandskämpfer abfingen, gelangten in kürzester Zeit nach Badajoz und in Wellingtons Hände. Er wußte nicht nur genau, wo die Franzosen standen, er kannte sogar die gesamte Gerüchteküche seiner Gegner und bald auch persönliche Schwächen und Unzulänglichkeiten der Marschälle Frankreichs, die er vielleicht, im richtigen Augenblick, zu seinen Gunsten nutzen konnte. Nur über die Pläne des Kaisers vermochte der Ire selbst auf diesem Weg nichts zu erfahren.
Kurz vor Weihnachten, nur Wellington, seine Adjutanten, ein paar Stabsoffiziere, Lady Lennox und Sergeant Dunn befanden sich noch in der Zitadelle von Badajoz auf der spanischen Seite der Grenze, kam ein überraschender Brief aus Navarra. Ein grobschlächtiger Bauer, mit wettergegerbtem Gesicht und knollig-roter Nase hatte sich raubeinig und in schlechtem Französisch den Weg ins Hauptquartier geebnet. Da Arthur nicht viel von Wachposten vor seiner Tür hielt, war der einzige Widerstand auf den der Mann stieß, der alte Sergeant Dunn. Doch noch bevor John reagieren konnte – er hielt ein Tablett mit Mittagessen und Kaffee in Händen –, hämmerte der sonderbare Kerl schon lautstark an die Tür von Wellingtons Arbeitszimmer.
„Kommen Sie rein, John! Sie brauchen die Tür nicht gleich einzuschlagen!” Arthur war nicht wenig erstaunt, als er in ein bärtiges, unbekanntes Gesicht blickte, daß anstelle seines alten Sergeanten ins Zimmer drängelte. Doch seit den ersten Tagen des Feldzuges auf der Iberischen Halbinsel und in Anbetracht seines multinationalen Feldheeres hatte er sich in solchen Fällen eine Frage angewöhnt, die ihm auch hier im Reflex entglitt: „Spanisch, Englisch oder Französisch?”
Der Bär begriff nicht so ganz, was der General nun eigentlich von ihm wissen wollte und bellte zurück: „Vasco!”
„Baskisch! Tut mir leid, das spricht hier leider niemand!” Der Ire blickte den Bärtigen entwaffnend an.
„Jefe! Er ist Baske! Versuche es doch einfach mal auf Französisch mit ihm!” Don Antonio schmunzelte, denn er hatte inzwischen den sonderbaren Besucher wiedererkannt. Er gehörte zur Truppe von El Minas, mit der er auf dem Pic Almanzor Bekanntschaft gemacht hatte. Arthur zuckte nur mit den Schultern und hob die Hände in einer sonderbar unbritischen Geste gen Himmel. Wenn er mit seinen Gedanken woanders war, dann konnte man ihn wunderbar überrumpeln. Dies hatte im Hauptquartier schon zu einigen Lacherfolgen geführt: „Bon, Monsieur! En quoi je peux Vous être utile?“
„J’ai une lettre d’El Minas! C’est toi, ce salaud d’aristocrate irlandais, qui botte les fesses des grenouilles?” Die Frage des Basken war unmöglich. In einem grauenvollen Patois hatte er sich bei Arthur erkundigt, ob er dieser widerwärtige, irische Aristokrat sei, der die Frösche ins verlängerte Rückgrat trat. Zumindest war dies die wohlerzogene Übersetzung eines Gentleman für das laute Gebell des bärtigen Wilden.
„C’est bien moi! Mais asseyez-vous donc, mon Ami et prenez d’abord une petite collation après vos efforts!”
„Quoi?” Der Baske hatte gerade eben kein Wort verstanden.
Jetzt bellte Wellington in an: „Pose tes fesse dans une chaise, Andouille et bouffe d’abord un truc. Tu veux du pinard?” Die drei Jahre in Angers hatten auch bei ihm Spuren hinterlassen. Wenn es sein mußte, dann konnte er sich problemlos auf das soziale Umfeld jedes Gesprächspartners einstellen. Ein zufriedenes Grinsen ging über das Gesicht des Bären. Er ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen: „B’en, b’en! Au moins, avec toi on peut causer normalement! Allons, fille moi le casse-croute et la niolle et je te raconte les Dernières de ton copain corse!”
Don Antonio verschluckte sich im Hintergrund vor lauter Lachen. Tränen liefen ihm aus den Augenwinkeln. Der Jefe und der Bär hatten sich in die tiefsten Abgründe der französischen Sprache begeben, so wie sie in den Kneipen, Häfen und finsteren Löchern zwischen Bordeaux und Toulouse praktiziert wurde. Der Portugiese hatte zwar schon vor einer ganzen Weile begriffen, daß der Ire Sinn für Humor hatte, aber bei dieser kleinen Unterhaltung eben, hatte sich der Oberkommandierende des anglo-alliierten Feldheeres selbst übertroffen.
„John, würden Sie bitte unserem verehrten Gast ein Mittagessen und Wein servieren!” Der Sergeant, der kein Wort Französische sprach hatte absolut nichts mitbekommen und die Pointe war ihm entgangen. Mit entrüstetem Gesicht knallte er das Tablett vor dem Basken auf den Tisch und verließ das Zimmer. Don Antonio hörte ihn gerade noch ein „Ungezogener Lümmel!” in den Bart murmeln. Der Bär zog sein Messer aus dem Gürtel und begann geräuschvoll zu mampfen. Beim Wein bemühte er sich erst gar nicht. Das Getränk gurgelte direkt aus der Flasche seine Kehle hinunter: „Ah, mon pote! C’est du bon, ça!” kommentierte er zustimmend den portugiesischen Rotwein aus Don Antonios eigenem Keller.
Arthur grinste immer noch. „Wenn der Wilde mit den Franzosen genauso umspringt, wie mit uns”, dachte er, „dann tut Bonny mir richtig leid!” Er schüttelte den Kopf: „Alors! Wo ist der Brief von El Minas?” Eine Hand von der Größe eines Tellers fuhr über einen riesigen, saucenverschmierten und von Haaren umwucherten Mund. Dann wurde sie fachgerecht und ordentlich an seinem nicht mehr so ganz sauberen, groben Leinenhemd abgewischt. Der Bär kramte ein fürchterlich zerknittertes Papier aus der Hosentasche hervor und drückte es dem Iren in die Hand: „Hätte ich beinahe vergessen, Kumpel! Aber ich bin geritten, wie der Teufel, weil der alte Minas gesagt hat, es wäre schrecklich wichtig! Übrigens, ich heiße Jose Etchegaray!”
Der General öffnete den Umschlag. Eine blutgetränkte, französische Depesche lag in El Minas’ Brief. Napoleon kündigte seinem Bruder Joseph an, daß er nicht vorhatte, nach Spanien zu kommen. Er wollte zuerst Prinzessin Marie-Louise von Habsburg, die Tochter des österreichischen Kaisers heiraten. Und dann mußte er endlich die Gründung einer Dynastie Bonaparte in Angriff nehmen. Seine Priorität war es, einen Thronfolger zu bekommen. Um den Krieg in Spanien und um die Briten sollte sich der bewährte Andre Massena, Marschall von Frankreich und Prinz von Esslingen kümmern. Wellington streckte die Depesche Don Antonio mit einem Seufzer der Erleichterung entgegen. Dann klopfte er dem Bären kräftig auf die Schulter: „Jose Etchegaray, du hast mir ein. wundervolles Weihnachtsgeschenk gemacht. Ich danke dir und El Minas von ganzem Herzen!”
„Schon gut, Kumpel. Der Alte meint, wer so verrückt ist, sich alleine mit 320.000 Franzosen herumzuschlagen, der kann kein schlechter Kerl sein. Ich werd ihm sagen, daß er sich in dir nicht getäuscht hat. Bist auch nicht überheblich mit dem einfachen Volk!”
„Was hat der Minas dir aufgetragen? Braucht er irgend etwas?”
„Ach ja! Der Alte läßt dir noch ausrichten, daß er mit deinem britischen Sergeanten sehr zufrieden ist! Bringt den Männern bei, ordentlich zu kämpfen! Aber wir haben jetzt mehr Leute und brauchen mehr Waffen!”
„Die bekommt er! Ich werde Anweisung geben, daß ein schneller Klipper an die Küste bei San Sebastian geschickt wird. Ich lasse deinen Chef wissen, wo und wann er anlanden wird!”
Der Wilde beendete zufrieden seine Mahlzeit und leerte den Rest Wein. Dann streckte er sich genüßlich: „So, Kumpel! Jetzt werde ich ein Nickerchen machen und dann verschwinde ich wieder in Richtung Navarra.” Wellington überlegte einen Augenblick. Er bedeutete Jose mitzukommen und führte ihn in ein Zimmer im zweiten Stock: „Schlaf dich ordentlich aus. Ich werde dir noch ein paar Briefe für El Minas und euren britischen Sergeanten mitgeben. Wie schnell kannst du wieder in Navarra sein?“
„Wird wohl zehn, zwölf Tage dauern, Kumpel. Ich hab nur ein altes Maultier!” Der General ließ den Basken ausruhen und verzog sich hinter seinen Schreibtisch. Wenn nur Massena nach Spanien geschickt wurde, dann konnte es sich durchaus lohnen, im Frühjahr bereits eine kleine Expedition über die Grenze zu wagen. Der Prinz von Esslingen hatte kein gutes Verhältnis zu Victor, Ney, Mortier und Soult. Gewiß würden die Marschälle sich mehr in den Haaren liegen, als an einen vernünftigen Kriegszug gegen die Briten zu denken. Trotzdem war es nicht auszuschließen, daß das Frühjahr 1810 eine französische Offensive gegen Portugal brachte. Dabei gab es zwei alternative Stoßrichtungen: Entweder durch die Estremadura hinter Badajoz gegen Lissabon, oder von Asturien aus gegen Oporto und die Beira. Arthur war recht zuversichtlich, daß seine Befestigungsarbeiten an den Wällen von Torres Vedras bis zur Schneeschmelze insoweit abgeschlossen sein würden, als daß Lissabon ausreichend geschützt wurde. Doch der Stoß über Asturien gegen die Beira machte ihm Sorgen, denn sollten zumindest zwei der französischen Marschälle zu einem gemeinsamen Plan finden, dann konnte er davon ausgehen, daß zumindest einer Ciudad Rodrigo belagern und nehmen würde und damit die zentrale Straße von Spanien nach Portugal in französische Hand fiel. Und wenn dann noch Ney durch die Tras-dos-Montes marschierte, wäre die Zangenbewegung gegen die Briten perfekt und Arthur würde sich mit dem Rücken zum Atlantik mit einer Übermacht schlagen müssen, wie John Moore im Jahre 1808 bei La Coruña. Der Brief nach Navarra bat aus diesem Grunde dringend um nachrichtendienstliche Aufklärung aller französischen Truppenbewegungen durch die kantabrischen Berge zwischen Pamplona im Osten und der spanischen Atlantikküste im Westen.
Als Jose Etchegaray am nächsten Morgen nach Navarra zurückreiten wollte, fand er zu seinem großen Erstaunen an Stelle seines alten Maultieres ein ordentliches Reitpferd im Stall. Don Antonio drückte ihm die Zügel des Tieres und eine Ledertasche mit Proviant und den Briefen für El Minas und den britischen Sergeanten Dullmore in die Hand: „Mit den besten Empfehlungen von ‚diesem widerwärtigen, irischen Aristokraten‘. Den Schimmel schenkt er dir! Und er bittet dich, wie der Teufel zu reiten. Eure Waffen werden in acht Tagen bei Irun angelandet werden. Der dänische Klipper heißt ‚Seagull‘, der Kapitän Björn Lundström! Viel Glück, Kumpel!”
„Wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten über die Franzosen gibt! Der Ire braucht sich keine Sorgen zu machen. Die Männer Navarras stehen auf eurer Seite. Schickt uns einen Kurier durch die Berge über Bilbao, wenn es irgendwo brennt. Jeden Abend um Punkt zehn Uhr ist ein Verbindungsmann von El Minas in der Bodega ‚Kiruri Jatetxea‘. Euer Mann soll sich an der Theke ein Glas Chivite und eine Portion Txangurro bestellen. Die stehen nicht auf der Speisekarte und der Wirt wird unseren Kontakt holen!”
„Wie bitte?“ Jose hatte Don Antonio ein paar baskische Worte an den Kopf geworfen, die nur aus Umlauten zu bestehen schienen.
„Tut mir leid, hab vergessen, daß hier keiner Euskera versteht! Also, Kiruri Jatetxea, das ist die einzige Kneipe am Ostufer der Nerbioi-Mündung, direkt am Hafen von Santurtzi. Der Besitzer heißt Guridi. Schreib besser mit! Und Txangurro ist überbackene Seespinne! Hast du’s?“
„Danke!” Don Antonio hatte sorgfältig jedes Wort mitgeschrieben. Egal wie viele Franzosen sich in dieser Kneipe aufhalten würden, Baskisch war besser als jeder Geheimcode. Etchegaray schwang sich in den Sattel des Schimmels und stob davon. Mit diesem Pferd würde er in weniger als einer Woche bei El Minas sein. Der britische General hatte ihn mit seiner Geste nicht wenig erstaunt. Der Andalusier, den er nun ritt, mußte mindestens 20 Pfund Sterling gekostet haben. Das waren fast zwei Jahre Sold eines britischen Soldaten.
Kurz vor dem Weihnachtstag schickte Wellington auch noch die Stabsoffiziere und seine Adjutanten aus Badajoz nach Portugal. Er versprach Don Antonio spätestens am Neujahrstag bei ihm in Coimbra zu sein. Da er seit dem Tag seiner Landung in Lissabon keine ruhige Minute mehr gehabt hatte, wollte er zumindest den Weihnachtstag friedlich und nur mit Sarah verbringen. Der Winter in der Estremadura war genauso beißend kalt, wie der Sommer glühend heiß. Doch die bewohnbaren Teile der Zitadelle verfügten über riesige Kamine und John Dunn sorgte dafür, daß alles gut beheizt und heimelig warm war. Bevor er auf den Markt ging, kochte er für Lady Lennox eine große Kanne Tee und stellte sie ihr mit einem Teller selbstgebackener Weihnachtsplätzchen in den Salon. Die junge Frau saß in einem großen Ohrensessel, eine Decke über den Knien und ein dickes Buch in Händen. Ihre letzten Patienten hatten vor ein paar Tagen Badajoz verlassen und waren nach Coimbra und in das Hospital von Belem bei Lissabon gebracht worden. Auch die letzten Verwundeten von Talavera konnten nun als gesund betrachtet werden und bedurften keines Arztes mehr. Sie genoß die Ruhe und den Frieden, die im Hauptquartier eingekehrt waren. John füllte ihr eine Porzellantasse mit Tee und ließ einen Löffel Honig darin zerfließen. Dann schenkte er sich selber ein: „So, mein Kind, jetzt wo wir unsere Ruhe haben! Was möchten Sie am Weihnachtsabend essen? Auf dem Markt gibt es wieder alles reichlich, seit die Franzosen und unsere Rotröcke aus der Gegend verschwunden sind.”
„Mh, wie wäre es mit einer leckeren Gans, gefüllt mit Äpfeln, Rosinen und Kastanien und mit einem schönen, großen Schokoladenkuchen zum Nachtisch?” Sarah knabberte zufrieden an einem Weihnachtsplätzchen und trank ihren Tee in kleinen Schlucken. „Haben Sie unseren Sepoy-General schon gefragt?“
Dunn winkte ab: „Das ist vergebene Liebesmüh, Lady Sarah! Solange sein Magen nicht knurrt, ist die Speisekarte kein Thema, für das ich ihn irgendwie begeistern kann. Außerdem finde ich ihn einfach nicht. Ich kann mir keinen Reim darauf mache, wo Sir Arthur sich herumtreibt. Kopenhagen steht auch nicht im Stall!”
„Wie er sich bei dieser Kälte nur freiwillig vor die Tür wagen kann, anstatt hier vor dem warmen Kamin zu faulenzen?” Die junge Frau schauderte schon bei dem Gedanken, in ein paar Tagen bereits durch die Alentejo-Berge nach Coimbra zu reiten. Sie malte sich lebhaft aus, wie sie eingehüllt in einen schweren Mantel durch hohen Schnee stapfen würde, mit blaugefrorenen Ohren und Eiszapfen an der Nasenspitze, während hinter jedem Stein ein ausgehungerter Wolf nur auf sein Mittagessen lauerte. Badajoz lag etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel, die Berge hinter der spanischen Grenze aber erhoben sich auf bis zu 1200 Meter Höhe.
Als John Dunn sich aufmachte, den Markt in der Altstadt von Badajoz zu besuchen und Sarah Lennox noch tiefer unter ihrer kuschelig warmen Decke verschwand, war Lord Wellington endlich am Ziel seiner kleinen Reise angelangt. Er hatte die Zitadelle in den frühen Morgenstunden noch vor Tagesanbruch verlassen und war durch die winterliche Kälte nach Jerez de los Caballeros in der Sierra Morena geritten. Diesem Ausflug war ein langer, geheimnisvoller Briefwechsel vorausgegangen, von dem weder der alte Dunn, noch Lady Lennox etwas mitbekommen hatten. In Jerez gab es einen bekannten Züchter lusitanischer Pferde, der mehrere Jungtiere mit edelster Abstammung zum Verkauf anbot. Arthur hatte sich schon seit Wochen überlegt, welches Weihnachtsgeschenk er Sarah machen sollte. Jedesmal, wenn er in den Stall des Hauptquartiers ging, um Kopenhagen zu satteln, betrachtete er mißmutig das Pferd der jungen Frau. Die grobknochige, dunkelbraune Stute hätte jedem Kutschergaul in Kildare Ehre gemacht. Sie war bestenfalls zur Zucht geeignet, aber nicht als sicheres, leichtfüßiges Reittier für einen Feldzug. Er hatte eine Weile nachgedacht, ob er ihr nicht seinen dunkelbraunen Elmore schenken sollte, doch diesen Gedanken verwarf er bald. Seine Pferde waren für den Krieg ausgebildet worden und gemeingefährlich. Manchmal wurde selbst ihm angst und bange, wenn der eine oder der andere der beiden Hengste einen Anfall schlechter Laune hatte. Auch ein kräftiger und erfahrener Reiter konnte diese Tiere nur mit Mühe zur Raison bringen.
Der Ritt durch diese von herber Kargheit und Einsamkeit geprägte Landschaft wurde von Zeit zu Zeit durchbrochen von mittelalterlichen Burgen und Überresten antiker Siedlungen, die in der Provinz Lusitania noch zahlreich vorhanden waren. Die Zeit schien an diesen Orten spurlos vorübergegangen zu sein. Antike Stadtmauern und Adelspaläste hatten die Jahrhunderte und viele Kriege und Raubzüge fast unbeschadet überstanden. Die grüne Gebirgs- und sanfte Hügellandschaft durch die er ritt, war die Heimat seltener Tiere und Pflanzen. Immer wieder durchquerte Arthur weitläufige Waldgebiete. Manchmal sah er in der Ferne stahlblau die klaren Wasser eines Bergsees leuchten. Trotz des Winters nisteten noch viele Störche in diesem Teil der Estremadura. Diese Gegend besaß einen ruhigen, unaufdringlichen Charme, der den Iren magisch anzog. Doch gleichzeitig erschütterte ihn die bittere Armut, die er immer wieder in den Dörfern sah, durch die sein Weg ihn führte und die nicht nur eine Folge der französischen Raubzüge war.
Der Criador de Cavallos, Don Fernando Cabrrera de Ortiz besaß eine der besten Pferdezuchten ganz Spaniens. Seine Hazienda erstreckte sich über mehr als 800 Hektar zwischen der Stadt Jerez de los Caballeros selbst und Frenegal de la Sierra. Die Silhouette der drei Barocktürme der Stadt lag schon weit hinter dem General. Jerez selbst zählte zu den malerischsten Flecken der Estremadura. Ganze Stadtteile aus dem Mittelalter und der Renaissance waren noch vollständig erhalten und er hatte hier eine kleine Pause eingelegt um die Torre Sangriente, eine Burg aus dem frühen Mittelalter zu betrachten. Die drei Kirchen San Bartolome, San Miguel und San Maria de la Encarnaçion waren ebensoprächtige Bauwerke. Außerdem hatte der Entdecker des Pazifiks, Vasco Nuñez de Balboa in Jerez de los Caballeros das Licht der Welt erblickt und schon um ihrer historischen Bedeutung Willen hatte sich dieser Besuch gelohnt. Von der Estremadura aus eroberten viele Konquistadoren die Neue Welt und das Gold, das sie zurückgebracht hatten, war reichlich in die prachtvollen, kirchlichen Institutionen geflossen. Doch die Franzosen hatten während ihrer Besetzung dieser Provinz, jenseits des Duoro viele dieser Schätze geraubt und man konnte auch in Jerez deutlich die Spuren der Zerstörung erkennen. Nun ritt Wellington schon seit fast einer Stunde an sorgsam eingezäunten Weiden vorbei, auf denen friedliche Mutterstuten mit ihren Jährlingen grasten. Auch im Winter war die Sierra Morena durch die Bergfront im Westen gut vor den Stürmen und der Kälte der Atlantikwinde geschützt und bekam durch den Golfstrom bei Cadiz mildes Wetter zugetragen. Das Gras war satt und grün. Kopenhagen spitzte die Ohren und wieherte immer wieder schrill zu den Weiden hinüber. Er war gespannt, wie ein Bogen und tänzelte erregt unter dem Sattel. Immer wieder schlug er wütend nach Hinten aus. Die Hunderte von Stuten, die unerreichbar hinter hohen Zäunen standen, machten den jungen Hengst völlig verrückt. Sein Reiter bändigte ihn nur noch mit äußerster Anstrengung und dank einer scharfen Kandare. Am Horizont tauchten zu Arthurs Erleichterung endlich die Wohngebäude der Hazienda auf. Don Fernando hatte seinen Gast erwartet. Der Ire war trotz des weiten Rittes pünktlich in Jerez angekommen. Ein Bediensteter wollte ihm Kopenhagen abnehmen, doch der General schüttelte ablehnend den Kopf: „Tenga cuidado! Este caballo tiene sangre muy caliente!” Er mußte den mächtigen, muskulösen Hengst erst einige Male grob an den Zügeln reißen bevor er aufhörte zu steigen und mit den Vorderbeinen um sich zu schlagen. Don Fernando pfiff bewundernd durch die Zähne: „Por Dios! Tiene rabia! Überlassen Sie mir Ihren Hengst, Mylord und Sie können sich 25 meiner Pferde aussuchen!” Arthur streckte dem Spanier die Hand zum Gruß entgegen: „Tut mir leid, Don Fernando! Kopenhagen ist unverkäuflich! Haben Sie eine freie Koppel, von der aus er nicht zu Ihren Prachtstücken ausrücken kann?” Der Spanier lachte schallend: „Amigo, es wäre eine Sünde, den Fuchs alleine auf eine Koppel zu sperren. Lassen Sie ihn zu meinen Stuten, wenn Sie ihn schon nicht verkaufen möchten. Damit entschädigen Sie mich vielleicht in elf Monaten für das Prachtexemplar, das Sie heute aus meinen Ställen entführen möchten!”
„Von mir aus! Dann beruhigt er sich wenigstens wieder!” Als ob er die Einladung des Spaniers verstanden hätte, zerrte Kopenhagen seinen Herrn bis an das große Tor der ersten Koppel. Arthur löste ihm mit äußerster Mühe den Sattelgurt. Immer wieder mußte er den Hufen seines Pferdes ausweichen. „Verdammt, du Teufelsbraten, halt eine Minute still, dann laß ich dich zu den Mädchen!” Ein grober Ruck an den Zügeln holte den Hengst wieder auf den Boden zurück. Es gelang dem General gerade noch, seinem Pferd das Zaumzeug vom Kopf zu ziehen und aus dem Weg zu gehen, als der Fuchs ansetzte, aus dem Stand über das Tor zu springen und wie ein Wilder in die Stutenherde hinein stob. Er wieherte schrill und triumphierend. Die Mädchen waren von diesem raubeinigen irischen Flegel im ersten Augenblick nicht sonderlich begeistert. Mehrere Hinterhufe flogen in seine Richtung durch die Luft, was den Sportsgeist des Vollblüters erst richtig weckte. Er wölbte stolz seinen Hals und trabte mit aufgeblähten Nüstern zu einer der jungen Damen hin, um aufgeregt vor ihr herumzutänzeln und seinen ganzen Charme spielen zu lassen. Das Stütchen schien leidlich beeindruckt und wich nur wenig vor dem irischen Flegel zurück. Ihre Ohren spitzte sie aufmerksam. Wellington schüttelte belustigt den Kopf und klopfte sich den Staub aus der Kleidung. Zumindest würde sich sein Hengst auf dem Rückweg friedlicher benehmen als auf dem Hinweg. Auf der großen Koppel standen mehr als 50 Stuten zur Auswahl. Eine würde sein Ungeheuer sicher überreden können ...
Don Fernando legte seinem Gast zufrieden die Hand auf die Schulter und führte ihn ins Haus: „Puro sangre bien puesto! Se ve, que tiene excelente linea! Ein prächtiges Tier. Wer hat ihn gezüchtet?“
„Eigene Zucht! Sein Vater ist ‚Eochaid‘ ein goldfarbener turkmenischer Hengst, den ich aus Indien mitgebracht habe, seine Mutter ‚Lady Catherine‘, die von Godolphin Arabian abstammt! Damit ist der Fuchs auch ein Urenkel von ‚Eclipse’, dem berühmtesten Rennpferd meines Landes. Obwohl ich nicht Buch führe über meine Tiere! Ich züchte sie eigentlich nur für mich selbst! Hauptsache sie sind zäh, ausdauernd, furchtlos und aggressiv! Sie müssen für den Krieg taugen!”
Die beiden Männer ließen sich in zwei bequemen Sesseln am Rande einer Reitbahn nieder. Eine Frau in spanischer Landestracht bot ihnen Kaffee an. Don Fernando wies seinen Capataz an, die zum Verkauf stehenden Pferde zu bringen. Der Ire hob bewundernd die Augenbrauen. Eines war schöner als das andere, mit langen, lockigen Mähnen, feinen Köpfen, die an ihre arabischen Vorfahren erinnerten, leicht und trotzdem stabil gebaut. Er stellte seine Tasse auf den Tisch und ging von Pferd zu Pferd, betastete die Beine, hob die Hufe, sah ihr Gebiß prüfend an.
„Sie sind alle gesund, Mylord! Sie werden keinen Unterschied feststellen! Es ist eigentlich nur Geschmackssache, ob Sie einen Schimmel, einen Grauen oder einen Rappen möchten!”
Wellington ging vor den Tieren auf und ab. Sie waren erstaunlich ruhig und ihm als Fremdem gegenüber zutraulich und freundlich. Er entschied sich für einen großen, dunkelgrauen Wallach und zwei etwas hellere Stuten. Don Fernando bat seinen Capataz, die Tiere zu satteln. Dann führte der spanische Stallmeister jedes der Tiere unter dem Sattel vor. Sie beherrschten alle drei die Hohe Schule und verfügten über beeindruckende Gänge. Die Tiere bewegten sich mit einer tänzerischen Leichtigkeit.
„Kann ich die Pferde ausprobieren?“
Don Fernando wies mit der Hand zur Reitbahn: „Bitte, Mylord!”
Im ersten Augenblick war der spanische Sattel für den Iren ungewohnt, die Steigbügel kürzer als bei britischen Kavalleriesätteln, klemmten ihn vorne ein dickes Schaffell und hinten eine hohe Rückenlehne auf dem großen Grauen fest. Es dauerte zehn Minuten, bis Arthur herausgefunden hatte, wie spanische Pferde geritten werden mußten, doch der Lusitano machte seinem Reiter das Leben nicht schwer. Er war brav und fügsam. Alle Hilfen waren feiner und leichter, als die in England üblichen, den französischen nicht unähnlich. Es war einfach, die Lusitanos zu versammeln, sie waren wendig und gehorchten auch leisen Gewichts- und Schenkelhilfen. Der Doppelzaum, den die Tiere trugen war noch schärfer als Kopenhagens Kandare. Auch eine Frau würde in der Lage sein, ein solches Pferd ohne Probleme zu beherrschen. Der Ire probierte ebenfalls noch die beiden Stuten aus, doch mehr aus Freude an der Leichtigkeit der Tiere als aus wirklichem Interesse. Der große graue Wallach würde ein perfektes Pferd für seine Sarah sein. Und er war bildschön!
„Nun, Mylord?“