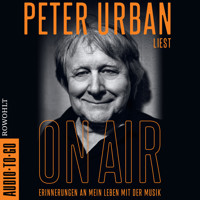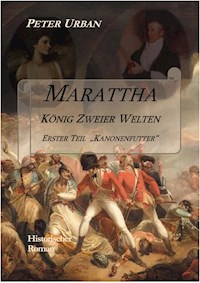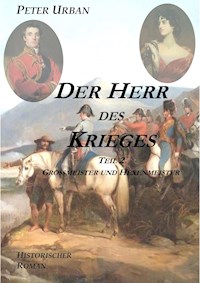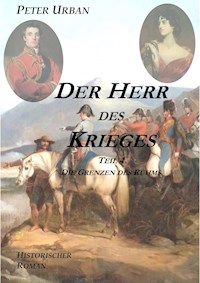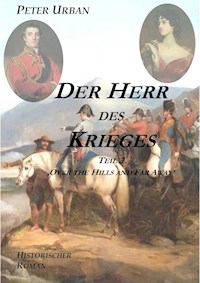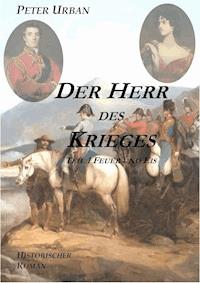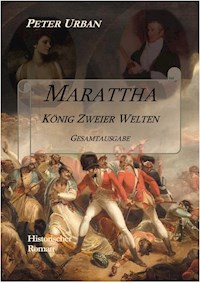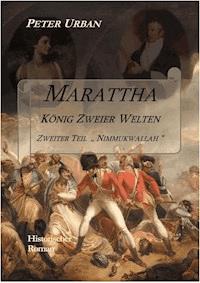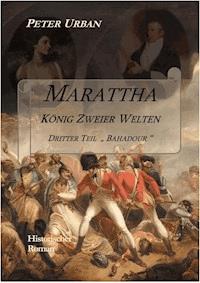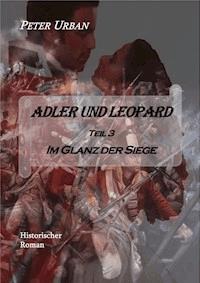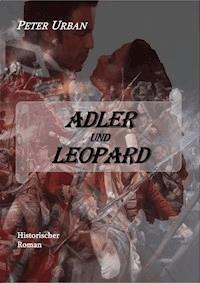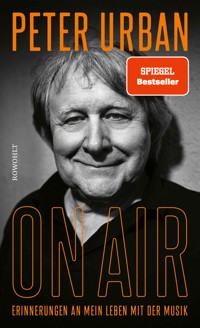
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrzehnten prägt Peter Urban die deutsche Radiolandschaft – als legendär trockener Kommentator des Eurovision Song Contests, als Moderator verschiedener Musiksendungen, inzwischen auch als Podcaster. Offen und unprätentiös beobachtet er seit fast 50 Jahren als Popexperte die nationale und internationale Musikszene und hat in seiner langen Laufbahn unzählige Popgrößen getroffen, interviewt und porträtiert – von Keith Richards über Yoko Ono zu David Bowie, Elton John, Joni Mitchell, Harry Belafonte und Eric Clapton. Mit diesem Buch legt er nun seine Memoiren vor, den Soundtrack eines Lebens, das beruflich wie privat immer von der Musik geprägt war. Die Reise beginnt in den 1950er Jahren in Niedersachsen, wo sich die Familie Urban nach der Flucht aus dem Sudetenland eine neue Heimat aufbaut. Schon früh kommt Peter Urban im Familienorchester «Urbani» mit Musik in Kontakt, doch seine Leidenschaft ist nicht die Klassik, sondern die neue Musik von der Insel. In den 1960er Jahren beginnt die andauernde Liebesbeziehung zu England, seine andere große Liebe ist der HSV, wo er zeitweilig auch Stadionsprecher ist. Seine Lust an neuen Stilformen ist später der Schlüssel zum großen Erfolg seiner Musiksendungen. Dieses Buch erzählt von einem bewegten Leben und ist zugleich ein Stück internationale Musikgeschichte made in Hamburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Urban
On Air
Erinnerungen an mein Leben mit der Musik
Über dieses Buch
Seit Jahrzehnten prägt Peter Urban die deutsche Radiolandschaft – als legendär trockener Kommentator des Eurovision Song Contests, als Moderator verschiedener Musiksendungen, inzwischen auch als Podcaster. Offen und unprätentiös beobachtet er seit fast 50 Jahren als Pop-Experte die nationale und internationale Musikszene und hat in seiner langen Laufbahn unzählige Pop-Größen getroffen, interviewt und porträtiert – von Keith Richards über Yoko Ono zu David Bowie, Elton John, Joni Mitchell, Harry Belafonte und Eric Clapton. Mit diesem Buch legt er nun seine Memoiren vor, den Soundtrack eines Lebens, das beruflich wie privat immer von der Musik geprägt war.
Die Reise beginnt in den 1950er-Jahren in Niedersachsen, wo sich die Familie Urban nach der Flucht aus dem Sudetenland eine neue Heimat aufbaut. Schon früh kommt Peter Urban im Familienorchester «Urbani» mit Musik in Kontakt, doch seine Leidenschaft ist nicht die Klassik, sondern die neue Musik von der Insel. In den 1960er-Jahren beginnt die andauernde Liebesbeziehung zu England, seine andere große Liebe ist der HSV, wo er zeitweilig auch Stadionsprecher ist. Seine Lust an neuen Stilformen ist später der Schlüssel zum großen Erfolg seiner Musiksendungen. Dieses Buch erzählt von einem bewegten Leben und ist zugleich ein Stück internationale Musikgeschichte made in Hamburg.
«12 Points an den ersten DJ des NDR! Peters bisheriges Leben, wie ihr seht, war knallevoll mit tollsten Musikabenteuern, von Quakenbrück bis Nashville, von Memphis bis nach Eppendorf, Onkel Pö, einmal Wahnsinn und zurück. Und so viele von uns hast du, lieber Peter, mit deinen Radio- und Fernsehshows begleitet und uns den Blues und Rock’n’Roll nahegebracht und verständlicher gemacht. Das konntest du, weil du diese Musik und dieses Lebensgefühl studiert und gelebt hast, ja, auch als Dr. Schnellfinger an den Keyboards in einigen genialen Bands, als höchster Rock-’n’-Roll-Studien- und Geheimrat, immer schön den Kopf durch die Wolken und die Füße fest auf dem Boden (und im Sumpf) der Underground-Clubs. Jetzt bist du mitten in deinen wilden Siebzigern, und das große Rock-’n’-Roll-Abenteuer und die fantastische Action-Achterbahn mögen nie aufhören! Dein Udo vom Club der Hundertjährigen!»
Udo Lindenberg
«Peter has such a deep and insightful understanding of a wide range of music, we forged a great connection from our first interview. Being a talented musician himself, he brings an insider’s view to so many legendary artists he’s befriended and interviewed over his many years as a top radio host. I’m so glad he’s written this fascinating book about his life and the music he loves.
Peter hat ein solch tiefes und einfühlsames Verständnis für ein breites Spektrum von Musik, dass wir von unserem ersten Interview an eine großartige Verbindung geknüpft haben. Als talentierter Musiker wirft er den Blick eines Insiders auf viele legendäre Künstler, denen er freundschaftlich verbunden ist und mit denen er in seinen vielen Jahren als bekannter Radiomoderator gesprochen hat. Ich freue mich sehr darüber, dass er dieses faszinierende Buch über sein Leben und über die Musik, die er liebt, geschrieben hat.»
Bonnie Raitt, 15-fache Grammy-Gewinnerin
«Urbans Betrachtungen sind Musik. Er ist der Meister des Dialogs, der sich permanent freischaufelt auf dem Weg zu Himmel, Hölle, Punk und Klang.»
Dieter Meier (Yello)
Vita
Peter Urban, 1948 in Bramsche geboren, begann seine Karriere beim NDR in den frühen 70er-Jahren mit der Sendung «Musik für junge Leute». 1977 erschien seine Dissertation über Songtexte aus der angloamerikanischen Popmusik. Seit 2003 war er Redakteur für das Format «Nachtclub», seit 1997 moderiert er den Eurovision Song Contest. Er ist heute immer noch mit «Die Peter Urban Show» für den NDR tätig, seit Januar 2021 moderiert er einen Podcast mit dem Titel «Urban Pop».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Jan Northoff
ISBN 978-3-644-01326-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für meine Familie
In Erinnerung an ...
Vorspiel: A splendid time is guaranteed for all!
1 Son of a Teacher Man
2 Schuld war nur der Bossa Nova
3 Ticket to ride
4 London Calling: die Dreifaltigkeit, der neue Messias und das Walross
5 Something In The Air
6 Baked Beans in Berkshire
7 Von der Gasoline Alley zur Rothenbaumchaussee
8 Hinter der roten Tür
9 Talking Blues
10 Ladies, Dukes & Princes
11 Schatten und Licht
12 Mandela und mehr
13 Euro Games
14 Satellit über Oslo
15 Europhoria
Nachspiel - Urban Pop
Im Andenken an:
Mein ganz besonderer ...
Bildnachweise
Tafelteil
Für meine Familie
In Erinnerung an Klaus Wellershaus (1938–2016)
Vorspiel: A splendid time is guaranteed for all!
Ganz Quakenbrück war in Aufregung, es war der 4. November 1961. Der Norddeutsche Rundfunk war mit einem riesigen Übertragungswagen angerückt, der die halbe Burgstraße neben der St. Marienkirche blockierte. Am Sonntag sollte aus unserer Kirche die Messe in Zigtausende nordwestdeutscher Haushalte übertragen werden. Techniker verlegten endlos lange Kabel, stellten Mikrofone auf, die am Samstagnachmittag bei einer Generalprobe getestet wurden. Ich war dreizehn und als Messdiener involviert. Wer schon einmal eine katholische Messe erlebt hat, weiß, dass da immer wieder Handglocken geläutet werden müssen; diese ehrenvolle Aufgabe war mir zugeteilt geworden. Ich verfolgte die Operation des NDR genauestens, war vom technischen und personellen Aufwand schwer beeindruckt, denn selbst die Ansagerin war mit nach Quakenbrück gekommen, um in einem provisorischen Studio im Führerhaus des Lkw ihren Job zu machen. Ich fragte mich, ob man sie nicht auch aus Hannover oder Hamburg hätte zuschalten können, aber nein, der NDR war buchstäblich live vor Ort. So beobachtete ich von draußen durch die Scheibe, wie die Dame um 18.55 Uhr anhob und etwa Folgendes gesagt haben muss, ich konnte sie ja nicht hören: «Hier ist der Norddeutsche Rundfunk, Glocken und Chor, Sie hören die Glocken der St. Marienkirche in Quakenbrück, danach singt der Kirchenchor St. Marien unter der Leitung von Franz Milleg ‹Lobt Gott mit Schall, ihr Heiden all›», so etwas wie der «Trailer» für die Übertragung am Sonntag.
Am Sonntagmorgen gespannte Stimmung in der Sakristei, selbst der sonst so souveräne Kaplan scheint nervös zu sein, er soll die Lesung vortragen. Punkt 9.45 Uhr ertönt die Orgel, das Vorspiel. Wir marschieren ein, vier Messdiener in weiß-roten Gewändern, drei Priester. Plötzlich stürmt ein NDR-Techniker hinter uns her, murmelt etwas wie «es pfeift bei uns» und überprüft die Mikrofone. Neugierig, wie ich bin, drehe ich den Kopf und sehe einen zweiten hektisch agierenden Techniker auf dem Orgelboden, bald darauf ziehen sie sich zurück, wir sind beim Gloria. Später erfahre ich den Grund für das Pfeifen, der clevere Organist hatte sich ein kleines Transistorradio mitgebracht, um den Gottesdienst besser verfolgen zu können. Das strahlte direkt in die Mikrofone des Chors und sorgte im Ü-Wagen für eine pfeifende Rückkopplung, meine erste Begegnung mit Feedback. Ab da läuft die Übertragung problemlos, ich schüttle die Handglocken mit einer solchen Kraft und Inbrunst wie nie zuvor, mein erster Auftritt im Radio war gerettet.
Es sollten noch einige mehr folgen, wie viele, ist nicht ganz exakt festzustellen, aber grob überschlagen sind es bis heute über viertausend Sendungen in fast fünfzig Jahren, einige Pannen waren auch dabei, dazu TV-Auftritte und Podcasts. Darin ging und geht es um Musik, wie sich Popmusik in den vergangenen sechzig Jahren entfaltet hat zu einem breiten internationalen und interkulturellen Strom aus vielen verwandten und verschiedenen Quellen, Stilen, Ausdrucksformen und Innovationen. Aber keine Sorge, ich erfinde auf den folgenden Seiten nicht die Geschichte der Popmusik neu. Ich erzähle vielmehr meine persönlichen Erfahrungen mit Musik, von meinen ersten Berührungen als Kind und als junger Musiker, meinen zahlreichen Reisen nach London, auf denen ich wegweisende Entwicklungen und wichtige Ereignisse der aufblühenden Popszene erleben konnte, wie den ersten Auftritt von Jimi Hendrix. Ich erinnere mich an die turbulente Phase der 68er und an die persönlichen und musikalischen Begegnungen eines langen Englandaufenthalts als Student. Natürlich hatten meine frühen Erlebnisse auch mit Fanverehrung zu tun – aber da war mehr: Rockmusik hatte etwas Befreiendes, war ein krasser Gegensatz zur Musik und Kultur der Eltern, es war Musik, die Beat und Groove, Bauch und Seele hatte, aus der Musik der Schwarzen Amerikas hervorgegangen, gemacht von Musikern, die anders aussahen, ein anderes Lebensgefühl beschworen. Heute ist das oft schwer nachzuvollziehen, heute ist Rock Mainstream, Massenkultur, da gehen Opa, Vater und Sohn gemeinsam zu den Stones oder Mutter und Tochter zu Harry Styles. Aber zu fast jeder Zeit, auch heute, gab und gibt es aufrüttelnde rebellische Musik, Folkrock, psychedelische Sounds, Punk, Ska, Reggae, Hip-Hop und Rap, Hardrock oder Metal in allen Varianten. Jede Generation hat eigene Helden, auch wenn der große einschneidende Durchbruch von Rock und Popkultur in den 60ern stattfand.
Wie bin ich aber dann zum Journalismus, zu Radio und Fernsehen gekommen, dahin, meine Interessen, Erkenntnisse und Vorlieben mit anderen teilen zu können? In meiner Geschichte haben einige wichtige Zufälle große Rollen gespielt, negative wie positive, aber eines hilft auch bei Zufällen immer, nämlich Engagement, Leidenschaft, Optimismus. Der Zufall, in Hamburg zu studieren, verschaffte mir nicht nur den Kontakt zum NDR, sondern auch eine höchst intensive Zeit als Musiker, die rund um einen der berühmtesten Musikclubs des Landes kreiste, das schwarze Ecklokal mit der roten Tür namens Onkel Pö. Davon berichte ich, genauso wie von meiner Rolle bei den Übertragungen epochaler Konzertereignisse wie Live Aid und des Konzerts zu Nelson Mandelas siebzigstem Geburtstag und von meinen vielen Treffen und Gesprächen mit einigen der bedeutendsten Persönlichkeiten der Popgeschichte. Bruce Springsteen, Joni Mitchell, Paul Simon, Elton John, Harry Belafonte, Yoko Ono, Bob Marley, David Bowie, Bonnie Raitt oder Eric Clapton – sie alle haben deshalb hier einen Auftritt. Über fünfzigtausend Songs habe ich in meinen Sendungen gespielt, gut zweitausend Konzerte besucht, nicht wenige kommen auch in diesem Buch vor, daher empfiehlt es sich, durch einen Gang zum Platten- oder CD-Regal, oder mit der Hilfe eines Streaming-Dienstes und des Internets, die Lektüre zu einem zusätzlichen Hörerlebnis werden zu lassen.
Natürlich möchte ich auch erzählen vom Eurovision Song Contest, den ich seit 1997 im Deutschen Fernsehen kommentiere – Geschichten, Gedanken und Höhepunkte, die zeigen, wie stark der oft als skurriler Liederwettbewerb verschriene ESC an Bedeutung, Aktualität, Vielfalt und Qualität gewonnen hat. Ursprünglich 1956 als völkerverbindende Maßnahme begründet, damit sich die früher verfeindeten Nationen Europas auch auf dem Gebiet der musikalischen Unterhaltung näherkamen, wurde der ESC oder Grand Prix zum größten Fernsehmusikereignis der Welt, mit über 200 Millionen Zuschauern in über vierzig Ländern. Er kann auch in politisch schwierigen Zeiten immer noch ein wunderbares Beispiel für internationale Verständigung sein, bei Künstlern, Funktionären, Fans und exemplarisch auch unter meinen Kollegen, den Kommentatoren.
Wie man sieht, geht es in ON AIR um eine breite, bunte Palette von Musik und um die persönlichen Geschichten, die sie umgeben – und vielleicht geht ja beim Lesen John Lennons Versprechen aus «Being for the Benefit of Mr. Kite!» in Erfüllung …
A splendid time is guaranteed for all!
1Son of a Teacher Man
Ein kühler grauer Nachmittag im Dezember 1954, ich bin sechs. Meine Eltern stapfen mit mir durch den Schneeregen zum Saal Sanders in der Otterbreite. Dort will die katholische Volksschule ein Weihnachtsmärchen aufführen, mein erster öffentlicher Auftritt steht bevor, passenderweise als Peterchen, der mit Schwester Anneliese und Maikäfer Herrn Sumsemann zum Mond fliegt, um dessen sechstes Bein zu finden. Hinter der Bühne lebhaftes Gegacker wie auf dem Hühnerhof, dazu heilloses Durcheinander. Jeder will sein Kostüm vorführen, das hilfsbereite Sandmännchen, die freundliche Nachtfee, der grimmige Mondmann, die hibbeligen Sternchen. Die bemalten Pappkulissen stehen bereit, das Kinderzimmer, die Mondrakete, die Milchstraße, die Weihnachtswiese. Ich werfe von der Seite einen Blick in den gefüllten Saal. Die Lichter verlöschen, meine Lehrerin schiebt mich sacht in die Mitte der dunklen Bühne, von dort soll ich das Eröffnungslied singen. Ich stehe ganz nah am geschlossenen Vorhang, er riecht alt und muffig, ich muss husten. Dann wird er weggezogen, das Scheinwerferlicht blendet brutal, ich kann nichts sehen, bin starr vor Schreck, wie hypnotisiert. Ein sanft gezischtes «Los, Peter» weckt mich auf, dann höre ich meine zittrige Stimme singen: «Leise, Peterchen leise, der Mond geht auf die Reise …»
Willkommen zu Peterchens Mondfahrt.
Die Gartenstraße machte ihrem Namen alle Ehre, hübsche, großzügige Einzelhäuser aus dunkelrotem Klinker thronten unter alten hohen Bäumen inmitten grüner Gärten. Kurz vor ihrem Ende lag ein größeres lang gestrecktes Backsteingebäude, die katholische Volksschule, deren Leiter mein Vater war. Wir wohnten in der Lehrerwohnung im Obergeschoss der Schule, wir, das waren Mutter Anni, Vater Karl und mein vier Jahre ältere Bruder Klaus. Mein Schulweg war der kürzeste der Stadt, aus der Wohnungstür die Treppe hinunter auf den Flur direkt in die Klasse. Meine erste Lehrerin, Fräulein Wienert, schrieb mir später, dass sie als junge Anfängerin Angst gehabt hatte, den Sohn des Schulleiters zu unterrichten, dabei war die Situation für mich genauso unangenehm, ich musste den Eindruck widerlegen, dass ich bevorzugt wurde, was nie der Fall war, und hatte das ständige Gefühl, besonders korrekt und brav sein zu müssen, weil man das vom Sohn des Chefs eben erwartete. In den Zeugnissen tauchte ständig die Bemerkung «zu still, sollte sich mehr beteiligen» auf, und das meine gesamte Schulzeit über bis zum Abitur. So still fand ich mich gar nicht, ich verlegte meine Aktivitäten nur lieber in die Pausen und in den Nachmittag. Kaum aus der Schule, flitzte ich durch den riesigen Garten, versteckte mich auf Bäumen und unter Rhododendronbüschen, tobte durch mein eigenes Paradies. Mein Erkundungsdrang endete nicht am Schulzaun, mit Nachbarkindern ging es über Leitern und Baugerüste auf das Dach des nahen Getreidespeichers am Bahndamm, über ein offenes Fenster hinein in unsere eigene Geheimwelt zwischen Säcken voller Roggen- und Weizenkörnern, wir waren nicht mal zehn.
Die Musik schlich sich konventionell in mein Leben. Bei uns zu Hause fiedelte es kräftig, mein Bruder übte an Violine und Gitarre, auch mein Vater holte ab und zu seine alte Geige aus dem abgewetzten Koffer. Ich wurde zur Blockflöte abgeordnet, fing eher widerwillig damit an. Nach und nach kamen aber Töne aus dem schmalen Gerät, die nicht mehr piepsig, sondern schön und zart klangen, wenn man den Luftdruck nicht zu hart einsetzte. Es ließen sich überraschend schnell und einfach Melodien finden oder diese vom Notenblatt abspielen. Blockflöte machte mir tatsächlich Spaß, und so wurde ich in das Familienensemble aufgenommen. Musik eigenhändig zu spielen, gehörte zu unseren Ritualen, besonders am Weihnachtsfest, das katholisch, traditionell und sentimental inszeniert wurde, mit Geheimniskrämerei, Versteckspiel und sich steigernder Aufregung. Schon Tage vorher durfte das Wohnzimmer nicht betreten werden, bis endlich an Heiligabend das Glöckchen klingelte. Natürlich hatte das Christkind die Geschenke abgeliefert, nicht der unchristliche Weihnachtsmann, wie es im überwiegend protestantischen Niedersachsen üblich war. Die Lichter und Kerzen brannten, die Vanillekipferln und Haselnussmakronen dufteten. Vor der Bescherung musste gesungen und musiziert werden, Mutter führte am Klavier, die beiden Streicher kratzten mehr oder weniger gekonnt auf ihren Saiten, ich blies die Flöte. Ich liebte den glitzernden «Weihnachtszauber», auch nachdem mir klar wurde, welches Theaterstück da aufgeführt wurde. Ich spürte einen beinahe spirituellen Hauch von Geborgenheit, Wärme, Harmonie und Freude, der natürlich umso stärker blies, wenn der materielle Segen besonders üppig ausfiel und die neueste Märklin-Lok unter dem Baum haltgemacht hatte.
Nicht nur zur Weihnachtszeit trat unser Familienorchester in Aktion, auch wichtige Familienfeiern wie der 85. Geburtstag von Opa Korschil wurden von einer Darbietung des «Urbani-Orchesters» gekrönt. Dabei hätte unser Ensemble eigentlich ganz anders heißen müssen. Mein Großvater trug den tschechischen Namen «Koril», für den er in der sudetendeutschen Heimat unserer Familie die deutsche Schreibweise «Korschil» verwandt hatte. Sein Sohn Karl war zwar das jüngste Kind, aber im Gegensatz zu seinen Schwestern durfte er seine Schulzeit verlängern und tat das an einer «Lehrer-Bildungsanstalt» in Brünn, der Hauptstadt Mährens. Drei Jahre später, mit neunzehn, war Karl Korschil Junglehrer an einer Dorfschule. Kurz vor der Annexion des Sudetenlandes 1938 durch Hitler-Deutschland nahmen er und seine Schwestern Anni und Paula offiziell den Mädchennamen ihrer deutschstämmigen Mutter an, sicherlich auch, um sich rechtzeitig den politischen Veränderungen anzupassen: aus Karl Korschil wurde Karl Urban. Im August 1939 zog ihn die Wehrmacht ein, gleich nach Kriegsbeginn wurde er in Polen verwundet und entging so dem späteren Schicksal seiner Garnison beim desaströsen Angriff auf Russland. Als Kinder erfuhren wir von ihm wenig über den Krieg und die Nazis, wir fragten auch nicht oft und selten intensiv.
Für meine Mutter Anni war als Tochter einer Arbeiterfamilie der Besuch einer höheren Schule aus finanziellen und logistischen Gründen ausgeschlossen – ihre Heimatstadt Bärn besaß weder Gymnasium noch Bahnanschluss. Zudem musste sie sich nach dem frühen Tod ihrer Mutter um den Haushalt und ihren jüngeren Bruder kümmern. Meinen Vater lernte sie mit neunzehn kurz vor dem Krieg kennen, für die Hochzeit blieb nur ein kurzer Weihnachtsurlaub Ende 1941. In den ersten vier Jahre ihrer Ehe sah meine Mutter ihren Mann nur bei kurzen Urlauben, 1944 kam mein Bruder Klaus zur Welt. Als im April 1945 russische Truppen Bärn besetzten, flüchtete sie zum Schutz vor Übergriffen mit dem einjährigen Baby aufs Land. Ihre späteren Schilderungen ließen nur vermuten, was sie erlebt hatte. Nachts versteckten sich die Frauen aus Angst mit den Kindern im Wald, manchmal wurden die Kleinen unter Wasser gehalten, damit sie ruhig blieben. Wenn wir tiefer bohren wollten, spürte man schnell, dass Mutter darüber nicht reden wollte.
1947 begannen die Abtransporte der deutschen Bevölkerung. Eingepfercht in einem Güterwagon, stehend, ging die tagelange Fahrt ins Ungewisse, das sich glücklicherweise als amerikanische Zone entpuppte. Nach drei Monaten in verschiedenen Flüchtlingslagern durften die «Heimatvertriebenen», so die offizielle Bezeichnung, im Juli 1947 zu Verwandten im norddeutschen Bramsche weiterreisen. Dort gab es einen Onkel, der schon vor dem Ersten Weltkrieg von großen Tuchfabriken und Webereien als «Gastarbeiter» und Streikbrecher gegen streikende einheimische Arbeiter angeworben worden war.
In Bramsche trafen sich auch meine Eltern wieder, Vater war schon 1946 aus der amerikanischen Gefangenschaft entlassen worden. Das Produkt des Wiedersehens kam im April 1948 auf die Welt und erhielt den Namen Peter Ernst, eine Hommage an den gastfreundlichen Onkel, der auch Pate wurde. Nachdem die Entnazifizierungsbehörde meinen Vater als früheren Wehrmachtsoffizier entlastet hatte, durfte er seinen Beruf wieder ausüben. Und nicht nur das, ehrgeizig, wie er zweifelsfrei war, nutzte er alle Möglichkeiten, das Bild des unbekannten «Flüchtlingslehrers» loszuwerden und sich in der «neuen» Zeit zu profilieren. Noch im selben Jahr gründete er den Kreisverband des katholischen Lehrervereins, wurde von der britischen Schulverwaltung beauftragt, seine deutschen Kollegen über die frisch verordnete demokratische Erziehungskultur zu informieren. Darüber hinaus engagierte er sich in der katholischen Kirchengemeinde, ließ sich in den Stadtrat und später in den Kreistag wählen – alles als Zugereister mit Anfang dreißig.
Meine Mutter schien länger zu brauchen, um die Traumata der Kriegszeit bis zu ihrer Ankunft im Westen zu verdrängen. Von Natur aus schüchtern, hatten sich ihre Ängstlichkeit und Anspannung verstärkt. Ich habe sie selten überschwänglich, unbeschwert, gelöst oder fröhlich erlebt, eher stets zurückhaltend, nachdenklich und übervorsichtig. Nur beim Musizieren lebte sie auf, am frisch erstandenen gebrauchten Klavier oder beim Singen schien sie glücklich zu sein. In Bärn hatte ein befreundeter Gönner der talentierten Anni den Klavierunterricht bezahlt, später hatte sie die Orgel in der Pfarrkirche gespielt und im Kirchenchor gesungen. Diesen Faden nahm sie in der neuen Heimat auf, knüpfte Kontakte in der katholischen Gemeinde, wurde Mitglied des Chors und half als Organistin aus.
Für unser Familienensemble war «Mutti» so eine Art Musical Director, sie gab den Einsatz, leitete uns durch die Berge und Täler der Notenzeichen. An Opas Geburtstag wurden Werke von Mozart und Telemann gegeben, mein Bruder Klaus (damals 14) hatte sogar ein eigenes Ständchen komponiert. Dem Programmzettel war eine Entschuldigung für eventuelle Misstöne und Disharmonien beigefügt, es habe angeblich zu wenig Zeit für die Proben gegeben.
Ich erinnere mich tatsächlich an eine hektische Phase damals. Ich hatte die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestanden, dem Urteil der Grundschule vertraute man damals nicht, und fuhr deshalb nach Abschluss der vierten Klasse wie mein Bruder jeden Morgen mit dem Zug ins 17 Kilometer entfernte Osnabrück. Dort besuchten wir das Gymnasium Carolinum, ein altehrwürdiges Institut, das Karl der Große im Jahr 804 gegründet hatte und das wie eine Trutzburg im Schatten des Doms lag, noch Ende der 1950er-Jahre war es nur Jungen vorbehalten. Doch die historische Aura des Caro beeindruckte mich nur am Rande, das Schönste am Fahrschülerleben war für mich, durch die Großstadt zu tigern, ohne Aufsicht unterwegs zu sein, das kleine Abenteuer der Zugfahrt, der tägliche Luxus am Bahnhofskiosk: ein Brausewürfel für fünf Pfennige, das Glas Wasser gratis!
Zwei Jahre zuvor waren dunkel gekleidete Damen und Herren in der katholischen Schule aufgetaucht, mein Vater wurde begutachtet, der nächste Karriereschritt stand an. Er sollte Schulrat für den Kreis Bersenbrück werden, und da das Schulratsamt im 30 Kilometer entfernten Quakenbrück lag, mussten wir umziehen. Aber der Veränderungen nicht genug, meine Mutter hatte noch eine Überraschung parat. Sie eröffnete mir, dass sie schwanger war und unser Familienorchester Zuwachs erwartete, worauf ich lauthals polterte, sie sei ja wohl verrückt geworden, ein Kind in ihrem Alter? Meine Mutter war 39. Ich war empört, wahrscheinlich, weil ich unbewusst meine bequeme Situation als Nesthäkchen der Familie bedroht sah – eine nicht ganz unbegründete Sorge.
Im Sommer 59 erblickte meine Schwester Gaby das Licht des elterlichen Schlafzimmers, bei uns wurde zu Hause geboren. Vier Wochen später gingen Krippe, Klavier, Kinder, Eltern und Jagdhündin Cora auf die kurze Reise ins neue Zuhause, eine großzügige Doppelhaushälfte in einem Viertel reich an Lehrern und Beamten. Quakenbrück war im Gegensatz zum nüchternen Bramsche eine architektonische Perle, eine hübsche, fast 800 Jahre alte Kleinstadt mit vielen alten Fachwerkhäusern, der Hohen Pforte, einem historischen Stadttor, das lange auch als Gefängnis gedient hatte, und der mächtigen Sylvesterkirche aus dem 13. Jahrhundert, der man in der Barockzeit einen spektakulären Turm aufgesetzt hatte, der weithin die flache Umgebung überragte. Auf unseren Urlaubsfahrten nach Süddeutschland hatte ich mit großen Augen romantische mittelalterliche Städte bewundert, Quakenbrück weckte diese Erinnerungen. Die Stadt war vom Bischof von Osnabrück als Grenzstadt begründet worden, um sein Bistum vor feindlichen Fürsten zu schützen. Dabei kam ihm der Lauf des Flusses Hase, den ich schon in Bramsche als übel riechendes verseuchtes Opfer der Textilindustrie kennengelernt hatte, zu Hilfe. In Quakenbrück strömte das gesäuberte Gewässer in mehreren Armen durch die Stadt, um danach abrupt im rechten Winkel nach Westen in Richtung Ems abzubiegen, als wolle es sich und das Osnabrücker Land vom «verfeindeten» Südoldenburger Münsterland abschotten und Eindringlinge abwehren. Noch heute verläuft die Kreis- und Bezirksgrenze entlang der Hase. Ich sollte bald die anderen praktischen Vorzüge des verzweigten Flusses lieben lernen, Radtouren entlang der Uferalleen, Kanuausflüge vom Bootshaus des Gymnasiums aus und kilometerlange Schlittschuhfahrten auf zugefrorenen Flussarmen in eisigen Wintern, die in den 1960er-Jahren noch zur Normalität gehörten.
Frische Wald- und Landluft bekam ich bald reichlich um die Nase. Mein Vater war für seinen Schulratsjob und andere ehrenamtliche Aktivitäten ständig im Landkreis unterwegs oder saß in Sitzungen und an Konferenztischen. Er war auf der Suche nach einem Ausgleich, Sport war wegen der Spätfolgen einer Kinderlähmung kaum möglich. Also fand er zwei Hobbys, für die er noch länger von zu Hause fort war, Forellen angeln und auf die Jagd gehen. Er hatte aber gerne einen Begleiter dabei, und der unwillige Mitstreiter sollte ich sein. Nichts fand ich langweiliger, als mit der Angel in der Hand auf anbeißende Fische zu warten, und noch unangenehmer, ihnen mit einem kräftigen Griff das Genick zu brechen, sie aufzuschlitzen und die glibberigen Gedärme zu entfernen. Wenigstens lagen die Forellenbäche und Fischteiche idyllisch in den Ausläufern des Wiehengebirges, genau wie die Wälder und Weiden des Jagdgebiets. Für die Jägerprüfung hatte mein Vater lange gepaukt, ein Gewehr gekauft und sogar besagte Jagdhündin Cora angeschafft. Die adelige Dame sollte eigentlich Fasane, Rebhühner und Feldhasen aufspüren und die abgeschossenen Opfer einsammeln. Dummerweise stellte sich heraus, dass sie keine lauten Geräusche ertrug, also «schussscheu» war. Bei jedem Gewehrknall schoss Cora auf und davon, aber nicht zum Apportieren, sondern auf Nimmerwiedersehen. Es dauerte lange, bis wir den verängstigten Hund mit lautem Rufen und Pfeifen gefunden und zurückgeholt hatten, was die übrigen Waldbewohner nun gänzlich verjagte. Aber so hatte ich Abwechslung, denn ich fand wenig spannend, tierische Zielscheiben aufzuscheuchen oder gefühlte Ewigkeiten vom Hochsitz nach einem bestimmten Rehbock Ausschau zu halten. Richtig befremdlich wurde es, wenn der Bock dann geschossen war und zu Hause weiter«behandelt» wurde: ausbluten, ausnehmen. Fell und Haut abziehen, was im Jägerlatein metaphorisch nett «aus der Decke schlagen» hieß, und schließlich zerteilen. Ich schaffte es meist, mich zu drücken, den Rehbraten mit Semmelknödel und brauner Soße, den meine Mutter später auf den Tisch zauberte, liebte ich allerdings sehr. Genau wie andere Spezialrezepte, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatte und die böhmisch-österreichische Küchentradition verrieten, das Sudetenland hatte schließlich lange zur K.-u.-k.-Monarchie gehört. Meine Favoriten: eine himmlische leicht süße helle Dill-Soße und «Reisfleisch», ein Reis-Topf mit geschmortem Kalbs- oder Rindfleisch, der nicht auf dem Herd, sondern tatsächlich im Schlafzimmer fertig gegart wurde, genauer im Bett, eingepackt in dicke Federkissen.
Da die Jagd- und Angelausflüge nicht zu meinem Lieblingszeitvertreib wurden, konnte ich mich nicht mehr länger gegen den Wunsch meiner Mutter wehren, Klavierspielen zu lernen. Die Möglichkeiten an der Blockflöte waren mir zu begrenzt, das Überwinden dieser Klippe hätte enorm viel Fleiß, Zeit, Disziplin und, ehrlich gesagt, auch mehr Talent erfordert. Am Klavier konnte man durch das einfache Drücken bestimmter Tasten mehrstimmige Melodien und Harmonien erzeugen, mit wenig Aufwand hatte ich Töne und Tonfolgen ausprobiert und versucht, kleine Klangbilder zu malen. Dieses improvisierte Tapsen im Tastenwald sollte nun in korrekte Bahnen gelenkt werden.
Die Pädagogin des Vertrauens wohnte in unserer Straße nur drei Häuser weiter. Frau C., die Ehefrau meines Sportlehrers, führte ein strenges Regiment. Humor, Freude und Leichtigkeit, die man ja gerne mit Musik verbindet, schienen ihr fremd, und wenn ich ihr düsteres Klavierzimmer betrat und mir aus dem sächselnden Mund eine dicke Knoblauchwolke entgegenschlug, ahnte ich, ich würde wenig Spaß haben. Mir war schon klar, dass Tonleiter-Training, Fingerübungen und gleichzeitiges Notenlesen für beide Hände kein reines Vergnügen versprachen. Aber statt mit monatelangem Pauken von trockenen Czerny-Etüden zu quälen, hätte man doch mit einigen hübschen und leichten Stücken der Herren Mozart, Schubert oder Chopin den Unterricht ab und zu aufhellen können. Achtzehn Monate ertrug ich den Drill, dann stieg ich aus dem klassischen Klavierunterricht aus, meine Eltern waren zwar nicht begeistert, wollten mich aber auch nicht zwingen. Statt auf dem Klavierhocker Etüden zu üben, lebte ich lieber meinen Bewegungsdrang aus, sprang mit Vorliebe aus dem Toilettenfenster im Hochparterre in den Garten, turnte mit Freunden durch die halb fertigen Rohbauten des benachbarten Neubauviertels. Dort fanden wir geheime Ecken und Kellerhöhlen, in denen wir ungestört Zigaretten aus Fünferpacks oder Tabakpfeifen paffen konnten, die Zahnpastatube und Kaugummis in der Tasche, damit niemand später zu Hause unserem Mini-Exzess auf die Schliche kam.
Am Marktplatz stand der über 50 Meter hohe, neugotische Turm der katholischen Kirche. Sie war bei einem Bombenangriff zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut worden, nur der Turm hatte überlebt. Aber das mittlerweile reichlich marode Bauwerk war vor meiner Neugier nicht sicher, große Höhen hatten mich schon immer gereizt. Ich begleitete manchmal meine Mutter, wenn sie an der Kirchenorgel probte, blätterte ihre Noten um, zog die Register und ließ mich von den fetten Tönen der großen Pfeifen vollblasen – ein ähnlich mächtiges Gefühl wie das Gitarrengewitter, das ich 30 Jahre später auf einer Festivalbühne miterleben durfte, als fünf Meter neben mir Neil Young seine Verstärker aufdrehte, voll in die Saiten griff und eines seiner berühmten sägenden Soli über die Menschen fliegen ließ – Like a Hurricane …
Zurück zu St. Marien – am Aufgang der Wendeltreppe zum Orgelboden entdeckte ich eine vernagelte Tür mit dem Schild «Zutritt verboten», was mich natürlich eher einlud. Einige Tage später kehrte ich mit einem Freund zurück, wir rüttelten an der Tür, und, oh Wunder, sie gab nach. Dahinter begann eine endlos lange hölzerne Wendeltreppe den Turm hoch. Anfangs lief der Aufstieg ohne Probleme, aber irgendwann wurde deutlich, warum der Zugang verriegelt war. Nachdem wir das Gerüst, an dem die Kirchenglocken hingen, passiert hatten, waren viele der Treppenstufen und Teile des Geländers an- oder ganz durchgebrochen. Außerdem bröckelten Steine des backsteinernen Turms, sodass manche Stücke auf die Treppe und den Glockenboden herunterfielen. Ein gewisses Maß an Ehrgeiz, Eigensinn und Beharrlichkeit, außer beim Klavierunterricht, zeichnete mich offensichtlich schon damals aus. Es war sicher leichtsinnig, aber nichts hielt uns auf, wir kletterten weiter, bis wir in der immer schmaler werdenden Turmspitze vier kleine Ausblickfenster erreichten. On Top of the World, Quakenbrück von oben, vorne Marktplatz, Rathaus und Sylvesterkirche, nach hinten der Blick auf Kirchenschiff, Friedhof und unser Viertel. Ich hatte meine billige Rollfilmkamera in der Tasche, für die Beweisfotos, die ich meinen Eltern aber nicht zeigte, das hätte heftigen Ärger eingebracht. Ich war doch verdammt froh, als wir heil und mit allen Knochen intakt wieder auf dem Erdboden standen.
Unsere Familie integrierte sich schnell und fleißig in das Stadtleben und die katholische Gemeinde, Vater als hoher Beamter, CDU-Mitglied, Stadtrat und Kirchenvorstand in einer Vierfachrolle zwischen Karriere, Partei, Politik und Kirche, die mein Bruder und ich immer kritischer betrachteten, Mutter als Organistin, die Söhne als Messdiener mit den üblichen, eher irdischen als himmlischen Erlebnissen. Trotz aller Zweifel rollten mein Bruder und ich uns für die werktäglichen Frühmessen um Viertel vor sechs aus dem Bett, rasten bei jedem Wetter mit dem Rad zur Kirche, wo man in der Sakristei auf einen ebenso unausgeschlafenen Kaplan traf, den eine betäubende Wolke aus Restalkohol, Rasierwasser und Messwein umgab. Sonntags wehten uns in den festlichen Hochämtern Schwaden von Weihrauch um die Ohren, weil wir Messdiener die dampfenden Fässer mit dem glühenden Harz in wahrem Feuereifer hin und her schwenkten, wie ein Hammerwerfer seine Drahtkugel vor dem Abflug. Die lähmende Langeweile ausladender Predigten war dagegen nur durch intensives Wegträumen zu überstehen, nur gut, dass wir weite Talare trugen, die manch frühpubertäre Fingerübungen gnädig verdeckten.
Meinen ersten Radioauftritt als «live on air» klingelnder Messdiener hatte ich ja schon hinter mir. Den Sonntagsgottesdiensten verdankte ich aber auch meine ersten Erfahrungen als «Sprecher». Seit den frühen 60er-Jahren wurde die Messe nicht mehr nach lateinischem Ritus, sondern in deutscher Sprache zelebriert, mit «Publikumsbeteiligung». Sogenannte Lektoren durften Gebetstexte, Fürbitten und Lesungen vortragen, ich war zunächst scheu und zittrig, gewann aber mit der Zeit immer mehr Sicherheit und bekam richtig Spaß daran, laut zu sprechen, mit Betonungen und Rhythmus zu spielen, für mich perfektes öffentliches Stimmtraining am Mikrofon. Moderne Zeiten in St. Marien, der Relaunch der katholischen Messe erlaubte uns später sogar, in der Kirche zu rocken, wenn auch mit gebremster Lautstärke. Wir, ein Kreis befreundeter Musiker, durften später dank der Initiative eines fortschrittlichen Geistlichen einen der allerersten «Beatgottesdienste» mit Rockband und deutschen Texten abhalten – aber bis dahin musste ich Pop- und Rockmusik überhaupt erst noch entdecken.
Im Musikunterricht meiner Schule war davon jedenfalls noch nichts zu spüren, da versuchte ein chancenloser Herr Notbohm mit traditionsbeladenen Themen gegen eine desinteressierte lärmende Schülerschar durchzudringen. Mir tat der Mann leid, ich versuchte wenigstens zuzuhören. Seit Mitte der sechsten Klasse besuchte ich nun das Artland-Gymnasium in der Altstadt. Artland war die Bezeichnung für die sehr fruchtbare Region rund um Quakenbrück mit reichen Großbauern, zahlreichen wunderschönen alten Fachwerkhöfen und wohlhabenden Dörfern. Da das AGQ damals das einzige Gymnasium im gesamten Kreis war, pendelte über die Hälfte der Schüler aus den Gemeinden und Kleinstädten der Umgebung täglich per Bahn und Bus zur Schule. Vielleicht auch deswegen fiel mir als ehemaligem Fahrschüler der schulische Neustart leicht. Ich fand sofort Kontakt. Zwar war ich bei Weitem der Kleinste und Jüngste in der Klasse, dafür aber nicht auf den Mund gefallen, schnell dabei mit frechen Bemerkungen und versauten Witzen, mit denen ich große Lacher erntete, deren anzügliche Pointen ich aber oft selbst noch gar nicht begriff. In den Pausen hing ich mit den Großen und Coolen herum, fast als deren Hofnarr oder Maskottchen. Der starke Hermann nahm mich gerne am Hosenbund, stemmte mich zum Spaß einarmig nach oben, aber wenn Ärger mit anderen Schülern drohte, stand ich unter seinem persönlichen Schutz.
Zwar war das 1354 als Lateinschule urkundlich erwähnte Quakenbrücker Gymnasium 550 Jahre jünger als das historische Carolinum, galt aber dennoch als eine der ältesten Schulen im Land. Doch Alter schützt vor Torheit nicht, das demonstrierte Tag für Tag das schrille Lehrerkollegium. Ich weiß, zu jeder Zeit, an jeder Schule gab und gibt es exotische Species der Gattung, aber wir waren wirklich mit einer ganz speziellen Mannschaft gesegnet. Der hutzelige Biologielehrer schwärmte stundenlang von seinem Studienfreund, «dem Nobelpreisträger», die korpulente, schlecht gelaunte Lateinlehrerin fläzte sich in den Sessel, die Beine auf dem Tisch, bis die Strumpfhalter zu sehen waren, dazu war sie fast so cholerisch wie unser Klassenlehrer. Der rastete regelmäßig komplett aus, schrie, fluchte und pfefferte Bücher durch die Klasse, leider nahm ihn keiner ernst. Oder «Specki», der Deutschlehrer, dessen feuchte Aussprache sein schmuddeliges Jackett vollsprühte und uns in die Flucht trieb, wenn er zu nah kam. Angeführt wurde die Truppe von einem Direktor, dessen Vergangenheit als Major in der Wehrmacht nicht nur in seinem schneidenden Ton und seinem militärisch knappen Haarschnitt aufblitzte. Wenn er stechenden Schrittes den Schulflur heruntermarschierte, stand alles still. Aber es gab auch Lichtfiguren, den menschlich feinen, lässigen Englischlehrer, den alle nur «You See» nannten, oder den kühl-korrekten, souveränen Mathelehrer aus altem ostdeutschen Adel.
Da die Schule mich nur bedingt forderte, musste meine überschüssige Energie auf anderen Spielfeldern raus. Wegen meiner geringen Größe war ich im Winterhalbjahr der Champ beim Turnen, in den Sommermonaten lief, warf und sprang ich aber den anderen hinterher, im Gegensatz zu meinem vier Jahre älteren Bruder Klaus. Der war ein hervorragender Sprinter und Weitspringer, holte sich bei Schulsportfesten nicht nur die Preise, sondern wegen seines blendenden Aussehens auch die bewundernden Blicke der weiblichen Schülerschaft ab – ein Vorteil, der mir noch nützlich werden sollte.
Meine Leidenschaft und Neugier galt großen Sportereignissen, ich verschlang alles, was ich in Zeitungen und Magazinen darüber zu lesen bekam. Schon mit acht hatte ich die Berichte von den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne ausgeschnitten, gesammelt und fein säuberlich thematisch geordnet in einer Mappe dokumentiert. Vier Jahre später hatten wir noch immer kein Fernsehgerät, weil meine Eltern dem Medium pädagogisch negative Einflüsse zuschrieben. Also musste ich selbst aktiv werden, um Sport live im Fernsehen miterleben zu können, und da kam mir die Beliebtheit meines Bruders bei den Damen zu Hilfe. Ich habe sicherlich furchtbar gebettelt und unendlich genervt, bis er mich am 25. Juni 1960 zu seiner Freundin, einer Notarstochter, mitnahm, damit ich 12-jähriger Knirps im Wohnzimmer der Familie das Fußballendspiel HSV gegen Köln sehen konnte. Mein Heimverein war eigentlich der VfL Osnabrück, doch obwohl ich nie in Hamburg gewesen war, geschweige denn ein Spiel des Clubs miterlebt hatte, war ich schon damals glühender HSV-Fan und bejubelte die Tore von Uwe Seeler und Gert «Charly» Dörfel zum 3:2 für die Hamburger. Ich konnte damals natürlich nicht ahnen, dass ich 30 Jahre später mit dem ungeheuer sympathischen, nie arroganten Uwe Seeler, Charly Dörfel und anderen früheren HSV-Stars wie Horst Hrubesch oder Peter Nogly in der NDR-Prominentenmannschaft durch die norddeutschen Lande touren würde. Charly war nach der Fußballkarriere Gerichtsvollzieher beim Ortsamt Stellingen geworden und verdiente sich in der Promimannschaft, einer Marketing-Aktion des NDR, gerne ein zusätzliches Taschengeld. Flanken schlagen konnte der sympathische Witzbold und Hobby-Clown mit seinen krummen Beinen wie früher, aber das Temperament ging öfter mit ihm durch, wenn er den Ball nicht passend erhielt und danach die Mitspieler beschimpfte. Da ich wegen mangelnder fußballerischer Qualitäten froh war, den Ball los zu sein, wurde mein Verhältnis zum eigentlich herzensguten Charly nie getrübt.
Einen zweiten Sporthöhepunkt des Jahres 1960 durfte ich auf keinen Fall verpassen, am 1. September schaffte es Klaus erneut, mich vor den Fernseher der Notarsfamilie zu schmuggeln, und so erlebte ich Armin Harys Olympiasieg über 100 Meter in Rom mit eigenen Augen, eine Sternstunde. Die anderen Highlights der Spiele erfuhr ich aus der Zeitung und dem Radio, die Bilder dazu liefen in meinem Kopf, schon immer hatte mich das grüne magische Auge der alten Empfänger fasziniert, Radio war meine wichtigste Informationsquelle, meine Verbindung zur Welt. Aber damit nicht genug, ich wollte selbst dabei sein und bastelte mir meine eigene olympische Fantasiearena … für das Mannschaftsfinale der Springreiter. Seltsame Dinge gingen im Garten unseres Hauses Bonnusstraße 12 vor sich, Bänke wurden umgekippt und mit Zweigen und Blumen verziert, die Böcke der Tischtennisplatte blockierten den von Buchsbaum eingezäunten Weg, hinter den Stachelbeersträuchern versteckte sich die mit Wasser gefüllte flache Gartenwanne. Oxer, Steilsprung, Gatter und Wassergraben, fertig war mein Parcours. Das Finale begann, ich lief im Halbgalopp durch die Büsche, sprang über die Hindernisse, tapste in den Wassergraben und hastete ins Ziel. Ich war das Pferd, ich war der Reiter, erst Hans-Günter Winkler mit der legendären Halla, dann Fritz Thiedemann mit dem nicht weniger berühmten Meteor. Ich war Kampfrichter, Zeitnehmer und Radioreporter zugleich, mein Traumfinale wurde ja live übertragen. Während ich also über den Parcours jagte, schilderte ich, natürlich außer Atem, für einen imaginären Sender das Geschehen, stöhnte bei Springfehlern, mahnte zur Vorsicht, feuerte Pferd und Reiter an, litt unter der knisternden Spannung und bejubelte den Erfolg, denn die deutsche Equipe siegte natürlich, wie im richtigen Leben. Die Siegerehrung durfte nicht fehlen, dafür baute ich mir aus Steinen und Brettern ein Podest. Ich schloss die Augen und dachte für einen Moment, ich hätte wirklich die Goldmedaille gewonnen.
2Schuld war nur der Bossa Nova
«Noch ’n Viertel?» Durch den Nebel aus Rauch und dicker Luft erkenne ich die üppigen Umrisse der resoluten Bedienung, die mich fragend mustert, ich nicke. Die Musik ist zu laut, um Worte zu verstehen. Seit gefühlt zwei Stunden tönt Manuela aus der Musikbox, immer wieder: «Schuld war nur der Bossa Nova» – der Hit der Saison. Es ist Juni 1963, unsere 10. ist auf Klassenfahrt am Rhein, Kaub, Loreley, Rüdesheim und heute Bingen. Nach dem Abendessen sind einige von uns von der Jugendherberge am Hang über den Fluss runter in die Altstadt gewandert, Ziel: das erstbeste Weinlokal. Ich bin 15, sehe aber aus wie 13, habe nur an Feiertagen am Tischwein genippt und dürfte hier gar nicht sein. Meine älteren, in Bahnhofskneipen und auf Schützenfesten sozialisierten Klassenkameraden beruhigen mich, zu Recht, niemand scheint sich um mein Alter zu scheren. Ich bestelle Weißwein, ein Schoppen, werde ich gefragt? Als der riesige Kelch mit dem grünen Fuß eintrifft, mache ich große Augen, ich kenne nur die normalen Gläser bei uns zu Hause, aber hier ist ja fast ein drittel Liter drin. Der Wein schmeckt so wie der meiner Eltern süß, lieblich nennen die das, der Zucker transportiert den Alkohol umso schneller ins Blut. Wir trinken, quatschen, rauchen. Die Laune steigt, mir ist heiß und leicht schwindelig. Nach dem zweiten Viertel wanke ich zur Toilette. Als ich zurückkehre, steht da ein dritter Kelch, irgendein fröhlicher Rheinländer hat ihn dem lustigen jungen Norddeutschen spendiert. Man will ja nicht unhöflich sein, also trinke ich weiter, bis mir der Kopf rotiert, ja, ja, der Bossa Nova, schon wieder das verdammte Lied, zieht denn keiner den Stecker? Jemand bläst zum Aufbruch, die Jugendherberge schließt um zehn die Tür ab, ich schwanke, kann kaum stehen. Starke Artländer Arme schleifen mich aus dem Lokal den Berg hoch. In der Herberge werde ich wie ein Kartoffelsack die Treppen hinaufgeschleppt, zu den Waschräumen im zweiten Stock. Ich muss würgen, schaffe es nicht mehr bis zum Klo. In der Not hängen mich zwei Mitschüler aus dem Fenster, und der gesamte Inhalt des lustigen Abends segelt hinunter in die Nacht, ein Glück, dass ich nicht hinterherfliege. Dann stopfen sie mich in die Duschkabine, drehen das kalte Wasser auf, mein Kopf beginnt aufzuklaren, als laut schreiend unser Klassenlehrer (der Bücherwerfer) herbeitobt: «Urban, was haben Sie getan, das gibt Ärger!» Ich stammele irgendwas von Manuela und stolpere in mein Bett.
Am nächsten Morgen passt mein Schädel kaum durch die Tür. Vor dem Frühstücksraum wartet der Herbergsvater mit Eimer, Lappen, Putzmittel und einer Leiter. Wortlos zeigt er auf die großen Fenster, die normalerweise einen perfekten Blick auf den romantisch im Tal fließenden Rhein erlauben, die nun aber völlig verklebt sind. Mit hochrotem Kopf hole ich mir die Höchststrafe ab, noch schwindelig stehe ich auf der wackeligen Leiter und putze unter den grienenden Gesichtern meiner Klasse und anderer Schüler, die genüsslich in ihre Brötchen beißen. Ich drehe mich um und sehe unten im Fluss die kleine Insel mit dem berühmten Binger Mäuseturm, in dem würde ich mich jetzt gerne verstecken … schuld war doch nur der blöde Bossa Nova, was kann ich dafür?
Meine erste Begegnung mit Popmusik war also eine schmerzhafte, immerhin war Manuelas Hit eine richtig gute, werkgetreue Coverversion des amerikanischen Originals «Blame It on the Bossa Nova», vom amerikanischen Autorenpaar Cynthia Weil und Barry Mann für die dünne Stimme der Sängerin Eydie Gormé verfasst. Weil/Mann waren Auftragskomponisten, die Anfang der 1960er-Jahre mit vielen anderen Teams wie Gerry Goffin/Carole King, Jerry Leiber/Mike Stoller, Doc Pomus/Mort Shuman, Ellie Greenwich/Jeff Barry oder Burt Bacharach/Hal David im New Yorker Brill Building an der Ecke Broadway/49. Street arbeiteten. Dort waren Hunderte von Musikverlagen zu Hause, die miteinander konkurrierenden Lohnschreiber saßen Tür an Tür in winzigen Bürokabinen, komponierten am Fließband und nahmen die Songs danach als Demos auf, Verkaufstrick und Kundenservice zugleich. Cynthia Weil und Barry Mann belieferten sehr unterschiedliche Klienten, aber wenn dabei zeitlose Klassiker vom Band fielen wie «On Broadway» für die Drifters, «Walking in the Rain» für die Ronettes oder «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’» für die Righteous Brothers, bewies diese Art der Produktion ihre starken Seiten. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatten angestellte Autoren viele Evergreens der populären Musik in den Büros der großen Musikverlage verfasst, die in der Tin Pan Alley, einem kurzen Abschnitt der 28. Straße/Ecke Broadway in New York, angesiedelt waren, ähnlich wie im Zeitalter des Barocks und der Renaissance die klassischen Auftragskomponisten für europäische Fürstenhöfe und Königshäuser. Weil/Mann verhalfen der britischen Band The Animals 1965 sogar zu einer Rockhymne, die fast politische Dimensionen erreichte, «We Gotta Get Out of This Place». US-Soldaten in Vietnam demonstrierten damit ihren Frust über die andauernde Hölle des Krieges.
Aber all das ahnte ich im Sommer 1963 natürlich noch nicht. Die Revolution des Rock ’n’ Roll der 1950er war an mir vorbeigerollt, für die Musik von Bill Haley, Elvis oder Little Richard war ich zu jung. Auch die Stars der folgenden Generation, der raue Eddie Cochran oder der frische Buddy Holly, fanden bei mir zu Hause nicht statt, genauso wenig britische Ersatzspieler wie der pflegeleichte Cliff Richard. Der einzige Sender, der permanent Popmusik spielte, war Radio Luxemburg, aber nicht bei Urbans zu Hause, da liefen ausschließlich Klassik, Nachrichten, Schul- oder Kinderfunk. Als niedersächsischer Knirps hatte ich am Radio gehangen, um den neuesten Geschichten aus dem norddeutschen Waldhagen über Bauer Piepenbrink und sein Dorf zu lauschen oder um Meisterdetektiv Kalle Blomquist auf der Spur zu bleiben.
Ich war schon 14, als nach ewigem Zögern meiner Eltern endlich ein Fernsehgerät angeschafft wurde, natürlich die abschließbare Variante. So eingeschränkt das Angebot mit nur einem Programm damals war, das ZDF sendete erst ab 1963, das Fernsehen öffnete mein Blickfeld, ließ mich fern sehen, manchmal auch spätabends, wenn meine Eltern schliefen und ich mich heimlich ins Wohnzimmer stahl. Allerdings lief selten ein Programm, das nicht als «jugendfrei» durchging, und Sendeschluss war sowieso schon kurz nach Mitternacht. Ich liebte die Fallschirmabenteuer der US-Serie «Sprung aus den Wolken» und besonders den Agenten John Drake der britischen Serie «Danger Man», der sich vor jeder Folge mit «Mein Name ist Drake, John Drake» vorstellte. Kein Wunder, dass dessen charismatischem Darsteller Patrick McGoohan die Rolle des James Bond angeboten wurde, er sie aber angeblich als Katholik aus religiös-moralischen Gründen ablehnte. Sein Markenzeichen liehen sich die Bond-Produzenten jedenfalls ungeniert aus. Ich verschlang Durbridge-Krimis, Sportsendungen und «Einer wird gewinnen», die europäische Spielshow des genialen H.J. Kulenkampff, ein meisterlicher Moderator oder Conférencier, wie man damals sagte, mal flapsig-frech, mal freundlich-charmant.
Aktuelle Musik konnte man im Fernsehen nicht sehen, außer deutsche Schlager von Manuela und Co. – nur ganz selten blitzten kurze Einblicke in eine für uns neue aufregende Musikwelt auf, wenn mein Bruder und ich die Sendungen des American-Folk-Blues-Festivals im kulturellen Grau des Fernsehprogramms entdeckten. Nach einer Idee des SWF-Jazzredakteurs Joachim-Ernst Berendt präsentierten die deutschen Veranstalter Horst Lippmann und Fritz Rau in ihrer wegweisenden Konzertreihe amerikanische Blues- und Folkkünstler auf europäischen Bühnen. Darunter waren viele von jungen Fans und Musikern verehrte Legenden wie Memphis Slim, John Lee Hooker, T-Bone Walker, Muddy Waters, Sonny Terry und Brownie McGhee, die oft zum ersten Mal überhaupt in Europa zu sehen waren. Die direkte, einfache, ehrliche Art dieser afroamerikanischen Künstler zu musizieren, ihre Trauer, Schmerz, Sorgen, Sehnsucht, Einsamkeit, aber auch Freude, Abenteuer und Lebenslust mit Seele und Gefühl, eben mit dem Blues, spontan auszudrücken, schoss mir sofort unter die Haut. Ich war infiziert.
In England strömten junge Bands wie die Rolling Stones, die Pretty Things oder die Yardbirds mit Eric Clapton und Jimmy Page in die American Folk-Blues-Konzerte, um die Musiker live zu erleben, deren Songs sie bisher nur von Importplatten kannten. Anschließend spielten sie die Songs nach. Einige wollten ihren Helden besonders nah sein. Der Konzertveranstalter Fritz Rau erzählte mir 2006, wie Mick Jagger 1970 bei einer von ihm organisierten Stones-Tournee in schnippischem Ton zu ihm sagte: «Du hast uns vor acht Jahren in Manchester aus der Garderobe geschmissen!» Tatsächlich hatte Fritz 1962 beim Folk-Blues-Festival-Konzert in Manchester drei schmale blasse junge Engländer, die unbedingt die amerikanischen Bluesstars treffen wollten, aus der Künstlergarderobe entfernt, ohne zu ahnen, wer die drei waren: Mick Jagger, 19, Keith Richards, 18 und Brian Jones, 20, Mitglieder einer aufstrebenden Londoner Bluesband, die sich nach einem Song ihres Idols Muddy Waters genannt hatten: «Rollin’ Stone».
In Quakenbrück versuchten sich indes die beiden Urban Brothers an einer wieder in Mode gekommenen Stilart, Skiffle. Ursprünglich in den 1920er- und 1930er-Jahren als Kombination aus Folk, Blues, Jazz, Country und Bluegrass entstanden, wurde Skiffle-Musik mit einfachen, oft improvisierten und selbst gebauten Instrumenten gespielt und in Bars, Tanzlokalen und auf Festen aufgeführt. In den 50er-Jahren wurde Skiffle-Musik vor allem in Großbritannien wiederbelebt, populäre Oldtime-Jazzbands wie die von Ken Colyer und Chris Barber begannen, in kleiner Besetzung beliebte Folksongs und Blues zu verjazzen. Besonders erfolgreich darin war Barbers Banjospieler Lonnie Donegan, dessen beschleunigte Version von «Rock Island Line», ursprünglich ein Song des Folkblues-Veteranen Lead Belly, ein Top-Hit wurde und im ganzen Land eine Welle von Skiffle-Combos auslöste – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum späteren Durchbruch britischer Beatmusik.
Diese Welle erreichte irgendwann auch die niedersächsische Provinz, mein Bruder Klaus hatte sich neben der Gitarre ein Banjo zugelegt, der Bass wurde aus einer Holzkiste, einem Besenstiel und einer Wäscheleine zusammengebastelt, ich lieh mir Mutters Waschbrett aus und klopfte mit Metallfingerhüten aus dem Nähkasten den Beat. Dazu sangen wir in unsere Version des Kazoo, meist eine Kirmeströte in Saxofonform, mit der wir unsere Stimmen verfremdeten und vorgetäuschte Trompeten- oder Sax-Soli bliesen. Unser Repertoire: bekannte amerikanische Folk- und Jazzsongs, von «When the Saints» zu «Take This Hammer» oder «John Henry», viele davon fanden wir in unserer speziellen Schatzkiste, einem dicken blauen Liederbuch mit Spirituals, Work Songs und Blues. Aus diesem Wunderwerk lernte ich die Akkorde der Songs am Klavier, brachte mir Harmoniezirkel und dessen Varianten und Verknüpfungen bei, begann endlich, Spaß an diesem Instrument zu entwickeln, zu improvisieren und frei mit den Tasten zu spielen. Zum sparsamen Skiffle-Sound passte Klavier allerdings nicht so recht, und die dazu erforderlichen Techniken des Barrelhouse, Ragtime oder Boogie-Woogie gaben meine Finger noch nicht her.
Für den Hausgebrauch brachte mein Bruder mir ein paar Gitarrenakkorde bei, was sich als sehr hilfreich bei der nächsten Freizeitaktivität, den katholischen Pfadfindern, erwies. Die trafen sich in einem eigenen Pfadfinderheim, das einsam unter großen Buchen auf einer Insel zwischen zwei Hase-Armen lag, ein idealer Platz, um unter sich zu sein, Musik zu machen, und allerlei Unfug anzustellen. An den traditionellen Ritualen und Regeln der Pfadfinder, an der Kluft mit Halstuch und Lederknoten, an Disziplin und Vereinsleben hatte ich kein Interesse, ich lavierte mich so durch. Umso erstaunlicher war es, dass ich zu einer Art Leitwolf, zum «Truppführer» bestimmt und später sogar zum örtlichen Häuptling, dem «Stammesführer» gewählt wurde – definitiv der erste in der Geschichte der Quakenbrücker St. Georg-Pfadfinder, der nicht imstande war, einen einzigen der für den Pfadfinder-Mythos «lebenswichtigen» Knoten zu knüpfen. Dafür konnte ich einige einfache Lieder auf der Gitarre begleiten, eine für die Stimmung am Lagerfeuer nicht zu unterschätzende Fähigkeit. Da wurden die Fahrten-Klassiker aus der obligatorischen «Mundorgel» in die Glut geschmettert, aber viel knisternder und spannender war die neue Art «Volksmusik», die wir nach und nach entdeckten, traditionelle amerikanische Folksongs und Spirituals wie «Michael Row the Boat Ashore» oder «500 Miles», wiederbelebt von Pionieren wie Woody Guthrie und Pete Seeger. Besonders ein Song wurde 1963 zu unserer Lieblingshymne, einfach, anklagend und poetisch zugleich, ein Lied gegen Krieg und Unterdrückung, für Freiheit, Gerechtigkeit und Respekt – ein neuer Song von einem 22-jährigen Sänger mit näselnder Stimme namens Bob Dylan aus der Folkszene New Yorks. Aber nicht dessen eigene spröde Fassung kam uns als erste zu Ohren, sondern die harmonisch-hübsche Hit-Version des Trios Peter, Paul and Mary. «Blowin’ in the Wind» war im Pfadfinderheim an der Hase ein Instant-Klassiker, er reflektierte wie kein anderer Song, den ich bis dahin gehört hatte, die Stimmung in der Hochphase des Kalten Krieges, die Furcht vor atomarer Gewalt, vor sozialer Ungleichheit, vor dem Verlust von Freiheit – und man konnte ihn gemeinsam mit Herz und Gefühl an jedem Lagerfeuer der Welt singen.
Dylan hatte das Lied 1962 geschrieben, nach der Kuba-Krise, die im August die Welt aufgerüttelt hatte. Obwohl die Karibik weit weg war, waren wir in unserer westdeutschen Nachkriegsidylle betroffen, fühlten die Angst vor einem Atomkrieg, die auch ein Jahr später noch nicht verflogen war. Dazu kam, dass die konservative Regierung in Westdeutschland uns keine Visionen und Ideen anzubieten hatte und kaum positive Signale aussandte. Da wurde zwar der verknöcherte Kanzler Adenauer, der auch in den Augen eines 15-Jährigen schon ewig regiert hatte, gegen den glanzlosen, trägen «Wirtschaftswunder-Minister» Erhard ausgetauscht, aber ein mutiges Zeichen des Aufbruchs war das nicht. Das wurde uns besonders deutlich bewusst, weil in den USA seit zwei Jahren eine charismatische Lichtgestalt als Präsident im Amt war. John F. Kennedy verkörperte alles, was wir in der deutschen Politik vermissten, Ideale, Engagement, Optimismus, Charme, mitreißende Ansprache, Witz, Ausstrahlung und den Glamour eines Filmstars – ja, JFK war mein Hero. Dann kam der 22. November 1963, ich sah gerade die Tagesschau, als die Eilmeldung des Attentats von Dallas eintraf. Ich konnte es nicht glauben, war wie erschlagen. Danach die Hoffnung, er könne überleben, und schließlich die bittere Todesnachricht. Nicht nur ich, das ganze Land war im Schock. Ich fühlte mich, als sei ein enger Freund oder Verwandter umgebracht worden, war emotional aufgewühlt, als wäre die Brücke zu einer gerechteren Welt zusammengebrochen, unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft zerstört.
In dieser turbulenten Zeit startete ein musikalisches Projekt, bei dem meine frisch erwachte Zuneigung zum guten alten Piano nützlich wurde. Uli, mit dem ich im ersten Jahr in Quakenbrück die Schulbank geteilt hatte, bevor er den Französischzweig und ich Latein wählte, fragte mich, ob ich Lust hätte, in einer Jazzband mitzumachen. Wulf und Ulis Bruder Hans-Jürgen, ehemalige AGQ-Schüler, die jetzt in Hamburg studierten, waren von der dortigen Jazzszene so fasziniert, dass sie eine eigene Band gründen wollten, und zwar in der Jazz-Diaspora Quakenbrück. Vielleicht auch, weil hier der hochtalentierte Uli wartete, der mit seinen 15 Jahren schon herausragend Klarinette spielte. Sein älterer Bruder war Posaunist und trat sogar mit Hamburger Kapellen auf, Wulf, der Antreiber und Organisator, zupfte ein solides Banjo. Ich fühlte mich geehrt, fragte mich jedoch, ob ich gut genug war. Ich kannte Oldtime Jazz in der populären britischen Version, Bands wie die von Chris Barber und Monty Sunshine waren auch in Deutschland angesagt. Doch deren verwässerter Dixieland, der zwar erfolgreich war, aber oft nur schlagerähnliche Melodien verjazzte und für uns wie Hintergrundmusik für Autohauseröffnungen und Volksfeste klang, war bei puristischen Jazz-Jüngern wie uns verpönt. Wir wollten den ursprünglichen Jazz wiederbeleben, so wie er seit etwa 1915 von afroamerikanischen und kreolischen Musikern in den Bars und Bordellen der schwarzen Viertel von New Orleans gespielt worden war. Für mich hieß das, die Platten der Originale hören und davon lernen, Musik von King Oliver’s Creole Jazz Band und von seinem Zauberlehrling, dem genialen Louis Armstrong, der schon als 17-Jähriger bei Oliver geglänzt hatte und der in den 20er-Jahren mit seinen Hot Five und Hot Seven Geschichte schrieb.
Damals waren die wichtigsten Jazzmusiker aus ökonomischen Gründen wegen fehlender Auftrittsmöglichkeiten von Louisiana nach Norden in die Metropole Chicago weitergezogen. Ausgerechnet eine Band weißer Musiker aus Chicago, die den Jazz aus dem Süden nachspielte, stand Pate bei der Namensgebung unseres ehrgeizigen Vorhabens. Ich bin nicht mehr sicher, ob das aus Absicht geschah oder nur, weil es gut klang: aus New Orleans Rhythm Kings wurden die Quaktown Rhythm Kings, und die wurden vervollständigt durch Dieter, der das Kornett blies, eine zusammengestauchte Trompete, und unseren Mitschüler Andreas, genannt Dicki, am Kontrabass, der mehr geschlagen als gezupft wurde, also der Bass. Das Kornett spielte die Hauptmelodien, Klarinette und Posaune phrasierten dazu und darüber, füllten die Zwischenräume, warfen sich Fragen und Antworten zu, improvisierten die Soli. Das Rhythmus-Trio von Banjo, Bass und Piano hatte schwer zu kämpfen, um sich gegen die lauten Bläser durchzusetzen und den Beat zu halten, zumal wir ganz traditionell auf Schlagzeug verzichteten. Verstärkung durch PA-Systeme steckte noch in den Babyschuhen, also hackte ich mit aller Kraft die Akkorde und Basstöne in die Tasten, die wir uns von den Platten abgehört hatten und die ich in ein graues Ringbuch schrieb. Beim Pianospielen waren die Tonarten mit vielen weißen Tasten die angenehmeren, also C-Dur, G-Dur, D-Dur mit Dominanten, Subdominanten und ihre Moll-Parallelen – für mich jedenfalls. Dummerweise waren die Instrumente unserer Bläser in B-Lagen gestimmt, ich musste daher viele Akkorde in B, Es oder As-Dur drücken, inklusive der ungeliebten schwarzen Tasten, eine weitere Hürde. Auf jeden Fall muss es ziemlich lustig ausgesehen haben, wie der kleine Junge mit dicken Wälzern unter dem Hintern besessen auf ein Klavier eindrosch und dabei sicher mal danebengriff, weil er sich kaum hörte.
Übungskeller mit Piano gab es nicht, und Bandproben in privaten Musikzimmern überforderten bald die Geduld noch so toleranter Eltern. Eher zufällig ergab sich die Chance, auf der Bühne des kaum genutzten Saals einer Gaststätte zu proben. Um auf die Bühne zu gelangen, musste man den schweren alten, muffigen Samtvorhang beiseitehieven, falls die Schnüre korrekt zogen. Dem reichlich verstimmten Klavier fehlten ein paar Hämmer, die Elektrik des Ladens musste aus Vorkriegszeiten stammen. Einmal griff ich auf der Suche nach dem Schalter für die Bühnenbeleuchtung daneben und landete im Sicherungskasten, der mit Blitz und lautem Knall explodierte. Der Stromschlag warf mich drei Meter zurück direkt auf den Klavierhocker. Meine Finger spielten die gesamte Probe Tremolo. Doch der Klang des alten holzgetäfelten Saals passte perfekt zum erdigen New-Orleans-Sound, so gut, dass wir mit einem Revox-Tonbandgerät einige Titel mitschnitten und davon eine eigene Schellackplatte pressen ließen.
Aber irgendwann wollten wir auch vor die Leute, die sollten hören und sehen, was da im Verborgenen köchelte. Es musste etwas Auffälliges her. Die beiden Studenten hatten oft einer der beliebtesten Hamburger Oldtime-Kapellen zugesehen, den Jailhouse Jazzmen in ihren gestreiften Sing-Sing-Hemden, die aber eigentlich einfache Fischer-Kittel waren. Die Idee wurde geklaut, ich tauschte Messdienergewand und Pfadfinderkluft gegen ein blau-weiß gestreiftes Hamburger Fischerhemd mit Stehkragen, für Quakenbrück ein exotischer Look. Zur öffentlichen Premiere der Band blieben wir gleich in der Gaststätte «Mauermann», in der wir probten, allerdings nicht im großen Saal. In unserer Lokalzeitung wurde per Anzeige verkündet, man beachte die fortschrittliche Kleinschreibung: «die neuen quaktown rhythm kings stellen sich vor mit einem tanztee, am sonntag, 1. märz 1964 bei e.mauermann im cafe, 17 uhr, eintritt frei».
Die Resonanz war groß, das Publikum überrascht und begeistert, ob getanzt wurde, entging meiner Aufmerksamkeit, so konzentriert starrte ich auf mein Akkord-Büchlein. Außerdem kamen mir bei dem Wort «Tanztee» schlagartig die traumatischen Erlebnisse meines Tanzkurses wieder hoch – die für den kleinen 14-jährigen Pit, ja, das war mein Spitzname, viel zu großen Tanzpartnerinnen, bei einem Fehltritt rauschte ich ständig mit der Nase gegen knallharte Büstenhalter, in den 60ern waren die Dinger offenbar noch aus Metall. Oder die Einsamkeit auf der Bank, wenn man bei der Damenwahl wieder mal als Letzter sitzen blieb. Oder das schallende Gelächter des gesamten Abtanzballs, als ich bei der offiziellen Vorstellung neben meiner einen Kopf größeren peinlich berührten Dame statt einer Verbeugung wie sie zu einem Knicks ansetzte und schnell noch den hochroten Kopf senkte, was dann wie eine Mischung aus Kratzfuß und Diener aussah.
Da tat der Erfolg der Rhythm Kings dem Selbstbewusstsein gut, als absolute Neulinge hatten wir uns für den bekanntesten Jazzwettbewerb im Nordwesten, dem Jazz Jamboree in Osnabrück, qualifiziert und erspielten uns dort nur einen Monat nach unserer Premiere völlig überraschend den zweiten Platz. Die Presse berichtete sehr positiv, und im Laufe des Jahres mehrten sich unsere Auftritte in der näheren und weiteren Umgebung in Jazzclubs, bei Festivals und Jazz-Tanzabenden, in Kneipen und Lokalen, an Schulen und Hochschulen, verbunden mit einer Einführung in die Geschichte des Jazz. Manchmal kam ich von Fahrten zu Konzerten erst weit nach Mitternacht nach Hause, argwöhnisch beäugt von meinen Eltern, die mich aber gewähren ließen, auch weil Bandleader Wulf für mein Wohlergehen bürgte, er studierte Pädagogik, was meinem Vater gefiel. Dennoch waren sie vielleicht froh, dass die Kings Zuwachs bekamen. Es hatte sich gezeigt, dass ein Kontrabass alleine der Band zu wenig Halt bot, es mangelte an Tiefe und Rückgrat. Im New Orleans Jazz übernahmen oft wie bei den traditionellen Brass Bands Tuba oder Sousafon diese Funktion. Das bot die Gelegenheit für meinen Bruder Klaus, der sich damals mit einem C schrieb und ebenfalls Pädagogik studierte, einzusteigen. Der Stuhl des Banjospielers war von Wulf besetzt, also brachte er sich innerhalb weniger Wochen das Tuba-Spielen bei, wurde viertes Bein der Rhythmus-Section, gab der Band den vermissten Wumms und meinen Eltern die Beruhigung, dass, wenn nötig, der ältere auf den jüngeren Bruder aufpasste.
Der weiteste Trip der QRKs führte nach Hamburg, unsere beiden «Senioren» hatten mit Geschick einen Auftritt im legendären Jazzlokal Riverkasematten in der St. Pauli-Hafenstraße direkt am Wasser der Elbe arrangiert. Als wir in Wulfs VW Cabrio über die Elbbrücken in die City fuhren und ich zum ersten Mal die Außenalster erblickte, in der Sonne glitzernd, mit Hunderten von Segelbooten übersät, war es um mich geschehen. Hier musste ich hin, egal wie.
Die Hamburg-Connection funktionierte auch in umgekehrter Richtung. Im Dezember 64 eröffneten wir in einem brach liegenden Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg unseren eigenen Jazzkeller. Quakenbrück war im Krieg Standort eines wichtigen Militärflugplatzes gewesen, der dazugehörende Bunker musste mit großem Aufwand entrümpelt, renoviert, gestrichen und eingerichtet werden. Nun trug er als plakativer Kontrapunkt zu seiner Nazi-Vergangenheit den Namen einer legendären afrokaribischen Bordellwirtin, die in der viel besungenen Basin Street von New Orleans ein berühmt-berüchtigtes Etablissement geführt hatte. Dort waren es Jazzgrößen wie Jelly Roll Morton, die als Hauspianisten die Kunden unterhielten: «Miss Lulu White’s Jazz Saloon». Lustigerweise kündigte die Lokalzeitung in ihrer Überschrift eine «Miss Lulu Wheite» an. Zur Einweihung der Quakenbrücker Filiale reiste einer der bekanntesten Trompeter des Nordens an, Abbi Hübner mit seiner neuen Band «Low Down Wizards». Der Laden war randgefüllt, die Luft feucht und stickig, die Bunkerdecke tropfte, meine Finger glitschten über die Tasten. Ob der neue Hotspot des Hot Jazz ohne Rotlicht dem historischen Vorbild bei post-musikalischen Jamsessions irgendwie nahekam, entzog sich meiner jugendlichen Kenntnis oder eher naiver Unkenntnis. Ich «ging» in dem Jahr ein paar Monate mit meiner ersten Freundin Marianne, wir trafen uns zu langen Spaziergängen mit scheuen Berührungen und Küsschen, aber nie mit Zunge. Ich blieb verbal forsch, doch hinter der großen Klappe unendlich schüchtern.
Die Transferstrecke Hamburg–Quakenbrück lief bald wie drei Dekaden später die Spielerakquise des Bundesliga-Basketballtopteams der Artland Dragons, das damals als Teil des