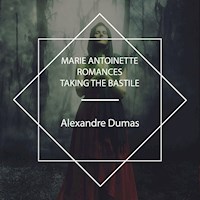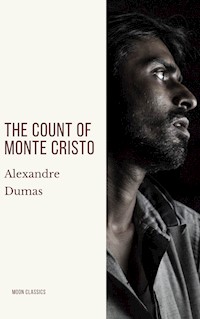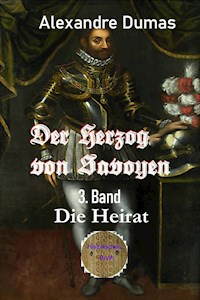
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emmanuel Philibert, Herzog von Savoyen ohne Territorien. Mit dem folgenden Frieden von Cateau-Cambrésis erhielt er seine Länder mit Ausnahme der Stadt Genf und einiger Festungen wieder zurück. 1574 und 1575 erwarb er darüber hinaus Pinerolo und Asti. Als Preis für die Rückgabe der Ländereien gehörte auch die Heirat mit Prinzessin Margarethe von Frankreich, Tochter von König Franz I. Am 9. Juli 1559 heiratete er sie in Paris. Die Ehe diente zur Bekräftigung der Aussöhnung ihres Bruders Heinrich II. mit Emanuel Philibert und war Teil des Frieden von Cateau-Cambrésis. Wie wird das seine große Liebe Léona verkraften und wird es die intrigante Katharina von Medici es noch verhindern? Geschrieben 1855.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Herzog von Savoyen
3. Band: Die Heirat
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke
Übersetzer: © Copyrigh by Walter Brendel
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Impressum
Kapitel 1: Eine Erinnerung und ein Versprechen
Kapitel 2: Der Abgesandte Ihrer Majestäten der Könige von Frankreich und Spanien
Kapitel 3: Im Haus der Königin
Kapitel 4: Im Haus des Favoriten
Kapitel 5: Wenn der Besiegte wie ein Sieger behandelt wurde, wird der Sieger wie ein Besiegter behandelt
Kapitel 6: Der Hausierer
Kapitel 7: Verzierungen und Brautkleider
Kapitel 8: Was sich im Château des Tournelles und in den Straßen von Paris in den ersten Junitagen 1559 abspielte
Kapitel 9: Nachrichten aus Schottland
Kapitel 10: Die Lanzenreiter der Rue Saint-Antoine
Kapitel 11: Die Kampfansage
Kapitel 12: Der Kampf mit stumpfem Eisen
Kapitel 13: Vorhersage
Kapitel 14: Das Sterbebett
Kapitel 15: Florentiner Politik
Kapitel 16: Ein König von Frankreich hat nur sein Wort
Kapitel 17: Wo der Vertrag ausgeführt wird
Kapitel 18: Der 17. November
Kapitel 19: Die Toten wissen alles
Kapitel 20: Die Straße von San Remo nach Albenga
Kapitel 21: Epilog
Kapitel 1: Eine Erinnerung und ein Versprechen
Ein Jahr war verstrichen, seit König Philipp II., als er sich von Cambrai nach Brüssel zurückzog und den Feldzug von 1557 für beendet erklärte, fünfundzwanzig Millionen Männer dazu veranlasste, vor Freude zu rufen: "Frankreich ist gerettet! "
Wir haben gesagt, welche elenden Erwägungen ihn aller Wahrscheinlichkeit nach davon abgehalten hatten, seine Eroberungen fortzusetzen; wir werden bald am Hofe König Heinrichs II. ein verhängnisvolles Gegenstück zu jener selbstsüchtigen Entschlossenheit finden, die, wie wir gesehen haben, Emmanuel Philibert so sehr betrübt hatte.
Der Kummer, den der Herzog von Savoyen empfunden hatte, als er sich auf diese Weise am rechten Ufer der Somme aufgehalten sah, war umso größer gewesen, als es ihm nicht schwer gefallen war, die Ursache dieser seltsamen Entscheidung zu erahnen, die für einige moderne Historiker ebenso unerklärlich geblieben ist wie für die antiken Historiker der berühmte Halt Annibals bei Capua.
Darüber hinaus gab es in diesem Jahr große Ereignisse, von denen wir gezwungen sind, den Leser zu informieren.
Das wichtigste dieser Ereignisse war die Rückeroberung von Calais von den Engländern durch den Herzog François de Guise. Nach dieser verhängnisvollen Schlacht von Crecy, die Frankreich fast so nahe an den Untergang gebracht hatte wie die von St. Quentin, war Edward III. gekommen, um Calais zur See und zu Lande anzugreifen: zur See mit einer Flotte von achtzig Segeln und zu Lande mit einer Armee von dreißigtausend Mann. Obwohl von einer kleinen Garnison unter dem Kommando von Johannes von Wien, einem der tapfersten Kapitäne seiner Zeit, verteidigt, ergab sich Calais erst nach einjähriger Belagerung und nachdem die Einwohner das letzte Stück Leder in der Stadt gegessen hatten.
Seit dieser Zeit, d.h. seit zweihundertzehn Jahren, waren die Engländer, wie auch heute noch in Gibraltar, nur mit einer Sache beschäftigt: Calais uneinnehmbar zu machen, und sie glaubten, dass ihnen dies so gut gelungen war, dass sie gegen Ende des anderen Jahrhunderts über dem Haupttor der Stadt eine Inschrift eingravieren ließen, die sich mit den folgenden vier Zeilen übersetzen lässt:
Calais, nach dreihundertachtzig Tagen der Belagerung,
Wurde, auf Valois besiegt, von den Engländern eingenommen.
Wenn das Blei wie ein Korken auf dem Wasser schwimmt,
Die Walliser werden Calais von den Engländern zurückerobern!
Nun, diese Stadt, wo die die Engländer dreihundertachtzig Tage gebraucht hatten, um sie von Philipp von Valois einzunehmen, und die die Nachfolger des Siegers von Cassel und des Besiegten von Crecy erst zurückerobern sollten, wenn Blei wie Kork über das Wasser schwimmen würde, hatte der Herzog von Guise - nicht einmal durch eine ordentliche Belagerung, sondern durch eine Art coup de main - in acht Tagen weggeschafft.
Dann, nach Calais, hatte der Herzog von Guise Guines und Ham zurückerobert, während der Herzog von Nevers Herbemont zurückeroberte; und in diesen vier Orten, Calais eingeschlossen, hatten die Engländer und Spanier dreihundert gusseiserne Kanonen und zweihundertneunzig eiserne Kanonen hinterlassen.
Vielleicht werden unsere Leser, wenn wir von all diesen tapferen Männern sprechen, die kämpften, so gut sie konnten, um die Misserfolge des vorigen Jahres zu beheben, überrascht sein, nicht die Namen des Constable und Coligny ausgesprochen zu hören - wir wissen, dass beide gefangen waren -, sondern den von Dandelot, nicht weniger berühmt, nicht weniger französisch vor allem.
Der Name Dandelot war der einzige, der einen Schatten auf den des Herzogs de Guise werfen konnte, indem er ihm an Genialität und Mut ebenbürtig war.
Das verstand der Kardinal von Lothringen, der so sehr mit dem Vermögen seiner Familie beschäftigt war, das im Moment ganz auf dem Kopf seines Bruders ruhte, dass er zu allem fähig war, sogar zu einem Verbrechen, um einen Mann zu entfernen, der diesem Vermögen im Wege stehen könnte.
Die Freundschaft des Königs und die Dankbarkeit Frankreichs mit dem Herzog von Guise zu teilen, bedeutete nach Ansicht des Kardinals von Lothringen, dem Vermögen des hochmütigen Hauses ein Hindernis in den Weg zu legen, dessen Vertreter bald den Anspruch erheben sollten, den Königen von Frankreich ebenbürtig zu sein, und die sich vielleicht nicht mit dieser Gleichheit zufrieden gegeben hätten, wenn nicht dreißig Jahre später Heinrich III. unter dem Dolch der Fünfundvierzig dieses von Heinrich II. unvorsichtig erhobene Vermögen zerbröseln ließ.
Da der Constable und der Admiral inhaftiert waren, beunruhigte, wie gesagt, nur ein Mann den Kardinal von Lothringen: dieser Mann war Dandelot; von da an sollte Dandelot verschwinden.
Dandelot gehörte der reformierten Religion an; und da er seinen noch schwankenden Bruder für diese Meinung gewinnen wollte, hatte er ihm nach Antwerpen, wo der König von Spanien ihn gefangen hielt, einige Bücher aus Genf mit einem Brief geschickt, indem er ihn aufforderte, die päpstliche Ketzerei zugunsten des Lichts Calvins aufzugeben.
Dieser Brief von Dandelot fiel durch einen unglücklichen Zufall in die Hände des Kardinals von Lothringen.
Es war die Zeit, in der Heinrich II. mit größter Strenge gegen die Protestanten vorging. Mehrmals schon war Dandelot bei ihm als mit Ketzerei befleckt denunziert worden; aber er hatte der Anschuldigung nicht geglaubt oder so getan, als ob er sie nicht glauben würde, so viel kostete es ihn, einen Mann von ihm fernzuhalten, der in seinem Hause erzogen worden war, seit er sieben Jahre alt war, und der gerade mit so großen und wirklichen Diensten die Freundschaft bezahlt hatte, die sein König ihm entgegenbrachte.
Aber bei diesem Beweis der Ketzerei gab es keinen Vorwand mehr für Zweifel.
Henry erklärte jedoch, dass in diesem Punkt kein Beweis, selbst wenn er in der Handschrift von Dandelot wäre, für ihn überzeugend wäre und dass er sich nur auf das Geständnis des Angeklagten verlassen würde.
Daher beschloss er, Dandelot in Anwesenheit des gesamten Hofes über seinen neuen Glauben zu befragen.
Da er ihn aber nicht überrumpeln wollte, lud er den Kardinal de Châtillon, seinen Bruder, und François de Montmorency, seinen Vetter, ein, Dandelot in das Lusthaus der Königin zu bringen, das er damals in der Nähe von Meaux bewohnte, und dafür zu sorgen, dass er so antwortete, dass er sich öffentlich entlastete.
Dandelot wurde daraufhin von François de Montmorency und dem Kardinal de Châtillon eingeladen, nach Monceaux - so hieß dieses Landhaus der Königin - zu gehen und seine Verteidigung vorzubereiten, wenn er es nicht für unter seiner Würde halte, sich zu verteidigen.
Der König war beim Abendessen, als er erfuhr, dass Dandelot gerade angekommen war.
Der König empfing ihn auf wunderbare Weise, indem er ihm zunächst versicherte, dass er die bedeutenden Dienste, die er ihm soeben erwiesen hatte, niemals vergessen würde; dann, auf die Frage nach den Gerüchten eingehend, die seinetwegen im Umlauf waren, sagte er ihm, dass er nicht nur beschuldigt wurde, zu denken, sondern auch, schlecht über die heiligen Geheimnisse unserer Religion zu sprechen. Dann formulierte er seinen Gedanken noch deutlicher:
"Dandelot", sagte er zu ihm, "ich befehle Ihnen, hier Ihre Meinung über das heilige Messopfer darzulegen".
Dandelot wusste im Voraus, welchen Schmerz er dem König zufügen würde; und da er für Heinrich einen großen Respekt, sowie eine tiefe Freundschaft hatte:
"Majestät", sagte er bescheiden, 'könntet Ihr nicht einen Untertan, der seinem König so tief ergeben ist, wie ich es bin, von der Beantwortung einer Frage des reinen Glaubens dispensieren, vor der Ihr, so groß und mächtig Ihr auch sein mögt, doch nur ein Mann von der Größe und Stärke anderer Männer seid?"
Aber Heinrich II. war noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem er einen Rückzieher machen konnte; er befahl daher Dandelot, kategorisch zu antworten.
Dann, als er sah, dass es keine Möglichkeit gab, der Frage auszuweichen:
"Majestät", antwortete Dandelot, "durchdrungen von den Gefühlen tiefster Dankbarkeit für alle Wohltaten, mit denen Eure Majestät mich zu überschütten beliebt, bin ich bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen und meinen Besitz für seinen Dienst zu opfern; aber, da Ihr mich zwingt, Euch dies zu bekennen, Majestät, in Sachen der Religion erkenne ich keinen anderen Herrn an als Gott, und mein Gewissen erlaubt mir nicht, meine Gefühle vor Euch zu verbergen. Folglich, Sire, scheue ich mich nicht zu verkünden, dass die Messe nicht nur etwas ist, was weder von unserem Herrn Jesus noch von seinen Aposteln empfohlen wird, sondern auch eine verabscheuungswürdige Erfindung von Menschen".
Bei dieser schrecklichen Lästerung, die die starren Hugenotten als eine Wahrheit ansahen, die man nicht laut genug bekennen konnte, erschauderte der König vor Erstaunen und ging vom Erstaunen zum Zorn über:
"Dandelot!" rief er, "bis jetzt habe ich Sie gegen die verteidigt, die Sie angegriffen haben; aber nach einer so abscheulichen Ketzerei befehle ich, aus meiner Gegenwart zu gehen, und erkläre, dass ich Ihnen mein Schwert durch den Leib jagen würde, wenn Sie nicht in irgendeiner Weise mein Schüler wärst!
Dandelot blieb ganz ruhig, salutierte respektvoll, ohne auf diese schreckliche Apostrophe des Königs zu antworten, und zog sich zurück.
Aber Heinrich II. hatte nicht die gleiche Gelassenheit bewahrt. Kaum war der Wandteppich, der über der Tür des Speisesaals hing, hinter Dandelot zurückgefallen, befahl er seinem Herrn der Garderobe, la Bordaisière, den Übeltäter zu verhaften und ihn nach Meaux zu bringen.
Der Befehl wurde ausgeführt; aber das genügte dem Kardinal von Lothringen nicht: er verlangte vom König, dass das Amt des Generaloberst der französischen Infanterie, das Dandelot gehörte, ihm entzogen und Blaise de Montluc übertragen würde, der dem Hause Guise völlig ergeben war, da er ein Page von René II. dem Herzog von Lothringen gewesen war.
Das war Dandelots Belohnung für die immensen Dienste, die er dem König gerade erwiesen hatte und die der König versprochen hatte, niemals zu vergessen!
Wir wissen, was seinen Bruder Admiral de Coligny später erwartete.
Das ist der Grund, warum der Name von Dandelot nicht inmitten all der Namen ausgesprochen wurde, die in jedem Moment hervorbrachen, erleuchtet vom Glanz irgendeines Sieges.
Emmanuel Philibert war seinerseits nicht untätig geblieben und hatte energisch gegen diese höchste Anstrengung Frankreichs gekämpft.
Die Schlacht von Gravelines, die der Graf Lamoral d'Egmont gegen den Marschall von Termes gewonnen hatte, war einer jener Tage gewesen, die Frankreich zu seinen unglücklichen Tagen zählen sollte.
Dann, wie in jenen eigenartigen Kämpfen, wo, nachdem sie gleichberechtigt gekämpft haben, zwei einander würdige Gegner, ohne etwas zueinander gesagt zu haben, aber mit gleicher Ermüdung erschöpft, einen Schritt zurücktreten und, ohne einander aus den Augen zu verlieren, auf den Griff ihrer Schwerter gestützt ruhen, erholten sich Frankreich und Spanien, Guise und Emmanuel Philibert: der Herzog von Guise in Thionville, Emmanuel Philibert in Brüssel.
Was König Philipp II. betrifft, so befehligte er persönlich die Armee der Niederlande, fünfunddreißigtausend Mann Fußvolk und vierzehntausend Pferde, die am Fluss Anthée lagerten. Dort erfuhr er vom Tod der Königin von England, seiner Frau, die gerade an Wassersucht gestorben war, die sie hartnäckig für eine Schwangerschaft gehalten hatte.
Die französische Hauptarmee war ihrerseits hinter der Somme verschanzt und war, wie die spanische Armee und ihre Anführer, vorübergehend inaktiv. Sie bestand außer aus sechzehntausend Franzosen aus achtzehntausend Reîtres, sechsundzwanzigtausend deutschen Infanteristen und sechstausend Schweizern; in der Schlacht hielt sie - so berichtet Montluc - eineinhalb Meilen Boden und es dauerte drei Stunden, sie zu umrunden.
Schließlich war Karl V., wie wir im ersten Teil dieser Arbeit sagten, am 21. September 1558 im Kloster von Saint-Just in den Armen des Erzbischofs von Toledo gestorben.
Und da die Ereignisse der Welt nur eine Kette von Gegensätzen sind, hatte die junge Königin Maria Stuart, fünfzehn Jahre alt, gerade den Dauphin Francis, siebzehn Jahre alt, geheiratet.
Dies war der Zustand der politischen und privaten Angelegenheiten Frankreichs, Spaniens, Englands und folglich der Welt, als an einem Morgen im Oktober 1558 Emanuel, - der, gekleidet in jene Trauer, von der Hamlet spricht, welche Trauer von der Kleidung bis zum Herzen reicht, gerade einige militärische Befehle an Scianca-Ferro erteilte, der sich von seiner Verwundung vollständig erholt hatte und den er als Kurier zu König Philipp schicken wollte, - sah Leona sein Kabinett betreten, immer noch schön und lächelnd in ihrem üblichen Kostüm, aber unfähig, einen tiefen Ton von Melancholie zu verbergen, der ihr Lächeln durchdrang.
Mitten im schrecklichen Feldzug in Frankreich, der im Jahr zuvor stattgefunden hatte, sahen wir das schöne Mädchen verschwinden. In der Tat hatte Emmanuel Philibert, um sie nicht den Strapazen von Lagern, Schlachten und Belagerungen auszusetzen, verlangt, dass sie in Cambrai bleiben sollte; dann, nach dem Feldzug, mit größerem Glück, mit einer tieferen Liebe als je zuvor, hatten sich die beiden Liebenden wieder getroffen, und da Emmanuel Philibert, entweder aus Müdigkeit oder aus Abscheu, wenig am Feldzug von 1558 teilgenommen hatte, dessen Operationen er von Brüssel aus geleitet hatte, hatten sich die beiden Liebenden nie getrennt.
Daran gewöhnt, die geheimsten Gedanken des Herzens von Leona in ihrem Gesicht zu lesen, fiel Emmanuel Philibert der melancholische Ton auf, der das fast gezwungene Lächeln des jungen Mädchens auslöschte.
Was Scianca-Ferro betrifft, der weniger geschickt als sein Freund darin war, die mysteriösen Geheimnisse des Herzens zu überraschen, so sah er in Leonas Eintritt nur ihr tägliches Erscheinen im Kabinett des Prinzen, und nachdem er sich mit dem hübschen Pagen ausgetauscht hatte, dessen Geschlecht für ihn schon lange kein Geheimnis mehr war und nachdem er mit dem hübschen Pagen, dessen Geschlecht für ihn längst kein Geheimnis mehr war, einen halb respektvollen, halb freundlichen Händedruck ausgetauscht hatte, nahm er Emmanuel Philibert die vorbereitete Depesche aus den Händen und ritt davon, wobei er sorglos ein Picardie-Lied summte und seine Sporen laut klingeln ließ.
Emmanuel Philibert folgte ihm mit den Augen zur Tür, und als der junge Mann verschwunden war, richtete er seinen besorgten Blick auf Leona.
Leona lächelte immer noch; sie stand, aber sie stützte sich auf einen Sessel, als ob ihre schwachen Beine sich geweigert hätten, sie zu tragen. Ihre Wangen waren blass, und in ihrem Auge glänzte eine letzte Träne, die nicht weggewischt worden war.
"Was ist heute Morgen mit meinem geliebten Kind los?", fragte Emmanuel Philibert mit jenem Ton zärtlicher Väterlichkeit, der der Liebe gegeben ist, wenn ein Mann von der Jugend zum Mannesalter übergeht.
In der Tat hatte Emmanuel Philibert am 8. Juli 1668 gerade sein dreißigstes Lebensjahr vollendet. Geschützt durch das Unglück, das ihn gezwungen hatte, ein großer Mann zu werden, was er vielleicht nicht geworden wäre, wenn er ruhig die Staaten des Herzogs seines Vaters geerbt und unangefochten regiert hätte, hatte Emmanuel Philibert im zarten Alter von dreißig Jahren der Zeit, d.h. mit dem des Constable, des Herzogs von Guise, des Admirals und des alten Marschalls de Trozzi, der gerade so glorreich bei der Belagerung von Thionville gestorben war.
"Ich habe", sagte Leona mit ihrer harmonischen Stimme, "sowohl eine Erinnerung an Dich als auch eine Bitte".
"Leona weiß, dass, wenn mein Gedächtnis undankbar ist, mein Herz treu ist. Sehen wir uns zuerst den Stoff an, dann sehen wir uns die Anforderung an".
Und während er die Glocke läutete, um einem Türsteher zu befehlen, niemanden hereinzulassen, winkte er Leona, zu ihm zu kommen und ihren Platz auf einem Stapel von Kissen einzunehmen, die in seiner Nähe aufgeschichtet waren und auf denen das Mädchen gewöhnlich saß, wenn sie mit ihrem Liebhaber tête-à-tête machte.
Leona kam und nahm ihren gewohnten Platz ein, und indem sie ihre beiden Ellbogen auf Emmanuels Oberschenkel stützte und ihren Kopf auf seine beiden Hände legte, warf sie ihm einen Blick von unendlicher Sanftheit zu, in dem man eine Liebe, besser noch, eine grenzenlose Hingabe lesen konnte.
"Nun?", fragte der Herzog mit einem Lächeln, das seinerseits eine Besorgnis verriet, so wie Leonas ihre Melancholie verriet.
"Welchen Tag des Monats haben wir heute, Emmanuel?
"Der 17. November, wenn ich mich nicht irre", antwortete der Herzog.
"Erinnert dieses Datum meinen geliebten Prinzen nicht an jeden Geburtstag, der es wert ist, gefeiert zu werden?"
Emmanuel lächelte offener als beim ersten Mal; denn sein Gedächtnis, besser als er es gemacht hatte, war soeben zurückgekehrt und hatte ihm das Ereignis, auf das Leona anspielte, in allen Einzelheiten dargestellt.
"Heute vor vierundzwanzig Jahren", sagte er, "ungefähr zu der Zeit, in der wir jetzt sind, wurde ich von meinem Pferd weggetragen, erschrocken beim Anblick eines wütenden Stieres, und fand, wenige Schritte vom Dorf Oleggio entfernt, am Ufer eines Nebenflusses des Ticino, eine tote Frau und ein fast totes Kind. Dieses Kind, dem ich das Glück hatte, ins Leben zurückzukehren, war meine geliebte Leona!"
"Hattest Du seit diesem Tag einen Moment, Emmanuel, in dem Du diese Begegnung bereutest?"
"Ich habe im Gegenteil jedes Mal den Himmel gesegnet, wenn sich mir die Erinnerung an dieses Ereignis aufdrängte", erwiderte der Prinz; "denn jenes Kind ist der Schutzengel meines Glücks geworden!"
"Und wenn ich dich an diesem feierlichen Tag zum ersten Mal in meinem Leben bitten würde, mir ein Versprechen zu geben, Emmanuel, würdest du mich zu anspruchsvoll finden und meine Bitte ablehnen?"
"Du machst mir Sorgen, Leona!", sagte Emmanuel. "Welche Bitte könntest Du an mich richten, die ich in diesem Augenblick nicht sicher erfüllen könnte?"
Leona wurde blass, und ihre Stimme zitterte, als ob sie auf ein entferntes Geräusch lauschen würde:
"Bei der Herrlichkeit deines Namens, Emmanuel; bei dem Motto deiner Familie: Gott bleibt, dem alles fehlt; bei den feierlichen Versprechen, die du deinem sterbenden Vater gegeben hast, schwöre mir, Emmanuel, mir zu gewähren, was ich von dir verlangen werde!"
Der Herzog von Savoyen schüttelte den Kopf wie ein Mann, der spürt, dass er sich zu einem großen und unbekannten Opfer verpflichtet, der aber gleichzeitig davon überzeugt ist, dass dieses Opfer zu Gunsten seines Glücks und seines Vermögens erfolgen wird.
Er hob feierlich die Hand:
"'Was immer du von mir verlangst, Leona", sagte er, "außer dass ich dich nicht mehr sehen soll, werde ich es gewähren".
"Oh", murmelte Leona, "ich ahnte, dass Du nicht uneingeschränkt schwören würdest. Danke, Emmanuel! Nun, was ich bitte, was ich sogar verlange, ist, dass Du kraft des Eides, den Du soeben geleistet hast, keinen persönlichen Widerstand gegen den Frieden zwischen Frankreich und Spanien leistest, dessen Vorschläge mein Bruder Dir soeben im Namen von König Philipp und König Heinrich unterbreitet hat".
"Frieden! Dein Bruder! Woher weißt du, was ich nicht weiß, Leona?"
"Ein mächtiger Fürst dachte, er bräuchte in deiner Nähe seinen demütigen Diener, Emmanuel; und so weiß ich, was du noch nicht weißt, was du aber wissen wirst".
Als dann auf dem Rathausplatz und direkt unter dem Fenster des fürstlichen Kabinetts ein großes Geräusch von Pferden zu hören war, erhob sich Leona und ging im Namen des Herzogs von Savoyen hin, um dem Amtmann den Befehl zu geben, den Anführer des Reiterzuges eintreten zu lassen.
Einen Moment später, während Emmanuel Philibert Leona am Arm festhielt, die weggehen wollte, verkündete der Amtmann:
"Seine Exzellenz Graf Odoardo de Maraviglia, Gesandter Ihrer Majestäten der Könige von Spanien und Frankreich".
"Lasst ihn eintreten", antwortete Emmanuel Philibert mit einer Stimme, die fast so zitterte wie die von Leona einen Moment zuvor.
Kapitel 2: Der Abgesandte Ihrer Majestäten der Könige von Frankreich und Spanien
An den Namen, den Sie gerade gehört haben, erkannten unsere Leser Leonas Bruder, den jungen Mann, der zum Tode verurteilt wurde, weil er versucht hatte, den Mörder seines Vaters zu ermorden, und schließlich den Herrn, den Karl V. seinem Sohn Philipp II. noch am Tag seiner Abdankung empfahl.
Unsere Leser werden sich auch daran erinnern, dass Odoardo Maraviglia zwar seinen Bruder erkennt, aber weit davon entfernt ist, zu vermuten, dass Leona, die er gerade im Zelt von Emmanuel Philibert im Lager von Hesdin getroffen hat, seine Schwester ist.
Der Herzog von Savoyen kennt also allein, zusammen mit seinem Pagen, das Geheimnis, das Odoardo das Leben rettete.
Wie Odoardo nun gleichzeitig zum Agenten Philipps und Heinrichs wird, das wollen wir in wenigen Worten erklären.
Sohn eines Botschafters von König Franz I., aufgewachsen unter den Pagen in der Intimität des Dauphins Heinrich II., öffentlich adoptiert von Kaiser Karl V. am Tag seiner Abdankung, genoss Odoardo am Hof des Königs von Frankreich und am Hof des Königs von Spanien gleichermaßen Gunst.
Ohne die Details dieses Ereignisses zu kennen, war außerdem bekannt, dass er sein Leben Emmanuel Philibert verdankte.
Es war also ganz einfach, dass ein an dem Frieden Interessierter auf die Idee kam, ihn zweimal von dem Mann eröffnen zu lassen, der das Ohr sowohl des Königs von Frankreich als auch des Königs von Spanien hatte, und dass, da die Hauptartikel dieses Friedens zwischen den beiden Fürsten vereinbart waren, derselbe Mann zu Emmanuel Philibert geschickt wurde, um ihn zu veranlassen, dieselben Artikel anzunehmen. Vor allem war es, wie gesagt, der Fürsprache des Herzogs von Savoyen zu verdanken, dass Odoardo Maraviglia nicht nur sein Leben gerettet, sondern auch von Kaiser Karl V. mit Ehren überhäuft und König Philipp II. empfohlen wurde.
Der Mann, der die Idee gehabt hatte, Odoardo Maraviglia vorzuschlagen, hatte sich in keiner Hinsicht geirrt. Der Frieden, der von Philipp II. und Heinrich von Valois gleichermaßen gewünscht wurde, hatte seine Vorbereitungen schneller gesehen, als in einer Angelegenheit dieser Bedeutung zu erwarten gewesen wäre; und, wie man vermutet hatte, obwohl die Gründe für die Sympathie des Emmanuel Philibert für den Sohn des Botschafters von König Franz I. nicht bekannt waren, war er einer der angenehmsten Boten, die zu ihm geschickt werden konnten.
Er erhob sich also, und trotz des Hintergedankens, dass diesem großen politischen Ereignis ein privater Kummer für ihn zugrunde lag, reichte er Odoardo die Hand, die der außerordentliche Gesandte respektvoll küsste.
"Mein Herr", sagte er, "Sie sehen in mir einen sehr glücklichen Mann, denn vielleicht habe ich schon in der Vergangenheit bewiesen und werde in der Zukunft Ihrer Hoheit beweisen, dass Sie das Leben eines dankbaren Mannes gerettet haben".
"Was Ihr Leben in erster Linie gerettet hat, mein lieber Odoardo, war die Großzügigkeit des edlen Kaisers, dessen Tod wir alle betrauern. Ich für meinen Teil bin nur der demütige Vermittler seiner Barmherzigkeit an Sie gewesen".
"So sei es, mein Herr; aber Sie sind für mich der sichtbare Bote der himmlischen Gunst gewesen. Ich bete Sie also an, wie die alten Patriarchen die Engel, die ihnen den Willen Gottes brachten. Im Übrigen, mein Herr, sehen Sie in mir einen Botschafter des Friedens".
"Sie wurden mir als solcher angekündigt, Odoardo; Sie wurden als solcher erwartet; ich empfange Sie als solchen".
"Ich wurde Ihnen angekündigt? Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich dachte, ich wäre der erste, der Ihnen meine Anwesenheit durch meine bloße Anwesenheit ankündigt; und was die Vorschläge betrifft, die ich Ihnen überbringen sollte, so waren sie so geheim ..."
"Machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur l'Ambassadeur", sagte der Herzog von Savoyen und bemühte sich um ein Lächeln. "Haben Sie nicht gehört, dass manche Menschen ihren vertrauten Dämon haben, der sie im Voraus vor den unbekanntesten Dingen warnt? Ich bin einer dieser Männer".
"Dann", sagte Odoardo, "kennen Sie den Grund meines Besuchs?"
"Ja, aber nur den Grund. Es bleiben die Details".
"Wenn Eure Hoheit es wünscht, werde ich bereit sein, ihm diese Details zu geben".
Und Odoardo verbeugte sich und gab Emmanuel ein Zeichen, dass sie nicht allein waren.
Leona sah dieses Zeichen und machte einen Schritt, um sich zurückzuziehen; aber der Prinz hielt sie bei der Hand.
"Ich bin immer allein, wenn ich mit diesem jungen Mann, Odoardo, zusammen bin", sagte er; "denn dieser junge Mann ist der vertraute Dämon, von dem ich vorhin sprach. Bleib, Leone, bleib!" fügte der Herzog hinzu. "Wir müssen alles wissen, was mir vorgeschlagen wird. Ich höre zu; sprechen Sie, Monsieur l'Ambassadeur".
"Was würdet Ihr sagen, mein Herr", fragte Odoardo lächelnd, "wenn ich Eurer Hoheit verkünden würde, dass Frankreich uns im Austausch für Ham, Catelet und Saint-Quentin einhundertachtundneunzig Städte zurückgeben würde?"
"Ich würde sagen", antwortete Emmanuel, "dass das unmöglich ist".
"Aber es ist so, Exzellenz".
"Und gibt Frankreich unter den Städten, die es zurückgibt, auch Calais zurück?"
"Nein, das tut es nicht. Die neue Königin von England, Elisabeth, die sich unter dem Vorwand ihres religiösen Gewissens gerade geweigert hat, König Philipp II. zu heiraten, den Witwer ihrer Schwester Maria, ist bei all dem ein wenig geopfert worden. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Frankreich Calais und die anderen von Herrn de Guise von den Engländern zurückeroberten Städte der Picardie behält".
"Und zu welchen Bedingungen?"
"Nach Ablauf von acht Jahren wird der König von Frankreich verpflichtet sein, sie zurückzugeben, wenn er nicht fünfzigtausend Ekus an England zahlen will".
"Er wird sie geben, wenn er nicht so arm ist wie Beaudoin, der die Krone unseres Herrn verpfändet hat!"
"Ja, aber es ist eine Art Genugtuung, die Königin Elisabeth zuteilwurde, und mit der sie glücklicherweise zufrieden war, da sie in diesem Moment viel mit dem Papst zu tun hatte".
"Hat er sie nicht zum Bastard erklärt?"
"Ja, aber er wird seine Oberhoheit über England verlieren. Elisabeth ihrerseits hat soeben erklärt, dass alle von der verstorbenen Königin Maria zugunsten der katholischen Religion erlassenen Edikte abgeschafft seien, und dass sie im Gegenteil alle unter Edward und Heinrich VIII. gegen den Papst vollzogenen Handlungen wiederherstelle, und dass sie, wie diese beiden Könige, ihren königlichen Vorrechten den Titel des obersten Oberhauptes der anglikanischen Kirche hinzufüge".
"Und was macht Frankreich mit seiner kleinen Königin der Schotten, inmitten dieses großen Konflikts?"
"Heinrich II. erklärte Maria Stuart zur Königin von Schottland und England als Erbin der verstorbenen Königin Maria Tudor, als alleinige Nachfahrin von Jakob V., Enkel von Heinrich VII., König von England, und aufgrund der Unehelichkeit von Elisabeth, die durch einen nie widerrufenen Pakt zum Bastard erklärt wurde".
"Ja", sagte Emmanuel Philibert; "aber es gibt ein Testament Heinrichs VIII., das Elisabeth in Ermangelung von Edward und Maria zur Erbin der Krone erklärt, und auf dieses Gesetz hat sich das Parlament gestützt, um Elisabeth zur Königin zu erklären. Aber bitte, lassen Sie uns wieder zur Sache kommen, Herr Botschafter".
"Nun, mein Herr, hier sind die Hauptbedingungen des Vertrages, die Grundlage, auf der er zustande kommen soll:
Die beiden Könige - der König von Spanien und der König von Frankreich - werden gemeinsam daran arbeiten, den Frieden in der Kirche wiederherzustellen, indem sie die Einberufung eines allgemeinen Konzils veranlassen.
Es soll eine Amnestie für diejenigen geben, die der Partei eines der beiden Könige gefolgt sind, mit Ausnahme jedoch der Verbannten von Neapel, Sizilien und Mailand, die nicht in die allgemeine Begnadigung einbezogen werden sollen.
Es wird dann festgelegt, dass alle Städte und Schlösser, die Frankreich dem König von Spanien abgenommen hat, insbesondere Thionville, Marienbourg, Ivoy, Montmédy, Damvilliers, Hesdin, die Grafschaft Charolais und Valence in Loménie, an den König von Spanien zurückgegeben werden sollen.
Ivoy soll als Ausgleich für die Zerstörung von Thérouanne abgebaut werden.
Dass König Philipp die Prinzessin Isabella von Frankreich heiraten soll, die er zuerst für seinen Sohn Don Carlos verlangt hatte, und dass er mit dieser Prinzessin eine Mitgift von vierhunderttausend Goldkronen erhalten soll.
Dass die Festung von Bouillon dem Bischof von Lüttich zurückgegeben wird.
"Dass die Infantin von Portugal in den Besitz der ihr von Seiten der Königin Eleonora, ihrer Mutter, Witwe von Franz I., zustehenden Güter gesetzt wird.
Schließlich, dass die beiden Könige dem Herzog von Mantua zurückgeben, was sie ihm in Montferrat genommen haben, ohne die Zitadellen, die sie dort errichtet haben, abreißen zu können".
"Und all diese Bedingungen werden vom König von Frankreich gewährt?", fragte Emmanuel.
"Was sagen Sie dazu?"
"Ich sage, dass es wunderbar ist, Herr Botschafter, und dass, wenn Sie es waren, die diesen Einfluss hatten, der Kaiser Karl V., als er vom Thron herunterkam, ganz richtig war, Sie seinem Sohn, dem König von Spanien, zu empfehlen".
"Leider nein, mein Herr", antwortete Odoardo, "die beiden Hauptverursacher dieses seltsamen Friedens sind Madame de Valentinois, die darauf bedacht ist, das Vermögen der Guise und den Kredit der Königin Katharina wachsen zu sehen, und Herr le connétable, der spürt, dass die Lothringer während seiner Gefangenschaft einen Fuß auf sein Haus setzen".
"Ah!" sagte Emmanuel, "das erklärt mir die häufigen Beurlaubungen, die Herr le connétable von König Philipp II. erbittet, um durch Frankreich zu reisen, und diese Bitte, die er an mich richtet, ihn und den Admiral für zweihunderttausend Ecus freizukaufen; eine Bitte, die ich dem König soeben durch die Vermittlung meines Knappen Scianca-Ferro unterbreitet habe, der einen Augenblick vor Ihrer Ankunft abreiste".
"Der König wird diese Bitte ratifizieren, es sei denn, er ist zutiefst undankbar", antwortete der Botschafter.
Dann, nach einem Moment des Schweigens, und mit Blick auf den Prinzen:
"Aber Sie, mein Herr", sagte er, "Sie fragen mich nicht, was für Sie getan werden soll?"
Emmanuel spürte, wie Leonas Hand, die er in seiner gehalten hatte, zitterte.
"Für mich?", erwiderte der Fürst. "Ach! Ich hatte gehofft, vergessen zu werden".
"Die Könige Philipp und Heinrich hätten einen anderen Unterhändler wählen müssen als den, der Ihnen sein Leben verdankt, mein Herr. Oh, nein, nein, Gott sei Dank, die Vorsehung war dieses Mal gerecht, und der Sieger von Saint-Quentin wird, so hoffe ich, reichlich belohnt werden".
Emmanuel tauschte einen schmerzhaften Blick mit seinem Pagen und wartete.
"Mein Herr", sagte Odoardo, "alle Orte, die dem Herzog, Eurem Vater und Euch genommen wurden, sowohl jenseits als auch innerhalb der Alpen, werden Euch zurückgegeben, mit Ausnahme von Turin, Pignerol, Chieri, Chivas und Villeneuve, die im Besitz Frankreichs bleiben werden, bis zu dem Tag, an dem Eure Hoheit einen männlichen Erben hat. Außerdem wird dem König von Spanien bis zum Tag der Geburt dieses Erben, der diese große Prüfung von Louise von Savoyen und Piemont entscheiden wird, erlaubt, Garnisonen in den Städten Asti und Verceil zu platzieren".
"Dann", sagte Emmanuel Philibert, "indem ich mich verheiraten muss?"
"Ihr verliert fünf Städte, die so prächtig sind, mein Herr, dass sie für die Krone eines Prinzen ausreichen würden!"
"Aber", sagte Leona scharf, "mein Herr, der Herzog von Savoyen, wird heiraten. Eure Exzellenz wird daher bitte seine Verhandlung abschließen, indem sie ihm sagt, zu welcher illustren Allianz er bestimmt ist".
Odoardo sah den jungen Mann mit Erstaunen an; dann kehrten seine Augen zu dem Prinzen zurück, dessen Gesicht die grausamste Besorgnis ausdrückte. Der Verhandlungsführer, so klug er auch war, irrte sich in diesem Ausdruck.
"Oh, seien Sie versichert, mein Herr", sagte er, "die Frau, für die Sie bestimmt sind, ist eines Königs würdig".
Und als Emmanuels blasse Lippen geschlossen blieben, anstatt sich für die Frage zu öffnen, die Odoardo erwartete:
"Es ist", so fügte er hinzu, "Madame Marguerite de France, die Schwester von König Heinrich II.; und neben dem gesamten Herzogtum Savoyen bringt sie ihrem glücklichen Ehemann dreihunderttausend Gold als Mitgift mit".
"Madame Marguerite von Frankreich", murmelte Emanuel, "ist eine große Prinzessin, ich weiß; aber ich hatte immer gesagt, Herr, ich würde mein Herzogtum durch Siege und nicht durch Heirat zurückerobern".
"Aber", sagte Odoardo, "Madame Marguerite von Frankreich ist würdig, mein Herr, der Lohn Eurer Siege zu sein; und wenige Fürsten haben den Gewinn einer Schlacht und die Einnahme einer Stadt mit einer Schwester eines Königs, Tochter eines Königs, bezahlt".
"Oh", murmelte Philibert, "wie habe ich zu Beginn dieses Feldzuges mein Schwert zerbrochen!"
Dann, als Odoardo ihn mit Erstaunen ansah:
"Eure Exzellenz", sagte Leona, "würden Sie mich einen Moment mit dem Prinzen allein lassen?"
Odoardo blieb stumm und fuhr fort, Philibert mit seinen Augen zu befragen.
"Eine Viertelstunde", wiederholte Leona, "und in einer Viertelstunde wird Eure Exzellenz von Seiner Hoheit eine Antwort erhalten, wie er sie wünscht".
Der Herzog machte eine ablehnende Bewegung, die sofort durch eine stumme und flehende Geste von Leona zusammengedrückt wurde.
Odoardo verbeugte sich und ging hinaus; er hatte verstanden, dass der geheimnisvolle Page allein diesen unbegreiflichen Widerstand überwinden konnte, der sich dem Herzog von Savoyen gegen die Wünsche der Könige von Frankreich und Spanien entgegenzustellen schien.
Eine Viertelstunde später betrat Odoardo Maraviglia, vom Türsteher gerufen, das Kabinett des Prinzen von Savoyen.
Emmanuel Philibert war allein.
Traurig, aber resigniert, reichte er dem Unterhändler die Hand.
"Odoardo", sagte er, "Sie können zu denen zurückkehren, die Sie geschickt haben, und ihnen sagen, dass Emmanuel Philibert den Anteil, den die Könige von Frankreich und Spanien dem Herzog von Savoyen freundlicherweise gegeben haben, mit Dankbarkeit annimmt".
Kapitel 3: Im Haus der Königin
Dank des Geschicks der Unterhädler, begabt mit all der diplomatischen Finesse, von der man sagt, sie sei eines der Vorrechte der florentinischen oder mailändischen Rasse, und vor allem dank des Interesses, das die beiden Könige an der religiösen Wahrung des Geheimnisses hatten, war am Hofe noch nichts, abgesehen von jenen vagen Gerüchten, die große Ereignisse begleiten, von den großen Projekten bekannt geworden, die Odoardo Maraviglia dem Herzog von Savoyen soeben skizziert hatte, und deren Verwirklichung Frankreich so viel kostete.
Mit großem Erstaunen begegneten sich daher vier Tage nach dem soeben geschilderten Gespräch zwei Reiter, jeder von einem Knappen begleitet und auf entgegengesetztem Wege kommend, und erkannten den einen für den Constable von Montmorency, den man in Antwerpen gefangen glaubte, den anderen für den Herzog von Guise, den man im Lager von Compiègne vermutete.