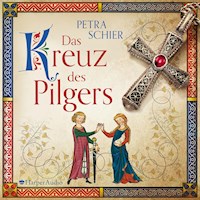9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine wahre Geschichte aus dunkler Zeit Anno 1636 ist ganz Deutschland vom Hexenwahn ergriffen. Schon einige Jahre zuvor traf es auch das beschauliche Rheinbach – eine Zeit, an die sich keiner gern erinnert. Und nun hat der Kurfürst den Hexencommissarius erneut in die Stadt beordert. Hermann Löher, Kaufmann und jüngster Schöffe am Rheinbacher Gericht, hat Angst um Frau und Kinder. Sein Weib Kunigunde gehört zur «versengten Art»: Angehörige ihrer Familie wurden damals dem Feuer überantwortet. Löher glaubt nicht an Hexerei und an die Schuld derer, die vor Jahren den Flammen zum Opfer fielen. Eine gefährliche Einstellung in diesen Zeiten. Als die Verhaftungswelle auch auf Freunde übergreift, schweigt der Schöffe nicht länger. Und schon bald beginnt für ihn und seine Frau ein Kampf gegen Mächte, die weit schlimmer sind als das, was man den Hexen vorwirft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Ähnliche
Petra Schier
Der Hexenschöffe
Historischer Roman
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadt Rheinbach nach Ansichten des 17. und 18. Jahrhunderts, dem Katasterplan von 1816 und der Beschreibung von Hermann Löher 1636
Der nuhn ein mahl das tormentiren folteren und peinigen / an den frommen / unschültigen verübt / observirt und gesehen / das wehe / wehe ruffen gehöret / das folteren betrachtet / der soll wohl anders reden / und weiß mehr davon zu sagen und zu schreiben / als einer der im Kuhlen Lust-Garten da von schreibet und traumet / wie man vermeinte Zäuberer und Zäuberinnen soll fangen / folteren / peinigen und verbrennen /
(Hermann Löher: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage der Frommen Unschültigen)
Prolog
Das Licht der Öllampe flackerte, als Hermann Löher sie auf dem Schreibpult abstellte. Schwerfällig ließ er sich auf dem gepolsterten Stuhl nieder, der ihm nun schon seit über dreißig Jahren als Sitzgelegenheit diente, wenn er seinen Geschäften nachging. Seine Knie knackten, und er stieß ein leises Ächzen aus, denn seit einigen Tagen plagte ihn ein Zipperlein im Kreuz. Er achtete nicht weiter darauf, denn wozu sich Gedanken über Dinge machen, die sich doch nicht ändern ließen? Für einen Mann von 81 Jahren war er noch erfreulich behände unterwegs. Dass ihm das Alter allmählich zusetzte, war wenig erstaunlich und erinnerte ihn vielmehr daran, dass ihm nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde verblieb. Zeit, die er nutzen musste, denn er hatte sich eine schwierige Aufgabe gestellt, die ihm bereits seit über einem Jahr viel Kraft abverlangte, sowohl körperlich als auch geistig.
Mit nicht geringem Stolz betrachtete er den imposanten Stapel dichtbeschriebenen Papiers, der sich in der offenen Truhe neben dem Pult befand. Weitere Seiten waren auf der Tischplatte verteilt, zuoberst das Blatt, an dem er gestern spät noch geschrieben hatte. Daneben lag aufgeschlagen ein Exemplar der Cautio Criminalis, die Seiten mit runden, polierten Flusssteinen beschwert, damit sie nicht von einem Windzug umgeblättert werden konnten. Auch eine Ausgabe der Heiligen Schrift hatte er stets griffbereit auf dem Pult abgelegt. Das Buch war vom vielen Gebrauch in den vergangenen Jahrzehnten stark abgegriffen, der Einband zerfleddert.
Im Regal hinter sich wusste Hermann neben dem Hexenhammer noch weitere Pamphlete verschiedener Theologen, Hexenjäger, Rechtsgelehrter sowie Gegner der Hexenverfolgung. Jedes einzelne Werk hatte er bis ins Detail studiert. Daneben Klemmhefter, in denen er seine Korrespondenz mit Pfarrer Winand Hartmann aus Rheinbach und seinem lieben Freund, dem Dominikanerpater Dr. Johannes Freilink, sammelte.
Der Morgen dämmerte gerade erst herauf; im Haus herrschte noch Stille. Hermann war als Einziger schon auf den Beinen. Seit er alt geworden war, brauchte er nur noch wenige Stunden Schlaf, sodass er die frühen Morgenstunden nutzte, um sich seinen Geschäften zu widmen oder – so wie im vergangenen Jahr – an seiner Klageschrift zu arbeiten.
Nicht mehr lange, dann war es vollbracht. Es fehlten nur noch der Appendix und die Anweisungen für den Buchsetzer und -binder und vielleicht hier und da noch ein paar Einfügungen im Text, wo er glaubte, sich nicht präzise genug ausgedrückt zu haben. Sicherheitshalber würde er ihn in den nächsten Tagen noch einmal vollständig lesen und die bereits markierten Stellen mit Zitaten und Bibelstellen untermauern.
Nachdenklich ließ er seinen Blick über die Einrichtung des Kontors wandern. Es handelte sich um einen großen, nahezu quadratischen Raum, der beinahe die Hälfte des Untergeschosses seines Wohnhauses in der Koningsstraat einnahm. Die Wände waren von Regalen gesäumt, in denen sich hauptsächlich Woll- und Tuchballen stapelten. Der Tuchhandel war schon immer sein Hauptgeschäft gewesen; nebenher belieferte er jedoch auch noch ein paar Eisenhändler, und wenn ihm ein langjähriger Geschäftspartner günstig Gewürze zum Weiterverkauf anbot, sagte er ebenfalls nicht nein.
Während es hinter den Fensterläden immer heller wurde, wanderten Hermanns Gedanken in die Vergangenheit, zu seiner geliebten Heimatstadt Rheinbach. Wie hatte es ihn entsetzt, als er vor drei Jahren von dem verheerenden Brand erfahren hatte, durch den der Großteil der Häuser in Schutt und Asche gelegt worden war. Eine Strafe Gottes, so war er sich sicher, für die schrecklichen, unaussprechlichen Dinge, die sich Jahre zuvor ereignet hatten. Nichts war dort seither mehr so, wie es einst gewesen.
Diese Schreckensnachricht war mithin der Auslöser für Hermann gewesen, seine Wemütige Klage zu verfassen. Niemals durfte ein solches Unrecht sich wiederholen. Doch wie sollten die Menschen dies begreifen, wenn nicht jemand ihnen berichtete, wie es gewesen war und welcher Mittel die falschen Hexenrichter sich bedient hatten, um ihre finsteren Pläne durchzusetzen?
Hermann schmerzte das Herz in der Brust, als die Bilder der lang vergangenen Ereignisse vor seinem inneren Auge aufstiegen. Tränen traten ihm in die Augen, doch er wischte sie schnell fort. Getrauert und bedauert hatte er lange genug. Nun war es an der Zeit zu handeln.
Entschlossen griff er nach dem Manuskript in der Truhe, um es vor sich auf dem Schreibpult abzulegen. Es fiel ihm nicht leicht, all die Ereignisse noch einmal zu durchleben, sie schwarz auf weiß in seiner eigenen Handschrift vor sich zu sehen. Doch die Gewissheit, dass er das Richtige tat, dass die Nachwelt ein Recht darauf hatte, die Wahrheit zu erfahren, gab ihm die Kraft, das vorläufige Deckblatt zur Hand zu nehmen. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Ritzen der Fensterläden blinzelten, öffnete er eines der Fenster und begann zu lesen:
Hochnöthige Unterthanige Wemütige Klage der Frommen Unschültigen;
Worin alle Hohe und Niedrige Oberkeit / sampt ihren Unterthanen klärlich / augenscheinlich zu sehen und zu lesen haben / wie die arme unschultige fromme Leute durch Fahm- und Ehrenrauben von den falschen Zauber-Richtern angegriffen / durch die unchristliche Folter- und Pein-Bank von ihnen gezwungen werden / erschreckliche / unthunliche Mord- und Todt-Sünden auff sich selbsten und
anderen mehr zu liegen und sie ungerechtlich / falschlich zu besagen.
1. Kapitel
Dan es ist kein lügen so schnel / Und die warheit vervolgt sie wel. Von diesen Famrauben und besagen ist niemant befreyet /
Die Frühsommersonne stand hoch am wolkenlosen Himmel. In den Straßen des kleinen Städtchens Rheinbach herrschte mittägliche Stille, die meisten Bewohner hatten sich ein schattiges Plätzchen gesucht, um der flirrenden Hitze zu entfliehen.
Hermann Löher war auf dem Weg von seinem Wohnhaus in der Nähe des Dreesertores zu einer außerordentlichen Sitzung der Schöffen im Bürgerhaus. Ein ums andere Mal wischte er sich mit dem Ärmel seines rotbraunen Wamses den Schweiß aus dem Gesicht. Beinahe konnte man es schon als Zumutung empfinden, die Zusammenkunft des Stadtgerichts auf den hohen Mittag zu legen. Nicht nur, weil die ungewöhnliche Sommerhitze Mensch und Tier gleichermaßen zusetzte, sondern auch, weil Hermann eigentlich andere Dinge zu tun hatte. In seinem Kontor warteten Woll- und Leinenballen darauf, sortiert und katalogisiert zu werden. Ganz zu schweigen von der Korrespondenz mit den Eisenlieferanten, die schon seit Tagen unbeantwortet auf seinem Schreibpult lag. Erst vor wenigen Stunden war er von einer mehrtägigen Handelsfahrt nach Trier heimgekehrt. Auf dem Rückweg hatte er noch einen Schlenker über Münstereifel – seinen Geburtsort – gemacht, um seine Schwester Luise zu besuchen, die vor drei Wochen mit ihrem dritten Sohn niedergekommen war. Nun war es dringend an der Zeit, sich wieder um die heimischen Geschäfte zu kümmern. Wie sehnte er bereits den Tag herbei, da sein ältester Sohn Bartholomäus alt genug sein würde, wenigstens einen Teil der anfallenden Arbeiten selbständig zu erledigen. Doch der Junge war gerade erst zwölf Jahre alt und noch in der Lehre, deshalb hatte Kunigunde in Hermanns Abwesenheit ein Auge aufs Kontor gehabt, soweit es ihr neben der Hausarbeit und der Betreuung der sechs Kinder möglich war.
Als umso ärgerlicher empfand er, dass er so kurz nach seiner Rückkehr Kuni schon wieder verlassen musste, um sich den städtischen Gerichtsangelegenheiten zu widmen. Nicht einmal sein Mittagsmahl hatte er in Ruhe zu sich nehmen können.
Der vom Kurfürsten Ferdinand von Bayern höchstselbst eingesetzte Hexenkommissarius Dr. Franz Buirmann hatte zu der Schöffenversammlung eingeladen, und dieser Mann scherte sich nicht im Geringsten um die Befindlichkeiten der einzelnen Schöffen.
Hermann war nicht wohl bei dem Gedanken an die Worte des Gerichtsboten Martin Koch, als dieser ihm am späten Vormittag von der Sitzung berichtet hatte. «Der ehrenwerte Kommissarius Dr. Buirmann beruft das hohe Gericht der Stadt Rheinbach ein, denn es wurde eine Weibsperson der Hexerei beschuldigt.»
Auf Löhers erschrockene Nachfrage, wer denn die besagte Weibsperson sei, hatte Koch keine Antwort gegeben. Er sei zur Verschwiegenheit verdonnert worden. Das verhieß nichts Gutes. Schon seit Monaten loderten in den Dörfern rings um Rheinbach die Scheiterhaufen. Nicht nur Dr. Buirmann, sondern auch andere Hexenkommissare, wie Dr. Schultheiß und Dr. Möden, führten die Prozesse mit gnadenloser Strenge. Grundsätzlich war dies natürlich zu begrüßen, denn die Buhlen und Gespielinnen des Gottseibeiuns richteten offenbar immer wieder große Schäden an Land, Leuten und Vieh an, wenn sie auf ihren Zusammenkünften zauberten und für Missernten, Seuchen und böse Unfälle sorgten. So zumindest argumentierten die Befürworter der Hexenprozesse für das harte, unbarmherzige Vorgehen gegen Männer und Frauen, die des Zauberns und der Buhlschaft mit dem Teufel bezichtigt wurden.
Hermann hatte selbst noch niemals eine Hexe gesehen und war sich nicht ganz sicher, was er von all der Aufregung halten sollte. Ihm fehlte die Zeit, sich näher mit den Prozessen in den umliegenden Ortschaften zu befassen, und besonders belesen war er auch nicht. Zwar hatte er in der Schule das Lesen, Schreiben und – besonders wichtig – auch das kaufmännische Rechnen zur Genüge gelernt. Auch die Bibel hatte er in Auszügen gelesen, doch sprach er weder Latein noch sonstige Fremdsprachen, und auch in den sieben Künsten fehlte ihm eine Ausbildung. Wozu hätte er die auch gebraucht? Er hatte bereits mit fünfzehn Jahren fest an der Seite seines Vaters Gerhard das Kaufmannskontor geführt. Er besaß einen wachen Verstand, eine rasche Auffassungsgabe und ein gutes Gespür für Geschäfte – alles wichtig und nützlich im alltäglichen Umgang mit Lieferanten und Kunden. Deshalb hatte er das Kontor schon zu Lebzeiten seines Vaters sehr erfolgreich gemacht und später sogar noch ausgebaut. Seinem Vermögen und Einfluss war es zu verdanken, dass er sogar für ein Jahr Bürgermeister der Stadt Rheinbach gewesen war und vor wenigen Monaten dann als jüngstes Mitglied, mit 36, in den Schöffenrat berufen worden war. Was könnte er sich noch mehr wünschen?
Zwar war er in Rechtsangelegenheiten wenig bewandert, doch seinen Mitschöffen ging es kaum anders. Keiner von ihnen hatte Recht und Juristerei studiert – bis auf den ehrenwerten und klugen Vogt Dr. Schweigel, der ein guter Freund von Hermanns Vater gewesen war. Alle übrigen Schöffen, ebenso wie die Ratsherren, urteilten weitgehend nach überliefertem und hergebrachtem Recht und aus der eigenen Lebenserfahrung heraus. Da Rheinbach ein ruhiges, blühendes Städtchen war, gab es auch kaum einmal mehr, als Nachbarschaftszwistigkeiten abzuurteilen. Seit über hundert Jahren war in Rheinbach niemand mehr hingerichtet worden, bis … ja, bis vor einigen Wochen die Magd des Großbauern Hilger Lirtz von mehreren Bürgern der Zauberei bezichtigt worden war. Sie war zusammen mit einer alten Frau namens Grete Hardt der Hexerei überführt und verbrannt worden. Da die Rheinbacher Schöffen zunächst gezögert hatten, einen Hexenprozess anzustrengen, war ihnen von oberster Stelle in Bonn ein gewisser Dr. Schultheiß als Berater zur Seite gestellt worden. Er hatte denn auch beide Frauen recht schnell dazu gebracht, ihre Untaten einzugestehen. Wenig später hatten die Rheinbacher Bürger erfahren, dass der hochgeschätzte Dr. Franz Buirmann, ein Schöffe des Kölner Hochgerichts, hergeschickt würde, um sich des Problems der sich ausbreitenden Hexensekte anzunehmen und den Rheinbacher Schöffen mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen.
Hermann erinnerte sich dunkel daran, diesem Buirmann vor vielen Jahren schon einmal begegnet zu sein. Damals war dieser aber noch ein unbedeutender Student der Juristerei gewesen, ohne große Aussicht auf Macht und Einfluss. Er war Hermann nur deshalb im Gedächtnis geblieben, weil er so ein hässlicher, dürrer Kerl mit spitzem Kinn und hervorquellenden Augen war, der sich für wunders wie wichtig hielt. Kaum älter als Hermann, hatte er sich ebenfalls auf Brautschau befunden und ein Auge auf das jüngste Kemmerling-Mädchen geworfen. Die Älteste – Anna – war mit dem jetzigen Schöffen Gottfried Peller verheiratet. Marianne hatte den unansehnlichen Dr. Gortzis, wie sie ihn nannte, voller Abscheu abgewiesen und sich über ihn lustig gemacht. Sie hatte gut daran getan, denn später ehelichte sie einen reichen und nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Wesen her weit angenehmeren Advokaten. Buirmann hatte schließlich nach etlichen weiteren Körben durch die Töchter hochgestellter Familien ein mittelloses Mädchen aus Bonn geheiratet, dessen Vater sich mit dem Kochen von Salpeter mehr schlecht als recht den Lebensunterhalt verdiente. Gehässige Zeitgenossen behaupteten, solch eine Partie sei durchaus passend für den Sohn eines einfachen Trommlers.
Doch Buirmann war ehrgeizig. Er hatte es inzwischen auch ohne angeheiratetes Vermögen in das Kölner Hochgericht geschafft und sich darüber hinaus einen Namen als Spezialist für Hexenprozesse gemacht. Da er sich im Gegensatz zu Hermann – oder sonst jemandem aus dem Rheinbacher Stadtrat oder Schöffenkolleg – tagtäglich mit solchen Dingen beschäftigte und schon viele Hexen überführt hatte, ging Hermann davon aus, dass der Mann wohl wusste, was er tat. Immerhin hatten alle Angeklagten ihre Frevel gestanden.
Dennoch verspürte Hermann ein ungutes Gefühl in der Magengrube. Von der Stadtmauer oder den Wachtürmen aus konnte man manchmal bei gutem Wetter die Rauchsäulen der Scheiterhaufen aus Meckenheim, Flerzheim und anderen umliegenden Ortschaften sehen. Er war sich nicht sicher, ob er froh darüber sein sollte, dass das Brennen nun offenbar auch in Rheinbach weitergehen würde. Die Hinrichtung der beiden armen Frauen neulich hatte ihm ziemlich zugesetzt. Niemals zuvor hatte er einen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen gesehen. Noch Tage nach der Hinrichtung hatte er sich eingebildet, den Gestank des verbrannten Fleisches in der Nase zu haben.
Wenige Schritte vor dem Bürgerhaus, das sich in der Nähe der Rheinbacher Burg befand, blieb Hermann stehen und wischte sich erneut den Schweiß aus dem Gesicht. Irgendwo sang ein Vogel tapfer gegen die Mittagshitze an. Auf einem niedrigen Mäuerchen an der staubigen Straße kauerte die schwarz-weiß gescheckte Katze der Kramerin und schien die Sonne zu genießen wie eine Eidechse. «Na, Nicolette, du scheinst ja die Einzige zu sein, der dieses Wetter zusagt. Machst wohl eine Pause vom Mäusejagen, wie?» Schmunzelnd trat Hermann auf sie zu und streichelte ihr über das weiche, warme Fell. Die Katze reckte ihr Köpfchen und schnurrte genüsslich.
Mit der anderen Hand zog Hermann seine Taschenuhr hervor. Er war überpünktlich, eigentlich sogar noch ein bisschen zu früh. Vielleicht sollte er sich erst ein wenig in den Schatten setzen und verschnaufen. So erhitzt und schweißnass machte er gewiss keinen guten Eindruck, und als jüngster der Schöffen war er genau darauf sehr bedacht. Er blickte sich um und hatte gerade ein schattiges Plätzchen unter einer ausladenden Linde ausgemacht, als der markerschütternde Schrei einer Frau ihn zusammenfahren ließ.
Erschrocken drehte er den Kopf und versuchte herauszufinden, woher der Klageruf gekommen war.
Wieder ertönte ein Schrei, jämmerlich und lang gezogen. Die Katze sprang auf, fauchte und hastete in großen Sätzen davon.
Kam das Wehklagen aus dem Bürgerhaus? Befragte man die neue Zauberin womöglich schon? Noch bevor er weitere Schlüsse ziehen konnte, trat Martin Koch, der kleine, hagere Gerichtsbote, aus dem Bürgerhaus. Sein dünnes, schulterlanges braunes Haar lag ihm strähnig um den Kopf.
«Herr Löher, da seid Ihr ja. Kommt, die anderen sind alle schon versammelt, und Dr. Buirmann wartet nur noch auf Euch und Dr. Schweigel.» Koch gestikulierte in Richtung des oberen Geschosses, in dem sich der Gerichtssaal, die Peinkammer sowie die Schöffenstube befanden, während die unteren Räume von Amtsstube und Ratssaal eingenommen wurden. Hermann folgte dem Boten schweigend.
Doch als ein weiterer qualvoller Schrei die Stille zerriss, blieb Hermann stehen. «Koch, wer schreit denn da so gottserbärmlich? Ist jemand in Not?»
Der Gerichtsbote drehte sich um, auf den Lippen ein schiefes Grinsen. «In Not? Ja, bei Gott, das sollte sie sein, die Erzzauberin. Die Hexe ist es natürlich, die Ihr da hört, Herr Löher. Der Henker hat ihr die Beinschrauben angelegt, damit sie endlich gesteht.»
«Was? Die Beinschrauben?» Hermann erschrak und spürte, wie ihm trotz der Hitze ein kalter Schauer übers Rückgrat lief. «Aber das ist doch … Das geht doch nicht. Ist das nicht gegen das Gesetz? Wenn eine Hexe festgenommen wird, muss sie zuerst ordentlich befragt werden. Der Herr Kommissar kann doch nicht einfach …»
«Ach was, darüber sind sie da drinnen schon längst hinaus. Ihr wart ja nicht in der Stadt, als man die Alte festgenommen hat.» Unbefangen und offenbar durchaus zufrieden mit den Vorgängen deutete Koch in Richtung der Treppe. «Dr. Buirmann hat sie schon seit drei Tagen oder so in der Peinkammer, weil sie so verstockt war, obwohl die Nadelprobe eindeutig bewiesen hat, dass sie eine Hexe ist. Dann hat sie zwar gestanden, aber sie weigert sich noch immer, ihre Mithexen zu verraten. Kommt, beeilt Euch, der Kommissar wartet nicht gerne.»
Das ungute Gefühl, welches Hermann bereits auf dem Weg hierher beschlichen hatte, verknäuelte sich in seiner Magengrube zu einem schmerzhaften Knoten, als er ins Obergeschoss hinaufstieg. In der Schöffenstube standen seine Kollegen stumm im Halbkreis versammelt: Herbert Lapp, der Älteste mit seinen siebenundsechzig Jahren, groß, schlank und mit eisgrauem Haar, drehte nervös seinen breitkrempigen Filzhut in den Händen. Gottfried Peller war ebenfalls schon über sechzig und leicht beleibt, aber seine Haltung ähnelte mehr der eines Kämpfers, der sich überlegte, wie und wann er am besten zum ersten Schlag ausholen sollte. Er schaute grimmig drein. Jan Thynen war erst Mitte vierzig, Johann Bewell zehn Jahre älter. Fast hätte man die beiden als Brüder ansehen können, da sie beide blondes Haar hatten und eine schlanke Statur. Doch Thynens Gesichtszüge waren kantiger, und seine Augen lagen weiter auseinander, was ihm zusammen mit seinem spitzen Kinn ein frettchenhaftes Aussehen verlieh.
Hermann blieb in der Tür stehen und blickte mit einer Mischung aus Empörung und Neugier in die schweigsame Runde. Dabei wurde ihm bewusst, dass zwei der Schöffen fehlten: Dietrich Halfmann und Richard Gertzen.
Erst auf den zweiten Blick erkannte Hermann den Amtmann Heinrich Degenhardt Schall von Bell, einen mittelgroßen, breitschultrigen Mann in farbenfrohem Wams und brauner, ausgepolsterter Kniehose. Statt eines wesentlich bequemeren Spitzenkragens trug er trotz der Hitze eine breite, mühlsteinförmige Halskrause, die ihm wohl Autorität verleihen sollte. Eigentlich war dies gar nicht nötig, war der Amtmann doch direkt vom Kurfürsten eingesetzt und oberster Beamter in Rheinbach und allen umliegenden Ortschaften. Sein dichtes braunes Haar lag in ordentlichen Wellen um seinen Kopf, der Kinnbart war sauber gestutzt, der passende Filzhut mit Pfauenfeder lag auf dem Schreibpult, hinter dem er sich niedergelassen hatte.
Bei Hermanns Eintreten erhob er sich. «Guten Tag, Herr Löher, schön, dass Ihr pünktlich seid. Wie …» Er stockte, als ein schier unmenschlicher Schrei aus einem der hinteren Räume erschallte. Danach war ein leiseres Schluchzen zu vernehmen, und er fuhr ungerührt fort: «Wie Ihr durch den Gerichtsboten Koch bereits erfahren habt, sind wir heute hier zusammengekommen, um einer gefährlichen Erzzauberin den Prozess zu machen. Leider ist sie nach wie vor verstockt, was ihre Mitzauberinnen angeht, deshalb haben wir Meister Jörg angewiesen, ihr noch einmal die Beinschrauben anzulegen.»
«Wie konntet Ihr sie foltern, obgleich nicht alle Schöffen anwesend waren?» Hermann trat einen Schritt vor, sah einen Schöffen nach dem anderen an. Alle wichen seinem Blick aus, teils betreten, teils gelangweilt. Peller war der Einzige, der den Kopf hob und gleichzeitig sichtlich hilflos die Achseln zuckte.
«Wollt Ihr mir wohl sagen, wie Ihr dazu kommt, mein Vorgehen anzuzweifeln?» Dr. Franz Buirmann erschien in der Tür. «Ich bin immerhin hergeschickt worden, um Euch bei der Prozessführung gegen die unheiligen Zauberer mit Rat und Tat beizustehen. Was wisst Ihr schließlich davon? Ich habe die Juristerei ausführlich studiert, und beim ehrenwerten Dr. Schultheiß steht geschrieben, dass zwei Schöffen als Zeugen der Folter in dringenden Fällen vollkommen ausreichen. Wozu ein ganzes Gericht damit aufhalten, vor allem, wenn gute Männer wie Ihr, Herr Löher, doch eigentlich Wichtigeres zu tun hätten, nicht wahr? Oder wollt Ihr mir sagen, Eure Geschäfte führten sich von selbst?»
Dr. Buirmann war zwar älter geworden, doch die Jahre hatten seiner Unansehnlichkeit keine Milderung zuteilwerden lassen. Noch immer war er dürr, die Gesichtszüge hager, das Kinn mit dem obligatorischen schwarzen Bärtchen spitz zulaufend und die Augen hervorquellend und gleichzeitig wachsam. Hermann kam er vor wie eine Kreuzung aus Ziege und Kröte, und er musste sich zusammenreißen, um diesen Gedanken zu verdrängen. Er wollte gerade antworten, doch der Kommissar hatte sich bereits dem Amtmann und den übrigen Schöffen zugewandt.
«Die Alte ist verstockt, dass es einen frommen Christenmenschen graust! Ich verfüge deshalb, dass Meister Jörg den Grad der Folter noch einmal verstärkt. Wir können nicht zulassen, dass die Hexe weiterhin schweigt und nicht nur ihre Seele dem Teufel überlässt, sondern darüber hinaus auch noch die Bürger dieser schönen Stadt gefährdet, indem sie die Namen ihrer Mitgespielinnen und Komplizen länger verschweigt. Folgt mir hinüber in die Peinkammer und überzeugt Euch selbst von der Garstigkeit, mir der sie sich dagegen wehrt, ihre Seele und die der anderen Übeltäter zu erretten.» Seine Stimme war mit jedem Wort lauter geworden und wurde von ausholenden Gesten begleitet. Schon wandte er sich ab, um dem kleinen Raum hinter dem Gerichtssaal zuzustreben, in dem die Gerätschaften für die peinliche Befragung aufbewahrt wurden.
«So wartet doch!», rief Hermann. Er begriff nicht, weshalb keiner der anderen Schöffen protestierte. «Wollt Ihr uns nicht erst einmal verraten, wen Ihr der Tortur unterzieht?»
Neben ihm hüstelte Gottfried Peller, Herbert Lapp räusperte sich verlegen.
Buirmann drehte sich mit einem unangenehm freundlichen Lächeln zu ihm um. «Verzeiht, Herr Löher, meine Nachlässigkeit. Es handelt sich um die Witwe Christina Böffgens. Und nun folgt mir, Ihr guten Herren.»
«Wie bitte?» Vor Schreck hätte Hermann sich beinahe verschluckt. «Ihr bezichtigt die alte Böffgens? Das ist doch Unfug! Sie muss sofort freigelassen werden. Eine alte, fromme Frau wie sie, großer Gott! Sie hat noch niemals jemandem ein Leid getan, und jetzt soll sie auf einmal zaubern können?»
«Freilassen, eine geständige Hexe? Niemals!» Wütend fuhr Buirmann herum und starrte Hermann an. «Wagt es nicht noch einmal, in diesem Ton zu mir zu sprechen, Hermann Löher. Ich bin vom Kurfürsten höchstselbst nach Rheinbach geschickt worden, um des Hexengezüchts Herr zu werden. Das Weib wurde von mehreren Zeugen beschuldigt, so etwas kann und darf ich nicht ignorieren. Die Alte wurde peinlich befragt, und zwar so lange, bis sie alles gestanden hat, so wahr ich hier stehe. Gott ist mein Zeuge, dass mir noch niemals eine Teufelsbuhle entwischt ist. Ganz gleich, wie verstockt sie auch sein mögen – früher oder später gestehen sie alle. Denn nur auf diese Weise erretten sie ihre beklagenswerten Seelen vor dem ewigen Höllenfeuer.»
«Aber die Böffgens doch nicht!», wagte Hermann erneut einzuwenden. «Das muss ein Irrtum sein. Sie hat über zwanzig Jahre lang tugendsam und getreu mit ihrem Ehemann zusammengelebt und führt seit seinem Tode den Tuchhandel erfolgreich allein weiter. Kinder waren den beiden nicht vergönnt, deshalb haben sie einen großen Teil ihres Vermögens der Kirche gestiftet und den Armen und Bedürftigen gespendet. Sogar einen hübschen kleinen Altar hat die gute Frau nach Peter Böffgens Tod …»
«Seht Ihr denn nicht die Scheinheiligkeit, mit der sie sich all die Jahre hinter diesen ach so frommen Gesten versteckt hat?», unterbrach Buirmann ihn erbost. An seinem Hals war eine Ader hervorgetreten und pochte heftig; sein Gesicht hatte sich rötlich verfärbt. «Genau das ist es doch, was uns an den Untaten der Zauberer so anwidert. Vordergründig führen sie ein allzu mustergültiges Leben, aber in Wahrheit sind sie alle des Teufels. Ausräuchern müssen wir die Hexenbrut, mit Stumpf und Stiel vernichten. Hört auf mich, Ihr guten Männer, und lasst Euch nicht von angeblich frommen Taten blenden. Wenn Ihr wie ich bereits vielfach Zeuge von Geständnissen der unaussprechlichsten Sünden geworden wäret, wüsstet Ihr, dass man nichts unversucht lassen darf, um sie vollständig auszurotten, diese Zauberischen.» Beinahe wild drehte Buirmann sich erneut um und stürmte auf die Peinkammer zu. Seine weiße Halskrause wippte bei jedem Schritt auf und ab. Der Amtmann folgte ihm entschlossen.
Die Schöffen sahen einander mehr oder weniger betreten an.
«Wir sollten ihm wohl besser folgen», brach Herbert Lapp schließlich das Schweigen und bewegte sich zögernd auf den Raum zu, in dem der Kommissar verschwunden war.
«Wie konntet Ihr es zulassen, Herr Lapp, dass sie die Böffgens einkerkern?» Hermann hielt seinen linken Arm fest. «Sie ist keine Hexe, um Gottes willen. Ihr werdet den Anschuldigungen doch wohl keinen Glauben schenken?»
In Lapps Miene war deutliches Unbehagen. «Der Kommissar erklärte bei ihrer Verhaftung, sie sei mehrfach besagt worden, und die Nadelprobe hat bewiesen, dass es wahr ist. Es kam kein Blut aus den Stichen. Da hat er sie peinlich befragt, und sie hat alles gestanden. Was sollten wir denn tun?»
«Aber ist es nicht so, dass er eigentlich nur hier ist, um uns zu beraten?», wandte nun auch Peller zweifelnd ein. «Stattdessen hat er den gesamten Prozess einfach an sich gerissen.»
«Ich weiß, ich weiß. Er behauptet, so würde es überall gemacht und dass wir sowieso keine Ahnung von den geltenden Gesetzen und Regelungen in Hexenprozessen hätten.» Lapp zuckte hilflos die Schultern. «Im Grunde stimmt das ja auch.»
«Aber gibt es ihm das Recht, einfach eine arme alte …» Löher brach ab, als ein erneuter Schmerzensschrei zu ihnen herausgellte.
«Gott, steh uns bei», murmelte Lapp und betrat die Peinkammer.
Hermann hastete ihm nach, hinter sich die Schritte der übrigen Schöffen. Er hielt unwillkürlich den Atem an. Es war warm hier drinnen, denn in einem großen Eisenbecken glühte ein Feuer. Gleichzeitig mit der Wärme schlug ihm der Geruch von Schweiß und Blut in die Nase, vermischt mit einer säuerlichen Note, die vermutlich von Erbrochenem herrührte.
Bisher hatte dieser Raum hauptsächlich als Lager für allerlei Utensilien und Gerichtsakten gedient, doch für die ersten Hexenprozesse gegen die Magd des Hilger Lirtz und die alte Grete Hardt war er vom Henker leergeräumt und seinem neuen Zweck zugeführt worden. Nun stand in der Mitte der hölzerne Peinstuhl mit den Eisenschnallen an den Armlehnen und den beiden Stangen links und rechts der hohen Rückenlehne, an denen die Arme des Angeschuldigten hochgebunden werden konnten. An der linken Wand hingen jetzt – zur Abschreckung und Verdeutlichung der bevorstehenden Qualen – diverse Messer, Haken und Gerätschaften, von denen Hermann nicht einmal wusste, wozu sie dienten. Allen waren spitze Zähne und Klingen gemein, die sich bei korrekter Anwendung auf die eine oder andere Art in das Fleisch bohren würden. Auch eine Maulsperre und ein in der Größe verstellbares eisernes Halsband mit nach innen gerichteten Zacken waren vorhanden sowie diverse Ketten und Seile. Auf dem Tisch unter einem der Fenster lag neben den Daumenschrauben ein Krokodilsmaul, das von frischen Blutflecken übersät war. An der Decke gab es einen Flaschenzug. Die gesamte Kopfseite des Raumes nahm ein großer, rechteckiger Tisch mit zehn Stühlen ein, der als Richtbank diente.
«Heilige Muttergottes», entfuhr es Hermann, als er Christina Böffgens in sich zusammengesunken auf dem Peinstuhl sitzen sah. Oder vielmehr das, was er für die alte Frau hielt. Man hatte ihr das Kopfhaar bis auf die Haut geschoren, wie auch sämtliches Körperhaar. Dass der Henker und seine Helfer mit den Rasierklingen nicht sonderlich zaghaft vorgegangen waren, konnte man an mehreren blutigen Kratzern und Schnitten an den Armen und Beinen der alten Frau erkennen. Der dünne, fleckige graue Kittel, in den man sie gesteckt hatte, bedeckte ihren Körper nur sehr fadenscheinig und gab den Blick auf ihren Körper auf unzüchtigste Weise preis.
Hermann hatte zuerst gedacht, sie sei ohnmächtig. Doch nun hob sie den Kopf und stierte erst Buirmann, dann nacheinander die Schöffen aus tief in den Höhlen liegenden Augen an. Ihr ehemals sanftmütiges Gesicht mit dem fröhlichen Lächeln war zu einer hässlichen Grimasse verzogen, ihre Lippen blutig gebissen, die Wangen von schmutzigen Flecken übersät.
Hermanns Magen hob sich, als er das volle Ausmaß ihres Elends erfasste. Er spürte, wie ihr Blick an ihm hängen blieb, konnte sich jedoch nicht dazu durchringen, ihn zu erwidern. Was hatten sie dieser armen Frau nur angetan? Der Frau, die mit seinem Vater und seiner Mutter immer so freundschaftlichen Umgang gepflegt hatte. Die ihm und seinen Geschwistern früher oft Gebäck zugesteckt oder im Herbst erlaubt hatte, Äpfel von den Bäumen hinter ihrem Haus zu pflücken. Die gerne ausgeholfen hatte, wenn eine Nachbarin jemanden benötigte, der auf den Nachwuchs aufpasste, und die sogar erst vor kurzem einer jungen, mittellosen Braut das Geld für eine kleine Aussteuer geschenkt hatte.
Nun waren ihre Finger blau und schwarz verfärbt, wo man ihr die Fingernägel herausgerissen hatte. Die Daumen waren vollkommen unförmig und geschwollen von den Schrauben. Ihre Beine steckten in speziell für sie angepassten Beinschrauben. Blut quoll zwischen den metallenen Schienen hervor.
Meister Jörg, der vierschrötige Rheinbacher Henker, war beim Eintreten des Kommissars zur Seite getreten, sodass der Frau eine kurze Atempause gewährt war.
«Das ist ja entsetzlich», hörte Hermann eine Stimme hinter sich. Johann Bewell trat ein Stück vor und bekreuzigte sich.
«Entsetzlich?», echote Buirmann sogleich. Offenbar hatte er ausgezeichnete Ohren, denn Bewell hatte sehr leise gesprochen. «Das ist es in der Tat. Seht sie Euch an, Ihr guten Schöffen, und lernt, wie man eine Hexe dazu bringt, ihre Übeltaten einzugestehen.» Er trat auf Christina Böffgens zu, umfasste grob ihr Kinn und zwang sie, den Kopf zu heben. «Nun, Christina, wie steht es?» Seine Stimme war plötzlich sanft und freundlich. «Bist du nun endlich bereit, die Namen deiner Mitzauberer zu bekennen? Es wird allmählich Zeit, findest du nicht? Oder soll Meister Jörg die Beinschrauben noch ein wenig fester anziehen? Die Stiefelchen passen dir, meine ich, noch nicht so ganz.» Er lächelte mild, als er ihr in die Augen blickte.
Christinas Mund öffnete und schloss sich mehrmals, doch es kam kein Ton heraus. Buirmanns Lächeln verbreiterte sich noch eine Spur, und er beugte sich weiter zu ihr hinab. «Ja? Du musst lauter sprechen, Christina, damit wir dich alle hören können.»
Hermann starrte widerwillig gebannt auf die alte Frau und den Hexenkommissar. Dann schrak er zusammen, als ihr waidwunder Blick ihn erneut traf, ihn fixierte.
«Ich bin keine Hexe», sagte sie mit überraschend fester Stimme. «Hermann Löher, Johann Bewell, Ihr kennt mich doch. Löher, Euch habe ich bereits auf meinen Knien geschaukelt, wenn Eure Mutter mit Euch und Euren Geschwistern zu Besuch kam. Helft mir doch in meinem Elend!»
Hermann spürte, wie sich seine Kehle zusammenschnürte und ihm der Atem stockte. Schon wollte er etwas antworten, doch ein Wutschrei Buirmanns hielt ihn davon ab. «Was sagst du da, alte Erzhexe?», rief er und holte aus. Er schlug jedoch nicht zu, sondern ballte nur die Hände zu Fäusten. «Erdreistest du dich etwa, dein Geständnis von gestern zu widerrufen? Wie kannst du es wagen?»
«Ja, ich widerrufe», antwortete Christina und blickte entschlossen zu ihm hoch. «Ihr habt mich mit Euren gemeinen Marterwerkzeugen gezwungen, furchtbare Dinge zu bekennen, die ich in Wahrheit nie getan habe. Noch niemals im Leben habe ich gezaubert!»
Hermann schluckte an einem Kloß, der sich in seiner Kehle gebildet hatte. Wo war er hier bloß hineingeraten? Sah denn niemand, wie irrsinnig die Annahme war, Christina Böffgens sei eine Hexe? Am liebsten hätte er sie auf der Stelle losgebunden.
«Das ist ja ungeheuerlich», tobte Buirmann und begann, in der Peinkammer auf und abzugehen. Dicht vor Hermann blieb er stehen. «Seht Ihr, was ich meine, wenn ich sie verstockt nenne? Weiß der Himmel, welche Teufel ihr über Nacht beigewohnt und ihr diese Arglist eingeflüstert haben.» Er fuhr zum Henker herum. «Dreht die Beinschrauben fester.»
Meister Jörg kratzte sich am Kopf, wo der blonde Haaransatz bereits weit zurückgewichen war. «Wie Ihr wünscht.» Er bückte sich und drehte an den Schrauben, bis Christina erst ein Stöhnen, dann einen jämmerlichen Schrei ausstieß. Sie biss sich auf die Unterlippe, bis Blut floss. «Ihr könnt mir die Beine brechen», stieß sie hervor, «aber ich werde mein Gewissen nicht mit einer Lüge belasten. Ich bin keine Hexe.» Ihre Stimme zitterte und wurde mit jedem Wort schwächer. Aus ihren Wangen war alles Blut gewichen. Ihr Atem ging in flachen, unregelmäßigen Stößen.
Hermann spürte bittere Galle in seiner Kehle aufsteigen.
«Bist du nicht?» Erbost baute Buirmann sich vor ihr auf. «Das werden wir ja sehen.» Mit der rechten Hand winkte er den Henker zu sich. «Bindet sie an die Strecke.» Er deutete auf den Flaschenzug unter der Decke.
«Jetzt?» Meister Jörg kratzte sich erneut am Kopf. «Ähm, seid Ihr sicher? Ich meine, sie ist schon ziemlich geschwächt, und …»
«Seid Ihr taub?», herrschte der Kommissar ihn an. «Die Strecke, jetzt sofort! Ich lasse mir doch nicht nachsagen, dass mich eine Zauberische an der Nase herumführt.»
«Aber ich weiß nicht, wie lange sie das durchhält», wagte der Henker einzuwenden.
«Ach was.» Buirmann winkte ab. «Die Alte ist clever und verschlagen. Sie will uns mit Hilfe teuflischer Kräfte weismachen, dass sie schwach und unschuldig ist. Ich aber werde Euch das Gegenteil beweisen. Los jetzt, tut Eure Arbeit.»
«Also gut, wie Ihr meint.» Mit sichtlichem Unbehagen löste der Henker erst die Beinschrauben, dann die Schellen, mit denen Christinas Handgelenke an den Peinstuhl gefesselt waren. «Los, hoch mit Euch», sagte er in durchaus freundlichem Ton und schleppte die Frau mehr zu dem Streckgerät, als er sie führte. Christina konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Aus Wunden an ihren Waden und Schienbeinen quoll das Blut, die Haut war blau und violett verfärbt.
«Müssen wir das wirklich alles mit ansehen?», fragte Johann Bewell zaudernd. «Bisher hat es doch auch gereicht, wenn Thynen und Halfmann bei der Folter zugegen waren.»
«Wo steckt Halfmann überhaupt?», fragte Peller in Richtung des Amtmannes, der bisher schweigend in der Nähe der Tür gestanden und alles mit steinerner Miene verfolgt hatte.
Heinrich Degenhardt Schall von Bell bedachte ihn mit einem kühlen Lächeln. «Die Schöffen Halfmann und Gertzen sind zusammen mit dem Gerichtsschreiber Melchior Heimbach in einer wichtigen Gerichtsangelegenheit unterwegs und deshalb heute von der Anwesenheit während des Prozesses freigestellt.»
«Was für eine wichtige Angelegenheit soll das denn sein?» Peller zuckte sichtlich zusammen, als Christina wieder ein lautes Stöhnen ausstieß.
Der Henker hatte ihr die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und den Strick an dem Seil befestigt, das über den Flaschenzug führte. Nun konnte er mit Hilfe einer Winde ihre Arme langsam nach hinten und oben ziehen, während sie mehr schlecht als recht auf ihren zerschundenen Beinen stand.
Der Amtmann warf ihr einen kurzen Blick zu, dann antwortete er dem Schöffen: «Sie stellen wichtiges Beweismaterial sicher.»
Hermann drehte sich zu ihm um. «Was denn für Beweismaterial?»
«Das werdet Ihr sehen, wenn sie es hergebracht haben.»
Christina stieß ein langes, qualvolles Ächzen aus, als der Henker auf Buirmanns Wink hin ihre Arme noch weiter nach oben zog. Ihre geschundenen Schultergelenke knackten.
«Weiter», befahl der Kommissar.
«Sie hält sich nicht mehr lange auf den Beinen», wandte Meister Jörg ein.
«Dann lässt sie’s eben bleiben. Weiter.»
Also wurden Christinas Arme noch weiter und weiter hochgezogen, bis die Gelenke krachten und ihre Arme ausgekugelt wurden. Die alte Frau schrie, über ihr Gesicht liefen Tränenströme.
Hermann hätte sich am liebsten Ohren und Augen zugehalten. Er ertrug es nicht, die gute Freundin so gequält zu sehen. Zaudernd trat er neben Buirmann. «Ist das wirklich notwendig? Wie lange soll sie das denn aushalten?»
Der Kommissar warf ihm einen verärgerten Seitenblick zu. «Sie braucht doch bloß zu gestehen, dann hat sie es hinter sich.» Er ging zu Christina, deren Beine inzwischen eingeknickt waren, sodass sie schwer an dem Seil hing. «Na, meine Liebe, wie sieht es aus? Bist du nun bereit zu gestehen, dass du eine Zauberin bist? Wer sind deine Komplizen und Mittänzer beim Hexentreffen gewesen?»
Mit letzter Kraft hob Christina den Kopf, versuchte vergeblich, auf die Füße zu kommen. «Ich …»
«Ja?» Lauschend reckte Buirmann ihr das Ohr entgegen.
Sie schluchzte, hustete und rang nach Atem. «Ich bin keine Hexe und kann nicht zaubern.»
«Was?» Das Gesicht des Kommissars lief rot an. «Meister Jörg!» Mit einer knappen Geste wies er den Henker an, die Alte noch mehr zu strecken.
Meister Jörg räusperte sich vernehmlich. «Herr Doktor, seid Ihr sicher? Wenn wir sie noch mehr peinigen …»
«Wird sie endlich den Mund aufmachen und bekennen.» Hektisch ging Buirmann in der Peinkammer hin und her, blieb wieder dicht vor Christina stehen. «Gestehe, du gottlose Erzzauberin! Gestehe endlich, und deine Qualen sind sofort vorbei.»
Christina weinte noch immer und stieß gleichzeitig ein schrilles Stöhnen aus. Ihre Stimme krächzte, als sie erneut zu sprechen versuchte. «Ich kann und kann einfach nicht zaubern. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht.»
Buirmann stieß einen fauchenden Ton aus. «Wie denn, willst du vielleicht eine Märtyrerin des Teufels werden?» Er beugte sich zu ihr hinab, bis sein Gesicht ganz nah an dem ihren war. «Dann stirb doch endlich, du alte Hexe!», schrie er sie unvermittelt an. Angewidert richtete er sich auf und trat einen Schritt zurück. «Weiter!», befahl er dem Henker, der daraufhin noch mehr an dem Gegengewicht zog, bis Christina beinahe wieder auf den Füßen stand.
Die Gefolterte stieß ein unmenschliches Quietschen aus, das in ein jämmerliches Stöhnen überging. «Nein, nein», stieß sie mit ersterbender Stimme hervor. «Gott und alle Heiligen sind meine Zeugen.» Zitternd rang sie nach Atem. «Ich will … in dieser Marter … und Pein … als frommer Christenmensch sterben.»
Hermann starrte wie betäubt auf die alte Frau, die wie ein Sack in den Seilen hing. Ein leises Plätschern war zu vernehmen, als ihr das Wasser an den nackten Beinen hinablief und sich in einer Lache auf den Holzdielen sammelte. Ein letztes Mal hob sie den Kopf, stierte Hermann mit anklagendem Blick an, dann schlossen sich ihre Augen. Mit einem heftigen Stoß entfuhr ihr die Luft aus der Kehle, ihr Kopf sackte auf ihre Brust; sie rührte sich nicht mehr.
2. Kapitel
Daher ruffet jederman mit Ungestümme: Ein Obrigkeit sol ein einsehen Thun: man soll nachfragen / wer doch die Hexen seyen / deren keine als durch böse Mäuler gemachet / und vorhanden sein.
In der Peinkammer herrschte eine düstere, beklemmende Stille. Der Henker hob den Kopf der alten Frau an und untersuchte ihre Augen, fühlte ihren Puls. Dann drehte er sich mit besorgter Miene zu Dr. Buirmann um. «Herr Kommissar, auf Euer Geheiß habe ich die Frau gefoltert, und sie ist an der Pein des Todes gestorben, wie ich es befürchtet hatte. Ich hatte gleich gesagt, dass sie das nicht mehr lange …»
«Schweigt!» Buirmann starrte sekundenlang auf die Tote, dann griff er sich mit beiden Händen an den Kopf, raufte sich die Haare, ging unruhig in der Kammer hin und her. «Bindet sie los!» Seine Stimme zitterte unnatürlich. Wie ein Verrückter stapfte er von dem Foltergerät zur Tür und wieder zurück, dann auf die versammelten Schöffen zu, machte kehrt und lief zum Fenster. Ohne Unterlass rieb er sich die Schläfen, zerrte an seinen Haaren, dann hielt er inne, ließ die Arme sinken. Ruckartig drehte er sich zu den Schöffen um. «Nein, nein», sagte er und fasste Herbert Lapp und Johann Bewell ins Auge. Seine Miene wirkte nun hart und entschlossen. «Nicht die Folter war es, die den Tod verursacht hat. Habt Ihr nicht auch gehört, wie es oben im Hals der Alten gekracht hat, als der Teufel ihr das Genick gebrochen hat?» Er wandte sich dem nächsten Schöffen zu und starrte ihn wild an. «Was meint Ihr, Gottfried Peller? Ist das nicht eine verstockte Hexe gewesen?» Wieder ging er weiter, blieb dicht vor Hermann stehen. «Und Ihr, Jan Thynen und Hermann Löher? Habt Ihr es nicht auch gehört? Das hat der Teufel getan, damit die alte Hexe nicht selig werden und ihre Komplizen besagen kann!»
«Was geht hier vor?», unterbrach eine dunkle Stimme die Tiraden des Kommissars. «Weswegen … O mein Gott! Was habt Ihr getan?»
In der Tür war ein hochgewachsener, schlanker Mann erschienen, dessen von weißen Strähnen durchzogenes Haar in ordentlichen Wellen bis auf seine Halskrause fiel. Intelligente graublaue Augen blickten aus einem von unzähligen Falten durchzogenen Gesicht. In der Hand hielt er eine in Schweinsleder gebundene Ausgabe der Kaiserlichen Halsgerichtsordnung, die er stets mit sich führte.
«Herr Dr. Schweigel!» Hermann war noch niemals so froh gewesen, den alten Vogt zu sehen. Andreas Schweigel war bereits über siebzig Jahre alt und bekleidete sein Amt seit mehreren Jahrzehnten. Mit seinem Vater war er gut befreundet gewesen, und auch Hermann gab sehr viel auf sein Urteil. «Wie gut, dass Ihr endlich kommt. Die arme Christina Böffgens ist unter der Folter gestorben, und wie Ihr sehen könnt …»
«Werdet Ihr wohl schweigen!», brüllte Buirmann ihn an und schien sich nur mit Mühe beherrschen zu können, Hermann nicht am Kragen zu packen und zu schütteln. «Es ist ganz eindeutig, was hier passiert ist. Ich habe es Euch doch gesagt: Der Teufel hat der alten Hexe das Genick gebrochen, damit sie ihre Komplizen nicht verraten kann. Pfui, pfui, pfui, wie stinkt es hier? Riecht Ihr es nicht auch? Der Teufel ist mit faulem Gestank davongezogen! Pfui, lasst uns schnell von dieser Bestie weggehen.» Schon wollte er zur Tür eilen, doch der Vogt stellte sich ihm in den Weg.
«Halt, Ihr bleibt hier, Dr. Buirmann! Das ist ja ungeheuerlich, was Ihr mit der armen Frau gemacht habt. Eure Vorgehensweise widerspricht sämtlichen Gesetzen der Carolina, ganz zu schweigen von der hergebrachten Rechtsprechung, die Ihr in Eurem Übereifer mit Füßen getreten habt!» Er wechselte ins Lateinische und redete wütend und begleitet von heftigen Gebärden auf den Hexenkommissar ein. Dieser verschränkte jedoch stur die Arme vor der Brust und beharrte darauf, dass der Teufel am Tod der Angeklagten schuld sei.
Schließlich brach Schweigel seine Wutrede ab und sah bekümmert an Buirmann vorbei auf den zerschundenen Leichnam Christina Böffgens, den der Henker mittlerweile von der Strecke losgebunden und auf dem Boden abgelegt hatte. Seufzend richtete er seinen Blick zur Decke. «Diese Tat, die wir heute an dieser Frau begangen haben, können wir, wenn sie bekannt wird, vor Gott, dem Landesfürsten und allen Menschen nicht verantworten.»
«Ich habe es versucht», murmelte Hermann. «Wirklich, ich habe alles versucht. Er hat es nicht zugelassen. Er hat gesagt, es muss so sein. Sie ist keine Hexe, sie kann nicht zaubern.»
«Was habt Ihr getan?» Schweigels Stimme gellte in seinen Ohren. «Warum habt Ihr zugelassen, dass sie die alte Frau zu Tode foltern?»
«Ich habe protestiert. Peller ebenfalls und Herbert Lapp. Es hat nichts geholfen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.»
«Schweigt, Hermann Löher! Es ist ganz eindeutig, was hier passiert ist.» Buirmann stand dicht vor ihm und fixierte ihn mit irrem Blick. «Ich habe es Euch doch gesagt: Der Teufel hat der alten Hexe das Genick gebrochen, damit sie ihre Komplizen nicht verraten kann. Pfui, pfui, pfui, wie stinkt es hier? Riecht Ihr es nicht auch? Der Teufel ist mit faulem Gestank davongezogen!
«Nein, nein, das stimmt alles nicht. Ihr habt sie zu Tode gefoltert, und das darf nicht geschehen. Es ist Unrecht!»
«Hermann?»
«Habt Ihr es nicht auch krachen gehört? Das hat der Teufel getan, damit die alte Hexe nicht selig werden und ihre Komplizen besagen kann!»
«Nein. Ihr wart es. Ihr habt sie weiter peinigen lassen. Es tut mir so leid. Ich hätte es verhindern müssen.»
«Hermann!»
«Das hat der Teufel getan, damit die alte Hexe nicht selig werden und ihre Komplizen besagen kann!»
«Nein, nein, nicht der Teufel!»
«Ist das nicht eine verstockte Hexe gewesen?»
«Sie war keine Hexe!»
«Das hat der Teufel getan …»
«Verzeiht mir, Frau Böffgens!»
«… hat der Teufel getan …»
«Hermann, wach auf!»
«… Teufel getan …»
«Nein!» Mit einem Schrei fuhr Hermann auf und starrte in das besorgte Gesicht seiner Frau Kunigunde, die sich über ihn beugte und mit einer Hand über seine schweißnasse Stirn streichelte. Ihr langes braunes Haar war wie immer zur Nacht zu einem Zopf gebunden, der ihr über die rechte Schulter fiel. Einige lockige Strähnen hatten sich gelöst und ringelten sich weich um ihre Wangen.
Hermann rang verzweifelt nach Atem, hatte das Gefühl zu ersticken. Sein Herz raste so heftig in seiner Brust, dass es schmerzte.
«Es ist alles gut», sagte Kunigunde. «Du hast nur geträumt.»
«Geträumt?» Seine Stimme kratzte ihn im Hals. Sogleich wandte Kunigunde sich ab und goss Wein aus einem Krug in einen Becher. Er nahm ihn dankbar und trank in gierigen Schlucken. Seine Hände zitterten, als er das Gefäß sinken ließ. «O Gott», murmelte er, als die Erinnerung an den Traum ihn einholte. «Ich war dort. Es fängt wieder an.»
«Es war der Traum von Christina Böffgens, nicht wahr?» Kunigunde rückte wieder näher zu ihm und legte ihm einen Arm um die Schultern.
Dankbar lehnte er sich an sie, atmete tief durch. Die Augen zu schließen, vermied er jedoch aus Angst, den anklagenden Blick der sterbenden Frau erneut vor sich zu sehen. «Was soll ich tun? Ich kann nichts dagegen ausrichten.»
«Ruhig, Hermann. Es war nur ein Traum. Er ist vorbei.»
«Nein, du verstehst nicht …»
«Schsch …» Sie drückte zärtlich ihre Lippen gegen seine Schläfe. «Vergiss den Traum einfach. Denk an morgen, an deine Geschäfte. An den Geburtstag deiner Tochter. Maria wird schon bald sechzehn, stell dir das mal vor. Gewiss wird sie dieses Jahr zum ersten Mal als Mailehen ersteigert. Hoffentlich von einem braven, schmucken jungen Mann.»
«Nein, Kuni, bitte, hör zu.» Da sich sein Atem endlich etwas beruhigt hatte, setzte Hermann sich im Bett auf und griff nach der Hand seiner Frau. «Ich muss dir etwas sagen.»
Seine ernste Miene bewirkte, dass Kunigunde sich nun ebenfalls aufrichtete. «Was ist denn geschehen?»
«Das Schlimmste», antwortete er mit tonloser Stimme. «Das Schlimmste, Kuni. Es geht wieder los, und ich kann nichts dagegen tun.»
«Aber es war doch nur ein Traum», versuchte sie ihn zu beruhigen. «Du weißt doch, dass so etwas immer mal wieder …»
«Nein, nein, nicht der Traum.» Er schüttelte heftig den Kopf. «Das Brennen. Es fängt wieder an.»
Einen Moment lang herrschte entsetztes Schweigen zwischen ihnen.
«Das Hexenbrennen geht wieder los?» Er konnte sehen, wie alles Blut aus Kunigundes Wangen wich. «Bist du sicher? Vielleicht irrst du dich. Es wird doch so viel geredet.»
«Ich bin sicher.» Wieder drückte er ihre Hand, dann zog er sie fest in seine Arme. «Es kommt wieder ein Hexenkommissar nach Rheinbach. Schon in den nächsten Tagen wird er eintreffen.»
«Buirmann?»
Hermann presste kurz die Lippen zusammen. «Nein, nicht Buirmann. Sie schicken Jan Möden.»
«Hilde, was machst du denn da?» Kunigunde stellte den Weidenkorb mit den Einkäufen, die sie bei der Frau des Kramers getätigt hatte, auf dem großen Küchentisch ab und sah verwundert zu, wie ihre Magd an einem hässlichen Fleck auf der Hose eines der Jungen herumrieb.
«Ich mach die Kleider vom Gerhard sauber, Frau Löher, was sonst? Der Junge hat sie gestern im Wald angehabt, und es ist doch so schrecklich matschig draußen.»
Kopfschüttelnd nahm Kunigunde der Magd die Hose ab. «Die Flecken bekommst du so nicht heraus. Die Hose muss gewaschen werden, und wie ich meinen Sohn kenne, sehen Wams und Koller auch nicht besser aus.»
«Aber das ist doch nicht nötig. Ich meine … Muss ich die Sachen wirklich schon wieder waschen?» Hilde war alles andere als begeistert.
Kunigunde zuckte die Schultern. «Wenn du nicht willst, dass mein Sohn in verdreckten Kleidern herumläuft. Schau vorsichtshalber auch bei Bartel nach, er hortet in seiner Kammer gerne schmutzige Wäsche.»
«Kann das nicht die Wäscherin machen?» Nur zögernd ging Hilde zur Tür.
«Was hast du denn bloß?» Verständnislos musterte Kunigunde die Magd.
Hilde war Mitte zwanzig und nicht sehr groß, reichte ihr gerade bis zur Nasenspitze und war stämmig gebaut. Ihr rundes Gesicht war von glattem, blondem Haar umgeben, das zu ordentlichen Zöpfen geflochten und zu Schnecken hochgesteckt war. Hildes Lider senkten sich verlegen über ihre wasserblauen Augen. «Verzeihung, Frau Löher, ich wollte nicht ungezogen sein oder so. Aber neulich war doch dieser fahrende Bader in der Stadt, und der hat gesagt, dass man sich vor zu viel Wasser in Acht nehmen sollte, weil es die Poren der Haut öffnet, und dann können Krankheiten eindringen. Ich hab Angst, dass ich krank werde, wenn ich so oft die Sachen der Kinder waschen muss.»
«Aha.» Sorgsam legte Kunigunde die Hose zuoberst in den Wäschekorb. «Aber die Wäscherin darf ruhig krank werden, willst du sagen?»
«Äh …» Verblüfft hob Hilde den Kopf.
Kunigunde lächelte nachsichtig. «Es stimmt schon, wir sollten uns nicht allzu oft dem Wasser aussetzen. Da hat der Bader ganz recht. Aber wir dürfen uns auch nicht ganz verkommen lassen, nicht wahr? Wenn wir schmutzig sind, müssen wir uns säubern, und wenn die Kleider vor Dreck starren, hilft eben nur Wasser. Der Herrgott wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Also geh schon und sammele die Sachen der Kinder ein. Morgen halten wir einen kleinen Waschtag ab. Und vergiss nicht, den neuen Mehlsack in die Vorratskammer zu bringen.»
«Ist schon erledigt, Frau Löher. Der Beppo hat ihn reingetragen.»
«Gut, dann kannst du dich ja gleich um das Mittagessen kümmern.»
Nachdem die Magd die Küche verlassen hatte, wandte Kunigunde sich wieder ihrem Einkaufskorb zu, der heute hauptsächlich Garn, Bänder und einigen Zierrat enthielt. Sie hatte vor, das neue Kleid, das sie Maria zum Geburtstag schenken wollte, noch ein wenig zu verzieren. Auch ein paar Süßigkeiten, Zucker sowie verschiedene getrocknete Kräuter hatte sie erworben, die nun ihren Weg in die kleine Vorratskammer fanden.
Während sie die Nähutensilien hinüber in die Wohnstube trug und in die Schublade des großen Eichenschranks einsortierte, sann sie über die vergangene Nacht nach und den Tratsch, den sie beim Einkaufen aufgeschnappt hatte. Else, die Frau des Kramers Heribert Trautwein, war wie immer sehr gesprächig gewesen. Bei ihr erfuhr man alles, was sich in und um Rheinbach ereignete.
Heute hatte sie aufgeregt berichtet, dass ein hoher Herr mit einem Doktortitel, seines Zeichens Hexenkommissar des kurfürstlichen Gerichts, in der Stadt eingetroffen sei. Er habe sein Quartier im Gästezimmer des Gerichtsschreibers Melchior Heimbach in der Nähe des Wasemer Turms bezogen. Also hatte Hermann recht gehabt, Jan Möden war zurück.
Kunigunde hatte gehofft, diesen Namen niemals wieder zu hören und noch weniger jemals wieder diesem Mann begegnen zu müssen. Er war es gewesen, der ihren Stiefvater, Matthias Frembgen, vor fünf Jahren zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt hatte. Der lächerliche Prozess hatte nur wenige Tage gedauert. Die Tatsache, dass er Schultheiß ihres Heimatortes Flerzheim gewesen war, hatte ihm rein gar nichts genützt. Im Gegenteil – Kunigunde argwöhnte, dass es genau dieser Posten war, nach dem gewisse Leute getrachtet hatten, die ihren Vater dann auf schändliche, hinterlistige Weise bei Möden anschwärzten. Wie sonst war zu erklären, dass Mödens sogenannter Freund und Speichellecker Augustin Strom nur Wochen nach dem Tod ihres Stiefvaters in sein Amt eingesetzt worden war? Ausgerechnet er, den alle Welt nur Geck Augustin nannte, weil seine Mutter in der Zeit, da sie mit ihm schwanger gewesen, dem Wahnsinn verfallen war und sogar angebunden werden musste, weil sie so oft in Raserei geriet. Strom war ein aalglatter, intriganter Zeitgenosse. Das Weberhandwerk seines Vaters konnte er nicht ausüben, weil er durch eine sonderbare Krankheit ganz schwach und blutarm geworden war. Stattdessen hatte er begonnen, wie ein Weib am Spinnrad zu sitzen und Garn zu spinnen.
Schon allein beim Gedanken daran schüttelte Kunigunde angewidert den Kopf. Ein solcher Broterwerb war eines Mannes nicht würdig, fand sie, aber seit seiner Erhebung zum Schultheißen hatte Strom es zu einigem Ansehen und Geld gebracht. Er hatte sich ein großes Haus in Flerzheim gekauft und erst vor kurzem noch ein weiteres hier in Rheinbach.
Bereits während der Schulzeit hatte er sich ständig mit Melchior Heimbach herumgetrieben, einem hässlichen und kränklichen Jungen, der aber von seinen Eltern gehätschelt und auf die besten Schulen geschickt worden war. Das hatte ihm den Posten des Gerichtsschreibers für Rheinbach, Meckenheim, Flerzheim und noch einige andere Orte eingebracht. Strom hatte durch ihn ebenfalls das Lesen und Schreiben gelernt und war seit einigen Jahren sein Gehilfe, denn er besaß offenbar eine ausgesprochen schöne Handschrift – ganz im Gegensatz zu Heimbach, der an einer seltsamen Muskelschwäche litt, die seine Gliedmaßen mit der Zeit immer unbrauchbarer machte. Seine Beine hielten ihn zwar noch aufrecht, doch sein Gang erinnerte ein wenig an den einer watschelnden Ente. Sein rechter Arm war besonders schlimm befallen und regelrecht verdorrt. Kaum, dass er noch einen Griffel ordentlich halten konnte. Deshalb schrieb er längere Dokumente oder Protokolle mit der linken Hand. Allerdings konnte man das Gekrakel wohl nur sehr schwer entziffern, deshalb war Strom dazu eingesetzt worden, alle Schriftstücke, die Heimbach anfertigte, zu kopieren. Diese Tätigkeit hatte ihm ein erfreuliches Zubrot beschert sowie Zugang zu den höheren Kreisen.
Kunigunde war sich sicher, dass es Heimbachs Einwirken auf den Amtmann Schall von Bell zuzuschreiben war, dass Augustin Strom das Amt des Flerzheimer Schultheißen erhalten hatte. Und nur Gott allein wusste, was sich vorher ereignet hatte und welche Intrigen gegen ihren Stiefvater gesponnen worden waren.
Matthias Frembgen war nie ein Freund der Hexenprozesse gewesen. Anno 1628 oder 29 – ganz genau konnte Kunigunde sich nicht erinnern – hatte es in Flerzheim erstmals einen Fall von Hexerei gegeben. Oder vielmehr war eine Frau beschuldigt worden, zaubern zu können. Man hatte sie verurteilt, aber Matthias Frembgen hatte sich geweigert, aus diesem Einzelfall eine großangelegte Verfolgungsjagd zu machen. Stattdessen hatte er die Angelegenheit im Keim erstickt.
Genau dies hatten ihm die Ankläger vor fünf Jahren dann vorgeworfen und zu seinen Lasten ausgelegt. Sie behaupteten, er habe schon seit Jahren Hexerei in Flerzheim geduldet, sei ein Hexenpatron, der die bösen Erzzauberer gewähren ließ und sich an ihren Zaubertänzen und Hexenflügen sogar beteiligte.
Auch nach all der Zeit bildete sich ein Knoten in Kunigundes Kehle, wenn sie daran dachte, dass man ihren geliebten Stiefvater durch die Folter zum Geständnis gezwungen und nur wenige Tage später bei lebendigem Leib verbrannt hatte. Für sie gab es keinen Zweifel, dass nichts von dem, was er gestanden hatte, der Wahrheit entsprach. Ihr Stiefvater war ein strenger, aber gütiger Mann gewesen, gottesfürchtig und gerecht. Er hatte in jungen Jahren eine Frau geehelicht, die kaum älter als er und doch schon Witwe gewesen war. Von ihr, so hatte er immer erzählt, hatte Kunigunde ihre hübschen braunen Haare. Ihre Mutter war bei der Geburt des nächsten Kindes gestorben, ebenso wie das Kind selbst, das zu früh gekommen war, jedoch einen viel zu großen Kopf besessen hatte.
Matthias Frembgen hatte daraufhin gute zwei Jahre mit Kunigunde alleine verbracht, bis er kurz nach ihrem fünften Geburtstag erneut heiratete. Gertraud, von Frembgen immer liebevoll Traudel genannt, war nur wenig jünger als er gewesen und hatte sich sogleich des kleinen Mädchens angenommen. Kunigunde hatte sie vom ersten Tag an ins Herz geschlossen und liebte sie heute wie ihre leibliche Mutter. Umso mehr schmerzte sie der Gedanke, dass Jan Möden nun wieder in der Gegend war. Sie mochte sich gar nicht vorstellen, wie ihre Stiefmutter darauf reagieren würde, wenn sie selbst schon diesem grässlichen Menschen am liebsten den Hals umgedreht hätte.
Trautweins Else hatte sich regelrecht gefreut, dass ein solch hoher Herr die Stadt besuchte, um, wie sie sich ausdrückte, für Recht und Ordnung zu sorgen und den Gerüchten über heimliche Hexenzusammenkünfte, die derzeit kursierten, auf den Grund zu gehen. Natürlich war sie nicht von hier und erst seit etwas mehr als einem Jahr mit dem Kramer verheiratet. Deshalb wusste sie nicht allzu viel über die Ereignisse, die besonders seit 1631 die Stadt erschüttert hatten, und schon gar nicht kannte sie die Gerüchte um Mödens zweifelhafte Vergangenheit. Es hieß nämlich, er sei nicht nur verschwendungssüchtig, sondern auch ein unverbesserlicher Schürzenjäger, der vor seiner Ehe mehrere Frauen aufs schändlichste verführt und dann sitzengelassen habe. Diese Geschichten waren anscheinend noch nicht zu Else Trautwein vorgedrungen, somit konnte ihr Kunigunde ihre Unbedarftheit nicht vorwerfen. Aber ein Grund zur Freude war Mödens Anwesenheit in Rheinbach ganz gewiss nicht.
Kunigunde zuckte zusammen, als hinter ihr Schritte auf den Bodendielen laut wurden. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie, ein Spitzenband in der Hand, seit geraumer Weile vor der geöffneten Schublade verharrt und vor sich hin gestarrt hatte. Hastig legte sie das Band in die Lade und schob sie energisch zu.
«Mutter? Ach, hier seid Ihr.» In der Tür zur Wohnstube war Maria erschienen, ihr Atem ging stoßweise, die Wangen waren vom eiligen Laufen leicht gerötet. Mit einer Hand strich sie sich die welligen, hellbraunen Haare aus der Stirn, die sich ihrem geflochtenen Zopf entwunden hatten. «Ich komme gerade von der Tringen und habe auf dem Weg hierher den Herrn Vogt getroffen. Er lässt ausrichten, dass er noch kurz etwas zu erledigen hat und dann hierherkommen will.»
«Was, zum Mittagessen etwa?» Erschrocken griff Kunigunde nach dem leeren Weidenkorb. «Dann muss ich Hilde Anweisungen geben, die Suppe ein bisschen zu verlängern. Am besten schneidet sie noch eine von den eingelagerten Rüben hinein, die werden schnell gar.»
«Soll ich schnell eine heraufholen?», bot sich Maria sofort an.
«Ja, und beeile dich. Liebe Zeit, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wo steckt dein Vater?»
«Ich weiß es nicht, aber Beppo ist dabei, die Remise freizuräumen. Soll nicht heute noch eine Ladung Wollstoff eintreffen? Bestimmt bereitet Vater alles dafür vor.»
«Also gut, lauf zu und hol die Rübe, dann geh zu Hilde und sag ihr, dass wir Besuch erwarten. Danach deckst du mit Christine zusammen den Tisch.»
«Christine ist drüben bei Tringens Schwester Lisbeth.»
«Du meine Güte, noch immer? Sie sollte doch nur eine halbe Stunde drüben bleiben.»
Maria zuckte die Schultern. «Ihr wisst doch, wie die Kleinen sind. Wenn sie einmal spielen, vergessen sie die Zeit.» Als Zweitälteste der acht Löher-Geschwister fühlte Maria sich vor allem den drei jüngeren Schwestern haushoch überlegen. Da sie nun fast sechzehn Jahre alt war und damit als junge Frau betrachtet wurde, tat sie gerne, als sei sie der Ausbund an Vorbildlichkeit – zumindest so lange, bis sie selbst beim Plaudern mit ihrer Freundin Tringen die Zeit vergaß oder vor lauter Tagträumen ihre Pflichten vernachlässigte. Kunigunde sah es ihr meistens nach, wusste sie doch, wie sie selbst in dem Alter gewesen war. Abgesehen davon war Maria ihr eine große Hilfe, vor allem, seit der jetzt vierjährige Matthias und die gerade zweijährige Mathilde auf die Welt gekommen waren. Ohne die Mithilfe der älteren Geschwister wäre die Familie Löher ein Tollhaus, dessen war sie sich sicher.
«Dann lauf gleich noch einmal hinüber zu den Leutgebs und hol Christine ab.»
Während Maria sich auf den Weg in den Keller machte, eilte Kunigunde hinaus in den Hof und suchte nach Hermann, um ihn über den unerwarteten Besuch des Vogtes in Kenntnis zu setzen.
«Meine liebe Frau Löher, Ihr hättet Euch gar keine Umstände machen müssen», sagte der Vogt, als er am gedeckten Tisch saß und einen Schluck Wein trank, den Kunigunde ihm soeben in einen Zinnbecher eingeschenkt hatte. «Ich wollte mich mitnichten einfach selbst zum Essen einladen.»
«Ach was, das sind doch keine Umstände, Herr Dr. Schweigel», widersprach sie rasch. «Wir freuen uns immer über Euren Besuch. Es gibt zwar nur eine einfache Gemüsesuppe, aber sie ist sehr nahrhaft, und das ist die Hauptsache, will ich meinen.»
«Da habt Ihr wohl recht», bestätigte der Vogt lächelnd. «Und ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. Ihr empfangt mich immer mit solch offener Herzlichkeit. Das fehlt mir zu Hause sehr, seit meine liebe selige Frau nicht mehr da ist. Ganz zu schweigen davon, dass wir ja nie das Glück hatten, Kinder zu bekommen. Hier im Hause herrscht doch immer ein frohes Treiben.»
Kunigunde lachte. «Ja, oftmals mehr, als man ertragen kann.»
«Da mögt Ihr vielleicht recht haben.» Auch Schweigel lachte. «Obwohl Eure Kinder alle durchweg schön und wohlgeraten sind.»
«Wenn sie nicht gerade irgendetwas ausgefressen haben.» Sie schmunzelte noch immer. «Vor allem Gerhard ist manchmal ein rechter Tunichtgut.»
«So sind sie eben, die Jungen in dem Alter. Was ist er jetzt – zwölf Jahre, nicht wahr?»
«Im Sommer wird er dreizehn, und allmählich sollte er seine Flausen ablegen und sich ernsthaft in seiner Lehre bemühen.»
«Euer Gatte wird ihm den Kopf schon geraderücken und ihn das Rechte lehren, da bin ich mir sicher. Schaut, wie gut sich Bartel macht.»
Das Lächeln auf Kunigundes Lippen vertiefte sich, als der Name ihres ältesten Sohnes Bartholomäus fiel. «Wir sind sehr stolz auf ihn. Gerade in der letzten Woche hat er selbständig einen Handel mit einem neuen Eisenlieferanten abgeschlossen und einen hübschen Gewinn mit den Töpfen und Pfannen erwirtschaftet.»
«Seht Ihr, und genauso talentiert wird sich Gerhard einmal anstellen, da bin ich sicher.»