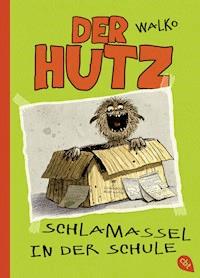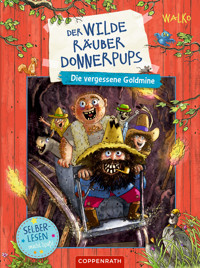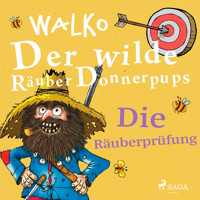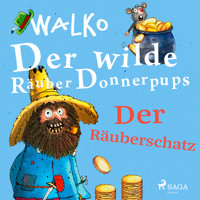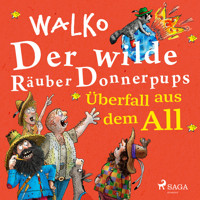9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Hutz-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sechs Wochen Maienfeld. Sechs Wochen ohne Computer, Konsole und Handy – das ist für den zwölfjährigen Gamer Elvis die Höchststrafe. Dann jedoch lernt Elvis in dem verschlafenen Nest bei seiner Oma den Hutz kennen, der als Hund getarnt in einem Baum in Omas Garten wohnt. Dem zotteligen Wesen ist ein übereifriger Zeitungsreporter auf den Fersen, und schon bald hat Elvis alle Hände voll zu tun, den Schreiberfiesling abzuwimmeln. Leider kommt es wie es kommen muss: Der »Tschornalist« schießt ein Foto, macht eine große Story daraus und der Hutz wird als gemeingefährlich festgenommen. Doch nicht mit Elvis! Die Rettung des Hutz’ wird sein erstes großes Abenteuer im real life.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mit Illustrationen des Autors
Kinder- und Jugendbuch-Verlagin der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015© 2015 by cbt Verlagin der Verlagsgruppe Random House GmbH, MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad OeynhausenUmschlag- und Innenillustrationen: Walkomi ∙ Herstellung: kwSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-13674-1www.cbt-buecher.de
1. Wie alles begann
Es war der Tag vor den Sommerferien und gerade hatte ich mir mein Zeugnis abgeholt. Ich war aber nicht auf dem Weg nach Hause, um ordentlich Cash für meine tollen Noten zu kassieren und anschließend mit meinen Leuten nach Italien oder sonstwohin aufzubrechen.
Nein, ich hatte Zeit … ich saß mit meinem Klassenkameraden Ludi auf einem Bretterstapel im Schatten einer Lagerhalle und rauchte eine.
Ludi und ich waren nicht wirklich Freunde. Ich war mit ihm hier, weil wir momentan etwas gemeinsam hatten. Und zwar ein total katastrophales Zeugnis!
Ludi war aber ganz anders gestrickt als ich. »Yeeees!«, rief er schon wieder. »Endlich Ferien, das ist so geil!«
»Mhm«, machte ich und stellte mein Handy ab, das schon wieder klingelte. Ich fühlte mich richtig erschlagen. Noch dazu war mir schlecht von der Zigarette. Ich rauche ja normalerweise nicht. Aber ich konnte mich ruhig schon mal daran gewöhnen.
»Mein lieber Herr Miller – mach nur so weiter und du wirst in der Gosse enden!«, hat mein Lehrer, Dr. Pippel heute zu mir gesagt. »Ich weiß wirklich nicht, wie du mit solchen Schulleistungen später einmal zu einer anständigen Arbeit kommen willst!«
Nun, mit der Arbeit wird es wohl auch so sein wie mit der Schule. Man will nicht, man muss!, dachte ich und nahm noch einen tüchtigen Zug, dass mir ganz schwarz vor Augen wurde.
Ach, es war verheerend! Um ganz ehrlich zu sein – ich traute mich nicht so recht nach Hause. Ich blieb noch den ganzen Nachmittag hier und ließ Ludis Weisheiten über mich ergehen. Zum Beispiel, dass gute Zeugnisse nur etwas für blöde Streber und Weicheier seien.
»Außerdem ist dein Zeugnis gar nicht schlecht, wenn du dir meins anschaust«, meinte Ludi schließlich und lachte fröhlich. »Ich muss jetzt los, was checken«, rief er, haute mir kräftig auf den Rücken und war schon weg. Also machte ich mich ebenfalls so langsam auf den Heimweg.
Es war schon nach sieben, als ich nach Hause kam. Gleichzeitig mit mir kamen auch meine Eltern, die mich schon gesucht hatten.
Die Erleichterung darüber, dass mir nichts passiert war, dauerte leider nicht lange. »Ans Telefon gehen kannst du wohl nicht«, brummte mein Vater und schüttelte den Kopf. »Na, dann lass mal sehen, alter Junge!«, meinte er dann.
Während ich den verwünschten Wisch umständlich aus der Mappe fingerte, sagte er plötzlich: »Sag mal, hast du etwa geraucht?« Aber im nächsten Moment war ihm die Antwort darauf egal.
»Himmeldonnerwetternochmal!!«, rief er. Er hatte es schon ein bisschen kommen sehen. Doch es war schlimmer, als er befürchtet hatte. »Nachprüfung oder Klasse wiederholen! Wahnsinn!«, rief er.
Ja, wem sagte er das?
»Erst war es für mich selbst ein Schock … doch es ist halb so wild!«, erklärte ich ihm. Ich war bereit, die Konsequenzen zu tragen, auf die Nachprüfung zu verzichten und die Klasse zu wiederholen.
So kam ich zu meinen Ferien und der nötigen Erholung, um den Lehrstoff im nächsten Jahr gut aufnehmen zu können. Nein, nicht nur aufnehmen, richtig in mich aufsagen wollte ich ihn.
»Was soll denn dieser Quatsch?!«, brüllte mein Vater. »Du wirst natürlich die Nachprüfung machen. Die schaffst du leicht, wenn du endlich aufhörst, deine Zeit mit dieser blöden Kiste zu verplempern!« Er meinte natürlich meinen Computer und damit hatte er leider ein wenig recht.
Man kommt nicht umsonst in der FIFA-Online-Bestenliste unter die ersten fünfhundert. Auch sonst waren die elektronischen Medien eine große Versuchung für mich. Mehrere Male hatte ich Anläufe genommen, für die Schule zu lernen, war jedoch immer wieder rückfällig geworden.
»Damit ist jetzt Schluss! Du siehst die Kiste erst wieder, wenn die Nachprüfung geschafft ist!«, rief mein alter Herr.
»Deine eigene Schuld«, meinte Mama, und damit sausten sie hinaus.
Schwer ließ ich mich auf einen Sessel plumpsen.
Mir war schlecht. Ich sah es vor mir, wie ich sechs lange Wochen über meine Bücher gebeugt in meinem Zimmer saß, während alle anderen Kids die Ferien genossen. Und in der FIFA-Online-Meisterschaft war ich auch erledigt. Ich musste mich gewaltig zusammennehmen, um nicht vor Wut zu heulen.
Als meine Eltern zurückkamen, war mir klar, dass sie soeben die Ursache des Übels in den Abstellraum gesperrt hatten. Und jetzt kam wohl die zweite Runde, bestimmt eine gewaschene Moralpredigt. Doch nichts davon.
Mama sagte ganz ruhig: »Wir haben nachgedacht, und wir machen Folgendes: Du fährst für ein paar Wochen zu Oma nach Maienfeld! Dort kannst du ungestört lernen und bekommst wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ich ruf sie nachher an!«
Ein wenig später ganz woanders
Glutrot ging die Sonne am Horizont unter. Gebannt starrten die zotteligen Arboori auf das wunderbare Schauspiel, ihre Mäuler sperrangelweit vor Bewunderung aufgerissen.
»Aaaaaaaaaahhhh!!!«, stöhnten sie vor Vergnügen.
Die ganze Welt erglühte und die Glut reflektierte an den glatten Felswänden, den Hütten, Büschen und Bäumen des alten Steinbruchs.
Auch der Hutz kreischte vor Begeisterung. Er hockte ein wenig abseits bei den Jüngeren – den Kindern und denen, die es wie er noch nicht zu Heldenehren gebracht hatten. Er freute sich, nach langer Zeit wieder mit allen zusammen eine Sonnenglut mitzuerleben.
Nirgends waren sommerliche Sonnenuntergänge so herrlich zu sehen wie hier im alten Steinbruch!
Als nur mehr ein letzter Rest des Sonnenlichts auf den Felsen lag und die Dunkelheit einfiel, fingen sie den Hüpftanz an. Hätte ein Mensch den Arboori bei ihrem Tanz zugesehen, wäre ihm oder ihr wahrscheinlich schwindelig geworden, so wild war ihr Gehopse und das Gepfeife, das sie dazu vollbrachten. Jeder hüpfte so, wie er sich gerade fühlte, und jeder pfiff, wie es ihm Spaß machte. Besonders chaotisch klang es, wenn sie mehrstimmig pfiffen und das taten sie meistens. Doch niemand konnte sie sehen oder hören, denn es kam so gut wie nie vor, dass sich jemand des Abends hierher verirrte. Außerdem waren Wachen aufgestellt, die aufpassten.
Der Hutz schaute ihnen ein wenig wehmütig zu. Er hätte gerne mitgetanzt, doch durfte er nicht. Denn er war zwar ein Arboori, doch noch immer kein Held.
Der Hüpftanz der Zotteligen ist ungeheuer kräfteraubend und dauert deshalb nie lange.
Schwitzend und schnaufend standen sie nachher da und unterhielten sich murmelnd in ihrer seltsamen Sprache miteinander.
Dann geschah etwas Merkwürdiges: Plötzlich riss einer seine zotteligen Arme senkrecht in die Luft. Gleichzeitig streckten sich auch alle anderen lang in die Höhe und warfen sich danach mit Schwung zu Boden. Und im selben Moment nahmen sie die Gestalt von Hunden an!
Daraufhin gingen sie auseinander – nicht ohne vorher dem Hutz einen missbilligenden Blick zugeworfen zu haben.
Der Hutz blieb noch eine Weile sitzen. Dann trottete er, nun als Hund getarnt, über die schmale Brücke und durch das hohe Wiesengras hinüber zu dem kleinen Städtchen, wo die ersten Lichter in den Häusern brannten.
Er hatte es nicht eilig. Dort wo er hinwollte, wurde er nicht freudig und ungeduldig erwartet. Sein bester Freund, der alte Schriftsteller Paul Michel lebte nicht mehr und Oma Michel hieß ihn bestimmt nicht herzlich willkommen. Etwas bedrückt schlich er wenig später durch den Garten, vorbei am hell beleuchteten Haus, hin zu dem knorrigen, schiefen, alten Lindenbaum. Die Linde sagte nichts, wie immer, als er sie zur Begrüßung tätschelte. Aber der Hutz hatte das Gefühl, als ob der Baum sich ein wenig freute, dass er nach der langen Zeit wieder einmal nach Hause gekommen war.
Er kroch in das Gebüsch und von dort durch den verborgenen Gang in seine Wohnhöhle unter dem Baum. Dort war alles wie gewohnt, und irgendwie war der Hutz froh, wieder zu Hause zu sein. Doch schnell überkam ihn auch ein bisschen Traurigkeit, als er zu dem Bild hinsah, von dem er und der alte Schriftsteller fröhlich herunterlachten.
Als er durch den hohlen Stamm in die Baumkrone kletterte, sah er Oma Michel auf der Veranda des Hauses stehen. Sein feines Gehör sagte ihm, dass sie telefonierte. Und was sie sagte, erweckte sein Interesse.
Der Hutz fasste Mut, kletterte vom Baum und stapfte durchs Gras hinüber zu dem Haus.
Als Oma Michel ihn vor sich auftauchen sah, erschrak sie ein wenig. Dann verdrehte sie missmutig die Augen.
»Ja, ist gut, so machen wir’s«, sagte sie ins Telefon. »Ich freu mich auf Elvis! Gute Nacht! Bis Montag dann!«
ELVIS! Ein freudiger Schreck durchfuhr den Hutz; er kannte diesen Namen!
Oma klappte das Telefon zusammen und wandte sich dem Hund zu, der etwas verlegen vor ihr saß.
»Aha! Auch mal wieder da, der Herr!«, sagte sie spöttisch. »Wie du nur aussiehst! Und wie du riechst! … Na, von mir aus kannst du bleiben. Doch untersteh dich, mir wieder Unruhe ins Haus zu bringen! Und lass den Jungen in Frieden! Ich warne dich!« Damit ging sie hinein und knallte die Tür zu.
Oma ist einverstanden!«, sagte Mama zufrieden und legte ihr Telefon auf die Kommode. Gerade hatte sie mit Oma über meinen Zwangsaufenthalt in Maienfeld gesprochen.
»Sehr gut!«, brummte mein Vater.
Ich war völlig anderer Ansicht, doch das schien in diesem Haus sowieso niemanden zu interessieren.
Übers Wochenende redeten wir ausführlich über die Sache. Das heißt, meine Eltern redeten und ich »hatte gefälligst zuzuhören«.
Ich musste nur jeden Tag ein paar Stunden lernen, den Rest der Zeit hätte ich ganz für mich, sagten sie. Es gab dort bestimmt auch nette Nachbarskinder – und wenn nicht, konnte ich mit Oma wandern, radeln, am Abend mit ihr Serien gucken und solche Dinge.
Ich sagte nichts, denn es war einfach absurd.
2. Die Abschiebung
Der Montagmorgen war grau und regnerisch. Gleich nach dem Frühstück ging es ab zu Oma. Mam und Paps waren bester Laune. Ich auf dem Rücksitz war so miserabel drauf wie das Wetter und mit jedem Meter vorwärts ging es mit meiner Laune abwärts.
Verzweifelt überlegte ich, was ich nur gegen diese brutale Abschiebung tun konnte. Ich meine, Oma war in Ordnung, doch mir war es bei ihr nie ganz geheuer gewesen, weil mir alles dort ein wenig verrückt vorkam.
Das fing bei dem total durchgeknallten Nachbarn an, von dem sie oft erzählte. Ich hatte ihn noch nie getroffen, doch anscheinend überwachte er aus unbekannten Gründen mit einem Fernglas ihren Lindenbaum. Einen hässlichen Baum, um den sie sich ständig Sorgen machte, weil er so windschief stand.
Auch war Oma selbst eine Person, die einem unheimlich auf den Geist gehen konnte. Weil sie jeden herumkommandierte wie ein Militär-Feldwebel, wie mein Vater immer sagte.
Dann Omas Hund! Er hieß Hutz und war total durchgedreht. Er gehorchte nie, roch übel, kletterte auf Bäumen herum, schlich sich an Leute an und erschreckte sie und weiß Gott was noch alles. Ich hoffte inständig, dass er nicht zu Hause war, was zum Glück oft vorkam.
Das Allerschlimmste von allem aber war: Oma war so hoffnungslos uncool. Sie hatte nicht einmal die altmodischste Spielkonsole, das wusste ich. NICHTS! Ich sollte meine Ferien in einem kleinen Kaff hinter dem Mond verbringen, ohne Games und Internet! Wie sollte ein normaler Mensch das aushalten?
Nun – ganz verhindern konnte ich das böse Spiel nicht – ich konnte aber versuchen, es abzukürzen! Obwohl es gegen alle meine Prinzipien war, beschloss ich in diesem Moment, so schnell wie möglich mit dem Pauken anzufangen.
Wenn ich es eisern durchzog und jeden Tag bis zum Umfallen lernte, hatte ich den Stoff nach meiner Berechnung in einer, höchstens zwei Wochen intus. Dann konnte ich nach Hause zurück und die Sache war gegessen. »Goodbye Maienfeld« nannte ich die Aktion, und mit diesem Plan in der Tasche fühlte ich mich gleich ein wenig besser.
Trotzdem war ich stinksauer darüber, wie meine Eltern mich behandelten …
Es dauerte nicht lange, bis das Kaff vor uns auftauchte. Maienfeld war ein so winziger Vorort, dass man aufpassen musste, nicht versehentlich daran vorbeizufahren. Im Nu waren wir hindurch und schon begann Omas Siedlung Lindenhain, eine Ansammlung kleiner Häuser mit gepflegten Vorgärten hinter weiß gestrichenen Zäunen und sauber getrimmten Hecken. Wir bogen in den Auenweg ein und schon waren wir da.
Omas Häuschen stand inmitten eines großen Grundstücks mit einem Gemüsegarten, Blumenbeeten, Bäumen und Büschen. Der Rasen war nicht so kurz geschnitten wie in den umliegenden Gärten. Omas Rasen war mehr eine Wiese mit Gänseblümchen und Löwenzahn darin. Auch ihre Hecken waren nicht so tadellos getrimmt wie rundherum.
Durchs Wagenfenster konnte ich den alten schiefen Lindenbaum sehen und daneben den blauen Wohnwagen ohne Räder.
Am Gartenzaun wartete schon Oma. Mit dem Hund! »Hallo Mama!«, riefen meine Eltern.
»Oooh, wie blass du bist, mein Kleiner!«, rief Oma fröhlich. Sie war kaum größer war als ich, aber umarmte mich mit eisernem Griff, kaum das ich ausgestiegen war. »Das werden wir schleunigst ändern!«
Leider konnte ich ihre Herzlichkeit nicht ehrlich erwidern. Wie gesagt, ich konnte Oma gut leiden.
Nur – in meinem Traum von den großen Ferien spielte sie nicht mit.
Doch egal – ich hatte ja einen Plan und war ohnehin bald wieder weg von hier …
»Er ist ja wieder da«, sagte Mama mit einem Blick auf den Hund, der sich gerade genüsslich kratzte.
»Ja, so sieht’s aus«, meinte Oma säuerlich.
Das war die Sache mit diesem Hund. Er verschwand für lange Zeiten und war dann plötzlich wieder da.
Mir war er ein wenig unheimlich. Er kam mir manchmal gar nicht wie ein richtiger Hund vor, wenn er so komisch schaute und ein leises gluckerndes Geräusch machte, wie gerade eben.
»Hallo Hutz«, sagten meine Eltern zu ihm. Ihn zu streicheln ließen sie bleiben, denn er sah wie immer schmutzig und verlaust aus. Vor allem aber konnte er die Streichlerei selbst nicht leiden.
Mir war das ganz recht. Hunde waren sowieso nicht mein Fall und schon gar nicht so verrückte wie dieser.
»Wir zischen dann gleich wieder ab, alter Junge«, sagte mein Vater zu mir, nachdem sie eine Weile mit Oma geschwatzt hatten. »Es werden bestimmt ein paar tolle Wochen für dich. Vergiss aber nicht zu lernen!«
»Mach dir eine schöne Zeit, mein Schatz!«, sagte meine Mutter und drückte mich. Sie schienen es ja sehr eilig zu haben, mich loszuwerden. Ich stellte mich stocksteif. Sie sollten merken, dass ich enttäuscht von ihnen war. Sie hatten ihrem Sohn die Sommerferien verdorben … damit mussten sie leben.
Doch meine Eltern schienen überhaupt keine Schuldgefühle zu plagen, so fröhlich wie sie dreinschauten.
»Bis bald, mein Schatz! Ich ruf dich an!«, rief Mama, grinste Oma an und schlug die Autotür zu. Dann brausten sie davon.
3. Opas Schreibzimmer