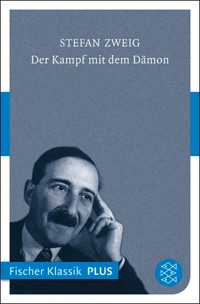
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Mit einem Nachwort von Knut Beck. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Hölderlin, Kleist, Nietzsche – drei Außerordentliche, denen sich Stefan Zweig als »Psychologe aus Leidenschaft, Gestalter aus gestaltendem Willen« zutiefst verbunden fühlte. Unverstanden von ihrer Generation, enden alle drei »vorzeitig in einer furchtbaren Verstörung des Geistes, einer tödlichen Trunkenheit der Sinne, in Wahnsinn oder Selbstmord.« Sigmund Freud rühmte Stefan Zweigs »Vollkommenheit der Einfühlung« in Wesen, Charakter und Gedankenwelt schöpferischer Menschen. Dies ist der zweite der drei vollendeten Teile des Zyklus ›Die Baumeister der Welt. Versuch einer Typologie des Geistes‹. Die beiden anderen Teile sind ›Drei Meister. Balzac, Dickens, Dostojewski‹ und ›Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Stefan Zweig
Der Kampf mit dem Dämon
Hölderlin. Kleist. Nietzsche
Fischer e-books
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
»Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen,
es sei denn als Untergehende,
denn es sind die Hinübergehenden.«
Nietzsche
Professor Dr. Sigmund Freuddem eindringenden Geiste, dem anregenden Gestalterdiesen Dreiklang bildnerischen Bemühens
Einleitung
Je schwerer sich ein Erdensohn befreit,
Je mächt’ger rührt er unsre Menschlichkeit.
Conrad Ferdinand Meyer
In dem vorliegenden Werke sind wie in der vorangegangenen Trilogie ›Drei Meister‹ abermals drei Dichterbildnisse im Sinn einer inneren Gemeinschaft vereinigt; aber diese innere Einheit soll nicht mehr sein als eine Begegnung im Gleichnis. Ich suche keine Formeln des Geistigen, sondern ich gestalte Formen des Geistes. Und wenn ich in meinen Büchern immer mehrere solcher Bilder bewußt zusammenrücke, so geschieht dies einzig in der Art eines Malers, der seinen Werken gerne den richtigen Raum sucht, wo Licht und Gegenlicht wirkend gegeneinanderströmen und durch Pendants die erst verborgene, nun aber offenbare Analogie des Typus in Erscheinung tritt. Vergleich scheint mir immer ein förderndes, ja ein gestaltendes Element, und ich liebe ihn als Methode, weil er ohne Gewaltsamkeit angewendet werden kann. Er bereichert in gleichem Maße, als die Formel verarmt, er erhöht alle Werte, indem er Erhellungen durch unerwartete Reflexe schafft und eine Tiefe des Raums wie einen Rahmen um das abgelöste Bildnis stellt. Dieses plastische Geheimnis kannte schon der früheste Porträtist des Wortes, Plutarch, und in seinen ›Vergleichenden Lebensdarstellungen‹ bildet er immer gleichzeitig einen griechischen und römischen Charakter in analoger Darstellung, damit hinter der Persönlichkeit ihr geistiger Schlagschatten, der Typus, besser deutlich werde. Ein Ähnliches wie der erlauchte Ahnherr im Biographisch-Historischen versuche ich im geistig nachbarlichen Element, im Literarisch-Charakterologischen zu erreichen, und diese zwei Bände sollen nur die ersten einer werdenden Reihe sein, die ich ›Die Baumeister der Welt, eine Typologie des Geistes‹ nennen will. Nichts liegt mir aber ferner, als damit ein starres System in die Welt des Genius einkonstruieren zu wollen. Psychologe aus Leidenschaft, Gestalter aus gestaltendem Willen, treibe ich meine Bildnerkunst nur, wohin sie mich treibt, nur den Gestalten entgegen, denen ich mich zutiefst verbunden fühle. So ist schon von innen her jeder Komplettierung eine Grenze gesetzt, und ich bedaure diese Einschränkung durchaus nicht, denn das notwendig Fragmentarische erschreckt nur den, der an Systeme im Schöpferischen glaubt und hochmütig vermeint, die Welt des Geistes, die unendliche, rund auszirkeln zu können: mich aber lockt an diesem weiten Plan gerade die Zwiefalt, daß er an Unendliches rührt und sich doch keine Grenzen stellt. Und so baue ich, langsam und leidenschaftlich zugleich, mit meinen selbst noch neugierigen Händen den durch Zufall begonnenen Bau weiter hinauf in das kleine Himmelstück Zeit, das unsicher über unserem Leben hängt.
Die drei heroischen Gestalten Hölderlins, Kleistens und Nietzsches haben eine sinnfällige Gemeinsamkeit schon im äußeren Lebensschicksal: sie stehen gleichsam unter demselben horoskopischen Aspekt. Alle drei werden sie von einer übermächtigen, gewissermaßen überweltlichen Macht aus ihrem eigenen warmen Sein in einen vernichtenden Zyklon der Leidenschaft gejagt und enden vorzeitig in einer furchtbaren Verstörung des Geistes, einer tödlichen Trunkenheit der Sinne, in Wahnsinn oder Selbstmord. Unverbunden mit der Zeit, unverstanden von ihrer Generation, schießen sie meteorisch mit kurzem strahlenden Licht in die Nacht ihrer Sendung. Sie selbst wissen nicht um ihren Weg, um ihren Sinn, weil sie nur vom Unendlichen her in Unendliches fahren: kaum streifen sie in jähem Sturz und Aufstieg ihres Seins an die wirkliche Welt. Etwas Außermenschliches wirkt in ihnen, eine Gewalt über der eigenen Gewalt, der sie sich vollkommen verfallen fühlen: sie gehorchen nicht (schreckhaft erkennen sie es in den wenigen wachen Minuten ihres Ich) dem eigenen Willen, sondern sind Hörige, sind (im zwiefachen Sinne des Worts) Besessene einer höheren Macht, der dämonischen.
Dämonisch: das Wort ist durch so viele Sinne und Deutungen gewandert, seit es aus der mythisch-religösen Uranschauung der Antike bis in unsere Tage kam, daß es not tut, ihm eine persönliche Deutung aufzuprägen. Dämonisch nenne ich die ursprünglich und wesenhaft jedem Menschen eingeborene Unruhe, die ihn aus sich selbst heraus, über sich selbst hinaus ins Unendliche, ins Elementarische treibt, gleichsam als hätte die Natur von ihrem einstigen Chaos ein unveräußerliches unruhiges Teil in jeder einzelnen Seele zurückgelassen, das mit Spannung und Leidenschaft zurück will in das übermenschliche, übersinnliche Element. Der Dämon verkörpert in uns den Gärungsstoff, das aufquellende, quälende, spannende Ferment, das zu allem Gefährlichen, zu Übermaß, Ekstase, Selbstentäußerung, Selbstvernichtung das sonst ruhige Sein drängt; in den meisten, in den mittleren Menschen wird nun dieser kostbar-gefährliche Teil der Seele bald aufgesogen und aufgezehrt; nur in seltenen Sekunden, in den Krisen der Pubertät, in den Augenblicken, da aus Liebe oder Zeugungsdrang der innere Kosmos in Wallung gerät, durchwaltet dies Heraus-aus-dem-Leibe, dies Überschwengliche und Selbstentäußernde ahnungsvoll selbst die bürgerlich banale Existenz. Sonst aber ersticken die gemessenen Menschen in sich den faustischen Drang, sie chloroformieren ihn mit Moral, betäuben ihn mit Arbeit, dämmen ihn mit Ordnung: der Bürger ist immer Urfeind des Chaotischen, nicht nur in der Welt, sondern auch in sich selbst. Im höheren Menschen aber, besonders im produktiven, waltet die Unruhe schöpferisch fort als ein Ungenügen an den Werken des Tages, sie schafft ihm jenes »höhere Herz, das sich quält« (Dostojewski), jenen fragenden Geist, der über sich selbst hinaus eine Sehnsucht dem Kosmos entgegenstreckt. Alles, was uns über unser Eigenwesen, unsere persönlichen Interessen spürerisch, abenteuerlich ins Gefährliche der Frage hinaustreibt, danken wir dem dämonischen Teile unseres Selbst. Aber dieser Dämon ist nur insolange eine freundlich fördernde Macht, als wir ihn bewältigen, als er uns dient zu Spannung und Steigerung: seine Gefahr beginnt, wo diese heilsame Spannung zu Überspannung wird, wo die Seele dem aufrührerischen Trieb, dem Vulkanismus des Dämonischen, verfällt. Denn der Dämon kann seine Heimat, sein Element, die Unendlichkeit, nur dadurch erreichen, daß er mitleidslos das Endliche, das Irdische, also den Leib, in dem er wohnhaft weilt, zerstört: er hebt an mit Erweiterung, aber drängt zur Zersprengung. Darum füllt er Menschen, die ihn nicht rechtzeitig zu bändigen wissen, erfüllt er die dämonischen Naturen mit fürchterlicher Unruhe, reißt ihnen das Steuer ihres Willens übermächtig aus den Händen, daß sie, willenlos Getriebene, nun in dem Sturm und gegen die Klippen ihres Schicksals taumeln. Immer ist Lebensunruhe das erste Wetterzeichen des Dämonischen, Unruhe des Blutes, Unruhe der Nerven, Unruhe des Geistes (weshalb man auch jene Frauen die dämonischen nennt, die Unruhe, Schicksal, Verstörung um sich verbreiten). Immer umschwebt das Dämonische ein Gewitterhimmel von Gefahr und Gefährdung des Lebens, tragische Atmosphäre, Atem von Schicksal.
So gerät jeder geistige, jeder schöpferische Mensch unverweigerlich in den Kampf mit seinem Dämon, und immer ist es ein Heldenkampf, immer ein Liebeskampf: der herrlichste der Menschheit. Manche erliegen seinem hitzigen Andrängen wie das Weib dem Manne, sie lassen sich vergewaltigen von seiner übermächtigen Kraft, sie fühlen sich selig durchdrungen und überströmt vom fruchtbaren Element. Manche bändigen ihn und zwingen seinem heißen zuckenden Wesen ihren kalten, entschlossenen, zielhaften Manneswillen auf: durch ein Leben hin währt oft eine solche feindlich-glühende, liebevoll-ringende Umschlingung. Im Künstler nun und in seinem Werke wird dieses großartige Ringen gleichsam bildhaft: bis in den letzten Nerv seines Schaffens zittert der heiße Atem, die sinnliche Vibration der Brautnacht des Geistes mit seinem ewigen Verführer. Nur im Schöpfer vermag sich das Dämonische aus dem Schatten des Gefühles in Sprache und Licht zu ringen, und am deutlichsten erkennen wir seine leidenschaftlichen Züge in jenen, die ihm erliegen, im Typus des vom Dämon hinabgerissenen Dichters, für den ich hier die Gestalten Hölderlins, Kleistens und Nietzsches als die sinnvollsten der deutschen Welt gewählt habe. Denn wenn der Dämon selbstherrlich in einem Dichter waltet, ersteht in flammenhaft aufschießender Steigerung auch ein besonderer Typus der Kunst: Rauschkunst, exaltiertes, fieberhaftes Schaffen, spasmische, überwallende Aufschwünge des Geistes, Krampf und Explosion, Orgiasmus und Trunkenheit, die μανια der Griechen, die heilige Raserei, die sonst nur dem Prophetischen, dem Pythischen innewohnt. Das Maßlose, das Superlativistische ist immer das erste untrügbare Merkzeichen dieser Kunst, das ewige Sich-überbieten-Wollen in ein Letztes hinein, in jene Unendlichkeit, der das Dämonische als in seine urweltliche Natur heimatlich entgegendrängt. Hölderlin, Kleist und Nietzsche sind von diesem promethidischen Geschlecht, das feurig die Grenzen des Lebens durchstößt, rebellisch die Formen durchdringt und im Übermaß der Ekstase sich selbst vernichtet: aus ihrem Auge flackert sichtbar der fremde fiebrige Blick des Dämons, und er spricht von ihrer Lippe. Ja, er spricht sogar, da diese Lippe schon stumm und ihr Geist erloschen ist, noch aus ihrem zerstörten Leib: nirgends wird der furchtbare Gast ihres Wesens sinnlich wahrnehmbarer, als da ihre Seele, von übermächtiger Spannung auseinandergequält, zerreißt und man nun wie durch einen Spalt hinabsieht bis in das innerste Geklüft, wo der Dämon haust. Gerade im Untergang ihres Geistes wird die sonst bluthaft verborgene dämonische Macht in allen dreien plötzlich plastisch offenbar.
Um diese geheimnisvolle Wesenheit des vom Dämon übermannten Dichters, um das Dämonische selbst ganz deutlich zu machen, habe ich, getreu meiner Methode des Vergleichs, unsichtbar einen Gegenspieler den drei tragischen Helden entgegengestellt. Aber der wahre Widerpart des dämonisch beflügelten Dichters ist durchaus nicht etwa der undämonische: es gibt keine große Kunst ohne Dämonie, ohne das der Urmusik der Welt entflüsterte Wort. Niemand hat dies gültiger bezeugt als der Erzfeind alles Dämonischen, der auch im Leben Kleisten und Hölderlin hart abwehrend gegenüberstand, als Goethe, da er zu Eckermann über das Dämonische sagt: »Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende Aperçu … steht in niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben.« Es gibt keine große Kunst ohne das Inspirative, und alles Inspirative strömt wieder aus einem unbewußten Jenseits, einem Wissen über der eigenen Wachheit. Als den wahren Widerpart des exaltativen, des von seinem Überschwang sich selbst entrissenen Dichters, des göttlich Maßlosen, sehe ich den Herrn seines Maßes, den Dichter, der die ihm verliehene dämonische Macht mit dem irdisch ihm verliehenen Willen bändigt und zielhaft macht. Denn das Dämonische, zwar die herrlichste Kraft und Urmutter aller Schöpfung, ist vollkommen richtungslos: es zielt einzig ins Unendliche, in das Chaos zurück, dem es entstammt. Und eine hohe, gewiß nicht geringere Kunst als die des Dämonischen entsteht, wenn ein Künstler diese Urmacht menschlich bemeistert, wenn er ihr Maß im Irdischen und Richtung nach seinem Willen gibt, wenn er die Poesie im Sinne Goethes »kommandiert« und das »Inkommensurable« in gestalteten Geist verwandelt. Wenn er Herr des Dämons wird und nicht sein Knecht.
Goethe: damit ist nun schon der Name für den polaren Typus ausgesprochen, dessen Gegenwart sinnbildlich dies Buch durchwaltet. Goethe war nicht nur als Naturforscher, als Geologe »Gegner aller Vulkanität« – auch in der Kunst hat er das Evolutive über das Eruptive gestellt und alles Gewaltsam-Krampfhafte, alles Vulkanische, kurz, alles Dämonische mit einer bei ihm seltenen und geradezu erbitterten Entschiedenheit bekämpft. Und durch nichts mehr als durch diese Erbitterung der Abwehr verrät er, daß auch ihm der Kampf mit dem Dämon das entscheidende Existenzproblem seiner Kunst gewesen ist. Denn nur wer dem Dämon inmitten seines Lebens begegnet, wer ihm schauernd ins medusische Auge gesehen, wer ihn erfahren in seiner ganzen Gefahr, nur der kann ihn dermaßen als fürchterlichen Feind empfinden. Irgendwo im Dickicht seiner Jugend muß Goethe dem Gefährlichen mal Stirn an Stirn zu einer Entscheidung über Leben oder Tod gegenübergestanden haben – Werther bezeugt es, in dem er Kleistens und Tassos, in dem er Höderlins und Nietzsches Schicksal prophetisch von sich fortgestaltet hat! Und von dieser schreckhaften Begegnung her ist Goethe ein ganzes Leben lang eine erbittere Ehrfurcht, eine unverhohlene Furcht vor der tödlichen Kraft seines großen Gegners geblieben. Mit magischem Blick erkennt er den Blutfeind in jeder Gestalt und Verwandlung: in Beethovens Musik, in Kleistens Penthesilea, in Shakespeares Tragödien (die er schließlich nicht mehr aufzuschlagen vermag: »es würde mich zerstören«), und je mehr sein Sinn auf Gestaltung und Selbsterhaltung gerichtet ist, um so sorglicher, um so ängstlicher weicht er ihm aus. Er weiß, wie es endet, wenn man sich dem Dämon hingibt, darum wehrt er sich, darum warnt er vergeblich die andern: Goethe verbraucht ebensoviel heroische Kraft, um sich zu erhalten, wie die Dämonischen, um sich zu verschwenden. Auch ihm geht es in diesem Ringen um eine höchste Freiheit: er kämpft um sein Maß wider das Maßlose, um seine Vollendung, indes jene einzig um die Unendlichkeit.
Nur in diesem Sinne habe ich, nicht in dem einer (im Leben zwar vorhandenen) Rivalität, Goethes Gestalt gegen die drei Dichter und Diener des Dämons gestellt: ich glaubte einer großen Gegenstimme zu bedürfen, damit nicht das Exaltative, das Hymnische, das Titanische, das ich in Kleist, Hölderlin und Nietzsche darstellend verehre, als die einzige oder als die sublimste Kunst im Sinne eines Werts erscheine. Gerade ihr Widerspiel will mir als geistiges Polaritätsproblem höchsten Ranges erscheinen: so mag es nicht überflüssig sein, wenn ich diese immanente Antithese in einigen ihrer Beziehungen übersichtlich abwandle. Denn beinahe mathematisch formelhaft setzt sich diese Kontrastierung aus der umfassenden Form bis in die kleinsten Episoden ihres sinnlichen Lebens fort: nur der Vergleich zwischen Goethe und den dämonischen Widerpartnern gibt, als ein Vergleich der höchsten Wertformen des Geistes, Licht bis in die Tiefe des Problems.
Was zunächst an Hölderlin, Kleist und Nietzsche sinnfällig wird, ist ihre Unverbundenheit mit der Welt. Wen der Dämon in der Faust hat, den reißt er vom Wirklichen los. Keiner der drei hat Weib und Kind (ebensowenig wie ihre Blutsbrüder Beethoven und Michelangelo), keiner Haus und Habe, keiner dauernden Beruf, gesichertes Amt. Sie sind nomadische Naturen, Vaganten in der Welt, Außenseiter, Sonderbare, Mißachtete, und leben eine vollkommen anonyme Existenz. Sie besitzen nichts im Irdischen: weder Kleist noch Hölderlin, noch Nietzsche haben jemals ein eigenes Bett gehabt, nichts ist ihnen zu eigen, sie sitzen auf gemietetem Sessel und schreiben an gemietetem Tisch und wandern von einem fremden Zimmer in ein anderes. Nirgends sind sie verwurzelt, selbst Eros vermag nicht dauernd zu binden, die sich dem eifersüchtigen Dämon vergattet haben. Ihre Freundschaften werden brüchig, ihre Stellungen zerstieben, ihr Werk bleibt ohne Ertrag: immer stehen sie im Leeren und schaffen ins Leere. So hat ihre Existenz etwas Meteorisches, etwas von unruhig kreisenden, stürzenden Sternen, indes jener Goethes eine klare, geschlossene Bahn zieht. Goethe wurzelt fest und immer tiefer, immer breiter greifen seine Wurzeln aus. Er hat Weib und Kind und Enkel, Frauen umblühen sein Leben, eine kleine, aber sichere Zahl von Freunden umsteht jede seiner Stunden. Er wohnt im weiten, wohlhabenden Haus, das sich mit Sammlungen und Seltenheiten füllt, er wohnt im warmen, schützenden Ruhm, der mehr als ein halbes Jahrhundert seinen Namen umfängt. Er hat Amt und Würde, ist Geheimrat und Exzellenz, alle Orden der Erde blitzen von seiner breiten Brust. Bei ihm wächst die irdische Schwerkraft im Maße wie bei jenen die geistige Flugkraft, und so wird sein Wesen immer seßhafter, sicherer mit den Jahren (indes jene immer flüchtiger, immer unsteter werden und wie gejagte Tiere über die Erde rennen). Wo er steht, ist das Zentrum seines Ich und zugleich der geistige Mittelpunkt der Nation: von festem Punkte, ruhend-tätig umfaßt er die Welt, und seine Verbundenheit reicht weit hinweg über die Menschen, sie greift hinab zu Pflanze, Tier und Stein und vermählt sich schöpferisch dem Element.
So steht der Herr des Dämons am Ende seines Lebens mächtig im Sein (indes jene zerrissen werden wie Dionysos von der eigenen Meute). Goethes Existenz ist eine einzige strategische Weltgewinnung, während jene in heldischen, aber niemals planhaften Kämpfen abgedrängt werden von der Erde und ins Unendliche flüchten. Sie müssen sich gewaltam über das Irdische hinausreißen, um dem Überweltlichen vereint zu sein – Goethe braucht nicht mit einem Schritt die Erde zu verlassen, um die Unendlichkeit zu erreichen: langsam, geduldig zieht er sie an sich. Seine Methode ist derart eine durchaus kapitalistische: er legt jedes Jahr ein gemessenes Teil Erfahrung als geistigen Gewinn sparend zurück, den er am Jahresende als sorgfältiger Kaufmann dann ordnend in seinen »Tagebüchern« und »Annalen« registriert, sein Leben trägt Zins wie der Acker die Frucht. Jene aber wirtschaften wie Spieler, immer werfen sie, in einer herrlichen Gleichgültigkeit gegen die Welt, ihr ganzes Sein, ihre ganze Existenz auf eine Karte, Unendliches gewinnend, Unendliches verlierend – das Langsame, das Sparbüchsenhafte des Gewinns ist dem Dämon verhaßt. Erfahrungen, die einem Goethe das Wesenhafte des Daseins bedeuten, haben für sie keinen Wert: so lernen sie nichts an ihren Leiden als verstärktes Gefühl und gehen als Schwärmer, als heilig Fremde sich selber verloren. Goethe aber ist der ständig Lernende, das Buch des Lebens für ihn eine unablässig aufgeschlagene Aufgabe, die gewissenhaft, Zeile um Zeile, mit Fleiß und Ausdauer bewältigt werden will: ewig fühlt er sich schülerhaft, und spät erst wagt er das geheimnisvolle Wort:
Leben hab ich gelernt, fristet mir, Götter, die Zeit.
Sie aber finden das Leben weder erlernbar noch lernenswert: ihre Ahnung höheren Seins ist ihnen mehr als alle Apperzeption und sinnliche Erfahrung. Was ihnen der Genius nicht schenkt, ist ihnen nicht gegeben. Nur von seiner strahlenden Fülle nehmen sie ihr Teil, nur von innen, von dem aufgehitzten Gefühl lassen sie sich steigern und spannen. So wird Feuer ihr Element, Flamme ihr Tun, und dies Feurige, das sie erhebt, zehrt ihnen das ganze Leben weg. Kleist, Hölderlin, Nietzsche sind verlassener, erdfremder, einsamer am Ende ihres Daseins als am Anbeginn, indes bei Goethe zu jeder Stunde der letzte Augenblick der reichste ist. Nur der Dämon in ihnen wird stärker, nur das Unendliche durchwaltet sie mehr: es ist Armut an Leben in ihrer Schönheit und Schönheit in ihrer Armut an Glück.
Aus dieser durchaus polaren Einstellung ins Leben ergibt sich bei innerster Verwandtschaft im Genius ihr verschiedenes Wertverhältnis zur Wirklichkeit. Jede dämonische Natur verachtet die Realität als eine Unzulänglichkeit, sie bleiben – Hölderlin, Kleist, Nietzsche, jeder in einer andern Weise – Rebellen, Aufrührer und Empörer gegen die bestehende Ordnung. Lieber zerbrechen sie, als daß sie nachgeben; bis ins Tödliche, bis in die Vernichtung treiben sie ihre unbeirrbare Intransigenz. Dadurch werden sie (prachtvolle) tragische Charaktere, ihr Leben eine Tragödie. Goethe dagegen – wie deutlich war er über sich selbst! – vertraut Zelter an, er fühle sich nicht zum Tragiker geboren, »weil seine Natur konziliant sei«. Er will nicht wie jene den ewigen Krieg, er will – als »erhaltende und verträgliche Kraft«, die er ist – Ausgleich und Harmonie. Er unterordnet sich mit einem Gefühl, das man nicht anders als Frommheit nennen kann, dem Leben als der höheren, der höchsten Macht, die er in allen Formen und Phasen verehrt (»wie es auch sei, das Leben, es ist gut«). Nichts nun ist diesen Gequälten, Gejagten, Getriebenen, den vom Dämon durch die Welt Gerissenen fremder, als der Wirklichkeit solch hohen Wert oder überhaupt irgendeinen zu geben: sie kennen nur die Unendlichkeit, und als einzigen Weg, sie zu erreichen, die Kunst. Darum stellen sie die Kunst über das Leben, die Dichtung über die Realität, sie hämmern sich wie Michelangelo durch die tausend Steinblöcke blindwütig, finsterglühend, in immer fanatischerer Leidenschaft durch den dunklen Stollen ihres Daseins dem funkelnden Gestein entgegen, das sie tief unten in ihren Träumen fühlen, indes Goethe (wie Leonardo) die Kunst nur als einen Teil, als eine der tausend schönen Formen des Lebens fühlt, die ihm teuer ist wie die Wissenschaft, wie die Philosophie, aber doch nur Teil, ein kleiner wirkender Teil seines Lebens. Darum werden die Formen der Dämonischen immer intensiver, jene Goethes immer extensiver. Sie verwandeln ihr Wesen immer mehr in eine großartige Einseitigkeit, eine radikale Unbedingtheit, Goethe das seine in eine immer umfassendere Universalität.
Durch diese Liebe zum Dasein zielt alles beim antidämonischen Goethe auf Sicherheit, auf weise Selbsterhaltung. Durch diese Verachtung des realen Daseins drängt alles bei den Dämonischen zu Spiel, zu Gefahr, zu gewaltsamer Selbsterweiterung und endet in Selbstvernichtung. Wie bei Goethe alle Kräfte zentripetal, also vom Äußern zum Mittelpunkt hin sich sammeln, so wirkt bei jenen der Machtdrang zentrifugal, aus dem innern Kreis des Lebens herausdrängend und ihn unvermeidlich zerreißend. Und dies Ausfließen – dies Überfließenwollen ins Gestaltlose, in den Weltraum, sublimiert sich am sichtlichsten in ihrer Neigung zur Musik. Dort vermögen sie ganz uferlos, ganz formlos sich auszuströmen in ihr Element: gerade im Untergang geraten Hölderlin und Nietzsche, ja sogar der harte Kleist in ihre Magie. Verstand löst sich vollkommen in Ekstase, die Sprache in den Rhythmus: immer (auch bei Lenau) umbrandet Musik den Einsturz des dämonischen Geistes. Goethe dagegen hat eine »vorsichtige Haltung« zur Musik: er fürchtet ihre verlockende Kraft, den Willen ins Wesenlose abzuziehen, und dämmt sie in seinen starken Stunden (selbst Beethoven) gewaltsam zurück: nur in der Stunde der Schwachheit, der Krankheit, der Liebe ist er ihr offen. Sein wahres Element aber ist Zeichnung, ist Plastik, alles was feste Formen bietet, was Schranken stellt gegen das Vage, das Gestaltlose, alles was das Zerfließen, Zergehen, Entströmen der Materie hemmt. Lieben jene das, was entbindet, in eine Freiheit führt, ins Chaos des Gefühls zurück, so greift sein wissender Selbstbewahrungstrieb nach allem, was die Stabilität des Individuums fördert, nach Ordnung, Norm, Form und Gesetz.
Mit hundert Gleichnissen könnte man diesen fruchtbaren Gegensatz zwischen dem Herrn und den Dienern des Dämons noch abwandeln: ich wählte nur noch das geometrische als das immer deutlichste. Goethes Lebensformel bildet der Kreis: geschlossene Linie, volle Rundung und Umfassung des Daseins, ewige Rückkehr in sich selbst, gleiche Distanz zum Unendlichen vom unverrückbaren Zentrum, allseitiges Wachstum von innen her. Darum gibt es in seiner Existenz auch keinen eigentlichen Kulminationspunkt, keine Spitze der Produktion – zu allen Zeiten, nach allen Seiten wächst sein Wesen gleich rund und voll dem Unendlichen entgegen. Die Form der Dämonischen dagegen deutet die Parabel: rascher, schwunghafter Aufstieg in einer einzigen Richtung, in der Richtung gegen das Obere, Unendliche empor, steile Kurve und jäher Absturz. Ihr Höhepunkt ist (dichterisch und als Lebensmoment) knapp vor dem Niederbruch: ja, er fließt mit ihm geheimnisvoll zusammen. Darum ist auch der Dämonischen, ist Hölderlins, ist Kleistens, ist Nietzsches Untergang integrierender Bestandteil ihres Schicksals. Erst er vollendet ihr Seelenbildnis, so wie der Niederfall der Parabel die geometrische Figur. Goethes Tod dagegen ist nur ein unmerkbares Partikel im vollendeten Kreise, er gibt dem Lebensbild nichts Wesentliches dazu. Tatsächlich stirbt er auch nicht wie jene einen mystischen, einen heroisch-legendären Tod, sondern einen Bettod, einen Patriarchentod (dem vergebens die Volkslegende durch eine Erfindung: Mehr Licht! etwas Weissagendes, Symbolisches zulegen wollte). Ein solches Leben hat nur ein Ende, weil es in sich erfüllt war: jenes der Dämonischen einen Untergang, ein loderndes Schicksal. Der Tod entgilt ihnen für Armut des Daseins und gibt ihrem Sterben noch mystische Macht: wer das Leben als Tragödie lebt, hat das Sterben eines Helden.
Leidenschaftliche Hingabe bis zur Auflösung ins Elementare, leidenschaftliche Bewahrung im Sinne der Selbstgestaltung – beide Formen des Kampfes mit dem Dämon fordern aber höchsten Heroismus des Herzens, beide schenken sie herrliche Siege im Geist. Die Goethische Lebenserfüllung und der Dämonischen schöpferischer Untergang – beide bewältigen sie, aber jeder Typus in einem anders bildnerischen Sinn, die gleiche, die einzige Aufgabe des geistigen Individuums: an das Dasein unermeßliche Forderungen zu stellen. Wenn ich ihre Charaktere hier widereinander stellte, geschah es nur, um das Zwiefache ihrer Schönheit im Sinnbild zu verdeutlichen, nicht aber, um eine Entscheidung herauszufordern, und am wenigsten, um jene noch umgängliche und durchaus banale klinische Deutung zu fördern, als ob Goethe die Gesundheit darstelle, und jene die Krankheit, Goethe das Normale, und jene das Pathologische. Das Wort ›pathologisch‹ gilt nur im Unproduktiven, in der niedern Welt: denn Krankheit, die Unvergängliches schafft, ist keine Krankheit mehr, sondern eine Form der Übergesundheit, der höchsten Gesundheit. Und wenn das Dämonische auch am äußersten Rande des Lebens steht und sich schon darüber hinaus beugt ins Unbetretbare und Unbetretene, so ist es doch immanente Substanz des Menschlichen und durchaus innen im Kreise der Natur. Denn auch sie selbst, die Natur, sie, die seit Jahrtausenden dem Saatkorn seine Zeit des Wachstums unveränderlich zuzählt und dem Kind im Mutterleib seine Frist, auch sie, das Urbild aller Gesetze, kennt solche dämonische Augenblicke, auch sie hat Ausbrüche und Überschwänge, wo sie – im Gewitter, in den Zyklonen, in den Kataklysmen – ihre Kräfte gefährlich spannt und bis ins Äußerste der Selbstvernichtung treibt. Auch sie unterbricht manchmal – selten freilich, so selten, wie solche dämonischen Menschen der Menschheit erscheinen! – ihren geruhigen Gang, aber nur dann, nur aus ihrem Übermaß werden wir erst ihres vollen Maßes gewahr. Nur das Seltene erweitert unsern Sinn, nur am Schauer vor neuer Gewalt wächst unser Gefühl. Immer ist darum das Außerordentliche das Maß aller Größe. Und immer – auch in den verwirrendsten und gefährlichsten Gestaltungen – bleibt das Schöpferische Wert über allen Werten, Sinn über unsern Sinnen.
Salzburg 1925
Hölderlin
Denn schwer erkennt der
Sterbliche die Reinen
›Der Tod des Empedokles‹ I
Die heilige Schar
… es würde Nacht und kalt
Auf Erden und in Not verzehrte sich
Die Seele, sendeten zuzeiten nicht
Die guten Götter solche Jünglinge,
Der Menschen welkend Leben zu erfrischen.
›Der Tod des Empedokles‹
Das neue, das neunzehnte Jahrhundert liebt seine Jugend nicht. Ein glühendes Geschlecht ist erstanden: feurig und kühn drängt es von allen Windrichtungen zugleich aus den aufgelockerten Schollen Europas der Morgenröte neuer Freiheit entgegen. Die Fanfare der Revolution hat diese Jünglinge erweckt, ein seliger Frühling des Geistes, eine neue Gläubigkeit entbrennt ihnen die Seele. Das Unmögliche scheint plötzlich nah geworden, die Macht und die Herrlichkeit der Erde jedem Verwegenen zur Beute, seit ein Dreiundzwanzigjähriger, seit Camille Desmoulins mit einer einzigen kühnen Geste die Bastille zerbrach, seit der knabenhaft schlanke Advokat aus Arras, Robespierre, Könige und Kaiser zittern läßt vor dem Sturm seiner Dekrete, seit der kleine Leutnant aus Korsika, Bonaparte, mit dem Degen die Grenzen Europas nach seinem Gutdünken zieht und die herrlichste Krone der Welt mit Abenteurerhänden faßt. Nun ist ihre Stunde, die Stunde der Jugend gekommen: wie das erste zarte Grün nach dem ersten Frühlingsregen schießt sie plötzlich auf, diese heroische Saat heller, begeisterter Jünglinge. In allen Ländern heben sie sich zugleich empor, den Blick zu den Sternen, und stürmen über die Schwelle des neuen Jahrhunderts, als in ihr eigenstes Reich. Das achtzehnte Jahrhundert, so fühlen sie, hat den Greisen und Weisen gehört, Voltaire und Rousseau, Leibniz und Kant, Haydn und Wieland, den Langsamen und Geduldigen, den Großen und Gelehrten: nun aber gilt Jugend und Kühnheit, Leidenschaft und Ungeduld. Mächtig schwillt sie empor, die aufstürmende Woge: nie sah Europa seit den Tagen der Renaissance einen reineren Aufschwall des Geistes, ein schöneres Geschlecht.
Aber das neue Jahrhundert liebt diese seine kühne Jugend nicht, es hat Furcht vor ihrer Fülle, einen argwöhnischen Schauer vor der ekstatischen Kraft ihres Überschwangs. Und mit eiserner Sense mäht es unbarmherzig die eigene Frühlingssaat. Zu Hunderttausenden malmt die Mutigsten der Napoleonische Krieg, fünfzehn Jahre lang zerstampft seine mörderische Völkermühle die Edelsten, die Kühnsten, die Freudigsten aller Nationen, und die Erde Frankreichs, Deutschlands, Italiens bis hinüber zu den Schneefeldern Rußlands und den Wüsten Ägyptens ist gedüngt und getränkt von ihrem pochenden Blut. Aber als wollte sie nicht bloß die Jugend allein, die wehrhafte, sondern den Geist der Jugend selbst ertöten, so hält diese selbstmörderische Wut nicht inne bei den Kriegerischen, bei den Soldaten: auch gegen die Träumer und Sänger, die, halbe Knaben noch, die Schwelle des Jahrhunderts überschritten haben, auch gegen die Epheben des Geistes, gegen die seligen Sänger, gegen die heiligsten Gestalten hebt die Vernichtung das Beil. Nie ward in ähnlich kurzer Zeit eine ähnlich herrliche Hekatombe von Dichtern, von Künstlern geopfert als um jene Zeitwende, die Schiller, ahnungslos des eigenen nahen Geschicks, noch mit rauschendem Hymnus gegrüßt. Nie hielt das Schicksal verhängnisvollere Lese reiner und früh verklärter Gestalten. Nie netzte den Altar der Götter so viel göttliches Blut.
Vielfältig ist ihr Tod, aber allen verfrüht, allen in der Stunde innerlichster Erhebung verhängt. Den ersten, André Chenier, diesen jungen Apoll, in dem Frankreich ein neues Griechentum wiedergeboren war, schleppt der letzte Karren des Terrors zur Guillotine: ein Tag noch, ein einziger Tag, die Nacht vom achten zum neunten Thermidor, und er wäre gerettet vom Blutblock und zurückgegeben seinem antikisch reinen Gesang. Aber das Schicksal will ihn nicht sparen, nicht ihn und nicht die andern: mit zornigem Willen fällt es wie eine Hydra immer ein ganzes Geschlecht. England ist nach Jahrhunderten wieder ein lyrischer Genius geboren, ein elegischer schwärmerischer Jüngling, John Keats, dieser selige Künder des Alls: mit siebenundzwanzig Jahren reißt ihm das Verhängnis den letzten Atem aus der klingenden Brust. Ein Bruder des Geistes beugt sich über sein Grab, Shelley, dieser feurige Schwärmer, den sich die Natur zum Boten ihrer schönsten Geheimnisse erlesen: ergriffen stimmt er dem Bruder im Geiste das herrlichste Totenlied an, das je ein Dichter dem andern gedichtet, die Elegie ›Adonais‹ –, aber ein paar Jahre nur, und ein sinnloser Sturm wirft seine eigene Leiche an den tyrrhenischen Strand. Lord Byron, sein Freund, Goethes geliebtester Erbe, eilt her und entzündet dem Toten, wie Achill seinem Patroklos, den Scheiterhaufen am südlichen Meer: in Flammen fährt Shelleys sterbliche Hülle in den Himmel Italiens empor –, aber er selbst, Lord Byron, verbrennt wenige Jahre später im Fieber zu Missolunghi. Ein Jahrzehnt nur, und die edelste lyrische Blüte, die Frankreich, die England gegeben war, ist vernichtet. Aber auch Deutschlands jungem Geschlecht wird diese harte Hand nicht gelinder: Novalis, der mystisch fromm bis ins letzte Geheimnis der Natur gedrungen, löscht allzufrüh aus, vertropfend wie ein Kerzenlicht in dunkler Zelle, Kleist zerschmettert sich den Schädel in jäher Verzweiflung, Raimund folgt ihm bald in gleich gewaltsamen Tod, Georg Büchner rafft als Vierundzwanzigjährigen ein Nervenfieber hinweg. Wilhelm Hauff, den phantasievollsten Erzähler, dies unaufgeblühte Genie, scharren sie als Fünf- undzwanzigjährigen ein, und Schubert, die liedgewordene Seele aller dieser Sänger, strömt vorzeitig aus in letzte Melodie. Mit allen Keulen und Giften der Krankheit, mit Selbstmord und Fremdmord rotten sie es aus, das junge Geschlecht: Leoparid, der edel-traurige, welkt in düsterm Siechtum, Bellini, der Sänger der ›Norma‹, stirbt in magischem Beginn, Gribojedof, den hellsten Geist des erwachenden Rußlands, erdolcht in Tiflis ein Perser. Seinem Leichenwagen begegnet zufällig im Kaukasus Alexander Puschkin, dies neue Genie Rußlands, sein geistiges Morgenrot. Doch er hat nicht lange Zeit, den Frühgesunkenen zu beklagen, ein paar Jahre nur, und die Kugel trifft ihn tödlich im Duell. Keiner von allen erreicht das vierzigste Jahr, die wenigsten unter ihnen das dreißigste, so wird der rauschendste lyrische Frühling, den Europa jemals gekannt, über Nacht geknickt, zerschmettert und versprengt die heilige Schar der Jünglinge, die in allen Sprachen zugleich den Hymnus der Natur und der seligen Welt gesungen. Einsam wie Merlin im verzauberten Wald, unbewußt der Zeit, halb schon vergessen, halb schon Legende, sitzt Goethe, der weise und greise, in Weimar: nur von diesen uralten Lippen formt sich noch in seltener Stunde orphischer Gesang. Ahne und Erbe zugleich des neuen Geschlechts, das er staunend überlebt, wahrt er in eherner Urne das klingende Feuer.
Einer nur, ein einziger von der heiligen Schar, der Reinste von allen, weilt noch lange auf der entgötterten Erde, Hölderlin, doch an ihm hat das Schicksal am seltsamsten getan. Noch blüht ihm die Lippe, noch tastet sein alternder Leib sich über die deutsche Erde, noch gehen seine Blicke blau vom Fenster hinüber in die geliebte Landschaft des Neckars, noch darf er die Lider frommen Blicks zum »Vater Äther«, zum ewigen Himmel hin aufschlagen: doch sein Sinn ist nicht mehr wach, sondern verwölkt in einen unendlichen Traum. Wie Tiresias, den Seher, haben die eifersüchtigen Götter den, der sie belauschte, nicht getötet, sondern ihm nur den Geist geblendet. Wie Iphigenia, das heiligste Opfer, haben sie ihn nicht geschlachtet, sondern in die Wolke gehüllt und hinweggetragen in den Pontus des Geistes, in die kimmerische Dunkelheit des Gefühls. Ein Schleier ist um seine Worte und seine Seele gedunkelt: verworrenen Sinns lebt der »in himmlische Gefangenschaft Verkaufte« noch dumpfe Jahrzehnte dahin, der Welt wie sich selbst verloren, und nur der Rhythmus, die dumpfe klingende Welle stürzt in zerstäubten, zerquellenden Lauten von seinem zuckenden Mund. Um ihn blühen und welken seine geliebten Frühlinge, er zählt sie nicht mehr. Um ihn sinken und sterben die Menschen, er weiß es nicht mehr. Schiller und Goethe und Kant und Napoleon, die Götter seiner Jugend, sind ihm längst vorausgegangen, brausende Bahnen durchqueren sein erträumtes Germanien, Städte ballen, Länder heben sich auf – nichts von alldem erreicht sein versonnenes Herz. Allmählich beginnt das Haar ihm zu grauen, ein scheuer, gespenstiger Schatten einstiger Lieblichkeit, tappt er hin durch die Straßen Tübingens, verspottet von den Kindern, verhöhnt von den Studenten, die hinter der tragischen Larve den abgestorbenen Geist nicht ahnen, und längst denkt kein Lebender seiner mehr. Einmal, in der Mitte des neuen Jahrhunderts, hört die Bettina, daß er (einst von ihr wie ein Gott gegrüßt) sein »Schlangenleben« noch führe in des braven Tischlers Haus und erschrickt wie vor einem Hadesentsandten – so fremd hängt er hinüber in die Zeit, so ausgeklungen tönt sein Name, so vergessen ist seine Herrlichkeit. Und wie er sich dann eines Tages leise hinlegt und stirbt, rührt dies stille Sinken nicht stärkeren Laut in der deutschen Welt als eines herbstlichen Blattes schwankes Zubodenschweben. Handwerker tragen ihn in verschabtem Gewand hin zu der Grube, die Tausende seiner geschriebenen Blätter werden vertan oder lässig bewahrt und stauben dann jahrzehntelang in Bibliotheken. Ungelesen, unempfangen bleibt für ein ganzes Geschlecht die heroische Botschaft dieses Letzten, dieses Reinsten der heiligen Schar.
Wie eine griechische Statue im Schoße der Erde, so verbirgt sich Hölderlins geistiges Bild im Schutt des Vergessens, jahre-, jahrzehntelang. Aber wie endlich liebevolle Mühe den Torso aus dem Dunkel gräbt, fühlt mit Erschauern ein neues Geschlecht die unzerstörbare Reinheit dieser marmornen Jünglingsgestalt. In herrlichen Maßen, der letzte Ephebe deutschen Griechentums, steht sein Bildnis wieder auf, Begeisterung blüht heute wie einst auf seiner singenden Lippe. Alle Frühlinge, die er verkündet, scheinen gleich sam verewigt in seiner einzigen Gestalt: und mit der strahlenden Stirne des Erleuchteten tritt er aus dem Dunkel wie aus einer geheimnisvollen Heimat zurück in unsere Zeit.
Kindheit
Aus stillem Hause senden die Götter oft
Auf kurze Zeit zu Fremden die Lieblinge,
Damit, erinnert, sich am edlen
Bilde der Sterblichen Herz erfreue.
Das Hölderlin-Haus steht in Lauffen, einem altertümlich-klösterlichen Dörfchen am Neckar, ein paar Wegstunden nur von Schillers Heimat. Diese ländlich-schwäbische Welt ist Deutschlands mildeste Landschaft, sein Italien: die Alpen drücken nicht mehr rauh heran und sind doch ahnend nah, silbernen Bogens strömen Flüsse durch Rebengelände, Heiterkeit des Volkes mindert die Herbe des alemannischen Stammes und löst sie gern in Gesang. Die Erde ist reich ohne Üppigkeit, die Natur lind, doch ohne Freigebigkeit: handwerkliches Geschäft gattet sich fast übergangslos der bäuerlichen Welt. Die Dichtung der Idylle hat dort ihre Heimat, wo die Natur den Menschen leicht befriedet, und selbst der in tiefste Düsternis getriebene Dichter denkt der verlorenen Landschaft mit gemildertem Sinn:
Engel des Vaterlands! O ihr, vor denen das Auge,
Sei’s auch stark, und das Knie bricht dem vereinzelten Mann,
Daß er sich halten muß an die Freund’ und bitten die Teuern,
Daß sie tragen mit ihm all die beglückende Last,
Habt, o Gütige, Dank!
Wie sanft, wie elegisch-zärtlich wird des Schwermütigen Überschwang, wenn er dies Schwaben singt, diesen seinen Himmel unter den ewigen Himmeln, wie beruhigt flutet der Aufschwall ekstatischen Gefühls zu ebenmäßigem Rhythmus zurück, wenn er an diese Erinnerungen rührt! Aus der Heimat geflüchtet, verraten von seinem Griechenland, zernichtet in seinen Hoffnungen, baut er aus zärtlichem Gedenken immmer wieder dies eine Bild der kindlichen Welt, und unsterblich ist es erhoben zu rauschendem Hymnus:
Seliges Land! Kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstock,
Nieder ins schwellende Gras regnet im Herbste das Obst.
Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge,
Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.
Und, wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,
Steigen am dunklen Gebirg Festen und Hütten hinauf.
Ein Leben lang sehnt er sich in diese Heimat als in den Himmel seines Herzens zurück: die Kindheit ist Höderlins wahrste, wachste und glücklichste Zeit.
Sanfte Natur hegt ihn ein, sanfte Frauen ziehen ihn auf: kein Vater ist (verhängnisvollerweise) da, ihn Zucht und Härte zu lehren, ihm die Muskeln des Gefühls gegen seinen ewigen Feind, gegen das Leben, zu härten: nicht wie bei Goethe zwingt früh pedantisch-zuchtvoller Sinn dem Werdenden das Gefühl der Verantwortung auf und preßt das Wächserne der Neigung zu planvollen Formen. Nur Frommheit lehrt ihn die Großmutter und die mildere Mutter, und früh schon flüchtet der träumerische Sinn in die erste Unendlichkeit jeder Jugend: in die Musik. Aber die Idylle hat vorzeitig ihr Ende. Mit vierzehn Jahren kommt der Empfindsame als Alumnus in die Klosterschule von Denkendorf, dann in das Kloster von Maulbronn, als Achtzehnjähriger in das Tübinger Stift, das er erst Ende 1792 verläßt – ein ganzes Jahrzehnt fast wird diese freiselige Natur hinter Mauern gesperrt, in klösterliches Gelaß, in drückende Menschengemeinsamkeit. Der Kontrast ist zu vehement, um nicht schmerzhaft, ja zerstörend zu wirken: aus der Ungezwungenheit freier sinnender Spiele an Ufer und Feld, aus der Weichlichkeit fraulich-mütterlicher Behütung preßt man ihn in das mönchisch schwarze Kleid, klösterliche Zucht schraubt ihn an einzelne Stunden mechanisch geordneter Tätigkeit. Für Hölderlin werden die Klosterschuljahre, was für Kleist die Kadettenjahre: Zurückdrängung des Gefühl ins Sensitive, Vorbereitung und Überreizung stärkster innerer Spannung, Widerstand gegen die reale Welt. Etwas in seinem Innern wird damals für immer verwundet und geknickt: »Ich will Dir sagen«, schreibt er ein Jahrzehnt später, »ich habe einen Ansatz von meinen Knabenjahren, von meinem damaligen Herzen, der ist mir noch der liebste – das war eine wächserne Weichheit … aber eben dieser Teil meines Herzens wurde am ärgsten mißhandelt, solange ich im Kloster war.« Wie er das schwere Tor des Stifts hinter sich schließt, ist der edelste, der geheimste Trieb seines Lebensglaubens schon vorzeitig angekränkelt und halb verwelkt, bevor er hinaustritt in die Sonne des freien Tages. Und schon schwebt um seine noch klare Jünglingsstirn – freilich ein dünner floriger Hauch nur – jene leise Melancholie des Verlorenseins in die Welt, die dann immer dunkler und dichter mit den Jahren die Seele umdämmert und schließlich den Blick für jede Freudigkeit verschattet.
Hier also, so früh schon, im Zwielicht der Kindheit, in den entscheidenden Formungsjahren beginnt jener unheilbare Riß in Hölderlins Innern, jene unbarmherzige Zäsur zwischen der Welt und seiner eigenen Welt. Und dieser Riß narbt niemals mehr zu: ewig bleibt ihm das Gefühl des in die Fremde verstoßenen Kindes, ewig diese Sehnsucht nach einer früh verlorenen seligen Heimat, die ihm manchmal wie eine Fata Morgana im dichterischen Gewölk von Ahnung und Erinnerung, von Träumen und Musik erscheint. Unablässig empfindet sich der ewig Unmündige aus den Himmeln – seiner Jugend, erster Ahnung, unbekannter Vorwelt – gewaltsam auf die harte Erde, in eine ihm widerstrebende Sphäre herabgeschleudert; und von jener Frühe, von jener ersten harten Begegnung mit der Realität an schwärt in seiner verwundeten Seele das Gefühl der Weltfeindschaft. Hölderlin bleibt ein vom Leben Unbelehrbarer, und alles, was er an Scheinfreude und Ernüchterung, an Glück und Enttäuschung gelegentlich gewinnt, vermag die unabänderlich festgelegte abwehrende Haltung gegen die Wirklichkeit nicht mehr zu beeinflussen. »Ach, die Welt hat meinen Geist von früher Jugend an in sich zurückgescheucht«, schreibt er einmal an Neuffer, und tatsächlich kommt er nie mehr mit ihr in eine Bindung und Beziehung, er wird paradigmatisch das, was die Psychologie einen »introverten Typus« nennt, einer jener Charaktere, die sich mißtrauisch gegen alle äußere Anregung abgesperrt halten und nur von innen heraus, aus den urtümlich eingepflanzten Keimen ihre geistige Gestaltung entwickeln. Ein halber Knabe noch, träumt er sich immer nur zurück in das Erlebnis der Kindheit, in die Ahnung mythischer Zeiten und die ungelebten Sphären des Parnaß. Die Hälfte seiner Gedichte variiert von nun ab nur dasselbe Motiv, den unlösbaren Gegensatz von gläubiger, sorgloser Kindheit und dem feindseligen, illusionslosen, praktischen Leben, der »zeitlichen Existenz« im Gegensatz zum geistigen Sein. Ein Zwanzigjähriger, überschreibt er schon trauernd ein Gedicht ›Einst und Jetzt‹, und im Hymnus ›An die Natur‹ rauscht dann strophisch gebunden diese seine ewige Erlebnismelodie herrlich hervor:
Da ich noch um deinen Schleier spielte,
Noch an dir wie eine Blüte hing,
Noch dein Herz in jedem Laute fühlte,
Der mein zärtlichbebend Herz umfing,
Da ich noch mit Glauben und mit Sehnen
Reich, wie du, vor deinem Bilde stand,
Eine Stelle noch für meine Tränen,
Eine Welt für meine Liebe fand;
Da zur Sonne noch mein Herz sich wandte,
Als vernähme seine Töne sie,
Und die Sterne seine Brüder nannte
Und den Frühling Gottes Melodie,
Da im Hauche, der den Hain bewegte,
Noch dein Geist, dein Geist der Freude sich
In des Herzens stiller Welle regte,
Da umfingen goldne Tage mich.
Aber diesem Hymnus auf die Kindheit antwortet schon in düsterem Moll die Lebensfeindschaft des früh Enttäuschten:
Tot ist nun, die mich erzog und stillte,
Tot ist nun die jugendliche Welt,
Diese Brust, die einst ein Himmel füllte,
Tot und dürftig wie ein Stoppelfeld;
Ach! es singt der Frühling meinen Sorgen
Noch, wie einst, ein freundlich tröstend Lied,
Aber hin ist meines Lebens Morgen,
Meines Herzens Frühling ist verblüht.
Ewig muß die liebste Liebe darben,
Was wir lieben, ist ein Schatten nur,
Da der Jugend goldne Träume starben,
Starb für mich die freundliche Natur;
Das erfuhrst du nicht in frohen Tagen,
Daß so ferne dir die Heimat liegt,
Armes Herz, du wirst sie nie erfragen,
Wenn dir nicht ein Traum von ihr genügt.
In diesen Strophen (die sich in unzählbaren Varianten durch sein ganzes Werk wiederholen) ist Hölderlins romantische Lebenseinstellung schon vollkommen fixiert: der ewig zurückgewandte Blick auf die »Zauberwolke, in die der gute Geist meiner Kindheit mich hüllte, daß ich nicht zu früh das Kleinliche und Barbarische der Welt sah, die mich umgab«. Schon der Unmündige sperrt sich gegen jeden Zustrom von Erlebnis feindlich ab: Zurück und Empor sind die einzigen Zielrichtungen seiner Seele, niemals zieht sein Wille ins Leben hinein, immer darüber hinaus. Er kennt und will kein Verbundensein mit der Zeit kennen, selbst nicht im Sinne des Kampfes. So setzt er seine ganze Kraft ins schweigende Erdulden, in die Selbstbewahrung der Reinheit. Wie Quecksilber gegen Feuer und Wasser, wehrt sich sein Eigenelement gegen alle Bindung und Verschmelzung. Darum umgürtet ihn schicksalhaft eine unbesiegliche Einsamkeit.
Hölderlins Entwicklung ist im eigentlichen abgeschlossen, als er die Schule verläßt. Er hat sich noch gesteigert im Sinne der Intensität, nicht aber entfaltet im Sinne der Aufnahme, der stofflich-sinnlichen Bereicherung. Er wollte nichts lernen, nichts annehmen von der ihm widersinnigen Sphäre des Alltags; sein unvergleichlicher Instinkt für Reinheit verbot ihm Vermengung mit dem gemischten Stoff des Lebens. Damit wird er aber zugleich – im höchsten Sinne – Frevler gegen das Weltgesetz und sein Schicksal im antiken Geist Entsühnung einer Hybris, einer heldisch heiligen Überhebung. Denn das Gesetz des Lebens heißt Vermengung, es duldet kein Außensein in seinem ewigen Kreislauf: wer sich weigert, in diese warme Flut einzutauchen, der verdurstet am Strande; wer nicht teilnimmt, dessen Leben ist bestimmt, ein ewiges Außen zu bleiben, tragische Einsamkeit. Hölderlins Anspruch, nur der Kunst und nicht dem Dasein, nur den Göttern und nicht den Menschen zu dienen, enthält – ich wiederhole, im höchsten, im transzendentalen Sinne – wie jener seines Empedokles eine irreale, eine überhebliche Forderung. Denn nur den Göttern ist es gegönnt, ganz im Reinen, im Ungemengten zu walten, und so wird es nur notwendige Rache, wenn sich das Leben an seinem Verächter mit den niedersten Kräften, mit der gemeinen Notdurft des Brotes rächt, wenn es gerade den, der ihm in keiner Form dienen will, immer wieder in die kleinlichsten Formen der Knechtschaft zurückstößt. Eben darum weil Höderlin nicht teilen will, wird ihm alles genommen; weil sein Geist nicht sich fesseln lassen will, fällt sein Leben in Hörigkeit. Hölderlins Schönheit ist gleichzeitig Hölderlins tragische Schuld: aus Gläubigkeit an die obere, die höhere Welt wird er Empörer gegen die untere, die irdische, der er nicht anders zu entfliehen vermag als auf der Schwinge seines Gedichts. Und erst als der Unbelehrbare den Sinn seines Schicksals erkennt – den heldischen Untergang –, bemeistert er sein Schicksal: nur eine kurze Spanne zwischen Aufgang und Untergang der Sonne gehört ihm zu, zwischen Ausfahrt und Scheitern, aber diese Landschaft einer Jugend ist heroisch: Felsgebirg des trotzigen Geistes, von schäumender Woge der Unendlichkeit umrauscht, seliges Segel im Sturm verloren und feurige Wolkenfahrt.
Bildnis in Tübingen
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.
Wie flüchtiger Sonnenblick zwischen lastendem Gewölk glänzt in dem einzig erhaltenen Frühbild Höderlins Gestalt: ein schlanker Jüngling, das blonde Haar in weicher Welle zurückwogend von klarer, morgendlich strahlender Stirn. Klar auch die Lippe und frauenhaft weich die Wange (die man sich leicht errötend denken mag von rasch aufwogender Glut), hell das Auge unter den schön geschwungenen schwarzen Brauen: nirgends nistet in diesem zarten Antlitz ein heimlicher Zug, der auf Härte deutete oder auf Hochmut, eher eine mädchenhafte Schüchternheit, eine verborgen-zärtliche Woge des Gefühls. »Anstand und Artigkeit« rühmt ihm ja auch Schiller von der ersten Begegnung her nach, und wohl kann man sich den schmalhüftigen blonden Jüngling im ernsten Habit des protestantischen Magisters vorstellen, wie er im schwarzen ärmellosen Kleid mit der weißen Halskrause sinnend die Klostergänge durchschreitet. Wie ein Musiker sieht er aus, ein wenig einem Frühbild des jungen Mozart ähnlich, und so schildern ihn auch die Stubengenossen am liebsten. »Er spielte die Violine – seine regelmäßige Gesichtsbildung, der sanfte Ausdruck seines Gesichts, sein schöner Wuchs, sein sorgfältiger reinlicher Anzug und jener unverkennbare Ausdruck des Höheren in seinem ganzen Wesen sind mir immer gegenwärtig geblieben.« Man kann sich auf diese weiche Lippe kein derbes Wort, in dies schwärmende Auge keine unreine Gier, in diese edelgeschwungene Stirn keinen niedern Gedanken denken, freilich auch keine rechte Heiterkeit in die aristokratisch zarte Verhaltenheit dieser Züge, und so, ganz in sich verborgen, scheu in sich zurückgedrängt, schildern ihn auch seine Gefährten: daß er niemals mindrer Geselligkeit sich mengte, nur im Refektorium mit Freunden schwärmerisch die Verse Ossians, Klopstocks und Schillers liest oder in Musik seinen sehnenden Überschwang entlastet. Ohne stolz zu sein, schafft er um sich eine unmerkbare Distanz: wenn er schlank, aufrecht, gleichsam einem Höheren, Unsichtbaren entgegen aus der Zelle unter die anderen tritt, ist ihnen, »als schritte Apoll durch den Saal«. Selbst den Amusischen, den kleinen Pfarrersohn und späteren Pfarrer, der dies Wort verzeichnet, gemahnt Hölderlins Wesen unbewußt an Hellas, an die heimliche griechische Heimat.
Aber einen Augenblick nur tritt so hell, gleichsam umleuchtet von einem Sonnenstrahl des geistigen Morgens, sein Antlitz aus dem Gewölk seines Schicksals, göttlich aus Göttlichem hervor. Aus den Mannesjahren ist uns kein Bildnis mehr überliefert, gleichsam als wollte das Schicksal uns Höderlin nur in seiner Blüte zeigen, einzig das strahlende Antlitz des ewigen Jünglings uns kennen lassen und niemals den Mann (der er niemals wahrhaftig geworden), und schließlich wieder – ein halbes Jahrhundert später – die ausgehöhlte, vertrocknete Larve des kindgewordenen Greises. Dazwischen liegt Grauen und Dämmerung: man ahnt nur aus überliefertem Wort, wie der halkyonische Glanz um diese mädchenhaft reine Gestalt, das Heilig-Beschwingte seines strahlenden Jünglingtums allmählich zu verlöschen begann. Jene »Artigkeit«, die Schiller an ihm als auffällig rühmt, erstarrt bald zu krampfigem Zwang, die Schüchternheit zu misanthropischer Menschenängstlichkeit: im abgeschabten Hauslehrerrock, der Letzte bei Tisch und nahe schon der bezahlten Livree der Diener, muß er die servile Geste des Niedergedrückten erlernen: scheu, verängstigt, gequält und der Macht seines Geistes nur ohnmächtig leidend bewußt, verliert er bald den freien klingenden Gang, in dem sein Rhythmus wie über Wolken hinschreitet, und auch innen bricht die Schwebe, das seelische Gleichgewicht. Hölderlin wird früh mißtrauisch und verwundbar, »ein Wort, ein flüchtiges, konnte ihn beleidigen«, das Mißliche seiner Stellung macht ihn unsicher und treibt seinen verwundeten, ohnmächtigen Ehrgeiz als tiefe Kerbe von Trotz und Bitterkeit in die verschlossene Brust zurück. Immer mehr lernt er sein inneres Antlitz vor der Brutalität des geistigen Pöbels zu verbergen, dem er zu dienen genötigt ist, und allmählich wächst ihm diese dienernde Maske hinein in Fleisch und Blut. Erst der Wahnsinn, der wie jede Leidenschaft alles Verschwiegene heraustreibt, macht die innere Verzerrung gräßlich offenbar: jene Servilität, hinter der er als Hauslehrer seine eigene Welt verbarg, ist krankhafte Manie der Selbstentwürdigung geworden, jene grauenvolle Geste, die jeden Fremden mit knicksenden, übertreibenden Verbeugungen unzählige Male begrüßt und ihn (immer voll Angst eines Erkanntseins) mit Titeln »Eure Heiligkeit! Eure Exzellenz! Eure Gnaden« sprudelnd überhäuft. Auch das Antlitz sinkt müde und ohne Spannung in sich selbst zurück, allmählich verdüstert sich das Auge, das einst so schwärmerisch nach oben geblickt, und wird wie eine qualmende Flamme, flackernd und gedrückt: manchmal zuckt schon grell und gefährlich über den Lidern der Blitz des Dämons, dem seine Seele verfallen ist. Schließlich ermüdet auch in den Jahren der Vergessenheit die hohe Gestalt, sie beugt sich – furchtbares Symbol! – dem drückenden Haupte nachsinkend vornüber, und wie dann fünfzig Jahre später, ein halbes Jahrhundert nach dem Jünglingsbilde, eine Bleistiftzeichnung den »in himmlische Gefangenschaft Verkauften« zum erstenmal wieder sinnlich zeigt, sehen wir erschüttert jenen Hölderlin von einst als hageren zahnlosen Greis, der am Stocke vorwärts tappt und mit feierlich erhobener Hand Verse ins Leere, in eine fühllose Welt spricht. Nur das natürliche Ebenmaß der Züge spottet der innern Zerstörung, und die Stirne bleibt noch im Sturze des Geistes gewölbt: wie eine Statue blank unter dem Dickicht des grauverwirrten Haares hält sie eine ewige Reinheit unverstellt dem erschütterten Blicke entgegen. Schaudernd schauen die seltenen Besucher auf die gespenstische Larve Scardanellis und suchen vergebens in ihr den Künder des Schicksals zu erkennen, der die Schönheit und gefährlichen Schauer der Mächte ehrfürchtig wie keiner verkündet. Aber der ist »ferne, nicht mehr dabei«. Nur der Schatten Hölderlins tappt noch im Dunkel vierzig Jahre über die Erde: der Dichter selbst ist weggetragen von den Göttern im Bildnis des ewigen Jünglings. Seine Schönheit strahlt rein bewahrt und alterslos in anderer Sphäre weiter: in dem unzerbrechlichen Spiegel seines Gesanges.
Mission des Dichters
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
Die Schule war für Hölderlin Kerker gewesen: voll Unruhe und doch voll leiser, ahnender Angst tritt er nun der Welt, der ihm ewig fremden, entgegen. Was an äußerer Wissenschaft zu lehren war, hat er im Tübinger Stifte empfangen, er bemeistert vollkommen die alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Latein; mit Hegel und Schelling, den Stubengenossen, hat er emsig Philosophie getrieben, und durch Siegel und Brief wird ihm außerdem bezeugt, daß er im Theologischen nicht müßig gewesen, daß er »studia theologica magno cum successo tractavit. Orationem sacram recte elaborantum decenter recitavit.« [Die theologischen Studien hat er mit großem Erfolg betrieben. Das heilige Thema hat er richtig, sorgfältig ausgearbeitet, mit Anmut vorgetragen.] Er kann also schon gut protestantisch predigen, und ein Vikariat mit Beffchen und Barett wären dem Studiosus gewiß. Der Wunsch der Mutter ist erfüllt, die Bahn steht offen zu bürgerlichem oder geistlichem Beruf, zu Kanzel oder Katheder.
Aber Höderlins Herz fragt von der ersten Stunde an niemals nach einem weltlichen oder geistlichen Berufe: er weiß nur von seiner Berufung, von seiner Mission höherer Verkündung. In der Schulstube schon hat er – »literarum elegantiarum assiduus cultor« [als tätiger Verehrer der schönen Literatur], wie das Zeugnis barock floskelt – Gedichte geschrieben, elegisch-nachahmende zuerst, dann feurig dem Klopstockschen Schwunge nachtastende und schließlich jene »Hymnen an die Ideale der Menschheit« in Schillers rauschendem Rhythmus. Ein Roman ›Hyperion‹ ist in den ersten ungewissen Formen begonnen, und nur hier, in dieser unirdisch aufschwebenden Sphäre empfindet sein hellseherischer Geist verwandtes Element: von der ersten Stunde wendet der Schwärmer entschlossen das Steuer seines Lebens dem Unendlichen zu, dem unerreichbaren Strande, an dem es zerschellen soll. Nichts kann ihn beirren, diesem unsichtbaren Ruf mit selbstzerstörender Treue zu folgen.
Von vornherein lehnt Hölderlin jedes Kompromiß des Berufes, jede Berührung mit der Vulgarität eines praktischen Erwerbs ab, er weigert sich, »in Unwürdigkeit zu vergehen«, zwischen die Prosaik einer bürgerlichen Stellung und die Erhobenheit des innern Berufes irgendeine noch so schmale Brücke zu bauen:
Beruf ist mirs,
Zu rühmen Höhers, darum gab die
Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir
verkündet er stolz. Er will rein bleiben im Willen und geschlossen in seiner Wesensform. Er will nicht die »zerstörende« Wirklichkeit, sondern sucht ewig die reine Welt, sucht mit Shelley
some world
Where music and moonlight and feeling
Are one
[einzig Welt





























