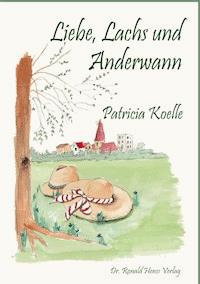9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtswald-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein Buch wie eine Umarmung – der finale Band der Sehnsuchtswald-Reihe von Bestseller-Autorin Patricia Koelle Schon immer wollte Anna-Lisa Malerin werden. Doch sie verzweifelt an ihrem mangelnden Talent. Als sie die Fotografie für sich entdeckt, kehrt sie in ihre alte Heimat auf dem Darß zurück – wo sonst gibt es bessere Motive als in dieser Küstenlandschaft voller Bäume und Geheimnisse? Ihre Fotos werden immer beliebter. Doch es reicht nicht aus, um den Traum von einem eigenen Fotostudio zu erfüllen. Als sie Lian kennenlernt, bauen sich zarte Gefühle auf. Aber ist er wirklich ungebunden? Ehe sie es herausfinden kann, wartet eine dringende Aufgabe auf sie: Sie soll helfen, ein altes Versprechen zu erfüllen. In Ostfriesland trifft sie dabei auf jemanden, der kreativ tätig ist wie sie und ihr Mut macht. Kann Anna-Lisa ihre Selbstzweifel überwinden und sich der Zukunft öffnen? Die Sehnsuchtswald-Reihe: Band 1: Das Licht in den Bäumen Band 2: Das Glück in den Wäldern Band 3: Das Leuchten der Blätter Band 4: Der Klang des Windes Die Romane sind auch unabhängig voneinander ein großer Lesegenuss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Ähnliche
Patricia Koelle
Der Klang des Windes
Ein Sehnsuchtswald-Roman
Über dieses Buch
Anna-Lisa wollte eigentlich Malerin werden. Doch sie verzweifelt an ihrem mangelnden Talent. Da entdeckt sie die Fotografie für sich und wagt es endlich, in ihre alte Heimat auf den Darß zurückzukehren. In der Küstenlandschaft voller Bäume und Geheimnisse findet sie ihre Motive. Ihre Fotos von Menschen und Landschaften werden immer beliebter. Doch es reicht nicht aus, um sich ihren Traum vom eigenen Fotostudio zu erfüllen. Inzwischen lernt sie Lian kennen, mit dem sie viel gemeinsam hat. Aber ist er wirklich ungebunden? Ehe sie es herausfinden kann, wartet eine dringende Aufgabe auf sie: Sie soll helfen, ein altes Versprechen einzulösen. Kurzerhand reist sie nach Ostfriesland und entdeckt mehr, als sie erwartet hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Patricia Koelle ist eine Autorin, die in ihren Büchern ihr immerwährendes Staunen über das Leben, die Menschen und unseren sagenhaften Planeten zum Ausdruck bringt. Bei FISCHER Taschenbuch erschienen, neben Romanen und Geschichten-Sammlungen, die Ostsee- und Nordsee-Trilogie sowie die Inselgärten-Reihe. ›Das Licht in den Bäumen‹, ›Das Glück in den Wäldern‹, ›Das Leuchten der Blätter‹ und ›Der Klang des Windes‹ gehören zu ihrer Sehnsuchtswald-Reihe.
Inhalt
[Widmung]
Anna-Lisa
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Emeric
9. Kapitel
Anna-Lisa
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Emeric
17. Kapitel
Anna-Lisa
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Emeric
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Anna-Lisa
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Emeric
30. Kapitel
31. Kapitel
Anna-Lisa
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Danksagung
[Leseprobe]
PATRICIA KOELLE
Pixie
1. Kapitel
2. Kapitel
Für alle, die schon einmal von einem Baum beschenkt wurden. Sei es durch eine Schaukel, die daran hing und einen Moment Leichtigkeit bot, sei es durch einen Ort für ein Baumhaus, ein Versteck, einen besonderen Zapfen, eine glänzende Kastanie, eine aparte Wurzel oder duftende Blüten. Oder einfach, weil er ein Orientierungspunkt war.
Und für alle krummen, knorrigen Weiden, die uns mit ihrem fröhlichen Hellgrün und ihren beschwingten Röcken als Erste den Frühling anzeigen und versichern, dass das Licht und die ganze Fülle des Lebens wiederkehren.
Anna-Lisa
Wiefelstede bei Oldenburg
2021
1
Anna-Lisa starrte ungläubig auf ihren Monitor. Wenn da wirklich stand, was sie eben gelesen hatte, war das die erste gute Nachricht seit Wochen.
Ausgerechnet an diesem erfrischenden, rosawolkigen Maimorgen, an dem sich draußen das Grün und das Leben so überschwänglich ausbreiteten, hatte sie sich wie gelähmt gefühlt. Die Vögel in den Baumwipfeln wussten anscheinend nicht, ob sie zuerst die Jungen füttern oder doch lauthals singen sollten. Sie selbst dagegen konnte ihren Alltag, so wie er in den letzten anderthalb Jahren gewesen war, nicht mehr ertragen. Immer bedrückender war das Gefühl geworden, bald zu ersticken in diesem Zimmer, in dieser Stadt und an einer Tätigkeit, die ihr immer stärker zuwider wurde. Und nun war da, während sie lustlos ihr Müsli löffelte, diese Nachricht aufgeploppt. Von Ava!
Ava Janning, von der sie die besten Aufnahmen ihrer nicht existierenden Karriere gemacht hatte. Die ersten Bilder, die sie mit runder Zufriedenheit erfüllt hatten, bei denen sie schon beim Auslösen gespürt hatte: Ja, das ist es! Das ist meins. So soll das werden! Endlich die Welt einfangen, auf Bildern festhalten, genau so, wie ich sie sehe. Die Schönheit eines Moments, die einen manchmal so unerwartet und tief trifft, dass einem die Luft wegbleibt und man zugleich lachen und weinen möchte. Ein alltäglicher Augenblick, der überraschend mit einer solchen Wucht berührt, dass er etwas verändern kann oder unvergesslich bleibt. Ein Bruchteil Leben, voller Staub und Licht und Farben und Atemlosigkeit, der durch seine Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit so groß und wundersam wird, dass er erschauern und hoffen und staunen und etwas anders und ganz neu wahrnehmen lässt. Dies bleibend und für alle spürbar machen, das wollte sie schaffen. Mit dem Malen, wie sie es einst so fest versprochen hatte, war es ihr trotz allen Studierens, trotz endloser hartnäckiger und verzweifelter Versuche nicht gelungen. Nicht mit Aquarell, nicht mit Kreide, nicht mit Ölfarbe. Mit gar nichts.
Dann aber hatte sie die Fotografie für sich entdeckt. Es war wie ein Zauberstab, den sie endlich gefunden hatte, nur war es auch damit kein Kinderspiel, ihn so zu gebrauchen, dass wirklich ihr eigener Zauber damit geschah.
Ava fragte in ihrer Nachricht an, ob Anna-Lisa Lust und Zeit hatte, Bilder von ihrem neuen Lampenatelier zu machen. Als sie sich vor anderthalb Jahren zufällig in einem Hotel begegnet waren, war dieses Atelier nur eine Idee gewesen. Avas Traum. Anna-Lisa war es geglückt, sie unbemerkt zu fotografieren, als dieser Traum in ihrem Gesicht gestanden hatte, während sie völlig selbstvergessen in der Abendsonne in einem Schuppen voller alter Werkzeuge an einer kunstvollen Lampe gebaut hatte. Die Bilder waren so atmosphärisch und ausdrucksvoll geworden, dass Ava sie mit Begeisterung für ihre nagelneue Website verwendet hatte. Man sah darauf die glückliche Vertiefung in ihre Arbeit und die Hoffnung, eines Tages das verwirklichen zu können, was in ihr brannte. Die warmen Farbtöne der Beleuchtung und Umgebung, der Fokus auf Avas Hände und ihr Gesicht im Profil, all das fügte sich zu einem Bild, das genau dieselbe Hoffnung in Anna-Lisa selbst wiedererweckt hatte. Es war für sie zu dem geworden, was ihr Vater Jakob einen »Aha-Moment« nannte und ihr Jugendfreund Paul respektlos, aber treffend, als »Boing!« bezeichnet hatte. Die Erkenntnis, dass ihr nach dem langen, verschlungenen Weg, den sie hinter sich hatte, endlich etwas gelungen war. Dass sie vielleicht doch noch möglich machen konnte, was sie schon als junges Mädchen unbedingt gewollt hatte.
Die Fotos von deinem Atelier mache ich sehr gerne. Wann soll ich kommen?, schrieb sie an Ava.
Sobald es dir passt. Ich freue mich.
Anna-Lisa dachte noch darüber nach, während sie die klebrigen Haferflocken von der Müslischale abwusch. Wie nett, dass Ava sie nicht vergessen hatte! Eigentlich hätte sie sich selbst melden oder wenigstens online verfolgen können, wie es Ava bei der Verwirklichung ihres Traumes erging. Ava war doch genau so gewesen, wie sie sich eine gute Freundin immer vorgestellt hatte. Stattdessen war Anna-Lisa in dieser nun endlich vergangenen Zeit der Pandemie, in der sie erheblich in ihrem Tun eingeschränkt gewesen war, im Trott und im Selbstmitleid versunken. Sie hatte notgedrungen im Homeoffice für eine Werbeagentur gearbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dafür aber hatte sie sich ihr Wissen eigentlich nicht angeeignet. Nicht, um Kleinanzeigen zu entwerfen, nicht, um industrielle Maschinen und mäßig inspirierende Hauseingänge zu fotografieren. Die sollte sie dann in die druckfertigen PDFs verwandeln, die die Agentur für Zeitschriften, Flyer und dergleichen benötigte. Sie kam damit über die Runden, doch die strengen Vorgaben ließen kaum Raum für schöpferisches Wirken. Es war höchstens eine gute Übung.
Mit ihrer eigenen Website war sie deshalb auch nicht weitergekommen. Anna-Lisa Hellmond, Fotografie war alles, was dort stand, vor einem wirkungsvollen Bild vom Mond über einem See. Weil das schön aussah und zu ihrem Namen passte. Und sie an einen besonderen Abend erinnerte, der ihr vielleicht Glück bringen mochte – irgendwann. Was jedoch ihr Alleinstellungsmerkmal sein würde, ihr Markenzeichen, vor allem ihr Herzensthema, das musste sie erst noch herausfinden.
»Entdecke eine Nische! Etwas, was du auf ganz eigene Weise kannst!«, war Fergus’ Rat gewesen. »Vor allem etwas, was dich bewegt. Was dich bis in die Ohrläppchen und die Zehen hinein glücklich macht, wenn es dir gelingt, und schwer betrübt, wenn du es nicht genau so hinbekommst, wie du es dir vorgestellt hast.«
Fergus, der Anna-Lisas festgefahrenem Leben eine ganz neue Richtung eröffnet hatte. Sie war unendlich dankbar, dass sie ihm begegnet war.
Sie stellte das Geschirr in den Schrank und schrieb an Ava. »Ich komme gleich morgen.« Schließlich musste sie sowieso nur selten in die Firma. Das würde sie einfach heute erledigen, dort eventuelle neue Aufträge besprechen und gleich mitnehmen. Dann ging eine Zeitlang alles Nötige von unterwegs. Außerdem würde sie ohnehin bald kündigen. Höchste Zeit, dass sie ihren Weg wiederfand! Für die Zeit der Pandemie konnte sie nichts, aber wenn sie auch jetzt, danach, wieder steckenblieb und sich nicht weiterentwickelte, würde sie nicht nur Fergus enttäuschen. Auch sich selbst. Und das wollte sie nicht mehr. Damit hatte sie sich lange genug gequält.
Sie freute sich auf Ava, die genau wie sie Mitte dreißig war und ebenfalls erst vor ein paar Jahren herausgefunden hatte, was sie wirklich wollte. Die hatte dabei allerdings Unterstützung von einem Partner. Anna-Lisa dagegen würde es allein schaffen müssen, doch darüber war sie gerade ganz froh. So konnte sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren und auf das, was daraus hoffentlich werden würde. Mit Ava darüber sprechen zu können würde auf jeden Fall guttun. Die vergangenen anderthalb Jahre waren eine einsame Zeit gewesen. Und sie vermisste Fergus, ihren weisen Berater in allen Lebenslagen, obwohl sie online viel Kontakt hatten. Sie hatte nie einen Großvater gehabt, darum war Fergus wie ein Geschenk in ihr Leben geschneit.
Auf dem Weg durch den hellen Frühlingsmorgen nach Oldenburg in die Firma erinnerte sie sich an den Tag, als sie diesem erstaunlichen Menschen begegnet war, so deutlich, als wäre sie wieder dort.
Damals hatte sie buchstäblich in seinem Schatten gestanden. Auf einem Pier bei San Francisco. Dieser Schatten, sehr rund und lang, fiel auf sie, weil jemand die Abendsonne verdeckte, die einen warmen Schein auf Anna-Lisa und ihre gerahmten Ölbilder geworfen hatte. Dieses besondere Licht verlieh den gemalten Szenen eine Qualität, die sie gar nicht besaßen. Anna-Lisa wusste das. Aber hin und wieder kaufte einer der vielen vorbeischlendernden Touristen in Urlaubslaune trotzdem eines zum Andenken, und sie war auf diesen Verdienst angewiesen. Ihren Käufern ging es um die Erinnerungen, die sie an die Orte auf den Bildern haben würden, nicht um den künstlerischen Ausdruck darin, der ihr nie so gelang, wie Anna-Lisa es gewollt hatte.
Als sie aufblickte, nahm sie den Fremden nur als Silhouette wahr. Er überragte sie bei weitem, und sein Umfang erklärte, warum sein Schatten so beeindruckend war, dass er wie ein Gewicht auf den abgewetzten Planken des Piers, auf ihren ausgebreiteten Werken und ihr selbst lag.
Sie kniff die Augen zusammen, und als er einen Schritt beiseitetrat, um ein Bild genauer zu betrachten, fiel das Licht von der Seite auf ihn. Er sieht aus wie ein Ire, fuhr ihr durch den Sinn, aber sie hielt von solchen Klischees eigentlich gar nichts. Trotzdem, sein gutmütiger, fröhlicher Ausdruck, seine Sommersprossen und seine buschigen, roten Augenbrauen, sein dazu passender Bart und ein letzter rötlicher Glanz in seinen ansonsten weißen, dichten und etwas wilden Haaren …
»Hi, ich bin Fergus. Fergus Phelan«, sagte er. »Was kostet dieses kleine Bild, in das ich mich verguckt habe?«
Später sollte sie erfahren, dass sein Vater Ire war und seine Mutter Mexikanerin. Letzteres erklärte seine dunklen Augen, die vor Lebendigkeit funkelten. Ihr erster Eindruck war, dass er damit mehr sah als andere.
»Das hier? Das finden Sie gut?«, fragte sie erstaunt, als sie das Bild aufhob, auf das er zeigte. Es war viel kleiner als die anderen, quadratisch, und es war fast nichts darauf außer Himmel und Meer, beides im verwaschenen Blau eines heißen, stillen Tages. Und ein winziger Mensch, der genau da saß, wo sie sich beide jetzt befanden: am Geländer eines Piers, der Richtung Horizont im Dunst verlief.
»Nein«, sagte er mit einer für seine Statur überraschend leisen Stimme, die dadurch umso klarer war. »Ich finde es eher mäßig. Aber es berührt mich.« Er nahm es ihr aus der Hand und wendete es, um das winzige Preisschild zu lesen, das sie auf die Rückseite geklebt hatte. Er zog einen Schein aus der Tasche, drückte ihn ihr in die Hand und winkte ab, als sie Wechselgeld heraussuchen wollte. »Es wird mir Freude machen. Danke.« Er steckte das Bild ein und lehnte sich neben Anna-Lisa an das Geländer. Beiläufig hielt er ihr die offene Tüte in seiner Hand hin. »Panierte Shrimps. Schmecken delikat nach Möglichkeiten und Abenteuern.«
Sie wollte den Kopf schütteln, doch gerade in diesem Moment knurrte ihr Magen vernehmlich. Es war ein langer Tag gewesen. Das jungenhafte Grinsen, das sich daraufhin auf seinem Gesicht ausbreitete, war so unwiderstehlich wie der Duft aus der Tüte. Also griff sie zu. »Vielen Dank, Mr. Phelan!«
»Oh, sag doch Fergus.« Er nahm noch einen Shrimp und hielt ihr die Tüte wieder hin. So aßen sie schweigend und kameradschaftlich im Wechsel, bis die Tüte leer war, und sahen dabei den Vorbeiflanierenden zu, den Möwen, die hoffnungsvoll über ihnen kreisten, und einem Segelboot am Horizont. Einen Sonnenuntergang würde es heute nicht geben, die Wolken wurden dichter, die Menge an Spaziergängern dünnte sich bereits aus.
»Du bist doch nicht beleidigt? Weil ich mäßig gesagt habe?«, fragte er schließlich.
»Nein«, antwortete sie ehrlich. »Ich weiß, dass die Bilder alle nur mäßig sind. Schmerzlich mäßig. Ich habe das Handwerk gründlich gelernt, aber mir fehlt das Talent.«
»Warum malst du dann?«
Sie hob die Schultern. »Lange Geschichte.«
»Ich habe Zeit. Und Durst. Von den Shrimps. Du bestimmt auch.« Er sah sich um. »Bleibst du noch lange hier? Wie heißt du eigentlich?«
»Oh, Entschuldigung. Anna-Lisa. Nein, ich denke, für heute reicht es.« Sie begann, die Bilder einzusammeln und in ihren Rucksack zu packen.
»Dann lade ich dich auf einen Drink ein.«
Während sie packte, sah sie aus dem Augenwinkel, wie er aus seiner Schultertasche eine Kamera mit einem langen Objektiv zutage förderte. Erst dachte sie, er zielte auf sie. Ihr wurde etwas mulmig zumute. Was wollte der eigentlich von ihr? Doch er nahm nur eine Möwe ins Visier, die neben einem Bild gelandet war, das noch auf der Brüstung lag, und es eingehend betrachtete.
In ihrem billigen Einzimmerapartment in einem hellhörigen Mietshaus war es entweder stickig oder eiskalt, weil die Klimaanlage nicht richtig funktionierte. Dort würde sie nur wieder Heimweh haben. Anna-Lisa hatte es nicht eilig. So fand sie sich wenig später mit Fergus an einem Tisch vor einer der Strandbars wieder. Sie bestellte einen alkoholfreien Fruchtcocktail, er ein Ginger-Ale.
»So von Künstler zu Künstlerin, wie suchst du deine Themen aus?«, fragte er.
»Früher wollte ich unbedingt Menschen malen. Aber sie sind nie zufrieden mit ihren Porträts. Eher empört. Und sie werden auch nie so, wie ich sie innerlich vor mir sehe und wie ich die Menschen wahrnehme.«
Er lachte. Sein Lachen war wie ein sanftes Grollen, wenn ein Gewitter an einem schwülen Tag nicht mehr fern ist und willkommene Abkühlung verspricht.
»Oh, das kenne ich. Wenn ich Porträts fotografieren sollte, waren die Leute auch nie zufrieden, meist gerade dann, wenn ich dachte, ich hätte ihren Charakter genau getroffen. Es war mir eigentlich gelungen, aber das machte ihnen Angst. Darum habe ich es aufgegeben. Und du?«
»Ich habe angefangen, die Menschen nur noch ganz klein zu malen. In ihrer Landschaft.« Ein Mann auf einem Traktor, allein und winzig auf einem Kornfeld, seltsam tapfer und zerbrechlich in der Weite. Eine anonyme Menschenmenge, eng vor einer Bühne gedrängt. Ein Kletterer an einer gewaltigen Bergwand. Ein Schornsteinfeger, wie verloren auf dem Dächermeer einer scheinbar endlosen Stadt.
Er nickte nachdenklich. »Du hast ein gutes Auge. Deswegen hat mir das kleine Bild etwas zu geben. Aus ihm spricht einiges, mit Wucht sogar. Aber es fehlen Lebendigkeit und Seele. Warum malst du?«, wiederholte er seine Frage von vorhin.
2
Fergus war geschickt im Fragen. Es war leicht, ihm etwas zu erzählen. Er war entspannt und zugleich aufmerksam. So holte er die ganze Geschichte aus ihr heraus, bevor es ihr richtig bewusst wurde. Selbst dann war es ihr nicht unangenehm.
»Als ich klein war, hatten wir eine Nachbarin. Henny Badonin. Sie war dort in Deutschland an der Ostseeküste eine Malerin, die sich einen Namen gemacht hatte. Sie malte Landschaften in Aquarell, die Landschaft unserer Halbinsel, die der Darß heißt. Es ist so schön da, deswegen haben sich viele Maler dort niedergelassen.« Anna-Lisa hörte selbst die Sehnsucht in ihrer Stimme. »Henny hatte einen besonderen Stil, den ich sehr mochte. Ganz zart und offen an den Rändern. Man sah die Bilder und wusste sofort, wie sehr sie ihre Heimat liebte. Es ging einem besser, wenn man sie betrachtete, sie waren voller Leichtigkeit und Freiheit. Außerdem war Henny lieb zu mir. Meine Mutter ist früh gestorben, und Henny war immer für mich da. Sie wurde mein Vorbild. Ich wollte unbedingt Malerin werden wie sie. Nur dass ich eben Menschen malen wollte, keine Landschaften. Das war ja ihr Gebiet. Ich wollte niemanden nachmachen. Und ich fand Menschen spannend.«
»Wie alt warst du da?«
»So zwölf, dreizehn. Obwohl, eigentlich fing es schon viel früher an. Dann starb Henny. Da war sie schon ziemlich alt. Aber meinen Vorsatz habe ich nie vergessen. Ihre Nichte Carly zog nebenan ein, sie war genauso kreativ und hat mich ermutigt. Sie malt nicht, sie macht Skulpturen aus Keramik.«
Anna-Lisa drehte ihr Glas auf dem Untersetzer herum. Sie sah ihr junges Ich vor sich, damals, dünn und sonnenblond, barfuß und unglaublich entschlossen. »Ich hatte Glück, dass ich von Menschen umgeben war, die an Schönheit und Ausdruck interessiert waren. Das hat mich geprägt. Mein Vater hat nie etwas dagegen gehabt, obwohl er selbst kein Künstler ist. Aber er ist der beste vorstellbare Vater.« Sie musste schlucken. Wie sie Jakob vermisste! Immerhin war er nicht allein. Er hatte nach dem frühen Tod ihrer Mutter schon lange seine neue große Liebe gefunden. »Sobald ich alt genug war, bin ich fortgegangen, um Kunst und Malerei zu studieren. Erst in Deutschland, dann in Amerika. An der Ostsee gab es viel Horizont, aber er hat mir nicht genügt. Ich wollte meinen eigenen erweitern. Ich habe mir damals geschworen, erst wieder nach Hause zu kommen, wenn ich so gut malen kann wie Henny.«
»Was für ein Blödsinn!«, meinte er freundlich.
Sie musste lachen. »Ja, das war es! Ich musste einsehen, dass ich nicht Henny bin. Ich kann leidlich malen, aber mehr auch nicht. Ich sitze an den Häfen und verkaufe drittklassige Bilder als Souvenirs, um mich über Wasser zu halten. Ich entwickle mich nicht mehr weiter. Es ist bloßes Handwerk. Ich habe versagt und traue mich nicht nach Hause, obwohl ich die Einzige bin, die von mir verlangt, mich an mein Versprechen zu halten.«
Fergus schüttelte den Kopf. »Nein, so einfach ist das nicht! Du hast den Blick. Deinen eigenen, und es ist ein guter. Scharf und sanft zugleich. Er treibt dich an und wird es immer tun. Nur, der Funke in dir springt nicht in dein Handwerk über. Das Lernen war keinesfalls umsonst, es hat deinen Blick geschärft und die Disziplin. Hast du schon mal überlegt, ob es für dich nicht nur das falsche Werkzeug ist, das du benutzt?«
»Aber was soll es denn dann sein?«, fragte sie kläglich. »Töpfern habe ich damals bei Carly versucht. Es liegt mir nicht. Und es ist auch nicht geeignet für das, was ich ausdrücken will.«
»Was willst du denn ausdrücken?« Er lehnte sich zurück und betrachtete sie gespannt, mit einem rätselhaften Lächeln im rechten Mundwinkel.
Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder, machte eine hilflose Geste zum Meer hin, wo die Dämmerung sich über das Wasser und den Strand legte und man nur noch ein vages Glühen in einem Wolkenspalt sah. Wo die Lichter an den Enden der Piere und an den Bojen und den Masten der Schiffe im Hafen bunt aufblinkten. »Das Große! Die Wunder. Das, was mich atemlos vor Glück macht, dass ich lebe.«
Er lächelte und nickte. In diesem Moment flammte auch die Terrassenbeleuchtung des Lokals auf und erhellte sein Gesicht, so dass sie deutlich das Leuchten in seinen Augen sehen konnte. Und dass er sie nur allzu gut verstand.
»Ja«, stellte er fest, »du findest keine Worte dafür, weil manches nur mit Bildern gesagt werden kann. Dann bist du auf genau dem richtigen Weg! Bilder sind deine Sprache. Darauf kannst du vertrauen.«
»Aber ich kann sie nicht, diese Sprache!«, brach es aus ihr heraus, mit der ganzen angestauten Verzweiflung, über die sie bisher mit niemandem hatte reden können.
Er hob einen Finger. »Moment! Ich sagte, Bilder sind deine Sprache. Ich sagte nicht, Malen ist deine Sprache.«
»Aber was dann?« Müde und hoffnungsvoll zugleich starrte sie ihn an.
»Magst du es mal mit der Fotografie versuchen?«, fragte er und lupfte seine Kamera, die neben ihm auf dem Tisch lag.
»Fotografie? Aber das macht doch heute jeder mit dem Smartphone. Die Welt und die Speicher sind so voller Fotos von Essen und Dingen, die keiner sehen will, und von so vielen Festen, dass wir später vor Erinnerungen selbst nicht mehr wissen werden, wer wir eigentlich waren.« Sie war enttäuscht. Für einen Moment hatte sie geglaubt, er könnte ihr helfen. »Ich mache oft Fotos, Bildnotizen, um gewisse Details nicht zu vergessen, die ich malen will. Aber beim Fotografieren bildet man doch nur ab, was sowieso da ist. Nicht das, was … was man fühlt. Wovon man erzählen will.«
»Ein häufiger Irrtum«, sagte er gelassen. »Übrigens kenne ich dein Dilemma besser, als du ahnst. Ich bin Ire. Was fällt dir dazu als Erstes ein? Nur Mut zum Klischee.«
»Musik«, sagte sie. Sie mochte irische Musik, die unweigerlich ihre Laune hob, wenn es nötig war.
»Genau. In meiner Familie wurde tatsächlich von morgens bis abends gesungen, gesummt, gepfiffen, gefiedelt, auf allen möglichen und unmöglichen Instrumenten improvisiert. Wir waren eine große, gefühlsbetonte Familie, und jeder drückte sich dadurch aus. Und nun stell dir mittendrin ein einziges, völlig unmusikalisches Kind vor. Mich.«
»Oh.«
»Ja. Oh. Aber Gefühle hatte ich genau wie die anderen. Ich musste etwas finden, um mich auszudrücken. Das war natürlich lange, bevor es Handys gab. Da entdeckte ich in einem Antiquariat eine alte Kamera, ein ganz einfaches Ding. Ich verdiente sie mir, indem ich Kundinnen ihre Einkäufe nach Hause trug. Eine davon fragte mich, was ich mit dem Trinkgeld machen wollte, und ich verriet es ihr. Da schenkte die alte Dame mir den fehlenden Betrag. ›Weißt du denn, wie du mit einer Kamera umgehen musst?‹, fragte sie. Das wusste ich natürlich nicht. Da bot sie mir an, es mir zu zeigen. Und sie vermittelte mich an einen ihr bekannten Fotografen. Von da an trug ich keine Einkäufe mehr aus, ich wurde sein Gehilfe. Ich habe den Laden gekehrt und Kaffee gekocht, aber er lehrte mich auch, wie man Bilder entwickelte. Und vor allem, warum! Es war wie pure Zauberei, in der Dunkelkammer zuzusehen, wie ein Bild auf dem weißen Papier erscheint, wenn es im Entwicklerbad liegt. Fotografie bedeutet nicht zum Spaß Malen mit Licht. Ich lernte, das Leben nicht nur einzufangen und abzubilden, sondern so wieder in die Welt hinauszuschicken, wie ich es sah und empfand.«
Anna-Lisa lauschte ihm gespannt. Das, was er beim Erzählen und mit seiner ganzen Persönlichkeit ausstrahlte, war genau, wonach sie suchte. So zu Hause zu sein in einer Sache. So sicher und so glücklich. Und so überzeugt.
Er winkte der Kellnerin und bat sie um die Rechnung. »Das, was heute geschieht, wenn mit einer Software auf einem Bild ein grauer Mittagshimmel gegen einen unwirklichen Sonnenuntergang getauscht und womöglich noch ein vorgefertigter Vogelschwarm eingefügt wird, hat damit nicht das Geringste zu tun«, fuhr er fort. »Weißt du, ich bin alt, aber durchaus auf dem aktuellen Stand, da mich alles, was mit meiner Leidenschaft zusammenhängt, immer noch interessiert, weil es jeden Tag neu ist und sich weiterentwickelt. Ich finde die moderne Technik mit all ihren Möglichkeiten phantastisch und nutze sie gern. Es ist zwar toll, dass man mit dem Handy so gut fotografieren kann, aber ich bevorzuge die Kamera bei weitem. Ich will bestimmt niemandem etwas vorschreiben oder sein Hobby verleiden. Ich sage dir nur, wie ich es sehe.« Er zwinkerte ihr zu. »Ob du es glaubst oder nicht, ich bin bei Social Media aktiv. Dort brüsten sich viele damit, dass ihre Bilder ›unbearbeitet‹ seien. Sie vergessen oder wissen gar nicht, dass das Bild vom Handy ebenso wie von der Kamera schon in dem Moment bearbeitet wird, in dem es aufgenommen und gespeichert wird. Das macht die Software. Und daran ist ganz bestimmt nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Würdest du ein Buch lesen wollen, das unbearbeitet ist? Mit allen Schreibfehlern? Ein Kleid anziehen, das nur mit Stecknadeln zusammengeheftet ist? Nein. Ein Bild muss entwickelt werden, das war immer schon so, und so nenne ich das auch heute noch. Es kommt wie bei jedem Werkzeug darauf an, wie man es benutzt. Auch früher wurde jedes Bild bearbeitet, zum Beispiel der Kontrast, indem der Fotograf es kürzer oder länger im Entwicklerbad ließ. Heute speichere ich die Rohdaten und entwickle dann digital, ohne schädliche, stinkende Chemie, und trotzdem ist es im Grunde derselbe Vorgang. Beim Aufnehmen komponiere ich das Bild, bis ich den richtigen Ausschnitt, die gewünschte, für mich perfekte Perspektive finde. Am Computer dann entwickle ich das Bild, bis der Kontrast, die Belichtung, die Farben und somit der Ausdruck genau so sind, wie ich es in der Wirklichkeit gesehen, gespürt, erlebt und bestaunt habe. Ich arbeite die Magie heraus, die in dem Augenblick für mich da war. Das bedeutet nicht, einen sogenannten vorgefertigten ›Style‹ draufzulegen. Den kann man kaufen. Was soll das? Der stammt nicht von mir. Der hat nichts mit der Realität zu tun, wie ich sie erlebt habe. Wenn alle denselben ›Style‹ benutzen, sehen alle Bilder gleich und nichtssagend aus. Nein, auch hier muss man das Handwerk beherrschen. Dann kannst du deine Seele, dein Empfinden hineinlegen wie der Komponist in ein Musikstück, wie deine Henny in ihre Landschaften. Und dann wird es einzigartig und ein Geschenk für den Betrachter, der es zu verstehen weiß.«
Er zahlte, bedankte sich bei der Kellnerin und stand auf. »Übrigens muss ich auch nicht an einen gerade angesagten sogenannten Spot wie zum Beispiel die Lofoten, um dasselbe Bild zu schießen, das unzählige Leute schon geschossen haben. Den Zauber an einem alltäglichen, auf den ersten Blick unscheinbaren Ort zu entdecken und sichtbar zu machen ist eine viel größere und befriedigendere Kunst. Wenn du willst, zeige ich es dir. Wie es mir damals die alte Dame ermöglicht hat. Magst du dir mein kleines Studio ansehen? Ich nenne es Werkstatt, denn darum geht es – um wirken und um Werke. Hier ist die Adresse.« Er reichte ihr eine Visitenkarte. »Ich bin morgen ab zehn Uhr dort. Wenn du Lust hast, komm vorbei.«
Anna-Lisa hatte abends im Bett gelegen und die Rückseite seiner Karte angesehen. Es war eine Stadtszene. Ein Spatz im Vordergrund, zwischen Unkraut und einem verlorenen Kaugummipapier, und hinten eine Häuserflucht, aus der Perspektive des kleinen Vogels gesehen. Ein Mensch im Vorübergehen, der Himmel, der sich in die Lücken drängte. Es hätte deprimierend wirken müssen. Stattdessen lag Optimismus drin, Lebenskraft und ein deutlicher Anflug von Humor. So winzig das Bild auf der Visitenkarte war, so groß schien es, denn es traf sie pfeilgerade ins Herz und erinnerte sie daran, worum es ihr immer schon gegangen war. Und dass es möglich war, auch für sie.
Unter diesem Eindruck stand sie am nächsten Tag ehrfürchtig vor den Bildern an den Wänden von Fergus’ Werkstatt.
Und so fing es an. Fergus machte sie mit einem jungen Kollegen bekannt, der noch analog fotografierte und seine Bilder im Labor entwickelte. »Es ist wie mit jedem Handwerk – alles, was du darüber erfahren kannst, bereichert dich. Auch die alten Methoden.« Sie lernte, wie man einen Film einlegt, wie man ein Bild im Entwicklerbad bewegt und welchen PH-Wert die Lösung haben muss, wie man es fixiert, wie trocknet. Sie lernte, was ein Makroobjektiv ist, was ein Teleobjektiv leisten kann, warum ein Polfilter nützlich ist. Begriffe wie Schärfentiefe, Belichtung, Blende flogen ihr um die Ohren. Später drückte ihr Fergus seine modernen Kameras in die Hand und schickte sie in der Stadt herum. Er erklärte ihr die Software und ließ sie unter seinem strengen Blick üben. Er zeigte ihr die Unterschiede zwischen seiner und ihrer Interpretation und war begeistert, als sie einen eigenen Stil entwickelte. Er war zufriedener als sie selbst und sagte, das müsse so sein.
Anna-Lisa war zum ersten Mal, seit sie von zu Hause weggegangen war, glücklich und zutiefst aufgeregt. Es war, als hätte sie Flügel bekommen, und alles stünde ihr offen. Jetzt wusste sie, dass sie gefunden hatte, was sie so lange gesucht hatte! Zumindest das richtige Instrument dafür. Die Kamera lag von Anfang an in ihren Händen wie ein Freund und zuverlässiger Partner.
»Zeit, in deine Heimat zurückzukehren«, hatte Fergus schließlich gesagt. »Das Handwerk beherrschst du jetzt, nun musst du allein deinen Weg finden. Sonst beeinflusse ich dich zu sehr und behindere dich. Und das Heimweh«, er klopfte ihr an die Stirn, »das sehe ich da jeden Tag geschrieben. Erst an deinen eigenen Orten wirst du herausfinden, was du mit deinem neuen Können machen kannst.« Er verkaufte ihr zwei seiner gebrauchten Kameras mit Objektiven zum Freundschaftspreis und schenkte ihr eine weitere dazu. Denn er brannte darauf, selbst die neuesten Modelle auszuprobieren. »Man darf nie aufhören, sich auf Neues einzulassen und zu lernen«, sagte er zufrieden und umarmte sie zum Abschied. »Wir bleiben in Kontakt, keine Sorge«, versicherte er ihr und sich selbst, als sie beide ein Taschentuch brauchten. »Ich bin so gespannt auf deine Bilder!«
Anna-Lisa bremste scharf. Sie war so in die Erinnerung versunken gewesen, dass sie fast den Zebrastreifen übersehen hätte und die Frau, die gerade hinüberwollte. So ging das nicht weiter. Erinnerungen waren gut, sich darin zu verlieren war gefährlich. Was zählte, waren die Gegenwart und die Zukunft.
Ja! Sie würde heute noch in der Firma Bescheid geben, dass sie ihre Tätigkeit als freie Mitarbeiterin dort beenden wollte. Morgen würde sie dann zu Ava fahren und dort weitermachen, wo sie ihr bisher bestes Bild geschossen hatte. Auch Fergus war dieser Meinung gewesen, als sie es ihm geschickt hatte. Ab jetzt würde sie wieder ihren ganz eigenen Weg gehen, ihre Homepage vervollständigen und ihr Thema finden.
Und dann endlich nach Hause zurückkehren, zu Jakob und Pilvilinna, dem Haus ihrer Kindheit auf dem Darß. Pilvilinna war ein finnisches Wort und bedeutete »Luftschloss«. Sie sah es vor sich – das sonnengebleichte, von Wind und Wetter fast silbern gewordene Holz, die weiß gestrichenen Fensterläden. Der Treppenpfosten in Form eines dicken Leuchtturms, der für sie immer ihr Anker gewesen war, ihr unerschütterlicher Fels in der Brandung. Man konnte sich daran lehnen oder ihn umarmen, wenn man Trost brauchte, und immer zu ihm zurückkehren, ob man aus der Schule oder von einer langen Reise kam.
Ihr alter Traum, besondere Bilder zu erschaffen, war vielleicht einmal ein Luftschloss gewesen. Inzwischen waren andere Bilder daraus geworden, als sie im Sinn gehabt hatte, und ihre Ambitionen kleiner, aber dafür konnte der Traum wirklich werden.
Sie hatte etwas zu sagen und etwas zu geben, das wusste sie dank Fergus nun. Und obwohl sie sich mit allerhand Jobs immer selbst hatte versorgen können und stolz darauf war – sie wollte jetzt auch endlich von ihrer Kunst leben können und nichts anderes mehr tun, das ihr sinnlos erschien. Es war höchste Zeit! Denn sie war alt genug, um bemerkt zu haben, wie kostbar Zeit war und dass sie so schnell vorüberflog wie die Möwenschwärme an der Ostsee, wenn Sturm aufkam.
Sie freute sich unbändig auf dieses Abenteuer.
3
Das mit der Kündigung war nicht schwer gewesen. Man bedauerte zwar, dass sie gehen wollte. Aber die meisten Mitarbeiter blieben nicht lange, es erstaunte daher niemanden. Einen letzten Auftrag hatte sie noch in der Tasche, eine Werbung für Wanderschuhe. Die fertige Anzeige konnte sie per Mail schicken. Dann war sie frei! Bei dem Gedanken drückte Anna-Lisa unwillkürlich auf das Gaspedal und musste dann erschrocken wieder Tempo herausnehmen, als jemand vor ihr in ihre Spur wechselte, ohne zu blinken.
Sie hoffte, dass ihr kleines Auto, das sie sehr gebraucht erstanden und das schon oft herumgezickt hatte, noch eine Weile durchhalten würde. Autofahren war für sie nur Mittel zum Zweck und die Fahrt zu Ava darum länger, als ihr lieb war. Fast fünf Stunden von Oldenburg in Niedersachsen bis zum Dorf Kranichruf bei Ivenack in Mecklenburg-Vorpommern. Sie versuchte, nicht daran zu denken, dass diese Fahrt sie auch immer näher an die Ostsee und den Darß brachte. Ivenack war davon nicht allzu weit entfernt.
Wenn sie das Heimweh überkam, war sie oft ans »Zwischenahner Meer« gefahren, weil das in ihrer Nähe lag und man dort mit Blick auf das Wasser leckere Krabben essen konnte. Aber auch wenn es Meer hieß, war es doch nur ein großer See, noch dazu einer, dessen Ufer man mit hässlichen Gebäuden verunstaltet hatte, mit riesigen Wohnkomplexen ohne Seele. Sie hatte sich nie an die Eigenart mancher Gegenden gewöhnen können, selbst kleine Seen als »Meer« zu bezeichnen. Dieses jedenfalls hatte mit der Ostsee nicht das Geringste gemeinsam, und auch mit keinem anderen Meer, schon gar nicht mit den Wellen des Pazifiks, die an die kalifornische Küste rollten und die sie mit Fergus fotografiert hatte.
Auf halben Weg legte sie eine Pause ein, um in einem Café in der Lüneburger Heide einen Kaffee zu trinken und den ersten Eisbecher des Jahres zu essen. Sie fand, sie müsste ihren Aufbruch feiern, und vor allem diese frische, neugierige Energie, die sie in sich spürte. Während sie auf das Eis wartete, machte sie eine Aufnahme von einer Frau, deren Silhouette in der Ferne zwischen den Wacholderbüschen wanderte, oben auf einem Hügel vor einem dunstigen Federwolkenhimmel. Danach legte sie die Kamera auf den Tisch und strich zärtlich darüber. Sie hatte doch alles in der Hand und um sich herum, was sie brauchte. Den »Zauberstab«. Die Landschaften. Die Menschen. Sie würde es schon schaffen.
Wie war allerdings noch offen.
»Braucht man so was heute noch?«, fragte die freundliche Kellnerin und nickte zu der Kamera hin, als sie servierte.
»Ich schon!«, sagte Anna-Lisa mit Nachdruck und ließ sich die heißen Kirschen auf dem Vanilleeis schmecken.
Sie hatte ganz vergessen, wie schön die Mecklenburgische Seenplatte war. Hier hieß es wenigstens »Seen«. Die Landschaft hatte ihr schon beim ersten Mal gefallen, als sie zu einem Foto-Workshop hier gewesen war, zufällig in demselben Hotel, in dem Ava damals einige Tage verbracht hatte. Die Veranstaltung war gründlich danebengegangen. Der Leiter hatte eine gänzlich andere Einstellung zum Komponieren von Bildern als sie. Dafür hatte sie Ava kennengelernt und etwas über sich selbst herausgefunden.
Auch Ava hatte hier einiges gefunden, ihre Zukunft nämlich. Sie hatte sich hier so wohlgefühlt, dass sie gegenüber dem Hotel eine alte Scheune gemietet und umgestaltet hatte. Nun baute und verkaufte sie dort ihre einzigartigen Lampen. Inzwischen hatte sie einen Freund, der zu ihr gezogen war, aber den hatte Anna-Lisa noch nicht kennengelernt.
Im Hotel wohnte sie auch diesmal. Avas kleine Wohnung unter dem Scheunendach war beengt, und Anna-Lisa wollte ihr dort nicht mit der gesamten Ausrüstung im Weg sein. Außerdem kannten sie sich dafür noch nicht gut genug.
Es war ein außergewöhnliches Hotel, ein kleines, gemütliches, weißes Schloss mit vielen verspielten Türmchen und einem angenehm natürlichen Park voller alter Bäume. Das Nachmittagslicht fiel wie ein Willkommen auf die Fassade, als Anna-Lisa vorfuhr und ihre Ausrüstung hineinschleppte. Zum Glück gab es einen Aufzug.
»Bin da«, schrieb sie an Ava, und kurze Zeit später klopfte es an ihre Zimmertür. Da stand Ava und strahlte.
Schon bei ihrer ersten Begegnung hatte Anna-Lisa Ava schön gefunden, auf eine ganz eigene Art. Zierlich und ein wenig wie nicht ganz von dieser Welt mit ihren großen Augen und den langen braunen Haaren, die nur leicht mit bunten Spangen zurückgehalten wurden. Anna-Lisa hatte ihren eigenen blonden Pagenschnitt und ihre blauen Augen immer etwas langweilig gefunden. Zum Geburtstag hatte ihr Fergus dann den Druck eines Porträts geschickt, das er unbemerkt einmal von ihr gemacht hatte. Sie hatte es lange und erstaunt betrachtet. Es war, als würde sie sich selbst ganz neu begegnen. Seitdem war sie mit ihrem Aussehen versöhnt.
»Irgendwann wird man sowieso gut Freund mit seinem Gesicht, je älter man wird, desto mehr«, hatte er einmal gesagt. »Das ist wie mit bequemen, abgetragenen Pantoffeln. Schließlich ist man schon einen langen Weg damit gegangen. Nur jenen, die immerzu an sich selbst herumdoktern, gelingt das nicht, weil sie andauernd wieder von vorn anfangen müssen.« Er war mit seinen Worten so klar und direkt wie mit seinen Bildern und eckte darum auch oft an. Anna-Lisa aber war mit seiner Art immer gut zurechtgekommen, sie mochte das so.
Ava hatte sich verändert, seit sie sich kennengelernt hatten. Sie wirkte sicherer, leuchtete irgendwie von innen heraus. Sie war wohl mittlerweile ganz und gar angekommen, an diesem Ort, in ihrer Tätigkeit, in ihrer neuen Beziehung.
»Ich freue mich so, dass du da bist, Anna-Lisa!«, sagte Ava und betrachtete staunend die auf dem Bett abgelegte Ausrüstung. Einige Objektive, die Köcher dazu, zwei Kameras, Stativ, Filter, Rucksack, Festplatten, Laptop, Akkus, Ladestation dafür, jede Menge Kabel … »Wie lange bleibst du? Haben wir etwas Zeit, oder willst du heute noch mit den Bildern loslegen? Ich würde dich nach der langen Fahrt am liebsten erst mal mit auf einen Spaziergang nehmen. Zum See, wo wir letztes Mal waren, weißt du noch?«
»Da wo wir das Mondfoto für meine Website gemacht haben? O ja!« Bewegung war genau das, was sie jetzt brauchte. »Ich hatte vor, ein paar Tage zu bleiben. Auf die Bilder von deinem Atelier würde ich mich gern morgen konzentrieren, wenn ich frisch und ausgeschlafen bin.«
»Wunderbar. Dann komm doch gleich mit. Ich habe ein kleines Picknick eingepackt. Mein Freund kommt auch mit, wenn dir das nichts ausmacht.«
»Na klar, ich bin schon gespannt, ihn kennenzulernen.«
»Und einen Gast haben wir auch«, erzählte Ava weiter, während Anna-Lisa die Schuhe wechselte, sich durch die Haare fuhr und eine Jacke überzog. »Ich schreibe ihnen mal, dass sie uns hier gleich abholen sollen.«
Anna-Lisa entschied sich, nur eine Kamera mitzunehmen. Sie war zu müde, um den ganzen Rucksack zu schleppen.
Dann überlegte sie es sich im letzten Moment doch anders.
»Ohne kannst du wohl nicht?«, fragte Ava mit einem Lächeln.
»Nicht an magischen Orten.« Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass sie immer dann, wenn sie einmal ohne ihre Ausrüstung loszog, besonders zauberhaften Momenten begegnete, meist so flüchtig, dass es nur diese eine Chance gab, sie festzuhalten. Unten bewunderte sie den alten Brunnen mit der marmornen Dame, die darin mit Fischottern spielte. Drum herum schwollen Rosenknospen. Ava beugte sich vor und sammelte ein paar braune Blätter vom letzten Herbst von den Schultern eines Otters, und Anna-Lisa nutzte den Moment, um ein Bild von der Szene einzufangen. Erst ein Porträt von Ava, aber noch besser gefiel ihr die zweite Aufnahme, bei der sie einige Schritte zurücktrat und die andere Kamera nahm, nicht die mit dem Teleobjektiv. Nun wirkte der helle Brunnen mit Ava klein unter dem weiten Frühlingshimmel und den alten Bäumen, die zierliche Frau wie ein Märchenwesen, eins mit ihrer Umgebung.
Ava blickte auf. »Da sind sie! Kommst du?«
Anna-Lisa steckte die Kamera weg. Aus dem Auto, das vor dem Tor hielt, stiegen zwei Männer, deren Bewegungen sich seltsam ähnelten. Und eine ferne Erinnerung in ihr weckten.
»Das ist mein Freund Peer!«, stellte Ava vor. »Und das sein Bruder Paul, der uns gerade besucht. Keine Angst, du siehst nicht doppelt. Sie sind Zwillinge.«
Anna-Lisa räusperte sich. Sie fühlte sich unversehens wieder zehn Jahre alt. »Ich weiß.«
»Hallo, Anna-Lisa.« Peer grinste und schüttelte ihr heftig die Hand. »Ich hatte mich schon gefragt, ob du das bist, als Ava deinen Namen nannte.«
»Das ist ja ein Ding! Lange nicht gesehen, Kleine!« Paul drängte seinen Bruder beiseite und griff seinerseits nach Anna-Lisas Hand. »Aber gleich wiedererkannt! Du hast dich kaum verändert. Und das ist kein billiges Kompliment, das ist die Wahrheit.« Er betrachtete sie neugierig. »Dieselben blonden Haare, dieselben blauen Augen, dieselbe freche Stupsnase. Und dieser geheimnisvolle Blick. Man weiß nie, was du denkst, das war damals schon so.«
»Du glaubst doch selbst nicht, dass du das mit dreizehn bemerkt haben willst«, gab Anna-Lisa zurück, aber insgeheim freute sie sich, dass die zwei sich überhaupt noch an das kleine Mädchen von nebenan erinnerten.
Ava blickte verblüfft von einem zum anderen. »Ihr kennt euch schon? Woher denn?«
Peer legte den Arm um sie. »Wir haben als Jugendliche manchmal unsere Tante Carly in Ahrenshoop auf dem Darß besucht, und Anna-Lisa wohnte nebenan.«
»Wir waren drei Jahre älter, und sie hat uns angehimmelt«, ergänzte Paul. »Das war neu für uns. Sie sah aus wie ein Engel, und wir fühlten uns unglaublich wichtig.«
»Ach was, ich hatte bloß sonst niemandem zum Spielen in der Nachbarschaft«, widersprach Anna-Lisa, aber mit einem Lächeln. Paul lag nicht ganz falsch. Sie hatte damals wirklich eine Weile für die zwei immer fröhlichen Jungs mit den wilden Locken geschwärmt, die vor Ideen und Lebenslust sprühten und weder Unfug noch Abenteuer scheuten.
Das schelmische Funkeln in ihren Augen war immer noch dasselbe, bei Paul etwas ausgeprägter als bei Peer. Es schien unwirklich, ihnen wieder gegenüberzustehen, und weckte ihr Heimweh erneut.
»Na, ist ja verrückt«, fand Ava. »Aber jetzt lasst uns losfahren, sonst wird es zu spät. Ihr könnt euer Wiedersehen unterwegs feiern.«
Das war wirklich verrückt. Aber auch wieder nicht. Ava hatte Peer ja auf dem Darß kennengelernt, das hatte sie mal erwähnt.
Anna-Lisa dachte gern an die lang vergangene Zeit zurück. Die Jungs waren nett zu ihr gewesen, hatten sie in ihre Streiche einbezogen und mit auf ihre Ausflüge genommen. Im Haus von Carly war sie immer willkommen gewesen. Sie hatte die Lebendigkeit dort genossen, denn bei ihr zu Hause hatte es ja nur ihren Vater Jakob und sie gegeben. Jakob war immer sehr ruhig und gelassen. So temperamentvolle Menschen wie die Zwillinge waren Anna-Lisa nie zuvor begegnet, und sie hatte noch nie so viel gelacht wie in jenen Sommertagen. Aber Peer und Paul konnten immer nur in den Ferien da sein.
»Lebst du noch in Berlin?«, fragte sie Paul unterwegs.
»Ja. Ich habe da eine Firma. Wir entwerfen und bauen Zäune. Ich mag Berlin.« Er lachte sie an. »Immer was los dort. Das passt zu mir.«
»Das kann ich mir denken.« Anna-Lisa fragte sich, wie Peer es hier in diesem winzigen, ruhigen Dorf aushielt. Er musste Ava sehr lieben. Oder hatte er sich in eine andere Richtung entwickelt als sein Bruder? Wenn sie darüber nachdachte, war er früher schon der Ruhigere von beiden gewesen.
»Du lachst immer noch mit diesem netten kleinen Hicks am Ende«, stellte Paul fest. »Und du?«, fragte er. »Wo wohnst du und was machst du?«
»Momentan hier und da und dies und das.« Sie erzählte ihm einiges, brach aber ab, als sie am Ivenacker See ausstiegen. »Oh, was für ein Licht! Entschuldigt bitte. Aber ich brauche unbedingt ein Hintergrundbild für meinen Wanderschuhauftrag. Das hier ist ideal!« Sie folgte hastig dem schmalen Pfad, zu dessen beiden Seiten mal Maiglöckchen, mal Margeriten und Löwenzahn blühten, und legte sich an einer Stelle bäuchlings auf den Boden, um den Weg entlangzufotografieren. Dicke Wolken drohten, das besondere Licht zu löschen, gaben aber einen perfekt dramatischen Hintergrund ab. Sie hielt den Atem an und hatte Herzklopfen wie immer, wenn eine bestimmte Szene sie tief berührte. Auch ohne ihren Auftrag hätte sie genau dieses Bild gemacht. Das Abendlicht brachte die Wärme in den Blütenfarben hervor und ließ das Grün des jungen Grases leuchten. Auf dem warmen Sand des Weges ruhte sich ein Pfauenauge aus. Sie rutschte hin und her, um genau den richtigen Ausschnitt zu finden. Der Weg wirkte wie ein unwiderstehliches Versprechen, dass in der Ferne Geheimnisse und Glück warteten, wenn man ihn weit genug wanderte. So, als müsste jeder Schritt darauf die reine Freude sein. Sie vergaß die Zeit, bis sie aufstand, zufrieden mit ihrem Ergebnis.
Sie sah die anderen wartend dastehen, sichtlich amüsiert.
»Entschuldigung«, sagte sie betreten.
»Du hast uns vergessen!«, sagte Paul gespielt beleidigt.
»Sie liebt ihr Handwerk eben«, nahm Peer sie in Schutz.
Ava klopfte ihr fürsorglich den Staub von der Hose. »Wollen wir weiter? Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch völlig okay.«
Sie spazierten am See entlang. Diesmal ließ Anna-Lisa die anderen vorangehen. Irgendwann waren Ava und Peer, die Hand in Hand liefen, im Gegenlicht nur Silhouetten vor dem glitzernden See, dahinter umkreiste sich ein Pärchen balzende Haubentaucher, ebenfalls wie Scherenschnitte. Anna-Lisa blieb stehen, blickte durch den Sucher und experimentierte mit der Einstellung. Sie hatte sich richtig erinnert, dies war ein magischer Ort! Genau der richtige, um ihre leidenschaftliche Freude am Fotografieren wiederzufinden, nachdem sie sich so lange mit dröger Arbeit hatte zufriedengeben müssen. Sie hatte schon befürchtet, den Zugang verloren zu haben.
»Peer hat recht. Du liebst deine Arbeit wirklich, oder?«, fragte Paul. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er auf sie gewartet hatte.
»Du deine nicht?«
Nebeneinander gingen sie weiter.
»Doch. Sehr. Ich kann dabei kreativ und trotzdem Geschäftsmann sein. Das mag ich.«
»Und du machst das allein?«
»Früher war Peer beteiligt. Aber seit er hier lebt, habe ich mir einen neuen Juniorpartner ins Boot geholt, einen Studienfreund. Im Team ist vieles leichter. Ich will auch mal Freizeit haben.« Er bückte sich nach einer Margerite und steckte sie ins Knopfloch ihrer Jacke. »Work-Life-Balance heißt das ja jetzt. Die Jüngeren haben das nicht erfunden, aber sie sorgen dafür, dass nicht mehr unweigerlich die Stirn gerunzelt wird, wenn man das Leben außerhalb der Arbeit ebenfalls würdigen und genießen möchte.«
»Und wie verbringst du deine Freizeit?« Sie mochte die Zwillinge immer noch, stellte sie fest, auch wenn sie sich noch daran gewöhnen musste, dass die schlaksigen Jungs von einst nun Männer waren. »Hast du Familie?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, dafür nehme ich alles, was nicht mit der Firma zusammenhängt, zu leicht. Sagt Peer, und ich denke, er hat recht. Ich mag meine Freiheit. Und du?«
»Oh, ich bin noch nicht einmal damit fertig, mich selbst zu organisieren.«
Er sah sie von der Seite an. »Na, komm schon! Noch nie der großen Liebe begegnet? Wir waren damals beide in dich verknallt. Da gab es doch bestimmt noch mehr seitdem.«
Es war merkwürdig. Paul war ihr immer noch seltsam vertraut. Wie ein Bruder.
»Da war mal jemand. In Oregon. Er hieß Craig.« Es tat noch ein bisschen weh, seinen Namen auszusprechen. Aber sie hatte es selbst beendet.
»Was hast du in Oregon gemacht?«
»Versucht, in einem Nationalpark zu malen. Es ging um eine Semesterarbeit. Craig arbeitete dort auf einem Campingplatz, und später ist er mir nach Kalifornien gefolgt.«
»Das war doch ein Liebesbeweis?«
Pauls Locken waren noch so wild wie früher, bemerkte sie. Waren da im Sonnenlicht immer schon rötliche Funken darin gewesen?
»Vielleicht. Aber er blieb sowieso nie lange an einem Ort.«
»Woran ist es gescheitert?« Paul schien ehrlich interessiert. Doch er entschuldigte sich sofort. »Sorry. Das ist eine sehr persönliche Frage. Du musst nicht antworten. Ich ecke oft an mit meiner Neugier, aber Menschen interessieren mich einfach. Es ist so faszinierend, wie verschieden sie ticken.«
Anna-Lisa musste lachen, er sah so zerknirscht aus. »Schon gut. Bei mir war es genauso. Deswegen wollte ich ja immer Menschen fotografieren.«
»Jetzt nicht mehr?«
»Doch, aber ich habe festgestellt, dass ich ihnen nicht zu sehr auf die Pelle rücken darf. Sie sind so verletzlich und machen lieber Selfies, um die Kontrolle zu behalten. Ich halte sie jetzt meist von weitem mitsamt ihrem Umfeld fest. Ohne ihre Umgebung kann man sie sowieso nicht verstehen.«
»Und Craig? Hast du ihn nicht verstanden? Oder er dich nicht?«
Vorn waren Peer und Ava stehen geblieben und breiteten die Picknickdecke an einer grasigen Stelle aus.
»Wir haben unterschätzt, wie verschieden wir waren. Er brauchte ständig Trubel und Gesellschaft, ich viel Ruhe und Raum. Wir dachten, mit gegenseitiger Rücksichtnahme könnte man das lösen. Aber auf Dauer hat es nicht funktioniert.«
»Habt ihr noch Kontakt?«
»Wir kommentieren gegenseitig auf Facebook.« Sie hob die Schultern. Das klang etwas armselig. Doch in Wahrheit war ihr seit der Trennung, als wäre sie von einem bedrückenden Gewicht befreit. Craig war bis zum Schluss davon ausgegangen, dass sie sich für ihn ändern würde. Nun war sie sogar froh darüber, dass mittlerweile ein Ozean zwischen ihnen lag.
»Verstehe. Na, dann, neue Wege, neues Glück. Ist doch verheißungsvoll.«
»Sicher.« Anna-Lisas Aufmerksamkeit richtete sich auf etwas anderes. Sie hob die Kamera. Ava und Peer auf der Picknickdecke, die auf dem grasgrünen Ufer so blau leuchtete wie das Wasser des Sees, darauf die beiden in Rot gekleidet. All die Farben zusammen waren unwiderstehlich, vor allem im Einklang mit den langen Schatten der Bäume, die darüber fielen.
»Hast du einen Selbstauslöser? Mach doch ein Bild von uns allen«, bat Ava. »Und dann komm her und lass es dir schmecken. Wir haben Salate aus dem Hotel und ganz frisches Brot.«
»Okay.«
»Hast du kein Stativ?«, erkundigte sich Peer. »Ich dachte immer, alle professionellen Fotografen rennen mit einem Stativ herum.«
»Ich nicht, außer bei Nacht. Das engt mich zu sehr ein. Ich will schnell und flexibel auf Situationen und Lichtverhältnisse reagieren können. Die Kameras können das inzwischen ausgleichen, ich kriege so gut wie alles auch aus der Hand scharf hin.« Aber für Situationen wie diese hatte sie ihr GorillaPod dabei, ein kleines, flexibles Stativ, mit dem sie die Kamera zum Beispiel an einem Ast befestigen konnte. Dann noch den Selbstauslöser einstellen, und schon saß sie bei den anderen auf der Decke. Sie spürte ein flüchtiges Bedauern, denn eine Szene wie diese hätte sie immer noch am liebsten gemalt. Andererseits wusste sie, dass dies ein Bild für ihrer aller Fotoalben werden würde, sei es analog oder digital. Eine Erinnerung, die Jahrzehnte später noch heller leuchten würde als jetzt und dadurch, dass sie sie für alle festgehalten hatte, für immer lebendig bleiben konnte. Beim Entwickeln würde dann der innere Glanz zutage treten, den sie in diesem Augenblick alle spürten. Er setzte sich zusammen aus gegenseitiger Sympathie, aus der Freude, diesen Frühlingsabend an diesem Ort miteinander teilen zu dürfen, aus Lachen und Wehmut und Neugier aufeinander, aus Plänen und Rückblicken, dem Geschmack von frischen Tomaten, würzigem Brot und Johannisbeeren. Aus dem Licht auf dem See und dem Duft aus dem Wald. Die Ringe, die springende Fische auf das Wasser zeichneten, die sanfte Brise in ihren Haaren, das Aufleuchten des Abendsterns – alles war enthalten in dem Zauber, den Anna-Lisa mit ihrem Bild unvergänglich machen würde.
In diesem Moment ließ sie den alten Wunsch, malen zu können, endgültig los. Es tat nicht einmal mehr weh.
Fergus hatte recht gehabt. Es war alles nur ihr Weg hin zur Fotografie gewesen.
»Weißt du noch, wie wir hier das Mondfoto für deine Website gemacht haben?«, fragte Ava, während sie Trauben von ihren Stielen pflückte. »Ich finde es superschön. Warum hast du die Seite noch nicht weitergestaltet?«
»Ein Mondfoto, weil sie mit Nachnamen Hellmond heißt?«, fragte Paul. »Gute Idee. Stimmige Basis, um eine Marke zu kreieren.«
Anna-Lisa rückte unbehaglich herum. »Eine Marke, das ist nicht einfach. Mir fehlt noch die zündende Idee. Hochzeitsfotografie und all das mag ich nicht mehr anbieten. Ich brauche etwas, was mich ausmacht, ein zentrales Thema …«
Paul nickte. »Du meinst ein Alleinstellungsmerkmal! So wie bei Ava die Lampen, von denen jede ein Unikat ist, das eine Geschichte erzählt.«
»O ja, ich bin schon so gespannt, die morgen zu fotografieren! Wann wollen wir anfangen, Ava?« Sie war froh über den Themenwechsel, aber in Paul schien der Geschäftssinn geweckt.
In Peer leider auch. »Paul hat recht! Schieb das nicht länger auf, Anna-Lisa. Du musst dich besser verkaufen. Dafür braucht es einen guten Auftritt.«
»Ich will mich gar nicht verkaufen. Ich möchte meine Bilder verkaufen«, widersprach Anna-Lisa, der solche Ausdrücke immer noch ein tiefes Unbehagen verursachten. Ihr Vorbild Henny hätte das sofort verstanden. So was war ihr auch zuwider gewesen. Sie hatte die meisten ihrer Bilder versteckt und niemandem gezeigt.
»Das ist dasselbe«, meinte Paul. »Du legst doch deine Seele in die Bilder.«
Das hatte er so schnell begriffen? Craig hatte das bis heute nicht geschafft.
»Ich weiß, dass es schwer ist«, sagte Peer mitfühlend. »Ich muss mich auch immer noch überwinden, wenn ich mit einem Angebot an Kunden herantrete. Aber wenn du davon leben willst, wirst du nicht drum herumkommen. Außerdem möchtest du doch, dass viele sich daran erfreuen. Das geht nur, wenn du sie auch für viele sichtbar machst.«
»Sie haben wirklich recht, Anna-Lisa. Aber es ist schwer. Ich muss mich auch noch daran gewöhnen. Ich mag meine Lampen gar nicht loslassen.« Ava verteilte Schüsselchen mit Panna Cotta. »Sieh es als Herausforderung. Kunst ist dazu gemacht, gesehen zu werden. Und sie ist ihren Preis wert – jedenfalls, wenn sie den Betrachtern Freude schenkt, sie bewegt und inspiriert oder tröstet.«
Das süße Dessert lag federleicht auf Anna-Lisas Zunge. Vielleicht sollte sie wie Paul überhaupt alles leichter nehmen und sich nicht selbst ausbremsen.
»Ich könnte dir mit der Website helfen«, bot Paul an.
»Danke. Das ist nett.« Warum nicht? »Ich überlege mir ein Thema. Ich melde mich, wenn ich so weit bin.«
»Schieb es nicht wieder auf«, meinte Peer. »Mein Bruder hat ein schlechtes Gedächtnis.«
Paul warf lachend einen Teelöffel nach ihm. »Dann kannst du ja einspringen.«
Die Sonne war hinter dem Wald untergegangen. Es waren kaum noch Wolken unterwegs, immer mehr Sterne funkelten im himmlischen Tiefblau. Auf dem See schimmerte ein orangeroter Widerschein vom Ende des Tages. Anna-Lisa half, die leeren Dosen im Rucksack zu verstauen, doch sie hätte hier noch ewig sitzen können, zwischen Wasser und Wald, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Zum ersten Mal seit langem fühlte sie sich nicht mehr allein.
4
»Leider scheint heute keine Sonne«, sagte Ava, als sie Anna-Lisa am nächsten Vormittag die Tür zum Atelier öffnete. »Es sieht hier immer so freundlich aus und bringt die Lampen gut zur Geltung, wenn das Licht durch die offene Scheunentür hereinfällt oder durch das Dachfenster.«
»Auf das Fenster ist sie stolz, das ist unsere neueste Errungenschaft«, sagte Peer lächelnd, als er hinter Anna-Lisa auftauchte und ihr Teile der Ausrüstung abnahm. Heute würde sie tatsächlich das Stativ brauchen. »Es war das Letzte, was beim Ausbau der Scheune noch gefehlt hat.«
»Vorläufig.« Ava lächelte in sich hinein.
Anna-Lisa sah sich um. Die ausgebaute Scheune war zugleich Laden, Werkstatt und Ausstellungsraum. Das passte wunderbar zu Avas künstlerischen Einzelstücken, die zu einem großen Teil aus Naturmaterialien wie Holz, Pergament, Wurzeln und Blättern, Steinen und etwas Glas gestaltet waren. »Es ist gut, dass keine Sonne scheint, das wäre viel zu grell. Übrigens, habt ihr im Garten einen Stromanschluss?«
»Im Garten? Ja, schon. Warum?« Ava sah verwirrt aus.
»Weil ich dachte, wir könnten heute Abend in der blauen Stunde einige Lampen draußen hinstellen, wo das Licht auf die Blüten fällt. Du hast da die zarten Akeleien und Tränendes Herz und Iris, Maiglöckchen, dann den knalligen Gartenmohn … und die hohen Stehlampen könnten neben den Flieder platziert werden. Das würde den Zauber deiner Lampen wunderbar sichtbar machen und das Natürliche deiner Werke herausstellen. Man sieht sofort, was dich inspiriert.«
Peer kniff prüfend die Augen zusammen, als sähe er es vor sich. »Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das mit dem Strom geht in Ordnung, ich hole nachher die Kabeltrommel raus und eine Mehrfachsteckdose.«
»Aber ein bisschen seriös soll es schon wirken«, meinte Ava zweifelnd.
»Natürlich«, beruhigte Anna-Lisa sie. »Die seriösen Bilder machen wir jetzt hier drin. Sie vermitteln die sachlichen Informationen. Aber die anderen sind es, die die Kunden gefühlsmäßig und endgültig überzeugen, du wirst sehen.« Es war seltsam. So oft war sie unschlüssig, zweifelte an ihrem Können und an dem Sinn ihrer Tätigkeit. Doch wenn sie einen konkreten Auftrag hatte wie diesen, dann war sie sich sicher. Dann fühlte sie sich auch nicht allein. Dann sahen ihr Fergus und Generationen leidenschaftlicher Fotografen über die Schulter und standen unsichtbar, aber felsenfest wie eine Wand der Unterstützung hinter ihr.
Sie fotografierte eine Lampe nach der anderen. Die hohe, schlanke aus Ästen und Wurzeln. Die mit den organischen Formen aus unregelmäßig gefärbter Seide und gepressten Herbstblättern. Die mit Vogelfedern zwischen zwei dünnen Schichten aus Glas. Die runde mit dem Fuß aus Steinen, auf der zarte Flechten unter transparentem Papier in ihren natürlichen leuchtenden Farben erstrahlten, wenn man die Lampe einschaltete. »Diese Flechten habe ich im Wald schon so oft fotografiert«, sagte Anna-Lisa bewundernd. »Sie sind so vielseitig, und ihre Farbtöne verblüffend. Man kann irre Makroaufnahmen davon machen. Aber hier kommen sie noch besser zur Geltung. Du hast ihr inneres Leuchten sichtbar gemacht!«
»Im Wald finde ich ohne Ende Materialien. Ich bin aber immer wieder erstaunt, wie gut diese Sachen den Leuten gefallen. Hier draußen gibt es nur eben fast keine Laufkundschaft. Außer den Hotelgästen vom Schloss«, erklärte Ava. »Darum wird jetzt, wo ich richtig in die Produktion gehen kann, der Onlineverkauf so wichtig.«
»Das kriegen wir hin, wenn die Bilder fertig sind«, versprach Anna-Lisa. »Habt ihr einen guten Webdesigner?«
»Das macht Paul. Er hat es sich zwar selbst beigebracht, aber er besitzt das Geschick. Geschäftsmann halt«, meinte Ava.
»Mit mir hattest du eben doppelt Glück«, neckte Peer sie, der mit einem Kaffeetablett hereinkam. »Zu dem verrückten Zwilling hast du auch einen brauchbaren dazubekommen.«
»Der Verrückte ist genau richtig für mich.« Ava küsste ihn und lachte, bevor sie den Kaffee einschenkte und Anna-Lisa eine Tasse reichte. »Ich war mein ganzes Leben lang viel zu vernünftig, bis du mich umgekrempelt hast.«
»Du hast dich selbst umgekrempelt«, widersprach Peer. »Anders geht das nicht. Aber es war mir eine Freude, dir dabei zuzusehen.«
Anna-Lisa verspürte überraschend eine unbestimmte Sehnsucht. Nach der Trennung von Craig hatte sie sich befreit gefühlt, bis jetzt. Diese beiden hier zusammen zu erleben zeigte ihr, dass auch eine solche Harmonie möglich war. Dass man sich gegenseitig unterstützen konnte, anstatt sich einzuengen. Noch war sie nicht bereit dazu, aber eines Tages …
»Ich stelle eine Onlinegalerie zusammen und schicke dir den Link, dann könnt ihr euch in aller Ruhe aussuchen, was ihr gebrauchen könnt«, sagte sie und legte eine neue Speicherkarte ein. »Ich bin gespannt, wie deine fertige Seite aussehen wird.«
Später saßen sie im Garten um einen Tisch herum und aßen den Salat, den Paul in der Küche komponiert hatte. Er schien eine Art Universaltalent zu sein.
»Das macht mir Spaß. Es lenkt von allen anderen Problemen ab«, erklärte er. »Von eigensinnigen Kunden mit Ideen, die sich beim besten Willen nicht verwirklichen lassen, Zahlenreihen, in denen sich ein unauffindbarer Fehler versteckt, und Lieferketten mit Lücken, die sich nicht stopfen lassen.«
Peer klopfte ihm auf die Schulter. »Du hast es aber auch schwer, Brüderchen! Brauchst du eine Runde Mitleid?«
Paul klapste ihm lachend auf die Finger.
Anna-Lisa fühlte sich wohl in dieser heiteren, zwanglosen Runde. Es überraschte sie, denn eigentlich hatte sie nie ein Problem mit dem Alleinsein gehabt. Jedenfalls war es wohltuend, hier zu sein und endlich einen Auftrag zu haben, der ihr wirklich Freude machte. Am liebsten wollte sie nur noch das: Aufträge, von denen sie zu hundert Prozent überzeugt war. Aber so funktionierte das nicht mit dem Lebensunterhalt. Das hörte sie ja auch bei Paul heraus. Sie wusste noch nicht einmal, was ihr nächster Auftrag sein und ob es einen geben würde. Sie musste vorerst alles nehmen, was sie bekommen konnte.
Als hätte er geahnt, worüber Anna-Lisa nachdachte, wandte sich Paul an sie. »Sag mal, rechnet sich das mit dem Fotografieren überhaupt noch heutzutage? Ich weiß von vielen Firmen und Tourismusbüros, dass sie zwar früher Fotografen dafür bezahlt haben, Bilder für Flyer und die Presse zu machen, für Firmenfeiern und Internetauftritte. Aber neuerdings sparen sie das ein, drücken irgendeinem Mitarbeiter ein Diensthandy in die Hand und sagen, das genügt.«
»Ja, so sehen die Bilder dann auch aus. Sie basteln einen Sonnenuntergang auf ein Mittagsbild oder einen Regenbogen über eine trockene Wiese und glauben, das würde den Charme der Landschaft vermitteln und Besucher anlocken wie ein Wurstbrötchen die Fliegen.« Anna-Lisa konnte den Groll nicht aus ihrer Stimme heraushalten.
»Na ja, sie müssen eben alle sparen. Ein Bild von einem Fotografen kostet schon eine Menge«, merkte Peer an. »Das sehen viele nicht ein. Sie machen Handybilder und schließen daraus, dass ein Bild schnell erledigt ist und es kaum Arbeit dazu braucht. Ich denke, ihnen fehlt einfach das Wissen.«