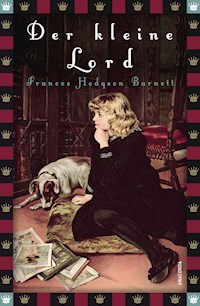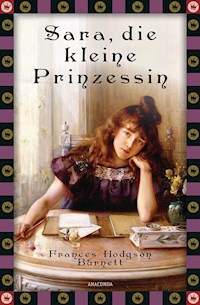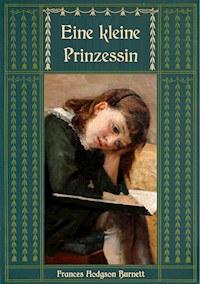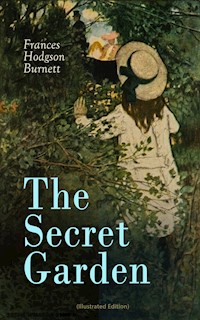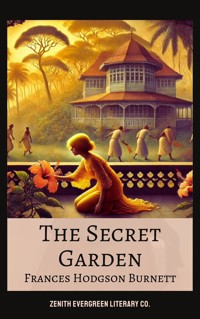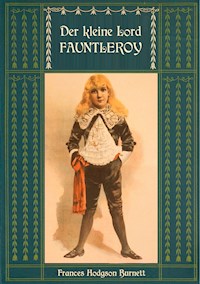
Der kleine Lord Fauntleroy: Mit den Illustrationen von Reginald Birch E-Book
Frances Hodgson Burnett
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nachdem sein Vater wegen einer nicht standesgemäßen Ehe von seinem adligen Großvater verstoßen worden und wenige Jahre darauf verstorben ist, wächst der kleine Cedric Errol als armer Halbwaise in Amerika auf. Seine Kindheit ist trotz aller Armut unbeschwert - bis eines Tages ein Anwalt im Auftrag seines Großvaters anreist, um Cedric als dessen einzigen Erben und zukünftigen Inhaber seines Titels und seines Vermögens zu sich nach England zu holen. Dort angekommen, will sein aufbrausender selbstsüchtiger Großvater, der Earl of Dorincourt, den neuen "Lord Fauntleroy" lehren, sich wie ein Aristokrat zu verhalten, doch das Zusammensein mit dem unverdorbenen und liebevollen Cedric lehrt ihn im Gegenzug viel mehr: Nach und nach schleichen sich Mitgefühl und Liebe in das versteinerte Herz des alten Mannes ... Ungekürzte Ausgabe mit zahlreichen Illustrationen von Reginald Bathurst Birch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Sind Sie der Earl?“, sagte Cedric. „Ich bin Ihr Enkel. Ich bin Lord Fauntleroy.“
Nach dem Text der englischen Erstausgabe:
„Little Lord Fauntleroy“, (1885)
übersetzt von Maria Weber
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 1
CEDRIC selbst wußte überhaupt nichts davon. Es war ihm gegenüber noch nie erwähnt worden. Er wußte, daß sein Papa ein Engländer gewesen war, weil seine Mama es ihm gesagt hatte; aber sein Papa war gestorben, als er noch ein ganz kleiner Junge war, so daß er sich nicht sehr an ihn erinnern konnte, außer daß er groß war, blaue Augen und einen langen Schnurrbart hatte und daß es eine großartige Sache war, von ihm auf seinen Schultern im Zimmer herumgetragen zu werden. Nach dem Tod seines Papas hatte Cedric herausgefunden, daß es am besten war, nicht mit seiner Mama über ihn zu sprechen. Als sein Vater krank war, war Cedric fortgeschickt worden, und als er zurückgekehrt war, war alles vorüber; und seine Mutter, die auch sehr krank gewesen war, fing gerade erst an, in ihrem Stuhl am Fenster zu sitzen. Sie war blaß und dünn, und alle Grübchen waren aus ihrem hübschen Gesicht verschwunden, ihre Augen sahen groß und traurig aus, und sie war in Schwarz gekleidet.
„Liebste“, sagte Cedric (sein Papa hatte sie stets so genannt, und so hatte der kleine Junge gelernt, es auch zu sagen), „Liebste, geht es meinem Papa besser?“
Er spürte, wie ihre Arme zitterten und so drehte er seinen lockigen Kopf und sah ihr ins Gesicht. Es lag etwas in seinem Ausdruck, das ihm das Gefühl gab, daß er weinen müßte.
„Liebste“, sagte er, „geht es ihm gut?“
Dann sagte ihm plötzlich sein liebevolles kleines Herz, daß er besser beide Arme um ihren Hals legen und sie immer wieder küssen und seine weiche Wange an ihre legen sollte; und er tat es, und sie legte ihr Gesicht auf seine Schulter und weinte bitterlich und hielt ihn, als wollte sie ihn nie wieder gehen lassen.
„Ja, es geht ihm gut“, schluchzte sie. „Es geht ihm sehr, sehr gut, aber wir – wir haben niemanden mehr außer uns. Überhaupt niemanden.“
Da begriff er, so klein wie er war, daß sein großer, gutaussehender junger Papa nicht mehr zurückkommen würde; daß er tot war, wie er dies von anderen Leuten gehört hatte, obwohl er nicht genau verstehen konnte, was für eine seltsame Sache all diese Traurigkeit verursacht hatte. Weil seine Mama immer weinte, wenn er von seinem Papa sprach, entschied er sich insgeheim, daß es besser war, nicht sehr oft mit ihr über ihn zu sprechen, und er fand auch heraus, daß es besser war, sie nicht still sitzen und ins Feuer oder aus dem Fenster sehen zu lassen, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen. Er und seine Mama kannten nur sehr wenige Leute und lebten ein Leben, das man durchaus für sehr einsam hätte halten können, obwohl Cedric nicht wußte, daß es einsam war, bis er älter wurde und hörte, warum sie keine Besucher hatten. Dann wurde ihm gesagt, daß seine Mama eine Waise sei und ganz allein auf der Welt gewesen war, als sein Papa sie geheiratet hatte. Sie war sehr hübsch und hatte als Gesellschafterin bei einer reichen alten Dame gelebt, die nicht freundlich zu ihr war, und eines Tages sah Captain Cedric Errol, der im Haus vorgesprochen hatte, sie mit Tränen in den Augen die Treppe hinauf rennen; und sie sah so entzückend und unschuldig und traurig aus, daß der Captain sie nicht vergessen konnte. Und nachdem viele seltsame Dinge geschehen waren, kannten sie einander gut und liebten sich innig und heirateten, obwohl ihre Ehe von mehreren Personen nicht gutgeheißen wurde. Am ärgerlichsten jedoch war der Vater des Captains, der in England lebte und ein sehr reicher und wichtiger alter Adliger mit einem sehr auffahrenden Charakter und einer äußerst ausgeprägten Abneigung gegen Amerika und die Amerikaner war. Er hatte zwei Söhne, die älter als Captain Cedric waren; und das Gesetz besagte, daß der Älteste dieser Söhne den Familientitel und die Güter erben sollte, die sehr groß und prächtig waren. Wenn der älteste Sohn sterben würde, wäre der nächste der Erbe. Und so bestand, obwohl er Mitglied einer so großartigen Familie war, kaum eine Aussicht, daß Captain Cedric selbst einmal sehr reich sein würde.
Aber es begab sich, daß die Natur dem jüngsten Sohn Gaben verliehen hatte, die sie seinen älteren Brüdern nicht geschenkt hatte. Er hatte ein anziehendes Gesicht und eine schöne, starke, anmutige Gestalt; er hatte ein strahlendes Lächeln und eine hübsche, angenehme Stimme; er war mutig und großzügig, hatte das gütigste Herz der Welt und schien die Macht zu haben, jeden dazu zu bringen, ihn zu lieben. Bei seinen älteren Brüdern war dies anders; keiner von ihnen war gutaussehend, besonders freundlich oder klug. Als Knaben in Eton waren sie nicht beliebt; als sie auf der Universität waren, dachten sie nicht ans Lernen, verschwendeten Zeit und Geld und schlossen nur wenige Freundschaften. Der alte Earl, ihr Vater, wurde ständig von ihnen enttäuscht und gedemütigt; sein Erbe war keine Ehre für seinen edlen Namen und versprach nichts anderes als ein selbstsüchtiger, verschwenderischer, unbedeutender Mann ohne mannhafte oder edle Eigenschaften zu sein. Es war sehr bitter, dachte der alte Earl, daß ausgerechnet der Sohn, der nur der Dritte war und nur ein sehr kleines Vermögen haben würde, derjenige sein sollte, der alle Gaben und Reize und alle Stärke und Schönheit besaß. Manchmal haßte er den gutaussehenden jungen Mann fast, weil er die guten Dinge zu haben schien, die mit dem stattlichen Titel und den prächtigen Gütern einhergehen sollten; und doch konnte er in den Tiefen seines stolzen, starrsinnigen alten Herzens nicht anders, als viel für seinen jüngsten Sohn zu empfinden. Es war in einem seiner Anfälle von Launenhaftigkeit, daß er ihn aussandte, um nach Amerika zu reisen. Er dachte, er sollte ihn für eine Weile fortschicken, damit er nicht durch ständige Vergleiche mit seinen Brüdern, die ihm zu dieser Zeit durch ihre aufsässige Art große Schwierigkeiten bereiteten, verärgert werden sollte.
Aber nach ungefähr sechs Monaten begann er sich einsam zu fühlen und sehnte sich heimlich danach, seinen Sohn wiederzusehen. Also schrieb er an Captain Cedric und befahl ihm, nach Hause zu kommen. Der Brief, den er schrieb, überschnitt sich mit einem Brief, den der Captain gerade an seinen Vater geschrieben hatte und in dem er ihm von seiner Liebe zu dem hübschen amerikanischen Mädchen und von seiner beabsichtigten Ehe berichtete; und als der Earl diesen Brief erhielt, war er außer sich vor Wut. So übellaunig er auch war, war er doch niemals in seinem Leben so wütend gewesen wie zu dem Zeitpunkt, als er den Brief des Captains las. Sein Kammerdiener, der gerade im Zimmer war, als er eintraf, dachte, daß Seine Lordschaft einen Schlaganfall erleiden würde, so außer sich war er vor Wut. Eine Stunde lang tobte er wie ein Tiger, dann setzte er sich hin und schrieb an seinen Sohn und verbot ihm, jemals wieder einen Fuß in die Nähe seines alten Hauses zu setzen oder seinem Vater oder seinen Brüdern zu schreiben. Er sagte ihm, er könne leben, wie es ihm beliebte, und sterben, wo es ihm beliebte, daß er für immer von seiner Familie abgeschnitten sein sollte und daß er niemals Hilfe von seinem Vater erwarten dürfe, solange er lebte.
Der Captain war sehr traurig, als er den Brief las; er liebte England sehr und liebte das schöne Zuhause, in dem er geboren worden war, von ganzem Herzen; er hatte sogar seinen jähzornigen alten Vater geliebt und Mitgefühl wegen seiner Enttäuschungen empfunden; aber er wußte, daß er in Zukunft keine Güte von ihm erwarten durfte. Anfangs wußte er kaum, was zu tun war; er war nicht zur Arbeit erzogen worden und hatte keine Erfahrung als Geschäftsmann, aber er verfügte über Mut und jede Menge Entschlossenheit. Also verkaufte er sein Patent in der englischen Armee, fand nach einigen Schwierigkeiten eine Stelle in New York und heiratete. Der Unterschied zu seinem alten Leben in England war sehr groß, aber er war jung und glücklich und er hoffte, daß harte Arbeit in Zukunft großartige Dinge für ihn bewirken würde. Er hatte ein kleines Haus in einer ruhigen Straße, und sein kleiner Junge wurde dort geboren, und alles war auf einfache Weise so heiter und glücklich, daß er es keinen Moment bereute, daß er die hübsche Gesellschafterin der reichen alten Dame geheiratet hatte, einfach weil sie so entzückend war und er sie liebte und sie ihn liebte. Sie war in der Tat ganz reizend, und ihr kleiner Junge glich ihr und seinem Vater.
Obwohl er in ein so ruhiges und einfaches kleinen Zuhause geboren worden war, schien es, als hätte es nie einen glücklicheren Säugling gegeben. Erstens war er stets gesund und gab so niemals Anlaß zu irgendwelcher Sorge; zweitens hatte er ein so sonniges Gemüt und eine so bezaubernde Art, daß es jedem eine Freude war; und drittens war er so schön anzusehen, daß man kaum die Augen von ihm wenden konnte. Anstatt ein kahlköpfiger Säugling zu sein, begann er sein Leben mit einer Fülle weichen, feinen, goldfarbenen Haars, das sich an den Enden kräuselte und im Alter von sechs Monaten in weichen Locken herabfiel; er hatte große braune Augen mit langen Wimpern und ein liebreizendes kleines Gesicht; er hatte einen so starken Rücken und so prächtige stramme Beine, daß er nach neun Monaten plötzlich zu gehen begann; seine Manieren waren für ein Kleinkind so gut, daß es entzückend war, seine Bekanntschaft zu machen. Er schien zu spüren, daß jedermann sein Freund war, und wenn jemand mit ihm sprach, wenn er in seinem Wagen auf der Straße war, sah er ihn mit seinen unschuldigen braunen Augen ernst an und ließ dann ein entzückendes, freundliches Lächeln folgen; und die Konsequenz war, daß es in der Nachbarschaft der ruhigen Straße, in der er lebte, keine einzige Person gab – auch nicht den Gemischtwarenhändler, der als die mürrischste Kreatur auf der Welt galt – , die sich nicht freute, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Und mit jedem Monat seines Lebens wurde er hübscher und einnehmender.
Als er alt genug war, um mit seiner Kinderschwester auszugehen und einen kleinen Wagen hinter sich herzuziehen, während er einen kurzen weißen Kiltrock und einen großen weißen Hut auf seinem lockigen blonden Haar trug, war er so hübsch, stämmig und rosig, daß er jedermanns Aufmerksamkeit auf sich zog, und seine Kinderschwester kam oft nach Hause und erzählte seiner Mutter Geschichten von den Damen, die ihre Kutschen anhalten ließen, um ihn anzusehen und mit ihm zu sprechen, und wie erfreut sie waren, wenn er auf seine fröhliche drollige Art mit ihnen sprach, als ob er sie schon immer gekannt hätte. Sein größter Reiz bestand in jener fröhlichen, furchtlosen Art, sich mit Menschen anzufreunden. Ich glaube, dies kam daher, weil er ein sehr vertrauensvolles Wesen und ein freundliches Herz hatte, das mit jedem sympathisierte und wollte, daß sich jeder so wohlfühlte, wie er selbst es tat. Es ließ ihn sehr schnell die Gefühle der Menschen um ihn herum verstehen. Vielleicht war er auch daran gewöhnt, weil er so viel Zeit mit seinem Vater und seiner Mutter verbracht hatte, die immer liebevoll und rücksichtsvoll, zärtlich und wohlerzogen waren. Er hatte zu Hause nie ein unfreundliches oder unhöfliches Wort gehört; er war immer geliebt und liebkost und zärtlich behandelt worden, und so war seine kindliche Seele voller Güte und unschuldiger herzlicher Gefühle. Er hatte gehört, wie seine Mama immer mit hübschen, liebevollen Namen angesprochen wurde und benutzte sie selbst, wenn er mit ihr sprach. Er hatte immer gesehen, wie sein Papa auf sie achtgab und sich sehr um sie kümmerte, und so lernte auch er, auf sie achtzugeben.
Als er also wußte, daß sein Papa nicht mehr zurückkehren würde und sah, wie überaus traurig seine Mama war, kam ihm allmählich der Gedanke in den Sinn, daß er tun mußte, was er konnte, um sie glücklich zu machen. Er war nicht viel mehr als ein Kleinkind, aber dieser Gedanke kam ihm immer wieder in den Sinn, wenn er auf ihr Knie kletterte und sie küßte und seinen lockigen Kopf auf ihren Nacken legte, wenn er seine Spielsachen und Bilderbücher brachte, um sie ihr zu zeigen, und wenn er sich leise neben ihr zusammenrollte, wenn sie sich auf das Sofa legte. Er war nicht alt genug, um etwas anderes tun zu können, also tat er, was er konnte, und war für sie ein größerer Trost, als er sich hätte vorstellen können.
„Oh, Mary!“, hörte er sie einmal zu ihrer alten Dienerin sagen; „Ich bin sicher, daß er versucht, mir auf seine unschuldige Weise zu helfen – ich weiß, daß er es tut. Er sieht mich manchmal mit einem liebevollen, verwunderten Blick an, als ob er Mitleid mit mir hätte, und dann kommt er zu mir und streichelt mich oder zeigt mir etwas. Er ist so ein kleiner Kerl, und doch glaube ich wirklich, daß er es versteht.“
Als er älter wurde, hatte er sehr viele merkwürdige kleine Angewohnheiten, die die Leute sehr amüsierten und sie für ihn einnahmen. Er war so sehr ein Gefährte für seine Mutter, daß sie kaum eines anderen bedurfte. Sie gingen zusammen spazieren und redeten und spielten miteinander. Als kleiner Junge lernte er lesen; und danach lag er abends auf dem Kaminvorleger und las laut vor – manchmal Geschichten und manchmal große Bücher, wie sie die älteren Leute lesen, und manchmal sogar die Zeitung; und zu solchen Zeiten hörte Mary in der Küche Mrs. Errol oft fröhlich über die kuriosen Dinge lachen, die er sagte.
„Und wirklich“, sagte Mary zu dem Lebensmittelhändler, „kann niemand sich das Lachen verbeißen, wenn er so drollig ist – und wenn er erst seine altmodischen Sprüche hersagt! Ist er doch an dem Abend, als der neue Präsident vorgeschlagen wurde, in meine Küche gekommen, stellt sich vor das Feuer, wobei er wie ein Gemälde aussieht, mit den Händen in seinen kleinen Taschen und sein unschuldiges Gesicht so ernst aussehend wie ein Richter! Und er sagt zu mir: ‚Mary‘, sagt er, ‚ich bin sehr vertraut mit der Wahl‘, sagt er. ‚Ich bin ein Republikaner, und Liebste ist es auch. Bist du eine Republikanerin, Mary?‘ ‚Tut mir leid‘, sage ich, ‚ich bin eine überzeugte Demokratin!‘ Und er schaut zu mir auf mit einem Blick, der einem zu Herzen geht, und dann sagt er: ‚Mary‘, sagt er, ‚das Land wird in den Ruin getrieben werden.‘ Und seit diesem Tag hat er keine Gelegenheit ausgelassen, um zu versuchen mich dazu zu bringen, daß ich meine Meinung ändere.“
Mary mochte ihn sehr und war auch sehr stolz auf ihn. Sie war schon seit seiner Geburt bei seiner Mutter gewesen; und nach dem Tod seines Vaters war sie Köchin und Hausmädchen und Kinderschwester und alles andere gewesen. Sie war stolz auf seinen anmutigen, kräftigen kleinen Körper und seine guten Manieren und besonders stolz auf das helle lockige Haar, das über seine Stirn hing und in liebreizenden Kringeln auf seine Schultern herabfiel. Sie war bereit, von früh bis spät zu arbeiten, um seiner Mama zu helfen, seine kleinen Kleider zu nähen und sie in Ordnung zu halten.
„Vornehm, nicht wahr?“, pflegte sie zu sagen. „Das Kind würde ich gern sehen, das auf der Fifth Avenue spaziert und so aussieht und geht wie er. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind würde sich nach ihm umsehen, wie er in seinem schwarzen Samtrock dahergeht, der aus dem alten Kleid der Herrin gefertigt ist, mit seinem kleinen Kopf hoch erhoben, das lockige Haar im Wind flatternd und glänzend. Es sieht aus wie ein junger Lord.“
Cedric wußte nicht, daß er wie ein junger Lord aussah; er wußte nicht, was ein Lord war. Sein bester Freund war der Gemischtwarenhändler – der mürrische Lebensmittelhändler, der niemals mürrisch zu ihm war. Sein Name war Mr. Hobbs, und Cedric bewunderte und respektierte ihn sehr. Er hielt ihn für eine sehr reiche und mächtige Person, da er so viele Dinge in seinem Laden – Pflaumen und Feigen und Orangen und Kekse – und ein Pferd und einen Wagen hatte. Cedric mochte den Milchmann, den Bäkker und die Apfelfrau, aber Mr. Hobbs mochte er am liebsten und war so vertraut mit ihm, daß er ihn jeden Tag aufsuchte und oft ziemlich lange bei ihm saß, während sie über die aktuellen Themen diskutierten. Es war ziemlich erstaunlich, über wie viele Dinge sie redeten – zum Beispiel über den Vierten Juli. Als sie über den Vierten Juli zu reden begannen, schien es wirklich kein Ende zu nehmen. Mr. Hobbs hatte eine sehr schlechte Meinung über „die Briten“, und er erzählte die ganze Geschichte der Revolution und gab sehr wunderbare und patriotische Geschichten über die Bosheit des Feindes und den Mut der revolutionären Helden wieder, und er rezitierte sogar einen Teil der Unabhängigkeitserklärung.
Cedric war so aufgeregt, daß seine Augen leuchteten und seine Wangen gerötet und seine Locken ganz durcheinander waren. Er konnte es kaum erwarten, sein Abendessen zu essen, nachdem er nach Hause gegangen war, so bestrebt war er, es seiner Mutter zu sagen. Vielleicht war es Mr. Hobbs, der ihn zum ersten Mal für Politik interessierte. Mr. Hobbs las gern Zeitungen, und so hörte Cedric viel über das, was in Washington vor sich ging; und Mr. Hobbs pflegte ihm zu sagen, ob der Präsident seine Pflicht tat oder nicht. Und einmal, als eine Wahl stattfand, fand er das alles ziemlich großartig, und ohne Mr. Hobbs und Cedric wäre das Land möglicherweise zerstört worden.
Mr. Hobbs nahm ihn zu einer großen Fackelprozession mit, und viele der Männer, die Fackeln trugen, erinnerten sich später an einen kräftigen Mann, der neben einem Laternenpfahl stand und einen hübschen kleinen schreienden Jungen auf der Schulter hielt, der seinen Hut in der Luft schwang.
Es war nicht lange nach dieser Wahl, als Cedric zwischen sieben und acht Jahren alt war, als etwas sehr Seltsames geschah, das sein Leben auf wundersame Weise veränderte. Es war auch ziemlich merkwürdig, daß er an dem Tag, als es geschah, mit Mr. Hobbs über England und die Königin gesprochen und Mr. Hobbs einige sehr unfreundliche Dinge über die Aristokratie gesagt hatte, besonders über Earls und Marquis’. Es war ein heißer Morgen gewesen; und nachdem er mit einigen Freunden Soldaten gespielt hatte, war Cedric in den Laden gegangen, um sich auszuruhen und hatte festgestellt, daß Mr. Hobbs ziemlich aufgebracht über einen Teil der Illustrated London News gebeugt dasaß, der ein Bild einer Zeremonie bei Hofe enthielt.
„Ach“, sagte er, „so machen sie es jetzt, aber sie werden eines Tages ihren Teil bekommen, wenn diejenigen, auf denen sie herumgetrampelt sind, sich erheben und sie himmelhoch in die Luft jagen – Earls und Marquis’ und sie alle miteinander! Es wird geschehen, und sie sollten besser die Augen offenhalten!“
Cedric hatte sich wie gewöhnlich auf den hohen Sitzhocker gesetzt, seinen Hut zurückgeschoben und seine Hände in die Taschen gesteckt, um Mr. Hobbs gebührenden Respekt zu erweisen.
„Haben Sie denn schon viele Marquis’ kennengelernt, Mr. Hobbs?“, fragte Cedric, – „oder Earls?“
„Nein“, antwortete Mr. Hobbs voller Empörung; „ich schätze nicht. Ich würde gerne einen von ihnen hier bei uns in die Finger bekommen, das ist alles! Ich will keine habgierigen Tyrannen auf meinen Crackerfässern herumsitzen haben!“
Und er wurde so aufgeregt bei dem Gedanken, daß er sich stolz umsah und sich die Stirn wischte.
„Vielleicht wären sie keine Earls, wenn sie es besser wüßten“, sagte Cedric, der ein vages Mitgefühl für ihre unglückliche Lage verspürte.
„Ach nein?“, sagte Mr. Hobbs. „Sie rühmen sich doch damit! Es steckt in ihnen drin. Sie sind ein übler Haufen.“
Sie waren mitten in ihrer Unterhaltung, als Mary erschien.
Cedric glaubte, daß sie vielleicht gekommen sei, um Zucker zu kaufen, aber das war es nicht. Sie sah beinahe blaß aus, als wäre sie über irgend etwas aufgeregt.
„Komm nach Hause, Liebling“, sagte sie; „Die Herrin will, daß du kommst.“
Cedric rutschte von seinem Hocker herunter.
„Will sie, daß ich mit ihr ausgehe, Mary?“, fragte er. „Guten Tag, Mr. Hobbs. Ich komme wieder.“
Er war verwundert, daß Mary ihn entgeistert anstarrte, und er fragte sich, warum sie immer wieder den Kopf schüttelte.
„Was hast du, Mary?“, fragte er. „Ist es das heiße Wetter?“
„Nein“, sagte Mary; „aber uns widerfahren merkwürdige Dinge.“
„Hat die Sonne Liebster Kopfschmerzen bereitet?“, erkundigte er sich besorgt.
Aber das war es nicht. Als er sein eigenes Haus erreichte, stand eine Kutsche vor der Tür und jemand war in dem kleinen Salon und redete mit seiner Mama. Mary drängte ihn eilig nach oben und zog ihm seinen besten Sommeranzug aus cremefarbenem Flanell mit einer roten Schärpe um die Taille an und kämmte seine Locken.
„Lords, wie?“, hörte er sie sagen. „Und der Adel und die Oberschicht. Ach! Lords, also wirklich.“
„Und das ist also der kleine Lord Fauntleroy.“
Es war wirklich sehr rätselhaft, aber er war sich sicher, daß seine Mama ihm sagen würde, was die ganze Aufregung bedeutete, also ließ er Mary klagen, ohne viele Fragen zu stellen. Als er angezogen war, rannte er die Treppe hinunter und ging in den Salon. Ein großer, hagerer alter Herr mit einem scharfgeschnittenem Gesicht saß in einem Sessel. Seine Mutter stand mit einem blassen Gesicht in der Nähe und er sah, daß Tränen in ihren Augen standen.
„Oh! Ceddie!“, rief sie und rannte zu ihrem kleinen Jungen und riß in ihre Arme und küßte ihn auf eine verängstigte, besorgte Art und Weise. „Oh! Ceddie, Liebling!“
Der große alte Herr erhob sich von seinem Stuhl und sah Cedric scharf an. Er rieb sein schmales Kinn mit seiner knochigen Hand, als er ihn musterte.
Er schien ganz und gar nicht unzufrieden zu sein.
„Und das“, sagte er schließlich bedächtig, „das ist also der kleine Lord Fauntleroy.“
Kapitel 2
IN der Woche, die folgte, gab es niemals einen erstaunteren kleinen Jungen als Cedric; eine solch seltsame oder unwirkliche Woche hatte es noch nie gegeben. Erstens war die Geschichte, die seine Mama ihm erzählte, eine sehr merkwürdige. Er mußte sie zwei- oder dreimal hören, bevor er sie verstehen konnte. Er konnte sich nicht vorstellen, was Mr. Hobbs davon halten würde. Es begann mit Earls: Sein Großvater, den er noch nie gesehen hatte, war ein Earl; und sein ältester Onkel, wenn er nicht durch einen Sturz von seinem Pferd getötet worden wäre, wäre auch irgendwann ein Earl geworden; und nach seinem Tod wäre sein anderer Onkel ein Earl geworden, wenn er nicht plötzlich in Rom an einem Fieber gestorben wäre. Danach wäre sein eigener Papa, wenn er noch leben würde, ein Earl geworden, aber da sie alle gestorben waren und nur Cedric übrig geblieben war, schien es, daß er nach dem Tod seines Großvaters ein Earl sein sollte – und für den Augenblick war er Lord Fauntleroy.
Er wurde ziemlich blaß, als er das erste Mal davon hörte.
„Oh! Liebste!“, sagte er: „Ich möchte lieber kein Earl sein. Keiner der Jungen ist ein Earl. Kann ich es nicht nicht sein?“
Aber es schien unvermeidbar. Und als sie an jenem Abend zusammen am offenen Fenster saßen und auf die schäbige Straße herab blickten, unterhielten er und seine Mutter sich lange darüber. Cedric saß auf seinem Schemel, umklammerte ein Knie in seiner Lieblingshaltung und hatte einen verwirrten Ausdruck in seinem Gesicht, das von der Anstrengung des Nachdenkens gerötet war. Sein Großvater hatte nach ihm schicken lassen, damit er nach England kommt, und seine Mutter meinte, er müsse gehen.
„Denn“, sagte sie und blickte mit traurigen Augen aus dem Fenster, „ich weiß, dein Papa würde es sich wünschen, Ceddie. Er liebte sein Zuhause sehr, und es gibt viele Dinge, an die man denken muß und die ein kleiner Junge noch nicht verstehen kann. Ich wäre eine selbstsüchtige Mutter, wenn ich dich nicht nach England gehen lassen würde. Wenn du ein Mann bist, wirst du es verstehen.“
Ceddie schüttelte traurig den Kopf.
„Es wird mir sehr leid tun, Mr. Hobbs zu verlassen“, sagte er. „Ich fürchte, er wird mich vermissen, und ich werde ihn vermissen. Und ich werde sie alle vermissen.“
Als Mr. Havisham – der der Rechtsanwalt der Familie des Earls of Dorincourt war und von ihm geschickt wurde, um Lord Fauntleroy nach England zu bringen – am nächsten Tag kam, hörte Cedric viele Dinge. Aber aus irgendeinem Grund tröstete es ihn nicht, zu hören, daß er ein sehr reicher Mann sein würde, wenn er erwachsen wäre, und daß er hier und dort Schlösser und große Parks und tiefe Minen und große Ländereien und Pächter haben würde. Er war wegen seines Freundes, Mr. Hobbs, beunruhigt und besuchte ihn kurz nach dem Frühstück in großer Sorge in seinem Laden.
Er fand ihn die Morgenzeitung lesend vor und trat mit ernster Miene zu ihm. Er glaubte, daß es ein großer Schock für Mr. Hobbs sein würde, zu hören, was ihm widerfahren war, und auf dem Weg zum Laden hatte er darüber nachgedacht, wie er ihm die Nachricht am besten überbringen sollte.
„Hallo!“ sagte Mr. Hobbs. „Morgen!“
„Guten Morgen“, sagte Cedric.
Er kletterte nicht wie üblich auf den hohen Sitzhocker, sondern setzte sich auf eine Crackerkiste und umklammerte sein Knie und war für einige Momente so still, daß Mr. Hobbs schließlich fragend über den Rand seiner Zeitung blickte.
„Hallo!“, sagte er noch einmal.
Cedric sammelte all seinen Mut.
„Mr. Hobbs“, sagte er, „erinnern Sie sich, worüber wir gestern Morgen gesprochen haben?“
„Nun“, antwortete Mr. Hobbs, „scheint mir, daß es England war.“
„Ja“, sagte Cedric; „aber gerade als Mary kam, um mich zu holen, wissen Sie es noch?“
Mr. Hobbs rieb sich den Hinterkopf.
„Wir erwähnten Königin Victoria und die Aristokratie.“
„Ja“, sagte Cedric, ziemlich zögernd, „und – und Earls, erinnern Sie sich?“
„Nun, ja“, gab Mr. Hobbs zurück; „Wir haben das Thema ein wenig berührt, so war das wohl!“
Cedric errötete bis zu der Locke auf seiner Stirn. Niemals in seinem bisherigen Leben war ihm etwas so Unangenehmes widerfahren. Er hatte ein wenig Angst, daß es auch Mr. Hobbs unangenehm sein könnte.
„Sie sagten“, fuhr er fort, „daß Sie sie nicht auf Ihren Crackerfässern sitzen haben wollten.“
„Das sagte ich!“, gab Mr. Hobbs bekräftigend zurück. „Und das meinte ich ernst. Sollen sie es nur versuchen – sollen sie es nur versuchen!“
„Mr. Hobbs“, sagte Cedric, „einer sitzt jetzt auf dieser Kiste!“
Mr. Hobbs wäre fast von seinem Stuhl gesprungen.
„Wie!“, rief er aus.
„Ja“, verkündete Cedric mit gebührender Bescheidenheit. „Ich bin einer – oder ich werde es einmal sein. Ich spaße nicht.“
Mr. Hobbs sah bestürzt aus. Er sprang auf und schaute auf das Thermometer.
„Die Hitze ist dir zu Kopf gestiegen!“, rief er aus und drehte sich um, um das Gesicht seines jungen Freundes zu untersuchen. „Es ist aber auch ein heißer Tag! Wie fühlst du dich? Hast du irgendwelche Schmerzen? Wann hast du angefangen, dich so zu fühlen?“
Er legte seine große Hand auf den Scheitel des kleinen Jungen. Dies war unangenehmer als befürchtet.
„Danke“, sagte Ceddie; „Mir geht es gut. Mit meinem Kopf ist alles in Ordnung. Es tut mir leid zu sagen, daß es wahr ist, Mr. Hobbs. Deshalb ist Mary gekommen, um mich nach Hause zu bringen. Mr. Havisham hat meiner Mama alles erzählt, und er ist ein Anwalt.“
Mr. Hobbs sank in seinen Stuhl und wischte sich mit seinem Taschentuch über die Stirn.
„Mr. Hobbs“, sagte Cedric, „ein Earl sitzt jetzt auf dieser Kiste!“
„Einer von uns hat einen Sonnenstich!“, rief er aus.
„Nein“, erwiderte Cedric, „das haben wir nicht. Wir müssen das Beste daraus machen, Mr. Hobbs. Mr. Havisham ist den ganzen Weg aus England gekommen, um uns davon zu erzählen. Mein Großvater hat ihn geschickt.“
Mr. Hobbs starrte mit weit aufgerissenen Augen auf das unschuldige, ernste kleine Gesicht vor ihm.
„Wer ist dein Großvater?“, fragte er.
Cedric steckte die Hand in die Tasche und zog vorsichtig ein Stück Papier heraus, auf das etwas in seiner eigenen rundlichen, unregelmäßigen Handschrift geschrieben war.
„Ich konnte es mir nicht merken, also habe ich es aufgeschrieben“, sagte er. Und er las langsam vor: „,John Arthur Molyneux Errol, Earl of Dorincourt.‘ So heißt er, und er lebt in einem Schloß – in zwei oder drei Schlössern, glaube ich. Und mein Papa, der gestorben ist, war sein jüngster Sohn, und ich hätte kein Lord oder Earl werden sollen, wenn mein Papa nicht gestorben wäre, und mein Papa wäre kein Earl geworden, wenn seine beiden Brüder nicht gestorben wären. Aber sie alle sind gestorben, und es gibt niemanden außer mir – keinen Jungen –, und deshalb muß ich einer sein und mein Großvater hat nach mir schicken lassen, damit ich nach England gehe.“
Mr. Hobbs schien immer erhitzter zu werden. Er wischte sich die Stirn und seine kahle Stelle und atmete schwer. Er begann zu bemerken, daß etwas sehr Bemerkenswertes passiert war; aber als er den kleinen Jungen ansah, der auf der Crackerkiste saß, mit dem unschuldigen, besorgten Ausdruck in seinen kindlichen Augen, und sah, daß er überhaupt nicht verändert war, sondern einfach so, wie er am Tag zuvor gewesen war, nur ein hübscher, fröhlicher, tapferer kleiner Kerl in blauem Anzug und mit einem rotem Halstuch, war er von all diesen Informationen über den Adel verwirrt. Er war um so verwirrter, weil Cedric es ihm mit so kluger Einfachheit und ohne sich darüber im Klaren zu sein, von welch enormer Bedeutung es war, mitteilte.
„Wie – wie sagtest du, lautet dein Name?“, erkundigte sich Mr. Hobbs.
„Er lautet Cedric Errol, Lord Fauntleroy“, antwortete Cedric. „So nannte mich Mr. Havisham. Er sagte, als ich ins Zimmer ging: ‚Und das ist also der kleine Lord Fauntleroy!‘“
„Also“, sagte Mr. Hobbs, „das haut mich aber um!“
Dies war ein Ausruf, den er immer benutzte, wenn er sehr überrascht oder aufgeregt war. Ihm fiel in jenem verwirrenden Moment nichts anderes ein.
Cedric hielt es für eine passende Äußerung. Sein Respekt und seine Zuneigung für Mr. Hobbs waren so groß, daß er all seine Äußerungen bewunderte und billigte. Er hatte noch nicht genug von der Gesellschaft gesehen, um zu erkennen, daß Mr. Hobbs manchmal nicht ganz konventionell war. Er wußte natürlich, daß er sich von seiner Mutter unterschied, aber andererseits war seine Mutter eine Dame, und er glaubte, daß sich Damen immer von Herren unterschieden.
Er sah Mr. Hobbs wehmütig an.
„England ist weit weg, nicht wahr?“, fragte er.
„Es ist quer über den Atlantik“, antwortete Mr. Hobbs.
„Das ist das Schlimmste“, sagte Cedric. „Vielleicht werde ich Sie für eine lange Zeit nicht wieder sehen. Ich mag den Gedanken nicht, Mr. Hobbs.“
„Die besten Freunde müssen sich trennen“, sagte Mr. Hobbs.
„Nun“, sagte Cedric, „wir sind seit vielen Jahren befreundet, nicht wahr?“
„Seit du geboren wurdest“, antwortete Mr. Hobbs. „Du warst ungefähr sechs Wochen alt, als du zum ersten Mal auf dieser Straße ausgefahren wurdest.“
„Ach“, bemerkte Cedric mit einem Seufzer, „ich hätte nie gedacht, daß ich irgendwann ein Earl sein müßte!“
„Du glaubst“, sagte Mr. Hobbs, „daß es kein Entrinnen gibt?“
„Ich fürchte nicht“, antwortete Cedric. „Meine Mutter sagt, daß mein Papa gewünscht hätte, daß ich es tue. Aber wenn ich schon ein Earl sein muß, kann ich zumindest eines tun: Ich kann versuchen, ein guter zu sein. Ich werde kein Tyrann sein. Und wenn es jemals wieder einen Krieg mit Amerika geben sollte, werde ich versuchen, ihn zu beenden.“
Es war ein langes und ernstes Gespräch, das er mit Mr. Hobbs führte. Nachdem Mr. Hobbs den ersten Schock überwunden hatte, war er nicht mehr so aufgeregt, wie man es hätte erwarten können; er bemühte sich, sich mit der Situation abzufinden, und ehe die Unterhaltung zu Ende war, hatte er sehr viele Fragen gestellt. Da Cedric nur wenige von ihnen beantworten konnte, bemühte er sich, sie selbst zu beant-worten, und da er recht bewandert mit Earls und Marquis’ und herrschaftlichen Anwesen war, erklärte er viele Dinge auf eine Weise, die Mr. Havisham wahrscheinlich in Erstaunen versetzt hätte, hätte dieser Gentleman ihn gehört.
Aber andererseits gab es viele Dinge, die Mr. Havisham in Erstaunen versetzten. Er hatte sein ganzes Leben in England verbracht und war nicht an Amerikaner und ihre Gepflogenheiten gewöhnt. Er war seit fast vierzig Jahren beruflich mit der Familie des Earls of Dorincourt verbunden, und er wußte alles über seine großen Güter, sein großes Vermögen und seine Bedeutung; und auf eine kühle, geschäftsmäßige Weise fühlte er ein Interesse an diesem kleinen Jungen, der in Zukunft der Herr und Besitzer von alldem sein sollte – dem zukünftigen Earl of Dorincourt. Er hatte alles über die Enttäuschung des alten Earls über seine älteren Söhne und über seinen heftigen Zorn über die amerikanische Ehe von Captain Cedric gewußt, und er wußte, daß er die sanftmütige Witwe immer noch haßte und nur mit bitteren und unbarmherzigen Worten von ihr sprach. Er bestand darauf, daß sie nur ein gewöhnliches amerikanisches Mädchen war, das seinen Sohn in die Ehe gelockt hatte, weil sie wußte, daß er der Sohn eines Earls war. Der alte Anwalt hatte beinahe selbst geglaubt, daß dies alles wahr sei. Er hatte in seinem Leben sehr viele selbstsüchtige Menschen gesehen, und er hatte keine gute Meinung über Amerikaner. Als er über die schlechte Straße gefahren und seine Kutsche vor dem schäbigen kleinen Haus stehen geblieben war, war er tatsächlich ziemlich erschrocken. Es schien wirklich ziemlich schrecklich, sich vorzustellen, daß der zukünftige Besitzer von Dorincourt Castle und der Wyndham Towers und von Chorlworth und all den anderen stattlichen Prachtbauten in einem unbedeutenden Haus in einer Straße mit einer Art Gemischtwarenladen geboren und aufgewachsen sein sollte. Er fragte sich, was für eine Art Kind er sein würde und was für eine Mutter er hatte. Er schreckte ziemlich davor zurück, sie beide zu sehen. Er hegte eine Art Stolz für die Adelsfamilie, um deren rechtliche Belange er sich so lange gekümmert hatte, und es hätte ihn sehr geärgert, wenn er sich gezwungen gesehen hätte, eine Frau zu vertreten, die ihm eine vulgäre, geldgierige Person zu sein schiene, die keinen Respekt vor dem Land ihres verstorbenen Mannes und der Würde seines Namens hätte. Es war ein sehr alter Name und ein sehr glanzvoller, und Mr. Havisham selbst hegte großen Respekt davor, obwohl er nur ein kühler, geschäftsmäßiger alter Anwalt war.
Als Mary ihn in das kleine Wohnzimmer führte, sah er sich kritisch um. Es war schlicht eingerichtet, aber es sah wie ein Zuhause aus; es gab keinen billigen, gewöhnlichen Zierat und keine billigen, grellen Bilder. Die wenigen Verzierungen an den Wänden waren geschmackvoll und im Raum befanden sich viele hübsche Dinge, die die Hand einer Frau angefertigt haben mochte.
„Bis hierhin gar nicht mal so schlecht“, hatte er sich gesagt; „aber vielleicht überwog der Geschmack des Captains.“ Aber als Mrs.