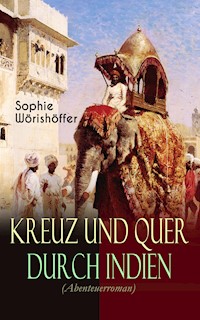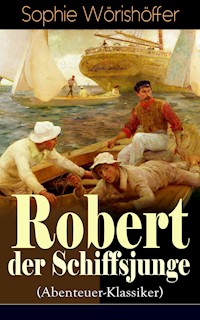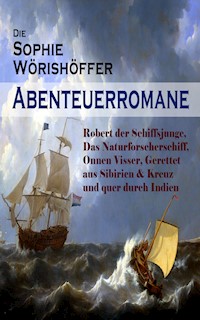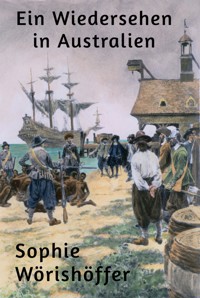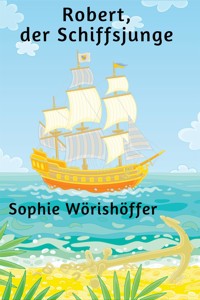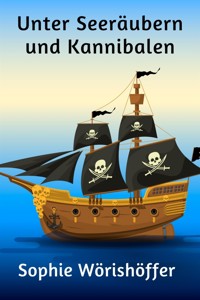3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seine Eltern sind verschuldet. Der sechzehnjährige Matthias verdingt sich deshalb als Schiffsjunge. Erst in der Südsee erfährt er, dass er auf einem Sklavenjägerschiff angeheuert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Korsar
Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDer Berg bebt
Es war etwa um fünf Uhr morgens an einem herrlichen, aber heißen Sommertage. Aus dem Krater des Vesuvs stieg eine leichte bläulich-weiße Rauchwolke – die Fumarole – in langsamen Windungen zum sonnenhellen Himmel empor, gleichsam die höchste Krone des ganzen, prachtvollen Gesamtbildes, seine Besonderheit, die vielleicht dem Fremden, eben erst hierher Gekommenen ein unruhiges Herzklopfen verursachen mochte, deren beständige Erscheinung aber den Bewohnern der Gegend etwas so Alltägliches war, dass kein Auge den Gipfel des Berges auch nur streifte.
Heute sollte die Weinlese beginnen. Aus den Dörfern und Städtchen am Abhange da unten hatten sich die Leute mit großen Körben und Butten zahlreich eingefunden, um den kostbaren Schatz an Trauben einzusammeln und ins Tal zu schaffen. Auch eine Anzahl halberwachsener Knaben kam die Anhöhen heraufgestürmt, nicht etwa im Verfolg der schmalen, gebahnten Wege zwischen den Weingärten, sondern durch die steinigen, von Lavablöcken bedeckten Schluchten, über tiefe Rinnen und Spalten, aus deren Mitte nur zuweilen einige breitästige Kastanien hervorwuchsen, über Stock und Stein mit lautem Hallo, das den ganzen, glücklichen Lebensmut ihrer fünfzehn oder sechzehn Jahre deutlich bekundete.
Es waren braune, schlanke Gestalten, einige unter ihnen kaum halb bekleidet, Burschen mit schwarzem, lockigem Haar und ebensolchen Augen, kecke lustige Gesellen, denen vielleicht auf Erden nichts gehörte als der zerschlissene Leinenanzug und der breitrandige Strohhut, unter dem die Blicke so fröhlich hervorlugten, als sei die ganze Welt ihr Eigentum, die aber trotz dieser unverkennbaren Armut doch gesund und kräftig aussahen und munter durcheinander sprachen oder sangen.
Zwei der Knaben unterschieden sich bemerkbar von ihren jungen Genossen, der eine durch einen etwas besseren Anzug und offenbar herausforderndes Wesen, der andere durch den weit größeren und kräftigeren Körperbau, der ihn im Verein mit einer helleren Hautfarbe und Blauaugen sogleich als einen Nordländer kennzeichnete. Auf dem Rücken trug der hübsche Junge den großen Korb und in der Hand ein Messer; er schien sich jetzt von den Genossen trennen zu wollen, der ausgestreckte Finger bezeichnete eine sorgfältig mit Dornen eingehegte Fläche, auf der die goldgelben und purpurnen Trauben in üppiger Fülle von den Stöcken herabhingen.
„Da ist meines Vaters Weingarten! Adieu alle miteinander!“
Der andere Junge mit dem kecken, wenig Vertrauen einflößenden Blick stand in diesem Augenblick still und hob die Hand, während er zugleich den Korb von der Schulter warf.
„Ich habe einen Plan!“, rief er.
„Dann gib deine Gedanken zum besten. Wollen wir den alten mürrischen Vater Jakopo ärgern?“
Der Knabe schüttelte den Kopf. „Ich weiß etwas viel Angenehmeres. Seht ihr da unten auf dem Meere das neue schöne Schiff mit den glänzend weißen Segeln und der großen Flagge?“
Aller Augen suchten den Golf, aus dessen blauer Tiefe in ziemlich bedeutender Entfernung ein stattlicher Segler emporragte. „Das ist die ‚Napoli‘“, rief einer. „Was soll’s mit ihr, Giulio?“
„Das Schiff des reichen Signor Ferrati. Es geht dieser Tage nach den Südseeinseln unter Segel.“
Giulio nickte. „Und ich gehe als Kajütjunge mit“, ergänzte er. „Vielleicht sehe ich in Jahren meine Heimat nicht wieder.“
„Und das war dein Plan, der Vorschlag, den du uns machen wolltest?“
„Das war der Ausgangspunkt für meinen Gedanken. Hört zu: Wer von euch ist schon auf dem Vesuv gewesen?“
Die Knaben sahen einander an. Die Hälfte war noch nicht auf dem Gipfel gewesen.
„Ich selbst bin auch noch nicht hinaufgekommen“, nickte Giulio. „Wie wäre es also, wenn wir heute die Sache versuchten? Vier Stunden genügen zum Aufstieg, ebenso viele zur Talfahrt – etwa gegen drei Uhr nachmittags sind wir wieder an Ort und Stelle, und kein Mensch erfährt, wo wir gesteckt haben.“
„Ich gehe nicht mit“, sagte der Blauäugige.
Giulio lachte spöttisch; in diesem Augenblick trug sein scharf geschnittenes Gesicht einen boshaften, ja gehässigen Ausdruck.
„Natürlich nicht!“, rief er. „Der brave, tugendhafte Matthias, dieser gehorsame Sohn wird sich ja um keinen Preis einen Spaziergang gestatten, dafür ist er ein viel zu zaghaftes Muttersöhnchen.“
„Willst du einmal wieder meine Fäuste fühlen, Giulio?“
„Streitet euch doch nicht gleich, ihr beiden. Ich finde, wir könnten wohl auf den Berg klettern und dann von nachmittags drei Uhr bis zum Abendläuten noch Trauben genug pflücken – besonders du, Matthias. Euer Acker ist klein.“
„Und wir anderen helfen dir später deinen Korb füllen.“
Der junge Deutsche sah zu dem rauchenden Berge empor. „Es sind die letzten Trauben“, sagte er halb zögernd, vielleicht von Giulios Worten heimlich gereizt, „wir haben unsere Vorräte fast völlig eingeerntet. Aber dafür erwarten mich die Meinigen auch schon nach zwei oder drei Stunden wieder zurück.“
„Ach, so lass sie doch warten. Wenn es weiter nichts ist, Matthias! Du kannst ja später dein längeres Ausbleiben erklären.“
„Seid ihr denn schon sämtlich entschlossen, den Aufstieg zu wagen?“
„Ja! Ja!“, hieß es. „Eine so gute Gelegenheit bietet sich nicht wieder.“
„Wir sind unserer zehn“, nickte Giulio. „Wenn weiter hinauf Eseljungen mit ihren Tieren am Wege liegen, so gibt es einen vergnügten Ritt. Ich bezahle die Kosten für uns alle.“
Er hielt zwischen Daumen und Zeigefinger ein Geldstück hoch empor. „Das hat mir mein Pate zum Namenstage geschenkt – ich will dafür in der Heimat einen letzten frohen Tag genießen. Wer weiß, wann ich Neapel wiedersehe.“
Er hatte bei diesen Worten seinen Korb in einem Gebüsch versteckt, und nach ihm taten alle übrigen Knaben das Gleiche, auch Matthias. Es lockte doch gar zu sehr, von dem schmalen Rande des Kraters in das Flammenmeer hinabzusehen – er konnte nicht widerstehen. Das verziehen ihm die Eltern, er glaubte es gewiss.
Wenige Minuten später trabte die ganze Schar über Geröll und Steine dahin, einem aufwärts führenden Wege entgegen. Die Trauben würden ja nicht davonlaufen, man pflückte sie morgen, meinten sie.
„Da sind die Esel!“, rief Giulio.
Eine Menge kleiner halb nackter Jungen kam zum Vorschein, hinüber und herüber schwirrten die Angebote, Esel wieherten und trampelten, Menschen schimpften oder lachten. Fünf Minuten später saßen die Jungen in den Sätteln, die Treiber liefen, mit Dornenstöcken versehen, immerfort spornend und eifernd hinterdrein, und im schnellen Trabe ging es bergauf.
Weiter und weiter entschwand den Blicken das blühende Landschaftsbild am Fuße des Vulkans. Die alten Weiber mit ihren bunten Kopftüchern, die Kinder und Bettler zwischen den Weingeländen wurden kleiner und kleiner, das Geräusch des werktätigen Lebens verstummte immer mehr, bis endlich kein Laut empordrang in die hehre Einsamkeit da oben.
Jetzt sah man die Fumarole schon näher und größer; wie eine Pinie war sie geformt, mit schlankem Stamm und breiter Krone, mitten aus dem riesigen Schlunde des Kraters kam sie heraus. Ob es nicht in der Luft nach Schwefel roch?
„Merkwürdig still ist der Tag“, sagte jemand. „Und kein Vogel singt mehr.“
„Weil es hier in den Steinwüsten keine gibt. Überall bedeckt fußhoch Lava den Boden.“
„Du“, fragte Giulio den Treiber seines Reittieres, „du, warst du schon einmal oben am Rande des Kraters?“
Der Junge nickte.
„Si, Signor, si!
Etwas wie ein Schauer unwillkürlicher Beklemmung überschlich die jungen Seelen.
„Kann man auch das Feuer sehen?“, fragte Matthias.
„Si! Si! Aber dazu musst du hinabsteigen, Signor – über den Rand –, musst mit sicherem Schritt von Stein zu Stein springen bis in die innerste Mitte des Kraters. Da steht ein einzelner Kegel – in dessen Schlund glüht die Flamme, da leuchtet es, und rote flüssige Glut füllt den Raum.“
Matthias schüttelte sich. „Das wage, wer mag!“, rief er. „Ich nicht! Ein Fehltritt – und die gärende Lava hätte ihr Opfer erfasst.“
„Schade ist’s!“, meinte ein anderer. „Gerade das Feuer würde ich gern beobachten. Ihr nicht auch?“
„Um diesen Preis nicht. Aber nun müssen wir bald den Gipfel erreicht haben, glaube ich.“
Die Füße der Esel glitten auf dem glatten Gestein aus, und bald weigerten sich die ermüdeten Tiere, noch weiter vorzugehen. Wie ein Feuerball stand am wolkenlosen Himmel die Sonne, kein Hauch milderte das Glühen und Brennen, kein fliegendes oder kriechendes Geschöpf belebte die Steinwüste. Wie Schattenstreifen lagen tief unten die letzten Kastaniengebüsche, wie dunkle Punkte die Türme von Neapel. Es flimmerte und blitzte vor den Augen der jungen Leute, die Esel keuchten, und die Treiber mussten beständig von ihren Dornenstöcken Gebrauch machen, um die widerspenstigen Vierfüßler vorwärts zu bringen.
„Der Schwefelgeruch wird immer stärker“, sagte Matthias.
Das fanden die Übrigen auch. „Es ist, als sei Staub in der Luft“, meinte einer.
„Oder feine Asche.“
„Das dachte ich schon vorhin. Meine Hand war mit feinem grauen Pulver bedeckt.“
Diese Wahrnehmung störte aber das Vergnügen keineswegs. Der obere Rand war erreicht, an einigen Stellen scharf und unerklimmbar, an anderen so breit, dass der Fuß bequem auftreten und dem Körper die nötige Stütze bieten konnte. Überall bildeten zackige Felsen eine Art natürlicher Brustwehr, es war ungefährlich, über den Rand in die Tiefe zu blicken, auch für den, der etwa leicht vom Schwindel ergriffen zu werden pflegte.
Fast wie eine Ebene dehnte sich das weite Rund, hie und da von rauchenden Spalten durchzogen, und nur in der Mitte wogte und gärte, den tieferen Schlund ausfüllend, die bewegliche Masse wie ein Knäuel von Riesenschlangen, bald zusammengeballt, bald auseinanderschnellend, unter- und übereinander dahinschießend wie lebende Wesen, die in enger Gefangenschaft den Ausgang suchen und, wenn undurchdringliche Mauern ihren Weg versperren, grollend, mit verdoppelter Stärke einen neuen Anlauf nehmen.
„Man könnte wohl ewig hier oben stehen“, sagte Giulio, „und das Wühlen und Gären da in der Tiefe beobachten. Ob sich immer, Tag und Nacht, jahraus, jahrein, die Massen so drehen und überstürzen?“
Die kleinen Führer schüttelten ihre Köpfe. „Nein, so arg nicht. Heute sind die Berggeister in vollster Arbeit.“
„Die Berggeister?“, lächelte Matthias.
„Si, Signor. Da unten wohnen braune Zwerge mit großen Kappen und Schaufeln in den Händen, die heizen den Berg, dass er wundervolle Reben trägt, Beeren, die den kostbaren Trunk geben, von denen die Menschen Kraft und Genesung erlangen. Wenn aber das Volk in Undank und Übermut verfällt, wenn ein Strafgericht notwendig wird, dann fliegt vom Himmel ein Vöglein und bringt den Zwergen die Botschaft Gottes.“
„Welche?“, fragte Giulio, die Lippen zu spöttischem Lächeln verziehend. „Welche Botschaft, mein Bursch?“
„Den Befehl, das Feuer da unten tüchtig zu schüren“, versetzte mit beklommener Stimme der Eseltreiber. „Dann entsteht im Innern des Berges ein Rollen und Grollen, ein Dröhnen, dass die Erde hebt, Flammen schlagen hoch empor, das Land bedeckt sich im weiten Rund mit fußtiefer Asche, und in gewaltigen Strömen bricht die Lava hervor. Ein Feuerstrom braust und rauscht zu Tal, die Weinberge werden zerrissen, die –“
„Still doch!“, unterbrach Matthias. „Still doch, Junge! Man hat ein Gefühl, als riefest du das Schrecknis herbei.“
„Hörtet ihr nichts?“, fragte eine Stimme.
„Nein. Was denn?“
„Es klang, wie wenn ein Wagen in weiter Ferne über eine Brücke fährt. Aber ich kann mich auch getäuscht haben.“
„Das kommt von der Erzählung dieses kleinen Burschen und von dem Wühlen und Bewegen da im Krater. Ich mag es nicht länger ansehen.“
„Ich auch nicht. Man ist ohnehin durch den langen Ritt hungrig geworden.“
Die Esel verzehrten ihre spärliche, aus dem Tal mit heraufgebrachte Heuration, und auch die jugendlichen Reiter suchten hier und dort zwischen den Lavablöcken möglichst bequeme Sitzplätze, um dann das Frühstück aus den Taschen hervorzuholen und tüchtig hineinzubeißen. Freilich, das Wasser und die Trauben fehlten hier oben in der Steinwüste gänzlich, man musste sich mit trockener Kost begnügen, aber das schadete weiter nicht, die kräftigen Zähne zermalmten das Brot, und die Rede floss ununterbrochen weiter.
„Also du willst ein Seemann werden, Giulio. Früher ist doch daran niemals gedacht worden.“
Der schlanke Knabe lächelte eigentümlich. „Vielleicht will ich auch nicht gerade den Beruf des Seemannes für immer ergreifen“, versetzte er, „aber die Reise nach der Südsee mache ich erst einmal mit. Mein Vetter Carlos ist erster Steuermann an Bord der ,Napoli‘, müsst ihr wissen.“
Die anderen sprachen hin und her. „Ich möchte auch einmal eine Seereise unternehmen“, meinte einer, „aber freilich – nicht mit der ‚Napoli‘.“
„Warum das nicht?“
„Man sagt, der geizige Ferrati wolle Sklaven einfangen und nach Südamerika an den Markt bringen.“
Giulio lachte. „Was kümmert das die Besatzung?“, rief er.
„Die wird an den Mast gehängt, wenn etwa ein dänisches Kriegsschiff den Sklavenjäger auf frischer Tat ertappt.“
„Wenn! Wenn! Das Wort ist dehnbar wie Gummi. Und nebenbei glaube ich auch an die Sklavengeschichte keinen Augenblick. Signor Ferrati will eine der Südseeinseln für sich gewinnen, will da eine Art König werden und zu seinen vielen Millionen noch neue erjagen, das ist alles. Diese Inseln werden ja jetzt von den Schiffen jeder seefahrenden Nation eifrig aufgesucht, alle Welt will in der Südsee Beute machen – warum nicht auch Signor Ferrati?“
„Weil er ohnehin schon ungezählte Reichtümer besitzt“, warf Matthias ein. „Er ist sicherlich ein harter, herzloser Mann.“
Der junge Nordländer seufzte, er dachte an das niedere Häuschen, in dem seine Eltern und Geschwister lebten, an die schwere Arbeit, welche der Vater leisten musste, um im Dienste des reichen Signor Ferrati sich selbst und die Seinigen mit Ehren durchzubringen. Früher hatte der fleißige Mann selbst ein Weingut im Besitz gehabt, war vermögend und glücklich gewesen, aber mehrere aufeinanderfolgende schlechte Ernten raubten ihm Hab und Gut und stürzten ihn außerdem in Schulden, die bis auf den gegenwärtigen Tag nicht getilgt worden waren. Er trat in die Dienste des reichen Italieners und trug Jahr um Jahr von der großen Summe eine Kleinigkeit ab, aber ohne Hoffnung, sich jemals wieder zur Selbstständigkeit emporzuarbeiten, besonders da Signor Ferrati ein sehr harter Gläubiger war und eben, weil sein Weinbergsaufseher ihm gegenüber kein Selbstbestimmungsrecht mehr besaß, nach Herzenslust den strengen Gebieter, ja, den Tyrannen spielen konnte.
An alles das dachte Matthias, als er so sinnend dasaß und auf das weiche sonnenbeschienene Blau des Meeres hinabsah. Die Genossen hatten indessen ihre Unterhaltung fortgesetzt und den geizigen Millionär tüchtig durchgehechelt.
„Vor fünf Jahren hat er seinen einzigen Sohn auf die See hinausgeschickt“, sagte einer. „Das war, als er das erste Schiff ausrüstete, um in der Südsee Sklaven zu fangen. Alfeo musste mit, ob er wollte oder nicht, denn er konnte ja doch die Besatzung überwachen und genau Acht geben, ob auch irgendeiner solche Unglücksmenschen von Insulaner für eigene Rechnung verkaufte. Der Alte soll ihn damals gewaltsam auf das Schiff gebracht haben.“
„So ist es“, nickte Giulio. „Das war die erste ,Napoli‘.“
„Sie kam niemals hierher zurück, nicht wahr?“
„Nie. Verschollen, verloren, untergegangen mit Mann und Maus.“
„Und das alles konnte den Geizkragen nicht mürbe machen? Er nennt auch dies schöne, schlanke Schiff getrost wieder ,Napoli‘ und versucht auf dem Wege, der ihn seinen einzigen Sohn gekostet hat, abermals das trügerische Glück?“
„Natürlich. Was geht denn das Schicksal des verschollenen Dreimasters das neue Fahrzeug an? Wind und Wellen fragen doch nicht nach dem Namen.“
„Aber der Unsegen geht gleichsam von Anfang her mit an Bord. Ich würde mich hüten, ein verfemtes Schiff zu besteigen.“
Matthias hob den Kopf. „Ich auch“, sagte er.
Giulio sandte ihm einen spöttischen Blick. „Bleib daheim, du deutscher Biedermann“, rief er im lachenden Tone. „Binde fleißig und ehrbar die Weinreben an Stöcke, suche auch jedes Steinchen vom Acker und scheuche die Amseln, wenn sie ja einen Beutezug unternehmen sollten. Das ist tugendhaft und anständig, ganz deiner würdig. Du bist eben zum Philister geboren.“
Matthias überhörte geflissentlich die beleidigenden Worte. „Wollen wir jetzt nicht an die Talfahrt denken?“, fragte er. „Es wird Zeit.“
Damit waren alle Übrigen einverstanden, und den Eseln wurden die Geschirre wieder angelegt. „Am Himmel steht eine schwarze Wolke“, sagte einer. „Hoffentlich überrascht uns kein Gewitter.“
In diesem Augenblick fuhr ein Windstoß durch die Luft, eine Säule aus loser, zerflatternder Asche hob sich hoch empor und wirbelte auseinander, die jungen Leute mit schwärzlichem Staub vom Kopf bis zu den Füßen überschüttend. Es pfiff und heulte um den Berg, dann wurde wieder alles still.
Die kleinen Eseltreiber hatten Mühe, ihre Tiere zum Gehorsam zu zwingen. Ein lautes „I – ah! I – ah!“ zeigte die Unruhe, welche sich der ganzen Herde bemächtigte. Die Grauen rissen an den Halftern, warfen die Köpfe zurück und machten Miene, in wilder Flucht den Berg hinabzurennen.
„Es kommt ein Unwetter“, meinte zitternd vor Furcht einer der Treiber. „Die Tiere sind klüger als wir, sie suchen Schutz.“
„Aber hier oben gibt es ja weder Baum noch Strauch. Du lieber Himmel, wenn wir nur erst ohne Unfall wieder auf ebener Erde angelangt wären!“
Er hatte noch nicht ausgesprochen, als ein neuer Windstoß daherfuhr, begleitet von langanhaltendem Donner und einem Aschenregen, der diesmal nicht wieder aufhören zu wollen schien. Die Luft verfinsterte sich von Minute zu Minute immer mehr, das Heulen und Brausen nahm beständig zu, unheimlich leuchtend spaltete ein Blitz das wirbelnde Aschentreiben.
Jetzt hatten die jungen Leute ihre Tiere bestiegen, und diese suchten, ängstlich durcheinander rennend, den Weg ins Tal. Man konnte nicht mehr mit Sicherheit sehen, konnte kaum atmen, kaum die Augen offen halten, so sehr tobte von allen Seiten der entfesselte Sturm.
„Ein Aschenregen!“, jammerten die Eseltreiber. „Heilige Jungfrau, stehe uns bei! Ihr sieben gepriesenen Nothelfer, verlasst uns nicht!“
„Ruhig! Ruhig!“, ermahnte Matthias. „Kameraden, ich glaube, wir müssen uns entschließen, zu Fuß zu gehen – die Herrschaft über die Tiere ist im Augenblick verloren.“
„Mein Esel sucht mich mit aller Macht abzuwerfen.“
„Und meiner möchte sich wälzen.“
„Das geht so nicht, Kinder. Lasst die Tiere laufen!“
Die Treiber irrten wie Verzweifelte im stäubenden Aschenregen umher, unablässig ihre Esel lockend, bald mit Drohungen, bald mit Schmeichelworten, immer aber vergeblich. Die Tiere gehorchten nicht mehr, die Oberhoheit des Menschen über die vernunftlosen Geschöpfe war verloren.
„Sorge jeder für sich!“, rief Giulio. „Wir können nicht beieinanderbleiben.“
„Das ist ein schlechter Vorschlag – gerade der Einzelne geht verloren.“
Es war Matthias, der das gesagt hatte und um den sich jetzt fast alle Übrigen versammelten. Man ließ die Esel laufen, wohin sie wollten, und suchte zwischen den zerstreuten Lavablöcken, in mehr als fußtiefer Asche watend, den abwärts führenden Weg. Der heftige Wind trieb den Rauch aus dem Krater um den ganzen Berg, Funken mischten sich hinein und festere Aschenklumpen; dann, als zufällig einer der Knaben emporblickte, sah er durch alle Hindernisse hinweg eine hohe Feuersäule, die aus dem mittleren Schlunde aufstieg. In jedem Augenblick konnte der Strom glühender, flüssiger Lava hervorbrechen und seinen Weg in das Tal nehmen.
Schauerlicher, furchtbarer Gedanke.
„Ruhig!“, ermahnte Matthias. „Ruhig! Durch den schnellsten Lauf könnten wir dem Verhängnis, wenn es wirklich eintritt, nicht mehr entrinnen.“
„Hältst du uns denn für unwiederbringlich verloren?“
„Das weiß nur Gott allein. Aber wer fallen und ein Bein brechen würde, der wäre es sicherlich.“
„Wir sind fehlgegangen!“, tönte Giulios helle Stimme. „Vor uns liegt eine breite Schlucht.“
„Auch die Esel können nicht hinüber. Sie laufen schreiend durcheinander.“
Im heftigen, den Blick mehr als nur halb verschleiernden Aschenregen sahen die jungen Leute das tief ausgehöhlte Bett eines früheren Lavastromes. Schwarz und unheimlich gähnte der offene Schlund – wie aus weiter Ferne drang zu den Obenstehenden das klagende Wimmern einer Tierstimme. Einer der Esel mochte in den Abgrund gestürzt sein und nun mit zerschmetterten Gliedern auf dem spitzen Gestein liegen.
Der Treiber rang voll Verzweiflung die Hände. „Das ist Mira, mein armes, gutes Tier – ach, ihr Heiligen, das ist Mira! Wie soll ich ihr nur helfen?“
„Vorwärts, Kleiner“, ermahnte Matthias. „Vorwärts! Danke dem Himmel, wenn du dich selbst zu retten vermagst.“
„Aber ich kann doch die arme Mira nicht in der Not verlassen!“
Seine Kameraden rissen den Schluchzenden gewaltsam mit sich fort, in dicht geschlossener Reihe ging es jetzt am Rande des Abgrundes dahin, während Blitz und Donner die Luft zerrissen und ein pfeifender Sturm die Asche in steter Wirbelbewegung den Wanderern um die Köpfe fegte. Man konnte nur mit Mühe atmen, nur hinter der vorgehaltenen Hand die notwendigsten Worte sprechen.
„Mir will scheinen, als ginge unser Weg nicht mehr bergab!“, rief Matthias.
„Großer Gott, das wäre schrecklich!“
„Aber die Schlucht zwingt uns, an ihrem Rande zu bleiben.“
„Oh, die Schlucht. Stundenweit führt sie dahin!“
„Und nicht zu Tal?“, rief Matthias.
„Nein – zur Wohnung des Eremiten.“
„Hier oben in der Steinwüste lebt also ein Mensch?“
„Ja, ein frommer Bruder Franziskaner. Seine Hütte hat er aus Lavablöcken aufgebaut – er lebt von dem, was ihm mitleidige Menschen schenken.“
„Kennt ihr diesen Mann?“
Ein einstimmiges „Si! Si! Signor!“, beantwortete die gestellte Frage. „Wer von den Leuten in Resina einen Schwerkranken im Hause hat, oder wen das Gewissen quält, der trägt dem frommen Bruder einen Krug Wasser hinauf“, erzählte einer der Knaben. „Dann schenkt ihm Fra Urbino seine Fürbitte.“
„Und ist die Wohnung dieses Mannes noch weit, ihr Jungen?“
Die kleinen Führer weinten sämtlich bittere Tränen. „Man kann ja nicht die Hand vor den Augen sehen“, schluchzten sie. „Es kommt gewiss das Jüngste Gericht, und wir alle müssen sterben.“
In den Lüften heulte die Windsbraut, immer dichter fiel der Aschenregen, immer wilder zuckten die Blitze durch das Dunkel, selbst starke Herzen hätten in diesem furchtbaren Kampf aller Elemente wohl die gewohnte Festigkeit verloren und ihren Mut schwinden gesehen, wie viel mehr nicht junge unerprobte Knaben, die noch dazu wussten, dass sie sich auf verbotenen Wegen befanden. Welche Sorge mochten wohl daheim die Angehörigen bei diesem Unwetter, bei der drohenden Gefahr eines vulkanischen Ausbruches empfinden!
Vorwärts! Immer vorwärts! Es gab kein Zurück, keine Bedenken mehr – die tiefe Schlucht zur Seite des Weges hinderte jede freie Bestimmung, jede Möglichkeit, eine andere Richtung einzuschlagen.
Noch eine martervolle Viertelstunde wurde durchlitten, dann schimmerte ziemlich nahe vor der kleinen Schar ein schwaches Licht durch die Finsternis des Aschenregens. Das Pünktchen stand fest, es bewegte sich nicht und erschien nach jeder plötzlich daherfahrenden Helle der Blitze immer wieder, ja, es nahm an Stärke offenbar zu – durch die Reihen der Knaben ging ein lautes Frohlocken.
„Das ist Fra Urbinos Hütte!“
„Ob er uns zu sich hineinlässt?“
„Oh gewiss, gewiss. Der fromme Bruder ist ein sehr guter Mann; er wird auch für uns die sieben heiligen Nothelfer anrufen.“
Keiner von allen erwog, dass ja gerade im Verzug die Gefahr verborgen lag; sie sehnten sich zu sehr nach einem schützenden Obdach, überhaupt nach menschlicher Nähe, um noch irgendwelche Bedenken zu hegen. Es mochte gegen zwölf Uhr mittags sein – bei solcher Tageszeit vollständig im Finstern zu tappen, das wirkte zu niederdrückend.
Einige fünfzig Schritte weiter durch Sturm und aufgehäufte Asche, dann trat ein seltsamer Bau aus viereckigen Steinen mehr und mehr erkennbar hervor. Zwei kleine unregelmäßige Fenster ohne Glasscheiben gestatteten den Blick in das Innere, das flache Dach war aus Brettern hergestellt, und eine schmale Spalte diente als Tür. Jetzt waren sämtliche Zugänge durch Matten verhüllt; der Wind fuhr um das niedere Haus und klapperte mit den Holzstücken auf dem Dache – hin und her schwankte drinnen das Flämmchen der Lampe, aber kein Laut einer menschlichen Stimme drang hinaus in die Finsternis.
Matthias bewegte ein wenig den Vorhang der Türspalte. „Fra Urbino!“, rief er.
Die Matte wurde sogleich zurückgezogen, und hinter ihr zeigte sich die hohe ungebeugte Gestalt eines Greises, dessen weißer Bart bis auf den Gürtel herabhing. Ein Käppchen aus schwarzem Seidenstoff bedeckte das Haupt des Alten, dessen Mönchgewand durch ein hänfenes Seil zusammengehalten wurde, während die Füße in Lederschuhen steckten. Fra Urbino schien bei dem Anblick seiner unerwarteten Gäste lebhaft zu erschrecken.
„Meine Kinder“, sagte er, „wie kommt ihr gerade jetzt hierher?“
„Wir sind von dem Aschenregen überrascht worden, frommer Vater. Ist es erlaubt, in Eurer Klause das Unwetter vorüberziehen zu lassen?“
Der Einsiedler trat zurück. „Seid willkommen!“, verletzte er. „Ob zum Leben oder zum gemeinsamen Tode, das weiß nur einer – bei ihm allein steht die Entscheidung.“
Das kleine Gebäude fasste kaum die ganze Schar der Besucher; überall am Boden kauerten müde und matt von der inneren Unruhe die Knaben, denen der Franziskanermönch den Trunk kalten Wassers reichte, das einzige Labsal, welches neben einigen Trauben und Orangen die arme Hütte hoch oben in den Steinwüsten des Vesuv ihren Gästen darzubieten hatte.
„In einer Stunde wird der Aschenregen aufgehört haben“, sagte Fra Urbino.
„Woher wisst Ihr das, frommer Vater?“
„Weil ich ihrer zwanzig und mehr hier oben schon durchlebte. Das Ärgste ist bereits vorüber.“
„Ach, dem Himmel sei gedankt!“
Der Mönch hob warnend die Hand. „Nicht zu voreilig, mein Sohn. Wer mag wissen, was noch nachkommt?“
Keiner der Knaben antwortete ihm. Wie ein lebendes, erbittertes Wesen riss und rüttelte der Wind an den Brettern des Daches, er pfiff und heulte, er warf Wolken feinen grauen Staubes in alle Fugen hinein und verursachte selbst in dem geschützten Raume auf der Haut ein Prickeln und Brennen, das fast noch mehr Qualen brachte als die behinderte Atmungsfähigkeit.
Der Mönch betete. Über seinem Lager aus duftenden getrockneten Blättern hing an der Steinwand das Bild des Gekreuzigten mit der Dornenkrone und dem gesenkten, ergebenen Dulderblick, zu diesem erhob er das Auge und die gefalteten Hände. „Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen.“
„Fra Urbino betet für uns“, raunte ein kleiner Eseltreiber. „Seht nur, der Himmel wird schon heller.“
„Und das Gewitter lässt nach. Du, Beppo, ob ich ihm von meiner Mira erzähle? Vielleicht geschieht für mich ein Wunder?“
Ein Rippenstoß sprach deutlicher als alle Worte. „Kann man denn auch für einen Esel beten?“
Der kleine Bursche verbarg sein Gesicht in den Händen. Er hatte die schwarzäugige Mira so sehr geliebt, so sehr, sie war mit ihm auf derselben Streu herangewachsen, hatte seine Mahlzeiten geteilt – er die Frucht und sie die Schalen –, sie war seine Spielgefährtin gewesen und doch dabei die Ernährerin des armen Elternhauses – und jetzt?
Nun lag sie tot oder sterbend in der Schlucht, so ganz verlassen, vielleicht vom Durst gequält, blutend und voll Schmerzen. Ach, weshalb durfte man nicht beten für einen Esel?
Und ganz heimlich tat er es doch, ganz verschwiegen, tief im innersten Herzen. „Lieber Gott, schicke Mira einen Engel, der ihr hilft! Lieber heiliger Krispin, mein Schutzpatron, lege du ein gutes Wort für uns beide ein!“
„Da ist die Sonne!“, rief mit lautem Tone Giulio. „Da ist die Sonne! Es wird wieder heller Tag!“
Der Wolkenvorhang zerriss, und der Donner hörte auf zu grollen. Im halben Schimmer des neuerwachenden Tageslichtes schien die aus dem Krater aufsteigende Feuersäule weniger rot und flammend, weniger grauenerregend als vorhin, die Blitze verloren sich, und der Aschenregen hörte allmählich auf, ja, nach einigen Minuten, hatten sich die kleinen Eseltreiber schon vollständig orientiert; man konnte an den Aufbruch denken.
„Hier geht es hinab“, rief Beppo. „In drei Stunden sind wir zu Hause.“
Der Einsiedler zog aus einer Spalte in der Wand ein kleines abgegriffenes Buch hervor. „In dem Vierteljahrhundert, seit ich hier oben lebe, sind zu mir viele schutzbedürftige Menschen gekommen“, sagte er, „alle dürstend und voll Angst und Schrecken wie ihr – die haben sämtlich ihre Namen hierher gesetzt und vielleicht noch ein Wort der Erinnerung außerdem. Wollt ihr ein Gleiches tun?“
„Gebt mir das Buch!“, rief mit seinem übermütigen Tone der junge Giulio. „Ich will den Reigen eröffnen.“
Der Einsiedler schüttelte den Kopf; ein ruhiger, freundlicher, aber doch mahnender Blick traf den Knaben. „Hüte dich, mein Sohn“, sagte der Alte. „Du bist ein kecker Bursche, dem es an Bescheidenheit fehlt. Das kann dir im Leben gefährlich werden.“
Dann reichte er Buch und Stift dem jungen Deutschen. „Beginne du, mein Freund, zugleich für die kleinen Eseltreiber mit, denke ich. Von diesen kann ohne Zweifel kein Einziger schreiben.“
Matthias nahm dankend das Heft, aus dessen Blättern ihm die Namenszüge aller Nationen entgegenschimmerten. Mit fester Hand schrieb er zwei Zeilen hinein und gab dann das kleine Buch zurück.
„Matthias Bergfeld“, las der Geistliche. „Den 3. Juli 1805. – So, ihr andern, jetzt ist es an euch.“
Die Knaben ließen das Buch von Hand zu Hand gehen, als aber einer derselben es dem trotzig und von Purpurröte übergossen dastehenden Giulio reichen wollte, da verschränkte dieser die Arme und schüttelte abwehrend den Kopf.
„Ich danke!“
Der Einsiedler hatte inzwischen alle Vorhänge zurückgezogen und die Öllampe ausgelöscht. „Eilt, dass ihr nach Hause kommt“, sagte er.
Die Mahnung war überflüssig; nach einem kurzen Danke, den außer Giulio alle Knaben aussprachen, verließ die kleine Schar auf dem nächsten Wege die Hütte. Giulio hatte nicht einmal zum Abschied den alten Geistlichen gegrüßt, er hielt die Lippen fest aufeinander gepresst und sah aus, als suche er nur eine Gelegenheit, zu streiten und vielleicht die Kraft seiner Fäuste zu erproben. Das kannten alle, sie wussten, wie rachsüchtig und rücksichtslos er war, und so kam es, dass ihn niemand anredete.
Die Eseltreiber pfiffen und riefen unablässig die Namen ihrer Tiere in alle Himmelsgegenden hinaus, aber keine Stimme antwortete den ihrigen. Möglicherweise hatten die Langohre den Weg in die heimischen Ställe allein gefunden.
Aber dennoch – ein Laut drang aus der Schlucht hervor, gerade da, wo dieselbe in Windungen auf den gebahnten Weg ausmündete.
„I – ah! – I – ah!“
„Das ist Mira!“, jubelte der kleine Treiber. „Mira! Mira!“
Und wirklich hinkte der Graue arg zerschunden langsam herbei; er hatte sich hier und dort verletzt, aber wenigstens lebte er doch noch, und als Kennerblicke seine Wunden untersuchten, da fand sich, dass keine derselben bedenklich war. Mira rieb die Schnauze an der Schulter ihres jugendlichen Gebieters und schien sagen zu wollen: „Ich halte es schon aus, sei nur ganz getrost!“
„Beppo“, flüsterte mit glänzenden Augen der kleine Bursche seinem vertrauten Freunde ins Ohr, „Beppo, ich habe doch für meinen Esel gebetet! Doch! Doch! Und du siehst wohl, wie nützlich das war!“
Giulio näherte sich dem Grauen. „Flink!“, gebot er in herrischem Tone. „Wo ist dein Stock? Ich will reiten.“
Der Treiber deckte schützend beide Arme über den Rücken seines Tieres. „Oh nein, Signor“, rief er in ängstlichem Tone. „Nein, das geht nicht an. Mira blutet, ihr Fuß ist verletzt, sie kann dich nicht tragen.“
„Das kümmert mich nicht. Ich habe dich bezahlt und will reiten.“
„Aber Mira ist ja gar nicht dein Tier, junger Herr! Da hast Cesares Esel gemietet, nicht den meinigen.“
„Das ist wahr!“, riefen zahlreiche Stimmen zugleich. „Das ist wahr!“
Giulio biss sich auf die Lippen. „Nun gut!“, rief er. Nun gut – wem gehört denn für heute dein Tier, Bursche?“
„Dem deutschen Herrn, Signor Giulio!“
Der Knabe lachte spöttisch, obgleich ihm der Ärger das Blut ins Gesicht trieb. Schon wieder stand ihm Matthias im Wege.
„Dem deutschen Herrn?“, wiederholte er mit scharfer Betonung. „Das verstehe ich nicht. Matthias und sein Vater sind Signor Ferratis Knechte, weiter nichts.“
Diesen Worten folgte eine Pause. Vielleicht hatte Giulio eine zornige Entgegnung erwartet und ärgerte sich jetzt um so mehr, je gelassener sein Gegner die Beleidigung aufnahm. Er konnte den Zank, welchen er herbeiführen wollte, nicht erreichen, Matthias blieb stumm.
„Du!“, rief er endlich in ungeduldigem, herrischem Tone, „Du! Wenn denn der Esel wirklich dein Reittier ist, so leihe ihn mir. Ich bin ermüdet.“
Matthias wandte den Kopf. „Sprichst du mit mir, Giulio?“
„Natürlich. Mit wem sonst?“
„Dann tut es mir leid, deine Bitte abschlagen zu müssen. Der Esel kann ja kaum sein eigenes Gewicht tragen.“
„Ach und da fürchtest du, ihm eine Arbeit zuzumuten, nicht wahr?“
„Ja. Ein hinkendes Tier zu besteigen, einen Rücken, von dem die Haut in Fetzen herabhängt, das wäre Tierquälerei!“
„Ha! Ha! Ha! – Bettler!“
„Was sagst du da?“
Mit geballten Fäusten wandte er sich zu seinem Beleidiger. „Was sagtest du eben, Giulio?“
„Ich nannte dich einen Bettler! Dich und deinen Vater, der überall Schulden hat, der –“
Weiter kam er nicht! Matthias hatte sich urplötzlich auf ihn gestürzt und ihn zu Boden geworfen, ehe noch irgendein Widerstand möglich gewesen war. Einige klatschende Ohrfeigen, dann zog Matthias aus der Tasche eine Handvoll kleiner Münzen hervor und schleuderte diese Giulio vor die Füße.
„Da hast du das mir vorhin geliehene Geld! Ich dachte es dir in anderer, freundlicherer Form zurückzugeben, aber du selbst bist es, der mich daran hindert.“
Giulio hatte sich ziemlich mühsam erhoben. Schon von der Schulbank her wusste er, dass seine Kräfte denen des Deutschen nicht gewachsen waren, aber eben aus diesem Grunde hasste er ihn und suchte beständig Reibungen, denen sich Matthias, solange es anging, schweigend zu entziehen verstand, bis dann bei Gelegenheiten wie diese seinen Langmut endlich riss und statt des Wortes die geballte Faust den Streit schlichtete.
„Hier stehe ich“, sagte mit blitzendem Blick Matthias. „Willst du dir Genugtuung verschaffen, so komm nur her – ich bin bereit.“
Giulio wandte sich ab. Er murmelte etwas, das keiner der Knaben verstand; die Centesimi, welche ihm sein Feind zugeworfen, ließ er unbeachtet in der Asche liegen, kümmerte sich auch um den Esel nicht mehr, sondern strebte allen voran dem Städtchen zu.
Die Übrigen flüsterten, und auf Giulios Kosten ging durch ihre Reihen ein leises, frohlockendes Lachen. „Das hast du ihm gut gegeben, Matthias. So muss es der Großsprecher haben.“
„Nun noch eine Viertelstunde“, rief einer, „dann sind wir zu Hause.“
Die Luft war jetzt vollkommen ruhig, die Sonne wie von einem leichten Dunst verschleiert. Überall auf den Weinbergen lag Asche, kein lebendes Wesen zeigte sich unter den sonderbar aussehenden Reben, wohl aber läuteten im Städtchen die Kirchenglocken, und von rechts und links eilten erschreckte, geängstigte Menschen zur heiligen Stätte, um den Schutz des Himmels zu erflehen.
Hie und da sprang einer aus der kleinen Schar mit schnellem Gruße davon, um auf einem Seitenpfade zwischen den Gärten das Elternhaus desto früher zu erreichen, auch Giulio hatte sich längst entfernt, und zwar indem er statt jedes sonstigen Abschiedes die Faust gegen den jungen Deutschen drohend erhob.
„Zwischen uns kommt die Abrechnung!“, hatte er gesagt und war verschwunden, ehe Matthias antworten konnte.
Beinahe als der Letzte erreichte dieser das Elternhaus. Auf den Straßen bewegten sich Leute, die ihr Hab und Gut schleunigst auf Wagen und Karren packten, um die gefährdete Gegend zu verlassen, während wieder andere leichte Leinwandzelte aufschlugen und mit ihren Familien dahin übersiedelten.
„Die Lava fließt nicht hierher“, behaupteten einige. „Es ist nur des Erdbebens wegen, wenn wir Zelte aufschlagen.“
Und dann erhoben sich andere Stimmen. „Das Erdbeben kann euch auch in Neapel und an allen sonstigen Orten erreichen.“
Dazwischen eilten die Ängstlichen zu den Kapellen, beteten Leute auf offener Straße, weinten Frauen überall. Matthias schlüpfte so schnell er konnte hindurch und stand mit wenigen Sprüngen im Wohnzimmer seines Elternhauses.
„Vater!“, rief er, „Mutter! Ihr seid doch nicht meinetwegen in Sorge gewesen?“
Ein Jubelschrei der Geschwister begrüßte ihn, die Mutter streckte ihm beide Hände entgegen. „Matthias, wie konntest du dich bei solchem Wetter vom Hause entfernen? Oh, wie haben wir alle uns geängstigt?“
Matthias hatte Mühe, sie einigermaßen zu beruhigen; als dann auch der Vater hinzukam, erzählte er beiden, was geschehen war, und erreichte auf die erste Bitte hin ihre Verzeihung. Signor Ferrati hatte schon zwei Boten geschickt, um sich zu erkundigen, ob auch alle seine Trauben von den Stöcken genommen seien. Er wollte vor Abend noch selbst kommen, um die Dinge in Augenschein zu nehmen.
„Solch ein geiziger Mann!“, seufzte Frau Bergfeld. „Er denkt nur an das Eigene, an den leidigen Gewinn; seine Mitmenschen sind ihm nicht der geringsten Rücksicht wert.“
„Vorhin war Signora Teresina, seine Gemahlin hier“, schaltete der Vater ein. „Sie hatte mehrere Diener bei sich, die den armen Leuten große Leinwandballen für Zelte überbringen sollten, aber ehe das noch geschehen konnte, kam schon der Schreiber des Gebieters nachgerannt und verbot in dessen Namen das Geschenk.
,Die Leute könnten ja in dem milden Klima sehr wohl einmal einige Nächte unter freiem Himmel schlafen‘, hatte er gesagt.“
„Der Schändliche!“, rief Matthias.
Bergfeld seufzte. „Komm, mein Junge, hilf mir – es ist noch so vieles zu tun, bis der ungeduldige Mann hierher kommt.“
Matthias hatte draußen Berge von Trauben gesehen, die alle noch der säubernden Hand notwendig bedurften, er wusste auch, dass viele Taglöhner schon jetzt flüchtig geworden waren und dass daher seinem Vater fast alle Arbeit allein oblag. Ohne Pause schafften beide, der Alte und der Sohn, rüstig fort, während rechts und links die Leute nur an ihre persönliche Sicherheit dachten. Aus dem Krater stieg immer noch die lodernde Feuersäule hoch in die drückend stille Luft empor, gewaltige Rauchwolken wirbelten nach, und ganze Funkenschauer verbreiteten sich weithin über den Berg. Aber trotz aller dieser beängstigenden Erscheinungen war es in der Natur vollkommen still, selbst die Tiere schwiegen und hielten sich in ihren Schlupfwinkeln versteckt. Man sah keinen Vogel, kein Insekt, man hörte ringsum keinen Laut, weder von den Zikaden in der Luft noch von den zahllosen Hühnern, die überall bei jedem Bauern gehalten wurden.
Gegen Abend kam Signor Ferrati und musterte seine Gärten; er ging von Weinstock zu Weinstock, um überall selbst mit geizigen Blicken zum Rechten zu sehen. „Die Leute sind fast alle geflüchtet“, sagte er im höhnischen Tone. „Es wird kein Einziger wieder in Arbeit genommen, Aufseher!“
Bergfeld griff an die Mütze. „Sehr wohl, Herr.“
Der Italiener musterte das blasse, kummervolle Gesicht seines Schuldners. „Gedenken Sie auch von hier fortzugehen, Aufseher?“
„Mir fehlen die Mittel, Herr. Ich kann es nicht.“
Ferrati zuckte die Achseln. „Nach Belieben“, antwortete er. „Nur dürfen Sie kein Stück Ihres Besitztums mitnehmen. Das alles ist mein, bis Sie Ihre Verpflichtungen mir gegenüber getilgt haben.“
„Ich weiß es, Herr.“
„Gut, gut, das vereinfacht die Sache. Sie würden von keinem anderen Manne so weitgehende Schonung erfahren haben wie gerade von mir, denken Sie daran wohl zuweilen? Ich gebe Ihnen und den Ihrigen Brot, obwohl ich einfach Ihre fahrende Habe mit Beschlag belegen und Ihnen die Tür zeigen könnte. Jetzt ist es Zeit, sich für diese Großmut dankbar zu erweisen.“
Bergfeld blieb die Antwort schuldig, und der Italiener entfernte sich langsamen Schrittes, indem er an jedes Fass nochmals herantrat und alle Einzelheiten prüfend überblickte.
Bergfeld sah ihm kopfschüttelnd nach. „Hast du es gehört, Matthias? Von den Tagelöhnern wird keiner wieder eingestellt. Wenn die armen Leute in ihre Häuser zurückkehren wollen, treibt sie der Büttel von der Schwelle.“
„Nachbar!“, sagte in diesem Augenblick ein Mann mit unruhiger Stimme, „seht doch einmal hierher. Die unheimlichen Zeichen mehren sich.“
Er deutete auf den Ziehbrunnen neben dem Hause, und als die beiden Deutschen näher traten, leuchtete er mit einer brennenden Laterne tief hinein. „Alles leer, Nachbar! Alles leer. Wo ist das Wasser geblieben?“
„Und sonst war der Brunnen oft bis an den Rand gefüllt!“
„Ja, ja. Nun ist alles in die Erde versunken.“
„Lasst uns doch nach unserem eigenen Brunnen sehen“, rief Matthias. „Vor einer Stunde habe ich noch Wasser geschöpft.“
Er eilte fort, um dann sogleich wieder zurückzukehren. „Alles verschwunden!“
Und so ging es mit sämtlichen Brunnen des Ortes. Bis auf den letzten Tropfen hatte sich das Wasser verloren.
„Wir sind noch nicht zu Ende“, meinte jemand. „Das Schlimmste kommt erst.“
„Eigentlich sollte man beizeiten fliehen, sollte an einer so gefährlichen Stelle gar nicht wohnen – aber das Geld, das leidige Geld!“
„Lasst nur womöglich den Frauen nichts merken. Vielleicht kommt auch das Wasser zurück.“
„Morgen kann schon alles wieder im gewohnten Geleise gehen.“
Das Letztere glaubte im Grunde niemand, aber was half es, den schlimmsten Befürchtungen Worte zu leihen; die bange Ungewissheit der Lage wurde dadurch nicht vermindert, sondern eher noch erhöht.
Die erste Hälfte der Nacht verging ohne Störung. Vielleicht schlief kein Mensch, aber es war doch auf den Straßen ruhig und still, bis sich gegen Morgen, als eben die Sonne aufging, zuerst ein vereinzeltes Rufen und Laufen, dann ein immer stärker werdendes Durcheinander von Stimmen bemerkbar machte. „Seht doch!“, riefen die Leute. „Seht doch!“
„Oh wie schön, wie prachtvoll!“
Gott erbarme sich! Etwas so Grauenhaftes sollte schön sein!“
„Ruhig doch, Kinder, seid vernünftig! Diese Erscheinung kann uns ja gar keine Gefahr bringen.“
Was mochte nur das neue Schrecknis sein?
Matthias erhob sich geräuschlos vom Lager, schlüpfte in seine Kleider und spähte hinüber zur Kammer, in welcher die Eltern schliefen. Bergfeld hatte sich halb aufgerichtet, er strich mit der Hand über die Stirn.
„Was gibt es, Matthias?“
„Ich will gleich nachsehen, Vater.“
„Aber wecke deine Mutter nicht auf, hörst du, Junge? Sie hat erst ganz vor Kurzem die Augen ein wenig geschlossen.“
Der Junge nickte stumm und schlich sich dann auf den Zehenspitzen hinaus. Draußen sahen alle Leute zum Vesuv empor, die einen voll Angst, die anderen versunken in einen Anblick, wie er allerdings nicht schöner und großartiger gedacht werden konnte.
An mehreren Stellen brachen aus dem Abhang des Berges hohe breite Ströme von siedendem Wasser hervor und wurden durch die Macht des nachtreibenden Druckes als vielfach gewundene Säulen hoch in die Luft hinauf geschleudert, oben zerplatzend und in den Strahlen der Morgensonne zu Millionen Tropfen zerstäubend.
Es schillerte in allen Regenbogenfarben, glühte und glänzte wie Diamanten, hoch von der flammenden Feuersäule überragt, von dem wallenden Rauch wie von einer Kuppel überdacht. Es rieselte herab gleich Funken im Fall, hier rot und dort grün, dann wieder tiefblau und violett. Als brenne der ganze Gipfel des Berges, so blendete die Pracht dieses Schauspiels.
Auch Matthias stand wie betäubt. Dergleichen hatte er nie gesehen.
„Und wenn nun neue Schlünde sich auftun“, sagte jemand. „Wenn unsere Häuser von dem kochenden Meerwasser überflutet werden?“
„Ach, das ist ja undenkbar.“
Der Sprechende hatte noch nicht geendet, als ein Laut wie das Rollen eines Lastwagens dumpf dröhnend erklang. Zugleich hob und senkte sich unter den Füßen der entsetzten Menschen die Erde in wellenförmigen Bewegungen, vornüber und zur Seite neigten die Häuser ihre Giebel, Bäume stürzten wie geknickte Halme, dann ein Krachen, ein Aufschrei von hundert Stimmen zugleich – und die Steinbauten sanken in sich zusammen, unter ihren zerschellten und zersplitterten Trümmern alle diejenigen, welche sich darin befanden, lebendig begrabend.
Eine Wolke von Kalkstaub wirbelte auf, Steine fielen hierhin und dorthin, Balken standen mitten auseinandergebrochen gen Himmel, Fensterscheiben stürzten klirrend zu Boden – hie und da flatterten Hühner oder Tauben mit geknickten Flügeln und Blutstropfen an den Federn schreiend auf, um dann sogleich schwerfällig wieder zurückzusinken, Geschrei und Rufen ertönte, es war eine Szene unbeschreiblicher Verwirrung.
Matthias raffte sich vom Boden auf, er taumelte gleich einem Betrunkenen. Da vor ihm der bis zur Unkenntlichkeit veränderte Trümmerhaufen, das war sein Vaterhaus, und inmitten der zerbrochenen Balken der auseinandergerissenen Mauern befanden sich die Eltern und Geschwister, alle, alle, die er auf Erden liebte.
Es war ihm, als stocke sein Herzschlag, als werde ihm die Kehle zusammengeschnürt. „Vater!“, rief er. „Mutter! Mutter! Lebt ihr denn nicht mehr?“