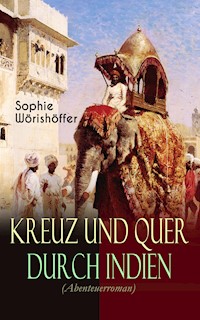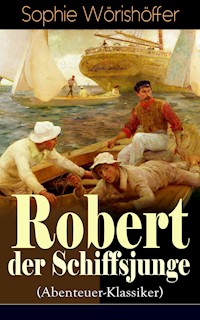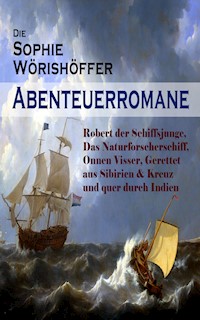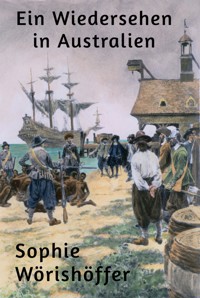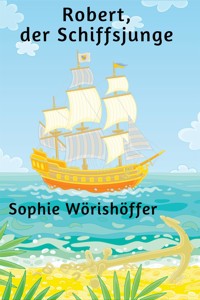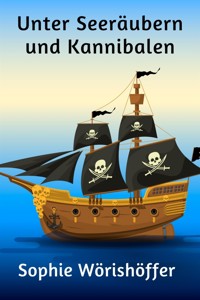3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hugo ist fünfzehn und will Kapitän werden. Erst einmal fährt er als Schiffsjunge um die halbe Welt, übersteht mehrere Schiffskatastrophen, einen Piratenüberfall und viele Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Lied vom braven Mann
Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEin Kleinkind überlebt
„Auf du und du, Kapitän, wenn ich auch den Jahren nach Ihr Sohn sein könnte?“
Der stramme, alte Seemann mit den klaren, blauen Augen und der breiten, herkulischen Brust hob langsam das Grogglas. „Auf du und du“, wiederholte er lächelnd. „Bin mit deinem Vater zugleich als Schiffsjunge auf der ‚Seemöwe‘ in den Dienst getreten, hab manchen tollen Tag mit ihm verlebt unter allerlei fremdem Volk – dergleichen bleibt unvergessen, Geerd Pfeiffer, wenn auch die Haare seitdem grau wurden. Prosit, möge deine erste Reise als Kapitän vom Glück begünstigt sein!“
Die Gläser klangen aneinander, und bedächtig leerten alle Teilnehmer des kleinen Kreises den Inhalt bis zum Grunde. In die Fenster der Dorfschenke lugten abendliche Sonnenstrahlen über das weite, offene Meer. Möwen spielten flatternd und schreiend um die steil abfallenden Dünen, und von mehr als nur einer Fischerbarke herüber klang während der Vorbereitungen zur Fahrt ein lustiges Singen. Der junge Kapitän zündete sich eine frische Zigarre an; sein offenes, männliches Gesicht war um einen Schatten ernster geworden.
„Die ‚Seemöwe‘ zerschellte vor Kap Hoorn, und mein Vater blieb mit Schiff und Mannschaft an der Küste von Schottland“, sagte er halb seufzend. „Du hast es glücklicher getroffen, Rolf Böge, du lebst in deinem eigenen behaglichen Hause und bekleidest den ehrenvollen Posten eines Vormannes der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger! Später sollst du mir die Rettungsgeräte noch zeigen, Alter, jetzt lass uns von deinem Sohne sprechen. Er ist ein frischer, kecker Bursche, der Schlingel, ich mag ihn gern leiden, du gibst ihn mir also mit auf die Fahrt?“
Der ältere Kapitän nickte. „Gewiss gebe ich ihn dir, Pfeiffer, und du sollst mir den Jungen nicht verziehen, das sage ich gleich vorweg.“
„Der Junge ist zum Seemann geboren“, rief einer von den Anwesenden. „Im vorigen Herbst strandete hier auf dem Außenriff eine Bark, da hättet ihr ihn sehen sollen, er war es, der die Meldung brachte und der dann als der Erste die Rettungsanstalten betrieb. Von den Spannhaltern hat er die Pferde herbeigeholt und selbst wie ein Mann in der Brandung gestanden, sooft das Boot hindurch musste. Seine erste Prämie besitzt er schon, der Hugo.“
Die Augen des Kapitäns leuchteten. „Er soll, gefällt’s Gott, einmal sein eigenes Schiff fahren, der Junge“, sagte er, „und soll dann, wenn ich längst für immer abgelöst bin, meine Stelle als Stationsvormann der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit Ehren verwalten. Ist es ihm bestimmt, in diesem Dienst den Tod zu finden, dann stirbt er wie der Soldat auf dem Schlachtfelde – ein besseres Los gibt es nicht.“
„Aber jetzt“, rief Pfeiffer, „ist es an der Zeit, von der Angelegenheit, die mich hierher geführt, zu sprechen, Kapitän Böge! Du willst mir also für die Fahrt um den halben Erdball deinen Jungen als Printer mitgeben? Nun, dann muss ich seine Legitimationspapiere und desgleichen deine väterliche Einwilligung schwarz auf weiß dem Wasserschout vorlegen, wie du weißt. Meine alte Mutter lebt hier im Dorfe, deshalb kam ich und kann die Sachen also selbst mitnehmen.“
Böge nickte. „Kannst du, Mann“, versetzte er, „kannst du – soweit ich nämlich imstande bin, dir zu dienen.“
Der junge Kapitän sah auf. „Hallo!“, sagte er. „Was bedeutet das?“
Eine Pause folgte diesen Worten, dann strich der alte Seemann langsam durch sein kurzgeschorenes, graues Haar. „Das bedeutet viel oder auch wenig, wie du es nehmen willst, Geerd Pfeiffer!“, antwortete er. „Hugo ist wohl dem Herzen nach mein Sohn, aber weiter nichts. Wo einstmals seine Wiege stand und wer seine Eltern gewesen sind, das weiß nur Gott allein.“
„Ach! – Und wer hat ihn dir anvertraut, Rolf Böge?“
Der Kapitän deutete mit der Pfeifenspitze hinaus auf das ruhig daliegende Meer. „Die dort“, sagte er, „die Wellen, das weite, wilde Wasser. Ich hab den Jungen herausgefischt, hab ihn dem Tode abgetrotzt und ihm eines ehrlichen Mannes Namen geschenkt, das ist alles, was ich weiß.“
„So, so! Es war also bei einem Schiffbruche an diesen Küsten?“
„Ja. Als vor reichlich zwölf Jahren das Bremer Auswandererschiff ‚Leonore‘ hier in einer Novembernacht auf die Dünen geworfen wurde. Es hatte mehr als dreihundert Passagiere an Bord – nur zehn sind gerettet worden, darunter mein Junge.“
„Eine grauenhafte Nacht!“, bestätigte ein anderer „Wir selbst verloren vier Mann.“
Der junge Kapitän ließ abermals die Gläser füllen. „Erzählt mir ein wenig, Leute!“, bat er. „Ich war damals in Ostindien, habe von der Sache gerüchtweise gehört. Wurde denn das Schiff ganz zerschlagen?“
„Ganz und gar. Wir haben wenigstens zehn Wagenladungen voll Trümmer geborgen, haben noch wochenlang die antreibenden Leichen aufgefischt und begraben.“
„Erzählt, erzählt! – Es war also in einer Novembernacht?“
Kapitän Böge legte beide Arme auf den Tisch und stützte mit der Rechten die kurze Seemannspfeife. „Ich bin an dreißig Jahre gefahren“, sagte er, „habe Sturm und Bedrängnis aller Art auf dem Meer und zu Lande erlebt, aber an diesen Tag, oder besser diese Nacht, werde ich denken, solange meine Augen offen stehen! Drei eigene Jungen hatte mir und meiner Alten der liebe Himmel geschenkt“, fuhr er nach einer kurzen Pause fort, „und alle drei wieder zu sich genommen. Der Letzte ward an jenem stürmischen Novembertage begraben, es regnete und hagelte abwechselnd, der Wind pfiff über das Meer, als wollte er es auf die Küsten peitschen, es war draußen alles nur eine einzige graue, undurchdringliche Masse. Luft und Wasser flossen zusammen, der Nebel hockte auf den Dünen wie ein Gebirge auf dem anderen, sehen konnte man fast gar nichts.
Meine Alte weinte immer so vor sich hin, sie dachte an den kleinen Burschen, der noch vor wenigen Tagen ihr Stolz, ihr ganzes Glück gewesen war, und der nun in dem Unwetter draußen lag, eiskalt in der kühlen Erde. Es war ganz still bei uns, nur der Sturm brüllte ums Haus und rüttelte an den Fensterläden wie mit Menschenhänden – sage euch, Kameraden, es ist mir an dem schlimmen Abend immer so gewesen, als müsse noch etwas Unerwartetes, etwas recht Böses geschehen, ich horchte fortwährend, ich stand bald vor der Hoftür, bald auf der Straße, und jeden Augenblick schlugen verworrene Laute an mein Ohr, jeden Augenblick glaubte ich Stimmen zu hören, die meinen Namen riefen.
Die Frau hielt das Gesangsbuch auf dem Schoß, aber sie konnte vor Tränen nicht lesen; ich sah so müßig, unruhig und bekümmert vor mich hin, da fiel plötzlich ein Kanonenschuss, der Schall kam von Wasser herüber und war gar nicht zu verkennen.
‚Jesus‘, rief ich, ‚ein Schiff in Not!‘
Noch ein Schuss, ein dritter, vierter. Ich hatte im Fluge den schweren Rock abgeworfen und die Pfeife in den Winkel geschleudert. Die Frau stand mit erhobenen Händen, zitternd vor Aufregung, mitten im Zimmer.
‚Rolf!‘, rief sie. ‚Rolf, soll ich dich auch verlieren?‘
‚Soll der Stationsvormann zu Hause bleiben, wenn die Leute ausrücken, Mutter? Soll dein Mann – Rolf Böge – hinterm Ofen sitzen, wenn brave Seeleute mit dem Tode ringen?‘
Draußen klopfte es schon. Die Fischer standen Mann für Mann im Toben des Wetters und erwarteten ihren Anführer, die Spannhalter kamen mit den Pferden, nach wenigen Minuten konnten wir den Raketenapparat und die beiden Rettungsboote dem Strande zuführen, dann begann die schwere, beinahe alle Kräfte übersteigende Arbeit.
Nebel auf dem Wasser, Nebel am Ufer – ich habe nie wieder solche Nacht erlebt. Alle Elemente hatten sich gegen die unglückliche Besatzung der ‚Leonore‘ verschworen, uns graute, sooft wir die Notschüsse hörten.
Ich lief dem Wagen voran mit dem Handgewehr über der Schulter, und sobald nur der Strand erreicht war, schoss ich ein Bukett roter Leuchtkugeln in die Luft, um zunächst den Unglücklichen auf dem Schiffe einen Trost zu bringen. Ich sah beim Glanze der roten Kugeln das Schiff, es hatte die Masten schon verloren, Kombüse und Kajüte waren über Bord gespült, aber an allen Wänden, an der Treppe und den Bolzen der großen Wasserfässer hingen menschliche Gestalten, festgeklammert in Todesangst, das Furchtbarste mit jedem Augenblick erwartend, und wenn nicht von uns, von den Wächtern des deutschen Strandes, die schnelle Hilfe kam – unrettbar verloren.
Meine Leuchtkugeln stiegen immerfort. Wie man dem Ertrinkenden laut und fröhlich zuruft, dass er gerettet sei, so erhält man die Lebens- und Geistestätigkeit der Verzweifelten durch die Zeichen naher Freundeshilfe. Lustig stiegen die roten und blauen Lichter in den Nebel empor, von Schiff herüber kam die Antwort, wenn auch nur durch eine Kugel. Die armen Schelme mochten auf dem Wrack keinen festen Fuß mehr fassen können, sie hatten die Besinnung wohl schon mehr als halb verloren.
Das unglückliche Schiff stampfte und wurde so langsam, auf der Seite liegend, der Brandung am äußeren Riff entgegengetrieben.
Ich beobachtete scharf – von Minute zu Minute sahen meine Augen auf dem Deck immer weniger lebende Wesen, immer weniger. Die Wogen hatten sie losgerissen, weggespült, hineingejagt in den Tod da unten.
Einer der Matrosen nahm nun das Handgewehr und besorgte die Leuchtkugeln, ich wollte selbst die Ankerrakete hinausschießen, um das Boot vom Lande abzubringen, denn die Seen folgten einander bei der Wut des Sturmes so schnell, dass unser Fahrzeug quer geworfen und umgeschlagen worden wäre. Der Schuss fiel, wir zogen an – gottlob, der vierhändige Anker hatte gefasst, nun galt es, mit der alten ‚Hohenzollern‘, unserem guten Boote, durch die Brandung zu kommen. Hei, wie es stieg, wie die brüllenden Wogen unter seinem flachen Kiel zerrinnen mussten – noch ein paar Hundert Schritt, und es konnte vom Wrack die erste lebende Ladung einnehmen. Die vordersten vier Mann zogen an der Winde, mein Vetter Frahm und ich standen am Ruder, die anderen legten sich mit all ihren Kräften in die Riemen. Vom Lande her folgten Lichter auf Lichter, ich sah die Rakete mit dem Jölltau über das Wrack hinfliegen, aber keine Hand packte den Läufer, kein Blaufeuer gab Kunde, dass die Verbindung mit dem Ufer hergestellt sei – die armen Menschen konnten, vor Kälte erstarrt, auf dem schräg liegenden Deck nicht mehr stehen, nichts mehr denken oder unternehmen.
Noch eine Rakete flog – das Jölltau streifte die Schiffswände, niemand nahm Notiz von der nahen Aussicht auf Rettung. Meine Kameraden am Lande schossen nun natürlich keine Raketen mehr in die Nacht hinaus, sondern holten, da sie beim Schein der Leuchtkugeln alles überblicken konnten, die beiden Läufer selbst wieder an und ließen den Raketenapparat in den Schuppen bringen. Er nützte uns hier nichts mehr, wir mussten uns ganz allein auf die Boote verlassen.
Inzwischen war das Deck leer geworden; von allen denen, die ursprünglich auf ihm lagen oder hockten, zeigte sich kein Einziger mehr, wohl aber schlug, je näher wir herankamen, immer deutlicher an unsere Ohren ein schauerlicher Ton – drinnen im verschlossenen Raume des Schiffes, halb unter Wasser, wurde geklopft.
Sie hatten bei Beginn des schlechten Wetters, wie üblich, alle Passagiere vom Deck in die Kajüten verwiesen, die Luken geschlossen und dann gekämpft, bis einer nach dem anderen erlag. Mehr als dreihundert Menschen waren sozusagen lebendig begraben.“
Kapitän Pfeiffer schauderte. „Grässlich!“, rief er.
„Ja – grässlich war es. Unser Anker tat seine Schuldigkeit, wir kamen an das Schiff, aber unter Luvseite, und so wurde natürlich der Kampf desto schwerer. Frahm und ich kletterten an Deck und suchten nun zuerst nach Signalgeräten. Alles schwamm, alles trieb und triefte, da gab es keinen Verschluss, keinen Blechkasten, keine Laterne – nur eine nasse, verödete Fläche zeigte sich unseren Blicken, aber überall unter Deck klopfte es und rief und schrie – sage euch, Kameraden, es läuft mir jetzt noch kalt über den Rücken, sooft ich daran denke.
Frahm hatte sich aus unserem Boote das Beil reichen lassen. ‚Wir müssen es wagen, Vormann‘, sagte er, ‚die Zeit drängt.‘
Ich wusste es wohl, aber das Herz klopfte mir unbändig. ‚Die Eingesperrten da unten quellen heraus wie das Wasser aus einer Schleuse‘, rief ich. ‚Wie sollen wir den Strom eindämmen?‘
Er schüttelte den Kopf. ‚Es muss doch geschehen, Vormann!‘
Und so sprengte ich denn in Gottes Namen mit einem wuchtigen Hiebe das Schloss der mittleren Luke. Ein Schrei aus Hunderten von Kehlen antwortete ihrem Aufspringen – nie werde ich vergessen, was jetzt meine Augen sahen.
Sie stürzten die Treppe herauf, sie schrien, schluchzten und jauchzten durcheinander, einige lachten sogar wie die Wahnsinnigen, einige sangen geistliche Lieder, andere fielen uns um den Hals oder zu Füßen.
Immer mehr und immer mehr – der Strom nahm kein Ende. Männer und Frauen, Greise Kinder von jedem Alter, Bauern mit Lebensmitteln und Lieblingstieren unter den Armen, alte Damen, die vergebens nach fester Stütze suchten, weinende Mädchen, Mütter mit Säuglingen, ein Geistlicher – alles durcheinander, alles drängend und hastend, als sei auf dem schrägen, nassen Deck die Rettung gewiss, als warte nicht mit hundert gierigen Krallen gerade hier der schrecklichste Tod, um seine Opfer zu packen.
Kopf nach Kopf, Körper nach Körper. Die nasse Flut drang von oben in den Raum, der Sturm heulte, das Schiff knarrte und schwankte, immer näher und näher kam es dem Außenriff, immer höher und höher stieg die Gefahr.
Vom Lande her erschien ein zweites Boot, das Durcheinander auf dem Deck wurde schrecklich. Frahm und ich hatten gleich anfangs versucht, die Leute zur Ordnung zu rufen, ein bestimmtes Kommando aufzustellen, aber das war verlorene Mühe, sie hörten nichts, kümmerten sich um nichts, sondern stürzten blindlings vorwärts, die meisten geradewegs in das Wasser hinein, ohne dass wir ihnen hätten helfen können.
Dieses Schreien, dieses Ächzen, diese lauten, verzweifelten Gebete – oh, es war schrecklich! Eltern sahen ihre kleinen Kinder in das Meer stürzen, wer eben noch gejubelt hatte, der fiel jetzt der Verzweiflung anheim – ich kann es nicht schildern, wie viel Grauen diese Stunde in ihrem Schoß barg.
Wir haben es nicht ändern können, Frahm und ich, wir standen mit den erhobenen Beilen vor den offenen Luke und drohten jeden zu erschlagen, der sich unserem Kommando widersetzen würde, aber die Leute hörten es nicht einmal. Sie hatten sechs oder acht Stunden da unten in Todesangst und Dunkelheit eingesperrt gesessen, ihre Besonnenheit war dahin. So oder so – das Verderben musste seinen Gang gehen.
Unser zweites Boot kam heran“, fuhr er fort, „als alles zu Ende war. In den Ecken und Winkeln, halbbetäubt oder gar völlig bewusstlos, kauerten noch einige Personen, zusammen zehn, die brachten wir glücklich an Land. Frahm und ich durchsuchten das Innere des Schiffes, wir klopften an alle Türen und riefen mit lauter Stimme, aber es schien kein Mensch mehr da zu sein, und so kletterten wir denn in unser Fahrzeug hinab.
Jetzt galt es, aus der gefährlichen Nähe des Wracks so schnell wie möglich fortzukommen. Die ersten Brandungswellen sprangen schon über Deck, in den nächsten Minuten musste das Schiff zwischen den Riffen eingekeilt festliegen und dann dem unvermeidlichen Zerschelltwerden mit schnellen Schritten entgegengehen. Wir stießen ab.
‚Höchste Zeit!‘, sagte Frahm. ‚Wie das Wasser tobt!‘
Wirklich warf sich die Brandung gleich einem lebendigen, wutschäumenden Ungeheuer über das Schiff dahin. Die Luken hatten wir wieder geschlossen, aber dennoch riss jeder Stoß schon Splitter und ganze Planken von dem mastlosen, halbzerstörten Rumpfe ab. Die anderen waren weit voraus, wir setzten die Riemen ein, um ihnen zu folgen, da war es mir plötzlich, als hörte ich wieder das rastlose Klopfen von vorhin. Einmal, zweimal!
Ja, es konnte nicht anders sein, dort im Innern des dunkeln Schiffskörpers, in dem großen, von Wasser überspülten Sarge, waren noch lebende, atmende Menschen! Uns erstarrte das Blut in den Adern. Lebendig begraben!
Ich horchte. Eine einzige Hand klopfte, eine schwache, kleine Hand – vielleicht die eines unschuldigen Kindes.
‚Frahm‘, sagte ich, ‚wir müssen umkehren.‘
‚Das geht nicht, Vormann! Du weißt es selbst. Keiner von uns kommt mit dem Leben davon.‘
‚Aber ich muss, ich will es unter allen Umständen. Bindet mir einen Läufer an den Rettungsring und passt gut auf. Licht genug habt ihr ja vom Lande her!‘
Das alles war schnell geschehen, meine Überkleider warf ich ab und stürzte mich in die Flut – das Boot konnte nicht heran –, und ich hatte auch bald das Wrack erreicht. Aber jetzt galt es, festen Fuß zu fassen, und da –“
„Lass mich erzählen, Vormann!“, rief der alte Frahm. „Du hast ein Seemannstück vollführt, das dir so leicht kein anderer nachmacht! Die Wellen schlugen mannshoch über Deck, aber sie hielten kleine, regelmäßige Pausen, und eine solche musste Rolf Böge benutzen, um die Luke zu öffnen und hinter sich wieder zu schließen. Auf den Knien liegend, die Hände fest um die Eisenbolzen der Wasserfässer geschlungen, den Kopf nach unten gedrückt, so hielt er der heranstürmenden Welle mutig stand. Wir glaubten ihn verloren, aber als sich das Wasser verlief, stand Rolf Böge aufgerichtet vor der Luke und hielt das Beil in der Hand. Ihm blieb vielleicht eine Minute oder noch weniger; wenn er nicht während dieser kurzen Zeit die Planken geöffnet und hinter sich wieder geschlossen hatte, dann war jede Hoffnung dahin.“
Der Erzähler hatte sich in seiner Erregung von Sitz erhoben, er schwenkte die verräucherte alte Pfeife.
„Ick seh em ümmer noch“, sagte er, unwillkürlich in die plattdeutsche Mundart verfallend, „ick seh em ümmer noch, sin ganz Gesicht wör kritwit. Herrgott im Leben, seg he, hör mi an, ick roop di! – Du hest versproken, nu holl Woord! – Un do mit eens, wör he weg, rin int Schipp! – So, Vörmann, nu kannst sülbst wedder anfangen, spinn dat Gaarn man uf!“
„Es gelang mir also, zwischen zwei Seen in das Innere des Schiffskörpers zu kommen. Dort durfte ich mir immerhin ein paar Minuten Zeit lassen; während die Brandungswellen über das Deck dahin donnerten und bei jeder einzelnen ein Sprühregen in den Raum hinabstürzte, drang ich bis zur Damenkajüte vor und öffnete hier eine Tür, hinter welcher, von einer Hängelampe schwach beleuchtet, eine junge zarte Frau auf den Knien lag und einen dreijährigen Knaben mit beiden Armen umschlossen hielt. Sie sprach kein Wort, die Todesangst mochte ihre Denkfähigkeit, ihr Bewusstsein schon halb zerstört haben – sie sah mich nur an und zitterte am ganzen Körper.
Viele Komplimente kann man in einer solchen Lage nicht machen, ein alter Seebär, wie ich, versteht sich ohnehin nicht darauf, na, und so nahm ich denn die beiden, Mutter und Kind, auf meine Arme, sagte nur: ‚Halten Sie den Jungen, Madame!‘ und kletterte dann in Gottes Namen die Treppe hinauf. Das Poltern der Brandung ging eben über Deck, ein Wasserstrahl traf uns auf die Köpfe, das Kind schrie laut, ich stemmte meine Schultern gegen die Luke und stand draußen, alles binnen Sekunden. Jetzt ins Wasser zu gelangen, war kein Kunststück denn das schräge Deck lag nur noch ein paar Fuß über dem Meer, und den Läufer wusste ich sicher befestigt am Rettungsring – sie holten mit allen Händen an, sobald sie mich sahen, ich konnte doch, wenn ich die halb ohnmächtige Frau halten wollte, weder selbst schwimmen noch mich auf den Ring verlassen, und so beschloss ich denn, wie ein Sack oder eine tote Katze am Läufer zu hängen; das bisschen Salzwasser konnte mich nicht schrecken, und überdies war die Fahrt kurz, kaum dreißig oder fünfunddreißig Schritte.
Sie übersahen vollkommen die Lage, in welcher ich mich befand, meine braven Kameraden, sie zogen auf Tod und Leben; es währte keine zwei Minuten, bis ich mich im Boot befand, aber dennoch war die Anstrengung für das arme junge Weib zu stark gewesen. Ihre Hände ließen nach – das Kind stürzte unmittelbar neben dem Fahrzeug ins Meer.
Frahm packte es im gleichen Augenblick und hob es hinein, aber die unglückliche Mutter mochte wohl ihren Liebling für verloren halten, mochte ihn retten, ihn wiederfinden wollen, genug, sie riss sich mit plötzlichem Ruck aus meinen Armen und verschwand unter den heranbrausenden Schaumkronen der Wellen – für immer, obgleich drei oder vier von uns sofort tauchten und mit langen Stangen den Grund durchsuchten. Erst am folgenden Tage fanden wir die Leiche.“
„Und den Jungen nahmst du zu dir in dein Haus, Böge?“
„Das tat ich. Es war über Mitternacht hinaus, als ich durchnässt, ohne Kopfbedeckung, selbst triefend, mit dem kleinen, triefenden Wesen nach Hause kam. Meine Frau hatte mich schon verloren gegeben, die Kunde von dem geschehenen schrecklichen Unglück war in das Dorf gelangt, und ein halbes Dutzend jammernder Weiber stand in jeder Ecke – ich konnte kaum die Haustür erreichen, so umringten und umdrängten sie mich.
Meiner Alten legte ich den kleinen Burschen an ihre Brust. ‚Da, Mutter, seine Eltern sind in dieser schlimmen Nacht ertrunken, der arme Kerl besitzt, wenigstens im Augenblick, keine andere Aussicht als die auf deine Barmherzigkeit. Willst du ihn nehmen, Alte?‘
Und da tat sie etwas, das mich über die ferneren Schicksale des kleinen Menschen vollständig beruhigte: Sie küsste die unschuldige Stirn. ‚Du hast ihn also gerettet, Rolf? – Oh, er wird sich erkälten! – Liese! – Liese, setze Milch zum Feuer – und bereite Grog für den Herrn – ich komme gleich!‘
Dann eilte sie mit ihm in das Schlafzimmer, ich hörte Kasten und Koffer knarren, ich hörte sie schluchzen, bitterlich, aus Herzensgrund, aber nach einer Stunde kam sie und fiel mir mit beiden Armen um den Hals. ‚Er liegt nun in dem Bette unseres kleinen Seligen, Rolf, er trägt seine Kleider – oh Mann, wie hab ich mich geängstigt um dich!‘
Weinen musste sie noch eine gute Weile, die Alte – tun’s ja einmal nicht anders, die Weibsen –, aber dann war doch alles gut, das Kind wurde mehr und mehr unser eigenes, wahrhaftig: Der Bengel kennt die Geschichte seiner Herkunft bis auf diesen Tag noch nicht. Er ist Rolf Böges Einziger – wer ihm etwas anderes erzählen wollte, den würde er auslachen.“
Pfeiffer nickte. „Von mir wird er nichts erfahren, Kamerad. Hast du übrigens in Betreff seiner Eltern keine Nachforschungen angestellt?“
„Alle erdenklichen, aber – alles umsonst. Es bleibt nur ein Kreis von Vermutungen, doch auch der bietet keine sicheren Anhaltspunkte. Wir hatten ja mehrere Passagiere geborgen, und diese konnten uns, als die Leichen der Ertrunkenen antrieben, einen hochgewachsenen Mann als den Gatten der armen Frau, die ich zu retten versuchte, bezeichnen. Die beiden Eheleute waren aus Baden oder vom Rhein her nach Bremen gekommen, um mit der ‚Leonore‘ nach New York zu gehen, sie schienen im Augenblick arm, konnten die Zeche im Hotel nicht bezahlen und trugen abgeschabte Kleider. Die Schiffsliste zeigte dreiundzwanzig kleine Knaben in dem Alter meines Geretteten – welcher davon war er?
Ich gab mir späterhin keine sonderliche Mühe mehr, das Rätsel zu lösen. Die Alte und ich, wir liebten den helläugigen kleinen Burschen, wir betrachteten ihn als unser Eigentum, und das soll er auch künftig bleiben. Was Rolf Böge dereinst hinterlässt, das fällt ihm zu – genug, um einen Mann und seine Familie vor der Armut zu bewahren, mehr braucht er nicht. Und nun“, fügte der Alte hinzu, „nun, Pfeiffer, willst du deinen neuen Printer persönlich kennenlernen?“
„Erst noch ein Glas Steifen! Komm heran, Wirt, trink mit auf die glückliche Fahrt der ‚Henriette‘ – sie geht nach der Westküste, da bedarf es der guten Wünsche!“
Am Strande vergnügte sich eine Anzahl größerer Knaben in Leinenkleidern und mit nackten Füßen am Kriegsspiel, wobei die hier und da aufragenden Dünen als Schanzen dienten und gelegentlich auch wohl einer der Kämpfer mit einem Satz in das Meer sprang, dort wie eine Ente tauchte und dann zwischen die Reihen der Übrigen fuhr, um sie auseinander zu sprengen. Dass dabei nicht wenig getobt und spektakelt wurde, versteht sich von selbst.
„Der da auf dem Sandhaufen, der Anführer, ist mein Junge!“, rief Böge. „Heda, Hugo!“
Der Knabe wandte sich um und schwenkte den Strohhut, dann eilte er in großen Sprüngen herbei, mit ihm zugleich ein riesiger Leonberger, der in tollen Sätzen seinen jungen Gebieter umkreiste und schließlich ihm zu Füßen im Dünensande artig liegen blieb.
„Hier, Hugo“, sagte Böge, „dein neuer Kapitän! Gib die Hand, Junge!“
Pfeiffer nickte wohlgefällig. „Willst du mit nach Afrika, mein Sohn? Ich kann gerade einen munteren Kajütejungen wie dich gebrauchen.“
Hugos Augen glänzten. „Ich will auch Kapitän werden wie mein Vater!“, rief er.
Die Männer lachten, und Pfeiffer wirbelte mit seiner derben Hand in dem blonden Gelock des kecken Burschen. „Nun“, sagte er, „sollst Kapitän heißen, Schlingel, aber erst nach fünfzehn Jahren etwa und wenn du mein Kajütejunge gewesen bist.“
„Darf Mohr auch mit?“, fragte der Knabe, auf seinen Hund deutend.
„Wenn er Pökelfleisch essen will, warum nicht? Hast ihn sehr lieb, den großen Kerl?“
„Es strandete hier am Riff vor drei Jahren ein böhmischer Fruchthändler mit seiner wackeligen alten Zille“, sagte Rolf Böge, „wir holten ihn samt Frau und Kindern in der Hosenboje an Land, aber der Hund, damals noch ganz klein, konnte nicht gegen die Flut aufkommen, er schrie kläglich um Hilfe, und so brachte ihn mein Junge aufs Trockene. Hugo schwimmt wie eine Ente, aber der Hund liebt ihn auch für die wackere Tat, als hätte er menschlichen Verstand.“
Der Abend war mittlerweile herabgesunken, es wehte kühler und immer kühler herüber vom Meere, die kleine Gesellschaft trennte sich am Strande auf baldiges Wiedersehen in Bremerhaven, wo die ‚Henriette‘ seebereit vor Anker lag, um demnächst ihre Fahrt nach Monrovia anzutreten.
Frau Anna Böge betrieb die Zurüstungen zur ersten Reise ihres Lieblings sehr emsig, obwohl sie dabei manche Träne heimlich weinte. Je näher die Trennungsstunde heranrückte, desto schwerer wurde ihr ums Herz, desto öfter seufzte sie. „Wenn wir ihn so plötzlich verlieren sollten, wie wir ihn gefunden haben, Rolf“, sagte sie kopfschüttelnd, „es ist doch ein eigen Ding um das Wasser und das Fahren darauf.“
Trotzdem aber packte sie ihm eine Menge guter Bücher zu unterst in die Kiste und tüchtiges Seemannszeug oben darauf. Hugo war seit Ostern konfirmiert, er hatte keine Beschäftigung, sondern lungerte so müßig herum, und das durfte nicht sein.
In Bremen blieben die Reisenden während der ersten Nacht, und dann ging es auf der Eisenbahn hinaus nach Bremerhaven. Gleich vorn wiegte die ‚Henriette‘ den schlanken Bug im Wellengekräusel, während aus dem gewaltigen Schornstein schon der blaue Rauch der Wolken hervorstieg. Gegen zwei Uhr mittags, mit eintretender Flut, sollte der Dampfer den Hafen verlassen. Schon nach acht Tagen nahmen Vater und Sohn Abschied.
Hugo war nie weiter als bis in die Stadt Bremen gekommen, jetzt sah er zum ersten Male den stattlichen Winterhafen, die Außenbassins und den hundert Fuß hohen Leuchtturm; der Kapitän der ‚Henriette‘ gesellte sich zu ihm und den beiden alten Freunden, Mohr sprang in großen Sätzen voraus, die Sonne lachte hell vom Himmel, und auf den großen Lloyddampfern herrschte so reges Leben, dass die Beklemmung unwillkürlich von der Seele des Knaben wich. Das Seeleben zog ihn mächtig an, er durchwanderte fröhlich die Räume des schönen Schiffes und überwand tapfer das Weh, welches ihn packte, als nun das: „Fremde von Bord!“ des Steuermanns erscholl und damit das Band zwischen ihm und der Kindheitsheimat zerrissen war. Noch ein Kuss, ein halb ersticktes: „Grüß die Mutter!“ – ein Händedruck mit dem alten Frahm, dann wurden die Laufplanken eingezogen, der Anker hob sich geräuschvoll aus den Fluten, und die Matrosen schwenkten singend ihre Mützen.
„Hurra für Bremen! – Ade! Ade!“
Mohr bellte aus Leibeskräften, als wollte er sagen: „Weshalb kommt ihr nicht mit?“ – Das Schiff hatte sich in stolzem Bogen gedreht, und hochauf spritzten um den Bug die weißen Schaumkronen. Hugo grüßte, er winkte mit dem Tuch, bis in der Ferne alles zu undeutlichen Umrissen verschwamm.
Erst als nichts mehr zu erkennen war, rührte sich Rolf Böge aus seiner früheren Stellung, er war doch sehr ernst geworden, das sonst so braune Gesicht blass.
„Kumm, old Niklas, wir hebbt hier nu nix mehr to dohn!“
Frahm nickte. „Bit an denn Dag, wo wi em up düff Flag wedder inhalen dohn, Kapitän!“
„Ja. Gott mag’s geben.“
Das Schiff zog hinaus in die Nordsee. Die Sonnenstrahlen umspielten das offene Deck, Möwen und Schwalben schossen durch die Luft – drei Kanonenschüsse als letzter Gruß an die zurückbleibende Heimat rollten donnernd über das weite Blau dahin.
Havarie, Schiffbruch und Durst
Die ‚Henriette‘ hatte Kap Palmas passiert, sie näherte sich jetzt in schneller Fahrt dem eigentlichen Ziel ihrer Reise, und schon sprachen die Matrosen unter sich von den Abenteuern, die sie in Liberia zu erleben hofften.
„Morgen Nachmittag werfen wir Anker!“, hatte der Kapitän gesagt.
Das Schiff wurde geputzt und nachgesehen, die Leute waren besonders fröhlich, sie schwatzten durcheinander wie die Elstern, besonders die jüngeren unter ihnen.
„Jetzt wirst du Affenbraten kennenlernen, Hugo, Bier aus sauren Pflaumen, fürchterliche Delikatessen, die noch fürchterlicheres Geld kosten. Hat dir dein Alter genügend Moses und die Propheten mit auf den Weg gegeben, mein Kleiner?“
„Ich möchte nur eines wissen“, rief ein anderer dazwischen. „Wenn wir hier gelöscht haben, wohin geht es dann?“
„Hier in Liberia ist nichts zu holen als Palmöl, und dafür hätten wir Fässer mitbringen müssen – also weiter, natürlich zuerst nach Kapstadt.“
„Hm“, sagte einer, „das ist schade. Ich war dort schon mehrere Male und würde lieber nach China oder Japan gehen.“
Noch während er sprach, erhielt das Schiff plötzlich einen Ruck, der die Leute taumeln und einige unter ihnen sogar zu Boden stürzen ließ.
Was war das? Erstaunte Gesichter sahen einander an, niemand fand Worte, um sich zu erkundigen, niemand konnte das Geschehene auf irgendeine Weise erklären. Das Wasser ruhig, der Wind ruhig – was hatte den jähen Stoß verursacht?
Aus dem unteren Raume des Schiffes kam mit blassem Gesicht ein Mann die Treppen heraufgestürzt und rief nach dem Kapitän. Es war der Maschinenmeister, sein ganzes Aussehen verstört und unruhig, deutete auf heftiges Erschrecken.