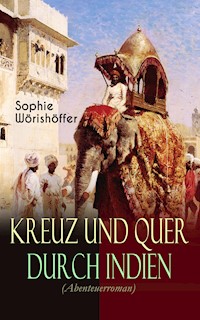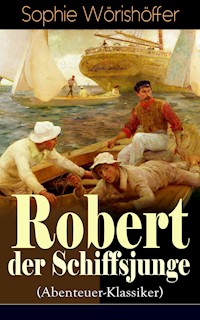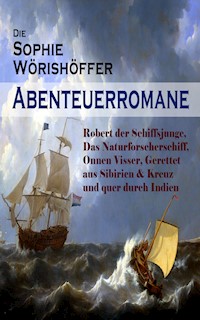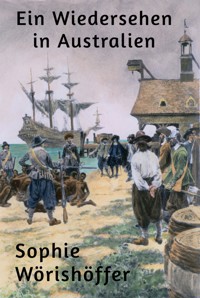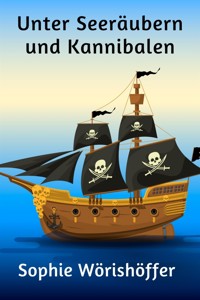
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dies ist die in sich abgeschlossene Fortsetzung des Buches »Kreuz und quer durch Indien«. Die jungen Seeleute Richard Wittenberg und Oskar Winter, nunmehr achtzehn Jahre alt, geraten, kaum den Gefahren Indiens entkommen, in der malaiischen Inselwelt in eine Vielzahl neuer Abenteuer und Gefahren.
Coverbild: Anton Gemini / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Unter Seeräubern und Kannibalen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZUM BUCH
Dies ist die in sich abgeschlossene Fortsetzung des Buches »Kreuz und quer durch Indien«. Kaum aus Indien entkommen, geraten die inzwischen achtzehn Jahre alten Seeleute Richard Wittenberg und Oskar Winter in der malaiischen Inselwelt in eine Vielzahl neuer Abenteuer und Gefahren.
Coverbild: Anton Gemini / Shutterstock.com
EINS
Von einem kräftigen Monsun getrieben näherte sich die Bark ‚Elisabeth‘ der malaiischen Inselwelt. Schon längst war das indische Festland den Blicken der Matrosen entschwunden.
Zwei von ihnen standen im Schatten des vom Wind geblähten Großsegels und blickten zurück in die Fahrtrichtung, aus der das schlanke wendige Schiff herkam.
„Hol’s der Teufel, Oskar“, sagte der Kräftigere von beiden, ein blonder Hamburger Seemann von etwa achtzehn Jahren namens Richard Wittenburg, „es war soweit ganz schön in Indien und wir haben dort eine Menge abenteuerlicher Dinge erlebt, während wir in den letzten Monaten kreuz und quer durchs Land zogen. Aber die Planken eines Schiffes sind mir auf die Dauer doch lieber als der Rücken eines Elefanten.“
Sein gleichaltriger Gefährte und Landsmann Oskar Winter nickte und erklärte nachdenklich: „Recht hast du, Richard, ich habe dieses Land der Fakire, Tempel und Schlangen auch allmählich satt. Wir wollen nur hoffen, dass unser englischer Käpten seine Handelsfahrt durch die malaiischen Inseln bald beendet hat und dann möglichst schnell Kurs auf Europa nimmt. Fast ein Jahr bin ich schon von zu Hause fort und habe manchmal tüchtig Heimweh, du auch?“
„Na es geht“, antwortete Richard mit einem etwas wehmütigen Zucken um den Mund. „Was habe ich schließlich in Hamburg zu versäumen? Du hast immerhin deine Eltern, deine Geschwister dort. Aber ich, wer wartet auf mich? Für das Waisenhaus, in dem ich meine Kindertage verbracht habe, bin ich allmählich zu alt geworden. Aber das ist schon richtig, ich wäre auch ganz froh, wenn wir diese Inseln hinter uns hätten. Es sollen sich hier, wie man mir in Bombay erzählte, eine Menge Seeräuber herumtreiben, Malaien, Chinesen und so weiter, allerhand zweifelhaftes Volk. Und Kannibalen soll es auch noch auf manchem sonst ganz netten Inselchen geben. Du hast doch von den Kopfjägern von Borneo, den Dajaks, gehört? Der Steuermann erzählte mir gestern heitere Dinge von diesen wilden Burschen, für die es kein größeres Vergnügen geben soll, als die Köpfe von Weißen und Malaien an ihren Haustüren aufzuhängen. Hm, die Dajaks werden wir ja noch kennen lernen, wenn wir in Borneo anlegen. Aber schließlich blieb uns nichts anderes übrig, als bei der ,Elisabeth‘ anzuheuern. Wir konnten ja nicht ohne Arbeit und Geld monatelang in Bombay auf der faulen Haut liegen und auf das nächste Schiff warten, das direkt nach Hamburg fährt. Verflucht, ich traue diesen Malaien nicht, sieh dir nur den Burschen da an, wie er uns misstrauisch von der Seite anstarrt. Jetzt grinst er sogar noch in sich hinein.“
Diesen Worten folgte eine Pause, während der Richard einem Manne nachsah, der mit einem großen Korb beladen über das Verdeck ging. Es war ein Malaie, ein untersetzter breitschultriger Bursche, dessen schwarze Augen unter gleichfarbigem, straff herabhängendem Haar blitzend hervorschauten, ein Eingeborener der Nikobarinseln, der auf der Bark als Koch angestellt war. Palo sprach nur das Unerlässlichste, hatte sich keinem der Matrosen angeschlossen und schien im Ganzen ein mürrischer Geselle zu sein, aber er beobachtete alles; was auch vorgenommen wurde, seine dunklen Augen sahen alles.
„Ich mag ihn nicht“, flüsterte Richard, „er hat einen falschen Blick.“
„Aber er kocht ausgezeichnet – und das ist für uns die Hauptsache.“
„Namentlich bei der harten Arbeit in diesen sturmreichen Gewässern!“
Sie gingen auseinander, der eine, um den Dienst in den Masten wahrzunehmen, der andere, um alte Segel zu flicken. Kapitän Vaughan war ein sehr gütiger Gebieter, aber er hielt auf Ordnung und geriet in den höchsten Zorn, sobald irgendwelche Nachlässigkeiten an den Tag kamen – aus diesem Grund hatte er den malaiischen Koch besonders gern und ließ ihn das auch häufig merken.
„Palo ist pünktlich wie ein gutes Uhrwerk“, sagte er einmal, „mit dem Glockenschlag steht das Essen bereit, und immer vorzüglich gekocht. Der schwarzköpfige Bursche gefällt mir sehr, alles an ihm glänzt von Sauberkeit.“
Nesbitt, der erste Steuermann, schüttelte den Kopf. „Als der einzige Malaie an Bord ist er ohnmächtig, Sir – sonst würde ich gerade ihn sehr scharf beobachten. Palos immer geschlossene Lippen verbergen ein Geheimnis.“
Der Kapitän lachte. „Sie verabscheuen die gelben Schlauberger, Nesbitt!“
„Und Sie vertrauen den Menschen im Allgemeinen viel zu leicht, Sir, nehmen Sie mir das nicht übel.“
„Keineswegs. Aber ich sehe nicht ein, weshalb man über schlimme Zufälle nachgrübeln soll, ehe sie eingetroffen sind. Palo kann uns das Schiff nicht in die Luft sprengen.“
„Übrigens“, setzte er hinzu, „lassen Sie für die Nacht alles Leinen wegnehmen, Nesbitt, es gibt wieder einmal eine gehörige Mütze voll Wind.“
,All right, Sir!“
Der Befehl wurde vollzogen. Dunkle Wolken jagten über den Himmel, ein feiner Regen stäubte den Matrosen in das Gesicht, und wie vom bösen Feind getrieben, flog die Bark durch das zischende, brodelnde Wasser.
Zuweilen schlug eine besonders hochgehende Woge über Deck, und es gab alle Hände voll zu tun, um den entstandenen Schaden wieder auszubessern.
Ein abscheuliches Wetter! Der Kapitän war entweder an Deck oder er saß bei den Karten, blass vor Aufregung der vielen umliegenden Inseln wegen. Wenn das Schiff von der Brandung erfasst und gegen den Strand geworfen wurde, so war es verloren.
Zuweilen kamen grüne, hochbewaldete Küsten in Sicht, dann verschwanden sie wieder wie die Bilder eines unruhigen Traumes. Haushohe Brandungswellen peitschten hier und da einen langgestreckten kahlen Strand, an dem zahllose Vögel nisteten, dann hüllten Schaum und Wogenschauer das Ganze in ihre weißen wallenden Schleier, und der Kapitän strich langsam mit der Rechten über die Stirn.
„Gottlob, wieder an einer dieser gefährlichen Inseln vorbei!“
In einer Nacht voll Regen und jäh auftauchender Kälte erhob sich das Toben des Windes zum Sturm. Es war so dunkel, dass man auf zwei Fuß Entfernung keinen Gegenstand mehr unterscheiden konnte; alle Lampen flogen zerschellt aus ihren Haltern, was nicht niet- und nagelfest war, wurde über Bord geschleudert.
Aber Kapitän Vaughan lächelte trotzdem. „Wir sind jetzt an den kleinen Inseln vorüber“, sagte er, „mag uns nun der Sturm in voller Fahrt nach Sumatra jagen – ich bin’s zufrieden.“
Die kahlen Masten starrten in das Dunkel empor, ächzend und knarrend bogen sich die Taue. An Deck nützte nur der Mann beim Ruder etwas, sonst niemand; in dem Toben des Wetters konnte weder gearbeitet noch Ausschau gehalten werden. Man musste es auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff ankommen lassen, denn es war unmöglich, etwas zu sehen, geschweige denn rasch auszuweichen.
Kreischend schossen in der schwarzen Nacht die großen Seevögel mit ausgebreiteten Flügeln über die Mastspitzen hin; kaum einer von der Mannschaft schlief, alle Herzen klopften schneller während dieser schauerlichen Fahrt durch die hohle rollende See.
Einige Stangen und Spieren waren schon über Bord gegangen, der an Deck liegende Notmast rasselte in seinen Eisenklammern wie ein lebendes gefangenes Wesen, das nach Befreiung ringt, von der Kapitänskajüte hatte der Sturm eine Seite der Tür weggerissen – plötzlich aber erscholl, bald nach Mitternacht, ein donnerndes Poltern, das kurz andauerte und dann mit einem Sturz in das Wasser endete.
Irgendein schwerer Gegenstand war vom Sturm über Bord gefegt worden.
„Es können nur die Trinkwassertanks sein“, flüsterte Richard, der im Logis zunächst der Tür lag. „Eine schöne Bescherung!“
In diesem Augenblick streifte ein fremder Körper sein Gesicht, er griff zu, aber ohne etwas zu erfassen. „Wer ist da?“, rief er laut.
Keine Antwort.
„Wer sollte hierher kommen?“, meinte ein anderer. „Man hörte auch keine Schritte.“
„Einerlei. An mir ging jemand vorüber.“
„Vielleicht war’s eine Ratte“, meinte die andere Stimme. „Verdammte Nacht das!“
Während dieser kurzen Unterhaltung lag Palo, der Malaie, in seiner Koje, und um den sonst so fest geschlossenen Mund spielte ein frohlockendes Lächeln. Er konnte es unter dem Schutz der Nacht wagen, diesen Triumph zu zeigen – kein Auge vermochte ihn zu beobachten.
Das Schiff ächzte in allen Fugen. Die Vögel kreischten, und der Sturm heulte. Bleiern langsam schlichen den Leuten die Stunden.
Beim ersten Tagesgrauen legte sich, wie gewöhnlich, die Wut der Elemente, aber eine neue Gefahr war an die Stelle der früheren getreten. Beide Tanks fehlten.
Kein Tropfen Wasser an Bord – ein höchst beunruhigender Verlust.
Der Kapitän stampfte vor Zorn mit dem Fuß. „Die Bolzen können nicht ordentlich befestigt gewesen sein“, rief er, „der Teufel soll eure Nachlässigkeit holen, ihr faulen Gesellen. Jetzt vergeht der ganze Tag unter unfreiwilligem Fasten, und abends können wir dann die Nikobarinseln anlaufen, um nur erst einmal etwas Wasser zu erlangen! Zwei Tage unnütz versäumt!“
„Vorwärts!“, fügte er hinzu. „Holt alle Fässer und Flaschen aus dem Raume hervor. Bei den vertrackten Malaien kann ich keine Tanks wiederkaufen!“
Er blieb während des ganzen unangenehmen Tages in seiner Kajüte; erst am Abend, als die Insel Groß-Nikobar in Sicht kam, erschien er und gebot, den passendsten Landungsplatz anzulaufen. Zugleich erhielt die Mannschaft den Befehl, sich zum Aufsuchen von Trinkwasser im Innern der Insel bereit zu halten.
„Palo!“, rief der Kapitän.
„Sir!“
„Ist diese Insel deine Heimat? Bist du mit Land und Leuten bekannt?“
Der Malaie schüttelte den Kopf. „Nein, Sir, die Hütte meiner Eltern stand auf Katschall.“
„Du kannst also den Matrosen hier nicht als Wegweiser dienen, du kennst im Innern der Insel weder Flüsse noch Quellen?“
„Nein, Sir!“
Der Kapitän und Mr Nesbitt wechselten einen schnellen Blick. „Sehen Sie wohl!“ sagte der eine, und: „Ich bin keineswegs überzeugt!“ der andere.
Palo konnte wieder gehen, seinen Betel kauen und mit verschränkten Armen auf seiner Schiffskiste sitzen. Da das Wasser fehlte, so gab es für ihn nichts zu tun.
Mit dem Einbruch des Abends begann abermals das Singen und Sausen des Sturmes. War schon die vorige Nacht eine höchst unangenehme gewesen, so wurde diese zweite geradezu schrecklich. Es fand sich keine auch nur einigermaßen geschützte Stelle, an der das Schiff Anker werfen konnte, noch weniger aber durften sich die Boote in den Gischt hinauswagen. Obgleich keine Brandung den Strand umbrüllte, so ging doch das Meer für jeden solchen Versuch viel zu hoch.
Die Bark wurde backgelegt, unbarmherzig zerrten die Elemente den schlanken Bau bald vor-, bald rückwärts, bis endlich unter den Qualen des Durstes und des beständigen Wartens abermals der Morgen dämmerte. Ein ziemlich breiter Fluss rollte, zwischen Gebirgshäuptern aus dem Wald hervorbrechend, seine Wogen in das Meer hinab, während eine klippenfreie Bucht der Bark gestattete, in ihrem Schutz Anker zu werfen.
Mr Nesbitt ließ die beiden Geschütze gegen den Strand kehren und sechs Kugelbüchsen bereit legen, die eine Hälfte der Mannschaft musste mit Fässern und Eimern im großen Boote an Land gehen, die andere blieb zur Bedeckung des Schiffes zurück; auf Palo achtete keiner. Er schien sich um die ganze Sache nicht im Mindesten zu bekümmern.
Der Strand bot ein Bild des stillsten Schöpfungsfriedens. Bis an die Wassergrenze hinab hatten Strandläufer und Regenpfeifer ihre Nester erbaut, große Eidechsen sonnten sich faul im Lichte des jungen Tages, und Schildkröten wanderten kriechend über den Sand. Weiter hinauf begann der Wald mit seinen zahllosen größeren und kleineren Tieren, Papageien, wunderbar schönen Hühnern, Tauben, Zuckervögeln, Fasanen und Pfauen sowie ganzen Horden von Affen, wilden Katzen und anderem kleinen Raubzeug. Die ausgesuchtesten Blumen und Früchte wuchsen überall, sodass wenigstens der brennende Durst einigermaßen gestillt werden konnte.
Das Hauptsächlichste indessen, das Wasser, fehlte vorläufig noch ganz, denn die See spülte an der Mündung des kleinen Flusses ihre gewaltigen Wellen so weit landeinwärts, dass alles ungenießbar wurde. Weiterhin versperrten die letzten Ausläufer der Gebirge den Weg.
Eine große Schildkröte musste zunächst ihr Leben lassen, Körbe voll Austern wanderten zurück zum Schiff, dann suchten die Matrosen den schroffen Felsen zu umgehen. Keine Spur einer menschlichen Nähe war weit und breit zu entdecken.
Palo saß noch immer mit verschränkten Armen auf seiner Schiffskiste und lächelte in sich hinein.
„Ist die Insel stark bevölkert?“, fragte ihn der Kapitän.
„Weiß nicht, Sir.“
Mr Nesbitt streifte ihn mit einem nichts weniger als schmeichelhaften Blick. „Wer die Bolzen aus den Lagern der beiden Tanks gezogen hat, weißt du vermutlich auch nicht, Bursche?“
„Nein, Sir!“
Es lag etwas Teuflisches in dem Behagen, womit Palo dem heißblütigen Schotten ins Auge sah.
Mr Nesbitt schlug mit der flachen Hand auf eines der beiden Geschütze. „Aber diese Dinger kennst du, nicht wahr, Kerl? Hüte dich, weiße Männer herauszufordern!“
„Steuermann“, begütigte der Kapitän, „er hat ja nichts getan!“
„Einerlei, sein Gesicht ist das eines Schurken.“
Palo blieb bei seinem unangenehmen Lächeln; er kaute Betel und sah zum Lande hinüber.
Die Matrosen waren vom Schiff aus nicht mehr zu erblicken. Während einige weiter gegen den oberen Lauf des Flusses hin vordrangen, um erst einmal reines süßes Wasser zu erhalten, vergnügten sich andere mit der Jagd, und zwar desto eifriger, je weniger sie von der Sache verstanden.
„Sieh! Sieh!“, rief einer. „Welch sonderbares Tier steht da in der Pfütze!“
„Ein Schwein! Hurra, wir können gerade frischen Braten gebrauchen?“
„Du Narr, es ist ein Hirsch, das sieht man doch auf den ersten Blick!“
„Ein Hirscheber“, belehrte Oskar, der längst für das ‚lebendige Nachschlagebuch‘ des Schiffes erklärt worden war. „Trefft ihn gut!“
Drei Kugeln pfiffen durch die Luft, aber ohne dem harmlosen Rüsselträger im Allermindesten zu schaden. Er verschwand schleunigst, und die betroffenen Schützen eilten ihm nach, so schnell sie konnten.
Mit ihnen hüpften von einem Baum zum andern die Affen, schwirrten Vögel ohne Zahl. Das fröhliche Gelächter der jungen Leute schallte durch die grüne Einsamkeit.
Unterdessen hatte die zweite Abteilung eine Stelle gefunden, wo sich die mitgebrachten Fässer bequem füllen ließen. Zuerst tranken alle nach Herzenslust, dann tauchten sie die Eimer ein und begannen das klare Nass zu sammeln. Die beutelosen Jäger stießen zu ihnen, wurden geneckt und neckten wieder, dann verteilte man die Gefäße, um den Rückweg anzutreten. Der Marsch musste ohnehin zweimal gemacht werden.
Als sich der Erste mit dem Fässchen auf der Achsel und dem Gewehr in der anderen Hand umwandte, um durch die überall sehr dichten Gebüsche wieder zum Strande zu gelangen, da blieb er plötzlich erschreckend stehen und von seinen Lippen rang sich ein Ausruf, der wie die größte Bestürzung klang. „Alle Donnerwetter!“, murmelte er.
Vor ihm blitzten die Augen eines Malaien, in dessen Gürtel der berüchtigte malaiische Dolch, der Kris, stak und der außerdem eine Büchse auf der Schulter trug – aber nicht das allein, wie durch Zauberei, wie aus dem Boden auftauchend, erschienen Dutzende von Gelben. Die Weißen waren vollständig umzingelt.
„Ich bin der Radscha von Groß-Nikobar“, sagte in gebrochenem Englisch würdevoll der Erste. „Wer seid ihr?“
Die Matrosen sahen einander verdutzt an. „Wir haben bei dem letzten Sturm unsere Tanks verloren“, antwortete einer, „deshalb warfen wir hier Anker, um etwas Wasser zu erlangen.“
Richard hatte sich die Reihen der Malaien näher betrachtet; es wurde ihm sofort klar, dass an eine Verteidigung leider durchaus nicht zu denken war.
„Höre mich an, Radscha von Groß-Nikobar“, mischte er sich in das Gespräch, „wir werden uns gewiss verständigen. Du willst jedenfalls das Wasser, welches hier fließt, als dein Eigentum betrachten und verlangst dafür Bezahlung. Ist es nicht so?“
Der Malaie wiegte den Kopf. „Wie du sagst, Faringi. Ich verlange einen Preis.“
„Gut, dann folge uns zum Schiffe. Der Kapitän gibt dir das Geld.“
Aber der Malaie rührte sich nicht. „Legt nur die Fässer ab“, sagte er, „für Wasser wird schon gesorgt werden. Ihr müsst uns jetzt folgen.“
„Wohin?“, rief Richard.
„Das findet sich. Wenn ihr gehorsam seid, so soll euch nichts geschehen – ein Radscha gibt sein Wort.“
Der Gelbe legte dabei die Hand wie zufällig an den Kris, als wolle er sagen: „Im entgegengesetzten Fall erwartet euch das Schicksal des Krieges.“
„Was willst du denn von uns, Radscha?“, rief Oskar. „Denkst du uns zu Gefangenen zu machen? Sollen wir nicht wieder an Bord zurückkehren?“
Der Gelbe ließ die Frage unbeantwortet. „Vorwärts!“, befahl er.
Seine Begleiter, die in allen Büschen hinter ihm standen, alle Wege sperrten und immer zahlreicher auftauchten, alle diese verschlagenen Gesichter kamen zum Vorschein, und bald umzingelten mehr als fünfzig Bewaffnete die sechs Weißen. Sie mussten sich die Kugelbüchsen aus den Händen und die Fässer von den Schultern nehmen lassen, ohne etwas dagegen tun zu können.
Einer der Leute versuchte es zwar; er streckte voll unbezähmbarer Wut den ersten besten Gelben mit einem regelrechten Boxerstoß in den Sand, aber dieser Ausfall bekam ihm übel. Im Augenblick waren seine Arme mit Bastseilen auf den Rücken gefesselt, sodass er bei dem nun folgenden Geschwindmarsch überall stolperte und einen höchst beschwerlichen Weg hatte, wobei ihm bei jeder Verzögerung ein tüchtiger Puff in den Rücken an das Verbrechen erinnerte, das er gegen einen der Untertanen des Radscha begangen hatte.
Während die anderen Weißen unruhig und voll böser Ahnungen schwiegen, bemühte er sich, alle Verwünschungen hervorzusprudeln, deren er sich im Augenblick erinnern konnte. „Gelbe Zitronen“, schrie er, „Affen Ihr alle! Bei Golly, es soll eins von Ihrer Majestät Kriegsschiffen hierher kommen und die ganze Insel vom Erdboden vertilgen. Ihr Räuber, ihr Mörder, lasst mich frei, und ich will euch zeigen, was meiner Mutter Sohn leisten kann!“
Aber keiner von den Gelben bekümmerte sich um diesen Ausbruch des Zornes; sie schritten hinter ihren Gefangenen her und schwiegen, bis nach schneller Wanderung durch das Gebirge eins ihrer Dörfer erreicht war.
Es stand im Tale und gewährte einen sehr friedlichen Anblick. Jedes Haus ruhte auf Pfählen von etwa zwei Metern Höhe, die Wände bestanden aus Bambusstäben, das Dach aus getrockneten Atapblättern. Unter einer derartigen Wohnung, auf dem Boden, wuchs dichtes Gebüsch, das in diesen ungesunden Gegenden dazu dient, die gefährlichen Ausdünstungen der Erde in sich aufzunehmen und ihre Wirkung abzuschwächen.
Der Eingang befand sich hoch oben, und eine Leiter aus Kokosfasern hing herab, um den Zutritt zu ermöglichen. Vor den Häusern lagen die Arbeitsplätze der Männer, meistens Feuerstellen auf zusammengetragenen Steinen und ein größeres, plattgeschliffenes Felsstück, das als Amboss diente.
Man sah an unbedeutenden Glutpfannen mit wenigen, höchst einfachen Geräten die Leute als Gold- und Waffenschmiede arbeiten, andere so feine Gewebe verfertigen, dass das Auge durch die Schönheit unwillkürlich gefesselt wurde. Die Frauen bearbeiteten die Blätter und Fasern verschiedener Palmenarten, die zum Dachdecken benutzt wurden, und selbst Kinder mussten bei diesen Beschäftigungen zur Hand gehen.
An den Hügeln weideten hübsche Ziegen und viele gelbe Ochsen, hier Karabauen genannt.
Als die Weißen erschienen, zogen sie aller Blicke sogleich auf sich; es war eine Doppelreihe lautlos staunender Menschen, die sie durchschreiten mussten, aber trotzdem fragte kein Einziger oder erlaubte sich irgendeine Beleidigung. Unangefochten gelangten die Matrosen zu einem einzeln stehenden, wenigstens vier Meter über dem Erdboden erhöhten Hause, das man ihnen als Wohnung anwies.
Ein großes Bambusgefäß mit frischem Wasser wurde hinaufgebracht, ferner eine Anzahl Matten und eine Mulde, die gekochten Reis sowie ein tüchtiges Stück Fleisch enthielt. Dann zog der Radscha in höchsteigener Person die Leiter weg.
In der offenen Tür stehend bat ihn Richard um einen kurzen Bescheid. „Wie lange sollen wir hier gefangen bleiben?“ fragte er.
„Bis morgen früh“, war die trockene Antwort.
„Und dann kommen wir zu unserm Schiff zurück.“
„Ja.“
Mehr war aus dem schweigsamen Würdenträger nicht herauszubringen. Er entfernte sich und ließ die Gefangenen allein. Um das Gebäude herum lagen spitze, wohl absichtlich dort zusammengetragene Kiesel; sie konnten deshalb nicht daran denken, in einem unbewachten Augenblick einen kühnen Sprung zu wagen, es wäre ihr sicherer Tod gewesen!
Der Gefesselte sprach zuerst, oder vielmehr, er sprach immer noch, nur jetzt in einem etwas veränderten Tone.
„Mache mir doch einmal einer die Flossen frei!“
Oskar zerschnitt die Bande, und jetzt fuchtelte der Sohn Altenglands gleich einem Besessenen mit beiden Armen in der Luft umher. „Solche Schinder“, rief er, „solche Haifische und Gaudiebe! Was wollen die Seeräuber von uns? Jesus, mein Heiland, ich glaube, sie essen Menschenfleisch!“
Ein unangenehmes Schweigen folgte diesen Worten. Dergleichen spukte damals noch in den Köpfen aller Seeleute, man wusste, dass es hier und da geschah, und der Gedanke daran ließ das Blut in den Adern erstarren.
„Der Radscha sagte aber doch, dass man uns morgen wieder an Bord brächte“, warf endlich Oskar ein. „Er ist der Gebieter dieser Insel!“
„Ein gelber Halunke mag er sein! Herauskommen soll er und sich ohne sein verdammtes Schnappmesser Mann an Mann gegen mich stellen, dann kann er erfahren, was ein richtiger englischer Boxkampf ist. Segne meine Seele! Wenn seine Spinnengewebe von Knochen nicht nummeriert sind, so findet er sie nimmer wieder zusammen.“
Nach diesem gewaltigen Zornesausbruch schob er seinen Kautabak in die andere Ecke des Mundes und machte eine kleine Pause, um sich zu erholen.
Richard zuckte die Achseln. „Was hilft der Ärger?“, sagte er. „Wir müssen sehen, wie wir durchkommen. Wenn ich nur wüsste, was die Malaien eigentlich wollen?“
„Vielleicht eine Lösegeld!“, rief jemand.
„Das wird der Kapitän ohne Zweifel bezahlen.“
„Ich glaube es auch – lasst uns also die Hoffnung nicht voreilig aufgeben.“
Er trat zurück, um sich nach dem langen Marsche ein wenig auszuruhen, aber bei dieser Bewegung brachte er die ruhelose Zunge des Kameraden wieder in Gang.
„Bei Golly“, rief der, „hier schwankt der ganze Fußboden! Segne meine Seele, wir purzeln elend hindurch und brechen das Genick. Vielleicht ist das die Art und Weise der gelben Schufte, um Gefangene zu schlachten!“
Er ging so vorsichtig, als habe er Glatteis unter den Füßen, bis zur Mitte des stattlichen Raumes, dann hüpfte er ein wenig empor, sodass der ganze Bau schaukelte und das Wasser im Bambuseimer nach allen Seiten über den Rand floss.
„Schauderhaft!“, rief er. „Du, Oskar, Klugschnabel, was bedeutet es?“
„Dass die Malaien keine Bretter besitzen, mein Junge, woher sollten sie dazu die Sägen nehmen? Der Fußboden ist aus Bambusstäben geflochten, deshalb schwankt er.“
„Das ist aber auch sogar notwendig“, setzte Richard hinzu. „Bei den häufigen Erdbeben dieser Gegenden würden festgebaute oder wohl gar steinerne Häuser zusammenstürzen und ihre Bewohner erschlagen – die Bambushütten dagegen biegen sich mit jeder Schwingung und fallen später von selbst in ihre Lage zurück.“
„Oh Jesus, also auch Erdbeben gibt es!“
Oskar hatte durch eine kleine Spalte der Rückwand gesehen und winkte jetzt seinen Gefährten. „Was liegt da unter dem offenen Schuppen?“, flüsterte er.
„Menschenfleisch?“, fragte der Engländer. „Das meinige verkaufe ich teuer.“
„Ach, dummes Zeug! Sieh einmal her, Richard!“
Der Gerufene trat hinzu. „Das sind Einzelteile eines Schiffes!“, rief er, „aber keines malaiischen. Beim Himmel, ich glaube, da steht sogar auf einer Planke ein deutscher Name!“
„Eng–“, las er. „Schade, schade, die Wand hindert mich, mehr zu erkennen.“
„Dem soll bald abgeholfen sein!“
Oskars Messer trennte mit gewaltigem Ruck die Bambusstäbe. Derbe Fäuste rissen das entstandene Loch größer und bald hatten die dreisten Zerstörer Platz genug, um die ganzen Köpfe hindurchzustecken. „Engellina!“, las Oskar. „Ein deutsches Schiff also!“
„Hallo – und da unten schimmert es rot-weiß. Wahrhaftig, das Hamburgische Wappen!“
Es lief den jungen Leuten kalt durch alle Adern. Vor zwei Jahren war die ‚Engellina‘ als verschollen angemeldet, die Versicherungsgesellschaft hatte das Schiff bezahlt, und die Frauen und Mütter seiner Besatzung trugen schwarze Trauerkleider. Wo mochten jene braven Männer ihr Grab gefunden haben?
„Hölle und Teufel“, sagte halblaut der Engländer. „Wo sind die Leute vom Schiff? Gefressen, sage ich euch, verzehrt, von den Seelenverkäufern als Karbonaden und Beefsteaks. Segne meine Seele, das ist ein Jammer!“
Richard fuhr mit der Hand durch das Haar. „Sie sind ermordet!“, sagte er nachdrücklich, „aber das andere ist Unsinn. Seht, da liegen auch ein paar Tanks – alles von der Engellina!“
„Schauderhaft!“, sagte leise eine Stimme – und dann wurde es still in dem Bambusgebäude. Sie sprachen nicht mehr, weil die Beklemmung zu schwer auf aller Herzen lag …
ZWEI
Den Zurückgebliebenen auf dem Schiffe wurde mittlerweile die Zeit lang und immer länger.
„Wo stecken die Burschen?“, meinte ärgerlich der Kapitän. „Sie könnten wahrhaftig jetzt Wasser gefunden haben.“
Mr Nesbitt machte sich an den Geschützen zu schaffen. „Soll ich einmal ein wenig Pulver verpuffen, Sir? Die Kerle werden das Zeichen ja verstehen.“
„Immerhin“, nickte der Kapitän. „Sie laufen den Affen und Pfauen nach, eine kleine Mahnung kann also keineswegs schaden.“
Der Schuss rollte langsam über das Wasser dahin, die eingesperrten Matrosen hoben wie auf Verabredung ihre Köpfe und sahen einander an, aber keiner von ihnen sprach ein Wort. Zu den Kameraden auf dem Schiffe hätte freilich auch der lauteste Schrei nicht hinüberklingen können.
Mr Nesbitt horchte. Ob keine Antwort kam?
„Tiger gibt es auf den Nikobarinseln nicht!“, sagte der Kapitän.
„Aber schurkische Malaien“, ergänzte der Steuermann.
„Bah, es ist kein Überfall denkbar, sonst hätten wir das Schießen doch hören müssen.“
Mr Nesbitt zuckte schweigend die Achseln.
Stunde auf Stunde verrann, die Sonne hatte die Mittagshöhe längst überschritten, aber alles blieb um das ankernde Schiff herum so kirchenstill, dass die Überzeugung, ein Unglück müsse geschehen sein, die Herzen der Wartenden mehr und mehr erfüllte. Zugleich regte sich auch wieder gegen Abend der heftige Wind; er schaukelte das Schiff und ließ es ungeduldig stampfen und zerren wie ein lebendes Wesen.
Binnen einer Viertelstunde musste die Nacht hereinbrechen – und noch war von den Ausgesandten nichts zu hören oder zu sehen. Wie jetzt schon der Durst zu quälen begann! Wein und Branntwein vermochten ihn nicht mehr zu löschen.
„Schießen Sie noch einmal, Mr Nesbitt“, sagte beklommen der Kapitän.
Das Geschütz wurde neu geladen, aber es kam keine Antwort. Sechs Schüsse – dann schüttelte der Steuermann den Kopf.
„Es hilft nichts, Sir! Unsere Leute sind in einen Hinterhalt gefallen.“
Zwei Matrosen meldeten sich mit der Bitte, das andere Boot nehmen und an Land gehen zu dürfen, aber der Kapitän zögerte, es zu gestatten. „Ich muss im Notfall das Schiff verteidigen können“, sagte er seufzend.
„Das wäre auch mit unserer Beihilfe nicht möglich, Sir. Ohne den Koch sind wir acht Männer – was könnte das einem feindlichen Überfall gegenüber nützen?“
Der Kapitän nickte. „So geht denn“, sagte er. „Sucht wenigstens etwas Wasser zu erlangen und haltet euch nirgends auf.“
Zwei Schiffslaternen wurden mitgenommen, Beile und Kugelbüchsen. Im letzten Tagesschein landete das Boot, dann kam die plötzliche tropische Nacht, und nur wie ferne verglimmende Punkte leuchteten noch die beiden Flämmchen in den beiden Blechlampen durch das sternenlose Dunkel.
Der Wind pfiff und das Wasser rauschte. Hier und da erklangen die Stimmen der kleinen Vögel, im Meer bewegten sich glänzende Leuchttiere, an der sandigen Küste kletterten Schildkröten auf und ab, riesenhafte Geschöpfe mit Panzern, die grünlich durch das Dunkel schimmerten.
„Schießt von Zeit zu Zeit das Gewehr einmal ab!“, hatte der Kapitän den beiden Leuten gesagt, aber kein Laut drang vom Ufer herüber.
Eine fieberhafte Eile hatte den Kapitän ergriffen. Er ging auf und ab, dann stand er wieder still, um sich die heiße Stirn mit dem Tuch zu trocknen.
„Hat der Satan da hinter den Bergen eine Falle, in welche die Leute blindlings hineinpurzeln, Nesbitt? Auch die beiden Letzten lassen nichts von sich hören.“
Der Steuermann legte plötzlich eine Hand auf seinen Arm. „Sehen Sie dorthin, Sir!“
„Wo denn?“
Seine Blicke suchten, dann erblasste er plötzlich. „Eine malaiische Prau!“, rief er.
„Zehn, Sir – zwanzig!“
„Du großer Gott!“
Die unförmigen Segel, vom Winde gebauscht, erschienen rechts und links, vor und hinter der Bark. Mehr als zweihundert bewaffnete Malaien, die Enterbeile in den Händen, Gewehre über den Schultern und im Gürtel den Kris, näherten sich in schneller Fahrt dem Schiff; selbst wenn die volle Besatzung an Bord gewesen wäre, wäre kein Entrinnen mehr möglich gewesen.
Mr Nesbitt und der zweite Steuermann hatten im Fluge die Kanonen scharf geladen und ihre Kugelbüchsen ergriffen, ebenso die noch zurückgebliebenen Matrosen. Die kleine Gruppe stand eng gedrängt im Vorderteil des Schiffes beieinander.
Die Malaien lagen jetzt mit ihren Fahrzeugen unmittelbar unter dem Bug der Bark. Wie Katzen kletterten sie in die Masten empor und von da aus mit gehobenen Beilen auf die Schanzkleidung des Schiffes.
„Was wollt ihr, Leute?“, rief der Kapitän.
Ein Hohngelächter antwortete ihm. Mehr und immer mehr Hände klammerten sich an sein Schiff, überall erschienen die gelben, von Turbanen umhüllten Köpfe.
„Achtung!“, rief der Steuermann. „Der Erste, der den Fuß auf das Verdeck setzt, muss es mit dem Leben büßen.“
Zugleich befahl er: „Feuer!“, und die beiden Geschütze taten ihre Schuldigkeit. Drei von den Prauen versanken in das Meer, dessen Fluten sich hochaufrauschend über den Mastspitzen schlossen.
Überall im Wasser sah man ringende, halbnackte Gestalten, überall erklang das Wimmern Sterbender. Jetzt war der Kampf eröffnet, die sechs Weißen schossen, so schnell sich die Waffen wieder laden ließen, auch eine zweite Lage der beiden Geschütze riss abermals mehrere Prauen aus den Reihen der Übrigen, aber damit war die Sache entschieden.
Vielleicht zwanzig oder dreißig Eingeborene hatten das Leben verloren, ebenso viele lagen schwer verwundet in ihren Prauen, aber an Deck des Schiffes standen mehr als hundert wehrhafte, wohlbewaffnete Männer, die den wenigen Weißen ohne Mühe ihre Büchsen entrissen und ihnen den Weg zu den Kanonen versperrten.
In der Mitte der eingedrungenen Schar befand sich Palo – und jetzt war der stumme Mund beredt geworden. Er schien seinen Genossen triumphierend zu erzählen, wie fein die Faringi überlistet worden waren, der Kreis der Zuhörer lachte – da übermannte es den sonst so gutmütigen Kapitän, er ergriff eine am Boden liegende Pistole und schlug mit dem Kolben nach des Verräters Stirn, als ihm plötzlich ein Malaie zuvorkam.
Die haarscharf geschliffene Klinge wirbelte durch die Luft und mit gespaltenem Schädel, blutüberströmt, brach der Kapitän zusammen. Noch einige Zuckungen, ein letztes Ächzen, dann war alles zu Ende.
Palo lachte. „Desto besser!“, rief er. „Ein Faringi weniger!“
Der Anführer der räuberischen Schar gebot jetzt Ruhe und ließ die wenigen Weißen um sich versammeln.
„Ich bin der Radscha von Groß-Nikobar“, sagte er auch hier wieder, „und ich habe dies Schiff erobert, um es für den Walfischfang zu benutzen. Die Männer meines Volkes sind gute Seeleute, aber sie besitzen keine großen Fahrzeuge, und daher musste ich mir ein solches verschaffen. Der Befehlshaber der Bark bin nunmehr ich, der erste und zweite Steuermann, sowie sämtliche Matrosen bleiben in ihren bisherigen Stellungen und erhalten einen Anteil an der Beute oder werden, falls sie sich widersetzen, getötet.“
Der Obersteuermann verbiss den Grimm, der ihn fast erstickte. „Vor deinen Füßen liegt ein Leichnam“, sagte er möglichst ruhig. „Willst du nicht zunächst den Befehl geben, ihn etwas passender zu betten, Radscha?“
Der Malaie lächelte. „Du hast recht, Faringi! Werft also den Körper in das Meer, Leute! Die Fische wollen auch leben.“
Nesbitt trat plötzlich zwischen die Leiche des Kapitäns und den prahlenden Malaien. Seine Augen blitzten drohend, er schüttelte die geballten Fäuste.
„Hüte dich, Radscha von Nikobar“, rief er mit lauter Stimme, „ein freier Seemann bietet deiner Gewaltherrschaft Trotz, und er verspricht dir im Namen seiner Genossen das Gleiche. Wenn du dich weigerst, dem ermordeten Kapitän vor versammelter Schiffsmannschaft ein christliches Begräbnis zukommen zu lassen, so versagen wir Steuerleute dir den Dienst. Du kannst eine Prau fahren, aber nach Kerguelen oder noch weiter in das Eismeer hinein gelangst du nicht ohne einen weißen Steuermann. Nun wähle!“
Mitchell, der zweite Steuermann, nickte lebhaft. „Goddam, Nesbitt, es ist, wie Ihr sagt, mein Alter. Ich rühre keine Hand.“
Die Augen des Malaien funkelten wie die einer Katze; über seine Lippen kam ein erzwungenes böses Lachen. „So viel Aufhebens!“ warf er hin. „Lächerlich. Macht mit der Leiche da, was ihr wollt. He, Soldin, Argo –wascht das Blut auf.“
Zwei von den Gelben trugen den Körper des Erschlagenen hinab in die Kajüte, einige andere säuberten an Deck den Fußboden. Als das geschehen war, wandte sich Nesbitt wieder an den Piratenhäuptling.
„Es wird jetzt Zeit, dir zu antworten, Radscha“, begann er. „Natürlich sind acht Mann von der Besatzung dieses Schiffes als Gefangene in deinen Händen? Sie wurden nacheinander ausgeschickt, um Wasser zu holen, und kamen nicht wieder.“
Der Malaie nickte. „Sind wohl aufgehoben“, sagte er kurz.
„Und du willst sie wieder an Bord liefern?“
„Wenn wir uns gütlich einigen können – ja. Im Augenblick brauche ich euch, das wisst ihr und das weiß ich, aber wenn erst einmal eine Reise gemacht worden ist, so kann die Bark irgendeinen großen Hafen anlaufen und dort Steuerleute genug finden.“
„Gut. Du versprichst also, uns nur für die gegenwärtige Fahrt zu verpflichten, später aber unserem Fortgehen nichts in den Weg zu legen?“
„Nichts! Ich wünsche sogar, dass diese Zeit recht bald käme. Die Bark soll zunächst den Hafen von Padang anlaufen, um Kohlen und Mundvorrat einzunehmen, dann geht es nach Kerguelen. Ich gebe euch vom Gewinn einen bestimmten Anteil.“
Nesbitt wusste nun allerdings, dass der habsüchtige Malaie freiwillig nie auch nur einen Pfennig bezahlen würde, aber das war Nebensache – die Frage nach dem Schicksal der Gefangenen dagegen viel wichtiger.
„Nimm an, dass wir über diesen Punkt im Reinen wären“, antwortete er, „und gib jetzt unsere widerrechtlich ihrer Freiheit beraubten Kameraden heraus, Radscha. Uns selbst nimm die Fesseln ab, ich mag sie nicht länger tragen.“
Dem Wunsch wurde entsprochen und dann ließ der neue Befehlshaber des Schiffes, Radscha Karoldi, wie er sich nannte, schnell nacheinander von den Kanonen der Bark sechs Schüsse abgeben. Das musste ein vorher vereinbartes Zeichen sein, denn wenige Stunden später kamen unter starker Bedeckung die Gefangenen mitten in der Nacht an das Schiff. Ebenso brachten mehrere Karabauen auf ihren Rücken die eisernen, von der ‚Engellina‘ geraubten Tanks, die jetzt neugefüllt waren und von den Malaien an Bord geschafft wurden.
Im Osten erhoben sich die ersten Strahlen der Morgensonne. Über Wald und Fels, über das blaue hochgehende Meer und die stille Bucht schossen die rosigen Lichter über ein Naturbild, reich an Formen und Farben, an wunderbarer südlicher Schönheit – aber sie trafen auch das gebrochene Auge des Erschlagenen, den jetzt treue Hände in das letzte irdische Gewand hüllten, sie glitten über tiefernste Stirnen und fest zusammengepresste, bärtige Lippen.
Nesbitt hatte den Matrosen gesagt, was inzwischen geschehen sei und ihnen geraten, sich zu fügen.
„Diese Piraten sind ein grausames, gewissenloses Volk“, schloss er, „und da der Mord, die Beraubung am Ufer einer freien, von keiner europäischen Macht beschützten Insel stattfanden, so besitzen wir keine Gerichtsbarkeit, die uns einen Rückhalt böte. Es ist klüger, im Augenblick zu gehorchen.“
Und in Padang zu flüchten!, setzte Richard hinzu, aber nur in Gedanken.
Sie erzählten flüsternd die Entdeckung der zahlreichen Schiffsgegenstände unter dem Bambusschuppen des Dorfes und zeigten dem Steuermann einen schwarzen frischgetünchten Fleck auf den Wasserbehältern. „Dort steht der Name ,Engellina‘, Mr Nesbitt, aber das Ganze ist überschmiert mit einer Art Teig, der sehr hart zu werden scheint; man muss ihn abschlagen, um den Namen lesen zu können.“
Der Steuermann sah auf. „Das Wort war also eingepresst?“, fragte er.
„Ja – mit deutlicher Schrift.“
„Gut“, nickte Nesbitt, „gut, jetzt lasst nur nicht merken, dass ihr es überhaupt wisst. Wir müssen die Schufte sicher machen.“
Er selbst nähte die Leiche seines gemordeten Kapitäns in das Segeltuch und band einen kleinen Sack mit Steinkohlen an die Füße, dann legten Mitchell und er den Körper auf ein Brett, während sich die Weißen im Hinterteil des Schiffes versammelten.
Wie vom Wind unter Deck gewirbelt, verschwanden bei diesen Vorbereitungen urplötzlich die Gelben. Vielleicht glaubten sie, dass ihnen die Götter der Weißen gefährlich werden könnten, vielleicht fürchteten sie Zaubersprüche bedenklicher Natur, kurz, sie waren unsichtbar geworden, ehe noch die Leichenfeier begann.
Nesbitt unterdrückte einen Seufzer des ohnmächtigen und gerade deshalb umso bittereren Grolles. Fünfzig Schritte weit entfernt lag das grüne Ufer mit seinen uralten Baumriesen, unter deren Schatten ein Grab so leicht hätte gegraben werden können, um dem Toten eine Ruhestätte zu gewähren, aber das würden die Malaien niemals gestattet haben. An Land gehen durften ihre Gefangenen nicht; darum zu bitten, wäre verlorene Mühe gewesen.
Und so nahmen sie die Mützen ab, um das Vaterunser zu beten. Nesbitt sprach nur wenige kurze Worte: „Du warst uns ein freundlicher gerechter Herr, Lionel Vaughan, du wolltest das Beste und hast es ausgeführt, so weit deine Kräfte reichten – möge dich der himmlische Vater richten, wie du selbst zu richten pflegtest, gütig und milde. Amen!“
„Amen!“, wiederholten einstimmig die Matrosen.
Leise wurde das Brett an Stricken bis zu den weißschäumenden Wellenhäuptern herabgelassen, und dann empfing das Meer den entseelten Körper des Gemordeten.
Als die Malaien sahen, dass die Weißen auseinander gingen, wurde ein hängendes Brettergerüst an der Galion herabgelassen und der Name ‚Elisabeth‘ überpinselt; das Gleiche geschah mit den Booten, die an den Längsseiten in ihren Tauen hingen. Später, nachdem die schwarze Grundfarbe notdürftig getrocknet war, erschien an der Stelle des Namens das plump gearbeitete Bild eines Krokodils.
So war die Umänderung äußerlich vollzogen, und der Dienst nahm seinen gewohnten Fortgang. Die beiden Anker rasselten empor, das Schiff bewegte sich und glitt wie eine Möwe über die Stelle hinweg, an der auf tiefem Grunde sein erschlagener Führer tot gebettet lag. Langsam entschwand das waldige Ufer dem Blick, neue kleine Inseln tauchten auf und blieben in der blauen Flut, gleich Meilensteinen am Wege, einsam zurück.
Nesbitt handhabte in der Kajüte des Kapitäns Karten und Instrumente, mit denen Radscha Karoldi nichts anzufangen wusste, aber der Versuch, anstatt nach Sumatra nach Madras zu steuern, schlug fehl.
„Du irrst, Faringi“, sagte mit spöttischem Lächeln der Malaie, „betrachte nur den Kompass. Wir Morgenländer besaßen ihn vor den Europäern, wie dir bekannt sein dürfte.“
Und Nesbitt ergab sich; es war an kein Entrinnen zu denken.
Die Mannschaft hatte jedoch, was den Dienst betraf, keinen Grund zur Klage, obwohl die an Bord umherlungernden Malaien ihr alle Arbeit ausschließlich überließen. Jeder dieser zerlumpten Burschen hielt sich für den Abkömmling irgendeines Radscha oder sonstigen Würdenträgers, keiner mochte auch nur die Hand aufheben; sobald sich jemand fand, der die Sache für ihn verrichten konnte, nahm er keinen zu Boden gefallenen Gegenstand selbst wieder auf.
Nur rauben, morden und Krieg führen, betrügen, wo es eben möglich war, hielten sie für ihrer würdige Beschäftigungen, während alles andere den Sklaven, im vorliegenden Fall den Weißen, überlassen blieb.
Palo kochte seinen Genossen den gewohnten Reis mit den vielen heißen Gewürzen und bereitete für die Weißen Pökelfleisch und Erbsen, aber Rum gab es nicht mehr, diesen und den Sherry des Kapitäns ließen sich die neuen Besitzer des Schiffes selbst schmecken.
„Jetzt müssen wir Sumatra in wenigen Tagen erreicht haben“, meinte Richard, „dann gilt es, eine Gelegenheit zur Flucht zu erwischen. Auf den Walfischfang begebe ich mich keinesfalls.“
„Ich auch nicht“, versicherte Oskar. „Lieber gleich in das Meer!“
„Hört, Kinder“, flüsterte Dick Poggins, jener Matrose, der sich so sehr vor dem Gegessenwerden fürchtete, „hört, Kinder, ich habe einen Plan!“
Die beiden jungen Leute horchten auf. „Nun, Dick, heraus damit! Wenn es etwas Gutes ist, so sollst du einen Orden haben.“
„Nicht wahr? Den Puddingsorden mit Schleifen von Knackwürsten, ich weiß schon. Seht einmal her – kennt ihr das hier?“
Er sah vorsichtig nach allen Seiten, stellte sich im Logis mit dem breiten Rücken gegen die Tür und zog unter der leinenen Jacke hervor eine bunte Fahne, die er vorsichtig entfaltete. „Kennt ihr diesen roten Ball, Kinder? Ich habe ihn gerettet, als die Heiden alle Flaggen verbrannten.“
„Das Notzeichen“, sagte Richard. „Wolltest du es hissen, wenn uns ein Schiff begegnet?“
„Oh bei Jingo, das lasse ich bleiben. Uns alle hätten die Haifische verspeist, ehe fremde Leute an Bord kämen – aber im Hafen, da soll das Ding aus dem Versteck hervor. ,In distress, want assistance‘ (,In Not, erbitten Beistand!‘). Die Eingeborenen führen solches Notzeichen niemals. Dass sie es unter den Übrigen nicht vermisst haben, beweist schon ihre Unkenntnis.“
Er verbarg das kostbare Tuch wieder auf der Brust und lachte lautlos. „Damit hetze ich den gelben Menschenfressern die Engländer auf den Hals“, sagte er leise. „Meiner Mutter Sohn will ihnen seine Fäuste gehörig zu schmecken geben.“
Es war durch dieses Gespräch einige Hoffnung in die Herzen zurückgekehrt; namentlich als der die Insel Sumatra umgebende Kranz kleiner, überaus reizender Inseln erreicht war. Die meisten waren unbewohnt, nur selten erschienen malaiische Dörfer dem Blick, dafür bot die Küste eine malerische, wahrhaft erhabene Schönheit. Vom Mittelrücken des Landes zog sich ein hoch bewaldeter Gebirgskamm, nach allen Seiten verzweigt, bis zum Meer herab, während aus dem prächtigen Grün einzelne hohe, von weißen Rauchwolken umgebene Vulkane majestätisch aufragten.
Während der Fahrt hatten die Malaien dem Krokodil am Bug des Schiffes noch einen zweiten Anstrich zukommen lassen und nun hielten sie sich für vollkommen sicher. Die ganze Küste von Sumatra, sowohl auf dem freien, als auf dem von den Holländern eroberten Gebiete wurde ja ausschließlich von Leuten ihres Volkes bewohnt, sie konnten also, wie es viele reiche Händler taten, ein europäisches Schiff gekauft und weiße Mannschaft angeworben haben.
Dennoch beobachteten sie Vorsichtsmaßregeln, die den Verkehr mit dem Lande sehr erschweren mussten. Hinter dem grünen Ufer einer der Inseln vor Padang wurde Anker geworfen, und eines Tages fuhr Karoldi im großen Boote, nur begleitet von seinen Landsleuten, zur Stadt, während zwanzig oder dreißig Malaien zur Bewachung an Bord zurückblieben.
„Was ist das?“, raunte Dick.
„Wenn wir hier liegen bleiben – dann gute Nacht, Hoffnung!“
„Das ist aber unmöglich, die Vorräte sind ja fast ganz verzehrt, wir haben nur noch für etwa acht Tage Wasser an Bord.“
„Aber auf der Insel fließt genug. Diese schurkischen Gelben sind alle miteinander verbündet, ihr sollt sehen, wir bleiben hier liegen.“
Die Stunden dieses Tages wurden endlos lang. Von der übrigen Mannschaft dachte keiner an das gefährliche Wagnis einer Flucht, nur die beiden Steuerleute, Richard, Oskar und Dick Poggins wollten das Schiff verlassen, ehe es die neue Fahrt antrat.
Der Abend brach herein, die ersten Sterne erschienen am Himmel, da ruderten mehrere Malaien das Boot wieder an die Fallreepstreppe. Karoldi sprach mit schwerer Zunge, er hatte zu viel getrunken und stolperte bei jedem Schritt. „Alles in Ordnung“, rief er, „Lahoul besorgt uns die Vorräte, Fässer, Pfannen, Lebensmittel, Harpunen. Hai! Hai! Die Geschichte geht gut.“
Richard und Oskar sahen einander bestürzt an.
Der berauschte Malaie schlief wie ein Stein, während die Übrigen miteinander flüsterten. Den beiden Steuerleuten war die Gelegenheit zum Entkommen jetzt abgeschnitten.
„Damn it!“, raunte Dick, „soll ich so viele von den Schuften niederboxen, wie meine Faust erlegen kann?“
„Um des Himmels willen nicht. Erst lass uns sehen, was sie tun wollen.“
Am folgenden Tag erschien eine große Prau und brachte wenigstens acht Säcke Reis, während von sonstigen Lebensmitteln, namentlich von Fleisch und Schiffszwieback nichts zu entdecken war. Am zweiten Morgen folgte eine gleiche Ladung, begleitet von Gewürz und etlichen Branntweinfässern, die gleich in der Kapitänskajüte ihren Platz fanden.
„Habt ihr’s gesehen?“, flüsterte Dick. „Den Kinderbrei sollen wir täglich dreimal schlucken, womöglich gar ohne Löffel, so hupp, zwischen drei Fingern, wie meine Großmutter selig die Prise aus dem Döschen nahm. Hölle und Teufel, ich wollte, ich wäre ein Stier und könnte die Schwefelbande mit den Hörnern niederrennen!“
Keiner antwortete ihm. In der Eisregion weder Fleisch noch Rum zu erhalten, war allerdings eine bedenkliche Aussicht.
Mit dem neuen Morgen erschienen zwei malaiische Prauen, die beide Kohlen geladen hatten. Jetzt mussten die Weißen schwer arbeiten, während ihre Gebieter abwechselnd zur Stadt fuhren und sich’s wohl sein ließen.
Von derartigen Ausflügen kehrten sie jedes Mal völlig berauscht zurück.
„Nun fehlen noch die Geräte für den Walfischfang“, raunte Dick, „dann heben wir die Anker und – segeln ab.“
„Ich nicht. Lieber sterben!“
„Pst!“, unterbrach Richard. „Habt ihr gestern Morgen den kleinen Dampfer mit der englischen Flagge bemerkt?“
„Den blauen? Es ist die Barkasse von einem Kriegsschiff. Was die hier wollen, mag der Himmel wissen.“
„Hm, vielleicht ist die Sache nicht so rätselhaft. Die Fregatte macht eine Fahrt zu wissenschaftlichen Zwecken und hat ihre Barkasse mit zehn oder zwölf Mann ausgeschickt, um hier das Inselgebiet zu erforschen. Heute war der Dampfer wieder ganz in der Nähe.“
„Und du meinst, dass wir ihn anrufen könnten?“
„Wenigstens wollen wir’s versuchen. Ich gebe dir ein Zeichen, Dick!“
Der Matrose eilte wieder zu seinen Kohlenkörben, während alle Malaien in der Kajüte zechten. Sämtliches Geld, um in Padang eine Schiffsladung von Kaffee, Vanille und Kampfer zu kaufen, viele Tausende hatten sie bei der Erbeutung des Schiffes in des Kapitäns Schränken aufgefunden, davon ließ sich tüchtig trinken und faulenzen.
Ein eintöniger Gesang begleitete das Aufwinden der schweren Körbe. Menschen und Gegenstände waren mit einem feinen schwarzen Staub bedeckt, prasselnd fielen die Kohlen hinab in den untersten Raum des Schiffes.
Die Sonne stand bereits schräg, für heute war alle Arbeit beendet. Aus dem dunkeln Gebüsch einer der Inseln glitt ein zierlicher kleiner Dampfer hervor und kam ganz in die Nähe des ‚Krokodils‘ – ein Boot wurde ausgesetzt, mehrere Männer ruderten an Land und begannen dort irgendetwas zu suchen, wahrscheinlich Muscheln, Steine oder Pflanzen. Sie unterhielten sich sehr lebhaft in englischer Sprache; einer hatte einen Feldstuhl mitgebracht, legte eine Mappe über die Knie und fing an zu zeichnen. Besonders das ‚Krokodil‘ schien seine Aufmerksamkeit zu erregen, er deutete mehr als einmal mit dem Bleistift hinüber, er sagte vielleicht ärgerlich: „Da haben sich diese Gelben ein europäisches Schiff gekauft und Christen in ihren Dienst genommen! Was doch der Reichtum nicht alles kann!“
„Dick“, flüsterte Richard, „nun ist es Zeit.“
„Well! Aber siehst du nicht den Hundesohn, den Palo da bei der Kombüse herumlungern? Er ist als Aufpasser hier.“
„Dann musst du ihn in der Küche einen Augenblick beschäftigen. Gib mir hinter den Tanks die Signalflagge.“
„Du willst also in den Mast steigen?“
„Natürlich! Deinen Fäusten gegenüber hat der Gelbe mehr Furcht.“