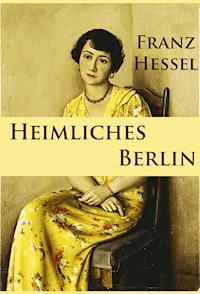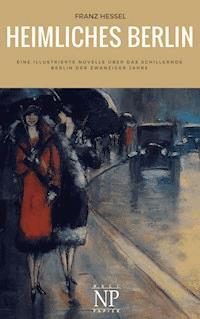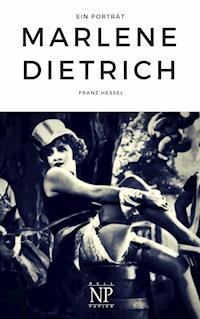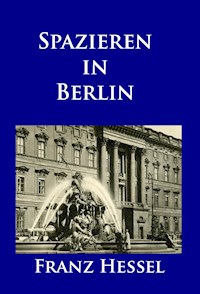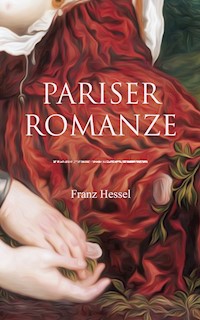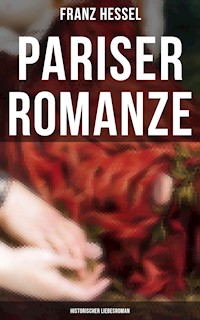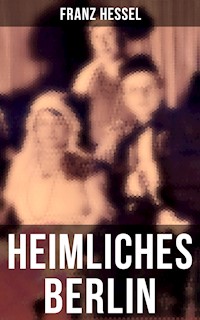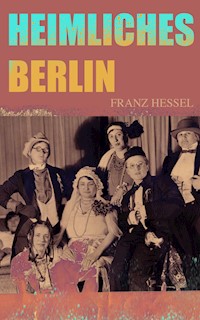0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Franz Hessels Buch 'Der Kramladen des Glücks' taucht der Leser in eine Welt voller Poesie und Melancholie ein. Hessel erzählt die Geschichten des Alltags auf eine authentische und einfühlsame Weise, die den Leser dazu bringt, über die kleinen Freuden des Lebens nachzudenken. Der literarische Stil des Autors ist geprägt von einer feinen Beobachtungsgabe und einer ruhigen, aber tiefgründigen Sprache, die die Leser in ihren Bann zieht. Das Buch reflektiert die Atmosphäre des frühen 20. Jahrhunderts und zeigt die Sehnsucht nach Schönheit und Glück in einer sich verändernden Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Kramladen des Glücks
Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Erstes Buch
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
Inhaltsverzeichnis
Es war früher Morgen. Der kleine Gustav saß allein und herrlich auf dem hellen Holz des Fußbodens. In der Luft war noch Staub und süßer Duft des gestrigen Festes, von dem er im Einschlafen Tanzmusik und Lachen gehört hatte.
Er sah empor zur Decke. Da hingen die bunten Ballons, die gestern die Tafel überschwebt hatten. Sie wedelten und winkten mit den kurzen Bindfäden. Und einer kam nun langsam ein Stückchen herab, herab zu ihm. Das Kind sah unablässig hinauf. Wie schön sie waren, die runden Sonnen, die bunten kreisenden Sonnen.
Da wehte ein frischer Luftzug herein. Und in duftigen Morgenkleidern kamen große Mädchen. Eine hob ihn auf an ihrem Kleid entlang bis an ihre Brust und küßte ihn und hob ihn noch höher. Da streckte er den Arm aus und erreichte den Faden des sinkenden Ballons. Und langsam zog er die Schimmerkugel näher. Am Ende würde sie singen wie der große Tanzkreisel vom Weihnachtsfest. Er wollte sie streicheln und griff zu.
Da klebte was Widriges an seinen Fingern und schrumpfte und ward ein garstiges altes Gesicht. O, Ekel! Ekel!
Gustav heulte so unartig, daß das große Mädchen ihn ärgerlich auf den Boden setzte und fortlief. Er heulte weiter und hielt die klebrigen Finger gespreizt in die Luft.
Es war ganz recht und begreiflich, daß nun auch noch der böse Mann kam. Er stand erst nur in Hemdärmeln an der Tür und spuckte in die Hände. Dann hob er den einen Fuß. Daran war ein Klotz mit einer lappigen Bürste. Er setzte ihn nieder und glitt hastig ruckweise über das Parkett hin und mit dem andern Bein rückte er immer nach.
So kam er gleitend und rutschend näher, furchtbar langsam näher und grinste. Er wußte wohl schon, daß Gustav sich nicht rühren konnte. Er ließ sich Zeit. Aber noch ehe er ganz nahe war, erschien die Mutter. Die trug das zitternde Kind aus dem Bereich des Bohners fort.
Herr Behrendt hob seinen kleinen Gustav empor und setzte ihn auf das Lederkissen des Drehschemels.
Ein beflissener Kommis schraubte den Sitz in die Höhe, so daß Gustav nach einigen lustigen und schwindligen Kreisfahrten so weit emporkam, daß er seine runden Händchen auf das Pult legen konnte. Nachdenklich besah er, was auf dem Pulte zu sehen war.
Ihn freuten die roten, blauen und schwarzen Linien des aufgeschlagenen Kontobuches. Und er fuhr mit dem Zeigefinger der Linken langsam und sorglich an einer Vertikalen entlang. Die suchende Rechte aber fand und griff einen großen Bleistift, mit dem es ihm gelang, rote Strichlein und Punkte auf das Papier zu bringen. Als er bemerkte, was so ein Stift leistete, wurde er wilder und zog so heftige Linien, kreuz und quer, irr und schief übers Blatt, daß ihn der Vater eilig herunternahm. Der Entthronte zeichnete noch eine Weile in der Luft weiter. Dann sah er den Vater vorwurfsvoll an und ließ den Bleistift fallen.
Während Herr Behrendt zu seinem Schreibtisch ins nächste Zimmer ging, übernahm der alte Kontorbote Carow den Kleinen und führte ihn zur großen Presse.
Gustav sah den Alten an blinkenden Griffen hantieren und freute sich, wie die Schicht der Papierbogen zu den vielen schwarzen Zähnlein emporstieg.
Das Schwerzusammengedrehte kurbelte Carow leicht und munter los und zeigte dem erstaunten Kinde auf einem Bogen das blaue Wunder der Kopiertinte.
Ein schrilles Klingeln erscholl, und dann rief der Vater. Gustav lief zu seinen Knien und wurde auf den Schoß gehoben. Ein blanker Stab kam ihm mit zwei Schlünden an Ohr und Mund. Darin wehte und sang erst der Wind wie in den Telegraphenstangen der Chaussee, an denen er auf dem Sonntagsspaziergang lauschen durfte. Und dann mit einnemmal war die Stimme der Mutter da, ganz nah. Gustav schaute sich um, wurde ängstlich: nur ihre Stimme war da und war nur in dem Schallding in des Vaters Hand.
Der Vater lachte und sagte: „Sprich doch zur Mama. Sie ruft dich.“
„Mutter,“ rief Gustav, „ich will zur Mutter.“
Und nun wollte er gleich heimgebracht werden, mochte nicht mit den kleinen Säckchen voll verschiedener Getreidekörner spielen, die als Warenprobe auf dem Schreibtisch standen und deren Art und Herkunft Herr Behrendt gern seinem kleinen Sohne erklärt hätte.
Die kränkelnde Mutter war meistens in dem dunklen Hinterzimmer, wo die Betten der Eltern standen.
Da war das Licht des Tages verhängt von grünen und grauen Vorhängen. Als Gustav diese einmal neugierig zurückstreifte und auf Zehenspitzen stehend an das niedere Fensterbrett langte, faßte er an große irdene Töpfe. Darin waren Tulpenzwiebeln, die er dann oft betrachtete und zaghaft berührte. Daß solche verschlossene Blätter Blüten bargen, erfuhr er erst viel später.
Am Betthimmel des elterlichen Lagers entdeckte er früh mit Erstaunen und Andacht zwei schwebende goldne Engel. So oft die Mutter ihn aufhob, sah er die Engel an. Dann regten sie sich und strebten zur Decke empor. Und die Schlangen der großen Hängelampe ringelten und züngelten aus der Mitte des Zimmers zu ihnen hinüber. Der Spiegel drüben auf der Toilette strahlte ihren Glanz in fließendem Glasgold zurück. Von der Kommode sahen die beiden Gipsbüsten mit weißen Augen nach ihnen. Die Engel schwebten hoch oben.
Aber einmal fragte Rudolf, der ältere Bruder, die Mutter, neben deren bunten Schuhen er auf der Fußbank saß — Gustav saß auf ihrem Schoß —; „Mutter,“ fragte er und sah mit großen braunen Augen empor, „was tun die Engel?“
„Sie fliegen und heben den Vorhang empor.“
„Aber sie können doch gar nicht fliegen, sie sind ja festgeklebt“, wußte Rudolf.
„Du bist ein Naseweis“, sagte die Mutter.
Aber er behielt doch recht, der Bruder Rudolf. Und von nun an hingen die armen gelben Engel angeleimt und konnten nicht hinab noch hinauf.
Im Garten hatte Gustav einen Lieblingsplatz, einen Rasenfleck nicht weit von der Laube, wo die Erwachsenen saßen, und ganz nahe bei dem Beet mit den Stiefmütterchen, die ihn anblickten wie Gesichter.
Von da schaute er den Spielen der älteren Kinder zu. Die Jungen jagten an ihm vorüber, ohne ihn anzusehn. Die Mädchen lachten ihm zu und klatschten für ihn in die Hände.
Manchmal blieben sie auch bei ihm und nahmen ihn auf den Schoß. Aber nur eine verstand es, ihn richtig zu setzen. Das war die große braunhaarige Bertha. Bei ihr saß es sich still und sicher. Sie schaukelte nicht hin und her. Sie schwatzte nicht zu ihm, wie die andern, kichernd unverständliche Lustigkeiten. Sie ließ ihm ihren Schoß und sprach inzwischen da oben ruhig weiter. Gustav sah bedächtig zu ihrem Hals und Mund hinauf.
Aber es gab da eine kleine Goldblonde, rund und flink wie ein Kätzchen. Sie wurde Miez genannt. Die mochte es nicht, daß er so behaglich saß, und störte ihn mit Erschrecken und Kitzeln und tausend niedlichen Quälereien aus seiner Ruhe auf.
Schließlich wurde es ihm dann zuviel und er verließ den Schoß der Bertha, um der Neckerin Miez nachzulaufen. Die war viel schneller, und der Wettlauf endete meist damit, daß Gustav auf die Nase fiel und weinte. Dann kam die Miez und war gut und zärtlich zu ihm. Aber so mochte er sie gar nicht. Es war ihm lieber, wenn sie lief und ihn auslachte. Zum Gutsein war ja die große Bertha da.
Draußen war Sommer. Aber die Mutter konnte nicht mit in den Garten. Darum blieb Gustav am liebsten bei ihr.
Sie saß am Fenster im Lehnstuhl auf vielen Kissen. Die Gardinen blieben heruntergelassen vor den weit offenen Scheiben. Gustav saß neben den Füßen der Mutter auf der kleinen Fußbank.
Den ganzen Vormittag floß das Licht in einem schmalen Trichter grauglänzend herein. Darin tanzten immerfort tausend Stäubchen rund herum.
Manchmal kam der Bruder Rudolf herein und rief ihn hinüber ins Kinderzimmer, die Damen und Ritter anzuschauen, die er für sein Theater bunt bemalt und ausgeschnitten hatte. Aber Gustav sah die Puppen kaum an und lief wieder zurück zur Mutter und zu dem Sonnentrichter.
Draußen war Winter. Die Mutter saß immer noch am Fenster. Die Gardinen waren jetzt hochgezogen vor beschlagenen Scheiben. Weiße Blumen und Blätter sah das Kind eines Morgens in der Scheibe schimmern. „Reif“ nannte das die Mutter und sagte dazu das Wort „schön“. Dies vornehme gedehnte Wort blieb lange Zeit in seinem Geist mit der unbestimmten Vorstellung von etwas Außergewöhnlichem verknüpft.
Das Kind war krank. Sein Bett stand neben dem Lager der Eltern an der Seite, wo die Mutter lag. Da war sie über ihm in ihren Kissen wie in weißen Wolken.
Halbe Tage lang brannte die kleine Lampe mit dem grünen Schirm; und die Schlangen der dunklen Hängelampe ringelten nun nach unten zum Licht. Gesicht und Hände der Mutter waren immer von Schatten bedrängt. Sie kam und verschwand in einem Nebel. Und war sie fort, so fürchtete sich Gustav vor den Dingen, die im Finstern sind.
Die Gestalten der Menschen, die kamen und gingen, warfen Riesenschatten, die sich an Wand und Decke reckten und bogen.
In diesen Fiebertagen faltete die Mutter zum erstenmal Gustavs Hände und lehrte ihn das geheimnisvolle Wort „Gott“ sprechen und Gott bitten, er möchte ihn wieder gesund machen. Gustav meinte, der dunkelbärtige Mann, der ihm den Puls fühlte und in den schmerzenden Hals den Löffel zwängte, der wäre Gott. Der konnte also die Worte seines Gebetes hören, ohne sichtbar zugegen zu sein. Er sah ihn also immer. Der im Dunklen.
Das Kind wagte kaum zu weinen, wenn man ihm die ekle Medizin eingab, oder wenn die Lampenschlangen in seinen Fiebertraum rollten. Die Tränen, die ihm wider Willen in die Augen traten, küßten die gütigen Lippen der Mutter fort, eh Gott sie sah.
II
Inhaltsverzeichnis
Vater, Mutter, Rudolf und Gustav saßen auf den dickwulstigen Sofakissen in dem schmalen Wanderzimmer, an dem all das Grün und Blau der weiten Welt vorbeikreiste. Hohe Stangen glitten plötzlich auftauchend am Fenster hin. Rauchwolken trieben dick und düster und weiße Wolken licht und fern. Manchmal wurde der ganze Raum eng und dunkel unter drückenden Wölbungen.
Das rasche Gleiten war sehr angenehm; aber wenn es dann langsamer wurde und immer langsamer und der Zug schließlich in tönender Halle mit einem Ruck, der einen zurückwarf, stehen blieb, dann wurde dem Knaben beinahe übel. Die Mutter nahm ihn auf den Schoß und wiegte ihn leise: das war noch süßer als das Gleiten.
Er sah hinaus in die wandernden Wiesen und sah Kühe darauf lagern und Schafe umhergehen und Kühe und Schafe mitgedreht und fortgezogen mit dem wechselnden Bild. Zuletzt kam die Sonne drüben ganz nahe an die Erde, er konnte sie sehen, ohne ans Fenster zu rücken, und sie wurde immer größer und runder als rund und legte ihren Goldschein auf Hände und Wangen der Eltern, und ihr Gold, finß floß durch die Locken des Bruders, der am Fenster kniete und unverwandt hinaussah.
Nachts in dem ungewohnten Hotelbett träumte Gustav, die Mutter höbe ihn auf und trüge ihn fort aus dem Haus. Sie hatte einen langen wallenden Mantel. War es nicht der, den sie immer um die Schultern nahm, wenn sie abends ins Theater ging und ihr Kind noch zum Einschlafen küßte? Aber jetzt wehte er hoch auf und es waren zwei schwarze Flügel. Und sie waren beide, die riesengroße Mutter und er, fort vom Boden und schwebten hoch. Er fürchtete sich, sie anzusehen und schloß die Augen. Und wenn er sie von Zeit zu Zeit wieder ausschlug, sah er unten die riesigen Stangen der Bahnfahrt aufstehen, stehen und nach der anderen Seite ab, sinken. Und mit einemmal war es, als kehrten sie sich alle um und verfolgten die Fliegenden. Da stieg die Mutter höher hinauf in ein großes Rauschen hinein.
Und als er aufwachte, war er nicht mehr im Bett, sondern auf einem Schiff über einem Meer. Aber das war noch nicht die Nordsee selber, sagte der Vater, denn in der Ferne war wieder Land zu sehen. Dahin sahen die Menschen auf dem Schiff. Und der Vater hob ihn hoch und zeigte ihm die Insel, wohin sie fahren wollten.
Die Insel wurde immer größer, bekam Berg und Tal und allerlei Farbe. Dächer wurden deutlich zwischen den Bodenwellen, ein Turm wuchs spitz in die Höhe. Und zuletzt stieg aus dem Wasser eine Brücke. Darauf liefen Leute umher und winkten und faßten nach dem fliegenden Tau.
Nun lärmte das große Rad unten im Schiff und das Wasser wurde schaumweiß wie Seifenwasser in der Waschschüssel. Man stieg ans Land.
Das Häuschen gehörte dem alten Kapitän mit dem Wettergesicht und der Tabakspfeife. Der erzählte den Knaben seine Abenteuer in den chinesischen Gewässern, wo das Meer so laut heult, daß man auf der Kommandobrücke die eigne Stimme nicht hören kann. Auch vom Klabautermann und Gespensterschiff wußte er Geschichten, die Rudolf sehr gern hörte. Gustav mochte sie nicht besonders leiden, am wenigsten abends vorm Schlafengehen. Das erinnerte ihn zu sehr an den Mummelux: so nannte seine alte Hanne den schwarzen Mann.
Vorm Häuschen war die Straße mit Ziegelsteinen gepflastert. Die waren lustig rot. Darauf spazierte man in hellen Strandschuhen.
Am Strande baute Rudolf eine Sandburg und Gustav mußte mithelfen. Aber er legte sich lieber in die Düne und ließ den feinen Sand durch die Finger rinnen und stach sich ein wenig mit Lust und Weh an den spitzen Gräsern. Oder er suchte unten am Meer Muscheln und glatte Steine, die er der Mutter brachte. Das Meer selbst, dies viele weite Wasser, blieb ihm einstweilen unheimlich, während Rudolf oft auf den Spaten gestützt ganz verloren und ergriffen hineinschaute.
Eines Abends — es war hohe Flut, und in der Ferne spritzte der Schaum bis zu den Sternen hin, auf — fragte Rudolf den Vater: „Wohnt Gott da oben auf dem letzten Stern?“
„Gott ist überall“, sagte der Vater.
Da bekam der kleine Gustav aufs neue Furcht vor diesem unheimlichen Doktor Überall und schlich zur Mutter.
Nachts im Traum ging er vom Strand heim. Und mit einemmal kamen die Riesenwellen wie schreiende Krieger des furchtbaren Gottes hinter ihm her, sie schwemmten die Düne an, rannen an den Ziegelsteinen der Straße entlang und flossen gierig leckend in den Garten und ihm in Schuhe und Strümpfe.
Und im Halberwachen betete er zu dem bösen Gott um Gnade und versprach ihm den großen bunten Ball zum Opfer, wenn er seine Wellen heimrufen wollte. Als er dann wach war und sich sicher in seinem Bett fand, war er froh, daß er nicht den kleinen neuen Gummiball versprochen hatte, mit dem sie jetzt immer spielten, und daß sich der gute Gott mit dem großen bunten, der nach mehr aus, sah, aber schlechter sprang, begnügte.
Dies Opfer warf er dann am nächsten Morgen heimlich und etwas abseits — denn er schämte sich vor den andern — in das ebbende Meer, das ihn verschluckte.
Aber er behielt eine dunkle Furcht vor dem Meer. Und wenn man ihm alle Kleider auszog und ihn in die bösen Wellen führte — der sonst so milde Vater war da unerbittlich streng — dann weinte er leise und zitterte. Ihm war bange, es möchte die große Hand des Gottes Überall von unten aus dem Meer nach ihm langen.
So oft er durfte, blieb er nun bei der Mutter, die immer seltener mit an den Strand kam und tagelang in vielen Kissen und Decken in der Sonnenecke des Gartens saß.
Die Gestalt der Mutter war anders geworden, sie trug weite Kleider, und Gustav durfte nicht mehr auf ihrem Schoß sitzen. Er fragte die alte Hanne, warum er das nicht mehr durfte, wo die Mutter doch jetzt viel mehr Schoß hatte, als früher.
„Auf den Schoß kommt das Schwesterchen,“ sagte Hanne, „das der liebe Gott dir schenken wird.“
Die Antwort gefiel ihm nicht sehr.
Und weil er nun selbst nicht mehr auf den Schoß der Mutter durfte, legte er alles, was er Schönes fand, darauf.
Von der benachbarten Wiese holte er die blauen Glockenblumen und den roten Mohn. Aus den blauen Blumen machte die Mutter Kränze, einen für sich und einen für ihn. Die roten band sie mit einem Gras, Halm zusammen, und er mußte sie in ein Glas stecken und an das Fenster stellen, das sie immer aus ihrer Gartenecke ansah.
Manchmal holte er die Blumen auch weiter her. Er ging auf die große Heide, die sich breit und rot hinstreckte zwischen den weißen Dünenbergen bis zum Himmelsrand. Heideblumen brachte er heim, denen gab die Mutter den seltsamen Namen Erika.
Eines Tages ging der Vater mit Gustav spazieren durch das Dorf, dessen niedere Häuschen wie Kniende in den großen Steindämmen staken. Und sie lasen die alten Jahreszahlen über den Türen.
Da fiel plötzlich ein starker Regen. Gustav zog die Kapuze seines Mantels bis über die Augen und ging als Blinder an des Vaters Hand weiter.
Aber der Vater war heut so wortkarg. Und dem Kleinen wurde angst, und zwar nicht um sich selbst, sondern um die Mutter. Er mußte immer denken: Nun sitzt sie im Garten, und es regnet so sehr, daß sie nicht auf kann. Und es gießt und fällt auf ihre Haare und Hände und auf ihren Schoß und auf die Blumen in ihrem Schoß.
Als sie heimkamen, war die Mutter nicht im Garten und nicht in der Veranda. Gustav fragte die alte Hanne: „Wo ist Mutter?“
„Mutter schläft,“ sagte sie, „muß schlafen, bis das Schwesterchen kommt.“
Derweil war wieder klares Wetter geworden. Und Gustav wartete den ganzen Tag im Garten, pflückte viele, viele Blumen und häufte sie alle auf die Kissen und Decken des leeren Stuhles.
Am nächsten Tage um die Mittagszeit traf er wieder die alte Magd und fragte: „Hanne, wo ist Mutter?“
„Der liebe Gott hat Mutter weggeholt. Und das Schwesterchen hat er auch weggeholt in seinen Himmel.“
Da wußte Gustav, daß dieser liebe Gott ein arger Gott war, er machte sich unsichtbar und konnte überall sein, um uns zu belauern und wegzunehmen was wir lieb haben. Aber er mochte noch nicht recht glauben, daß die Mutter schon ganz fort sein sollte.
Und als die andern zum Essen in die Veranda gingen, hielt er sich hinterm Haus verborgen, ob er dem lieben Gott die Mutter nicht doch noch abfangen könnte. Er würde sie ja gewiß hintenherum stehlen über die Gesindetreppe.
Er wartete einige Zeit, dann schlich er ins Haus hinein und tappte den dunklen Flur entlang, bis er in das Zimmer kam, in das die Mutter ihn immer die Blumen hatte bringen lassen.
Dämmerlicht war im Raum und Kerzengeruch. Und in der Mitte erhob sich etwas breit und weiß. Das war ihr Bett. Das stand nun mitten im Zimmer. Und über den Decken sah er aus dem weißen Hemd die gefalteten Hände der Mutter kommen, die weißen Finger und die blauen Schattenästlein auf den Handrücken. Und dann nahm er ihr Gesicht wahr und sah, daß die Augen geschlossen waren.
Ihm pochte das Herz im stillen Jubel, daß Gott die Mutter nicht gefunden oder wieder vergessen hatte. Er holte einen Schemel aus der Fensterecke, wo das Blumenbrett war, stieg hinauf, legte beide Hände auf die Decken und wollte die Mutter rufen. Aber die lag so still, daß er nicht sprechen konnte.
Nun sah er auch, daß die Decken Mund und Kinn verbargen. Ängstlich hob er den Arm, um das Laken zu lüften.
Da schlürften Schritte hinter ihm. Er wurde aufgehoben und sah über sich ein runzeliges Gesicht in dunkeln Tüchern, einen Finger gebietend am Mund.
Aus den Händen dieses Wesens nahm ihn Hanne, trug ihn in den Garten und gab ihm zu essen.
III
Inhaltsverzeichnis
Herrn Behrendt nahm es wunder, daß sein kleiner Gustav nie nach der verstorbenen Mutter fragte. Er hatte doch so sehr an ihr gehangen. Wenn der Vater mit Rudolf, der nun schon das Gymnasium besuchte, der Mutter gedachte, so nahm der Jüngere keinen Anteil.
Er liebte jetzt seine alte Hanne, besonders Morgens, wenn sie aus vielen Runzeln lächelnd an sein Bett kam. Abends war sie ihm weniger angenehm. Er träumte nämlich nicht gut von ihr. Im Traum wurde sie ein Hexenweib. Einmal sah er sie sogar einträchtiglich mit dem Mummelux zusammen sitzen auf einem Steinhaufen und Kinderknochen knacken.
Das lag zum Teil an den gruseligen Geschichten, die ihm die Alte erzählte. Hanne wußte nichts von Feen und Elfen wie der Bruder Rudolf. Sie fing nicht an: Es war einmal vor langen Zeiten, sondern: Wenn du die große Allee in Westend ganz zu Ende gehst, kommst du auf einen kahle unbebaute Wiese. Da ist es abends nicht geheuer ... Oder: in einer kleinen Gasse unten am Hafen wohnt ein böser Schlächtermeister. Das Fleisch ist billig bei ihm. Aber die Mädchen gehen nur ungern dorthin einkaufen. Denn in dem Laden gleich bei der Tür ist eine Falle mit einer hölzernen Klappe zugedeckt ...
Sie wußte von einem Bader, der beim Schröpfen oder Zahnziehen das Blut der Kinder in ein Gefäß auffing und bewahrte. Besonders von dieser Geschichte blieb ein Schauder in dem Knaben. Und als er viel später in anderm Zusammenhang und Sinn das Wort Blutgefäß hörte, war er einer Ohnmacht nah.
Das Wort Blut war ihm zugleich unheimlich und erregend. Hanne hatte ein katholisches Gebetbuch, darin lagen wie ausgeschnittene Klebeoblaten allerlei heilige Bilder: Da war die Schmerzensmutter mit sieben Schwertern im Herzen. Aus dem Herzen fielen ein paar lange schön gestaltete Blutstropfen. Ähnliche quollen aus der Dornenkrone des nackten Mannes, den sie Heiland nannte.
Ob es wohl weh tut zu bluten, dachte Gustav. Und als er einmal allein im Zimmer war, nahm er die Schere von Hannes Nähkasten und ritzte sich am Finger. Mit Andacht und Lust sah er den roten Tropfen quellen.
Freilich, als sich dann die kleine Wunde schloß, blieb von der Freude nur ein verdrießliches Prickeln und Ziehen übrig.
Die alte Hanne sagte: „Morgen schnüre ich mein Bündel und reise fort.“ Aber sie schnürte kein Bündel, worauf sich Gustav schon so gefreut hatte, sondern packte einen großen Strohkorb und eine altväterliche Handtasche. Als sie dann den Knaben zum Abschied küßte, war er erst ganz in dem Anblick der schwarzen faltigen Tasche zu ihren Füßen versunken. Mit einemmal sah er ihr ins Gesicht und fragte: „Gehst du zur Mutter?“
Einige Zeit war Gustav nun ohne Pflegerin. Im Hause mußte Rudolf auf ihn achthaben, im Garten der alte Carow.
Carow wohnte unten am Fluß beim Speicher. Er verwaltete eine große Wage. Darauf legte er links die mächtigen Kornsäcke und rechts kleine Eisenklötze. Und die kleinen Klötze brachten die großen Säcke in die Höhe. Bisweilen durften die Knaben in den Speicher kommen, wurden zwischen die Säcke gesetzt und mitgewogen. Es war schön zu steigen und zu sinken, bis man in die selige Schwebe kam, die Gleichgewicht genannt wird.
Von dem vielen Wägen war Carow wohl so ruhig geworden. Er sprach kaum ein Wort.
Wenn er im Garten arbeitete, schaute aus seiner linken Tasche ein riesenhaftes Butterbrod, aus der rechten ein rotes Tuch.
Gustav sah ihm andächtig zu, wie er aus allen Wegen des Gartens die Herbstblätter zusammen, scharrte zu dem Kehrichthaufen hinter der Laube. Es waren die ersten kalten Tage, und in den Querstäben der Laube knackte der Frost.
Hatte er genug geharkt, dann ging Carow zu den Rosenstöcken und tat Strohkleider um die Stämme für den Winter.
Manchmal hielt er in der Arbeit ein, zog mit magern braunen Fingern das rote Tuch aus der Tasche und wischte sich die Stirn. Dann fuhr er fort, den Sommergarten in eine verhüllte Winterwelt zu verwandeln.
Manchmal sah er zu dem Kinde hinüber.
Vielleicht lachte er ihm zu, vielleicht hatte er nur soviel Falten im Gesicht.
Zu Haus saß der Bruder Rudolf an dem schwarzen Pult und machte Schularbeiten oder las Indianergeschichten. Oder er schnitzte mit seiner Laubsäge aus feinem Holz zierlich durchbrochne Flächen. Dann wieder ging er in den Salon hinüber und spielte Klavierübungen. War er davon müde, so kam er zurück und nahm den „Kopfzerbrecher“, ein Geduldspiel, vor, oder er baute aus dreierlei Steinbaukasten nach einer schwierigen Vorlage ein Haus. Er hatte immer etwas zu tun. Und nachts schlief er gleich ein und schnarchte, als sägte er im Traume weiter.
Gustav nahm des Bruders weggeworfene Theaterpuppen und alte Holz, und Zinnsoldaten, stellte sie vor sich auf den Tisch und sprach leise mit ihnen. Er besah die Bilder in den großen Bilderbüchern und tat so, als könnte er die Verse darunter lesen, indem er mit dem Finger an ihnen entlang glitt.
Aber da er gar keine Freude an Zusammensetzspielen und Flechtwerk und all den nützlichen Dingen hatte, die erfunden sind, um die Kinder lehrreich und unterhaltend im Spiele für das Leben vorzubereiten, so blieben seine Finger ungeschickt.
Am Boden und im Bereich seiner Hände war die Stube ihm lieb und vertraut. Aber darüber begann eine feindliche Welt. Zwischen den beiden Fenstern hing an der Wand ein Spiegel, in dem die Gesichter Tags undeutlich, bei Lampenlicht unheimlich erschienen. Der Rahmen war aus schwarzem Ebenholz und endete oben in einer Fratze, die das Glas einzuschlucken schien.
Die Fenster des Kinderzimmers standen nachts offen. Durch die Spalten der Jalousien glitten oft die dünnen Strahlen des Mondes. Dann konnte Gustav kaum einschlafen. Und fielen ihm die Lider zuletzt vor Müdigkeit zu, so drangen die blassen saugenden Strahlen in seine Träume. Manchmal kroch er im Schlaf aus dem Bett und wachte am Morgen erschrocken in irgendeinem Zimmerwinkel auf.
Einmal träumte er vom Feuer. Er war allein zwischen den Flammen. Die andern hatten sich alle schon auf die Straßen gerettet.
Er stand mit geschlossenen Augen auf, ging durch die Zimmer bis an die Wohnungstür, öffnete sie, glitt die Treppe hinunter und rüttelte am Haustor.
Man fand ihn im Schlaf weinend unten an der Stiege unter der Gasflamme, die nachts das Treppenhaus erhellte.
IV
Inhaltsverzeichnis
Der ältere Bruder war fort zur Turnstunde. Gustav sah aus dem Fenster auf den Hof.
Da unten spielten die Jungen aus dem Hinterhaus. Sie waren viel merkwürdiger gekleidet als er und sein Bruder. Bunte Flecken hatten sie überall auf Jacke und Hose. Sie trugen farbige gewürfelte Halstücher. Mit ihren Fingern faßten sie in alles Seltsame und Neugiererregende, was im Schutthaufen lag und zwischen den Steinen des Hofes sproßte. Er hatte ihnen schon oft mit Sehnsucht zugesehen, und heute, wo niemand auf ihn acht gab, wollte er zu ihnen.
Rasch schlüpfte er die Hintertreppe hinunter. In der Hoftür blieb er stehen. Noch getraute er sich nicht zu den Knaben zu gehen, bis einer von ihnen den Kleinen bemerkte und heranwinkte.
Nun suchte er mit in Müll und Ritzen nach geheimnisvollen Dingen.
Dann wurde Kreisel geschlagen und Murmeln gerollt. Zuletzt spielten sie fangen. Das war das Allerschönste. Die andern waren alle größer und konnten viel schneller laufen als er. Da war es denn wundervoll, mitten im wilden Jagen plötzlich von hinten um den Leib gefaßt zu werden von starken Armen.
Einer war dabei, der lange Wilhelm, der nahm ihn immer in die Höhe, wenn er ihn gefangen hatte, und hob ihn auf die Schulter.
Gustav konnte kaum den nächsten Nachmittag erwarten, um wieder zu den neuen Spielkameraden zu kommen. Als er im Hoftor stand, sah er, daß mehr da waren als gestern.
Einer, den er noch nicht kannte, zeigte mit dem Finger auf ihn und rief ein böses Wort. Und die andern wiederholten es.
Gustav erschrak und fragte den langen Wilhelm, der ihm entgegenkam: „Was ist das, ein Jude?“
Wilhelm lachte gutmütig, drehte sich zu den andern um und sagte: „Er weiß selbst nicht, was er ist.“
Da lachten alle. Dann wurde wieder gespielt wie gestern.
Aber Gustav schlich sich bald fort und kam nie wieder zu den Jungen in den Hof.
Nachts träumte er oft wilde Spiele mit dem langen Wilhelm. Der hielt ihn fest im Arm und preßte ihn so eng an sich, daß das Kind sich nicht regen konnte. Er zog ihn hinter sich her querfeldein durch Wasserlachen und dann durch die Gosse einer breiten halbdunklen Vorstadtstraße und schlappte mit seinen viel zu weiten Pantoffeln.
An einem trüben Morgen mußte Gustav auch so früh von Hause fortgehen wie Rudolf und in die Schule. Er kam auf die nebeldünstende Straße, über der eine kalte rote Sonne hing, vorbei an eiligen blassen Männern und Frauen, und trat in den Hof der kleinen Vorschule, die — ein schmaler Fachwerkbau — neben dem stolzen Stadtgymnasium stand.
Nun mußte er täglich in die häßliche Klasse und hatte seinen Platz in der Bank einzunehmen. Das Ränzel kam ins Schubfach, die Hände auf das schwarzlackierte Brett.
Und dann trat der Herr Lehrer ein, und es hieß aufpassen. Man durfte nicht irgend etwas Anziehendes besehen, die dicken blonden Locken des Arnold Lederer, das spitze Ohr des kleinen Martin oder die Sonnenstäubchen zwischen Fenster und Tafel. Man sollte immerzu in das Gesicht des Herrn Lehrers sehen. Das war wirklich schwer zu machen. Und wenn man hineinsah, wurde man zum Einschlafen müde und hörte kaum noch, was der Mund des Herrn Lehrers vorbrachte.
Das ABC lernte Gustav indessen ganz gern. Die Buchstaben waren so verschieden und jeder neue überraschend. Als die fünfundzwanzig alle vor, und nachgemalt waren, gab es keine neuen mehr. Das war schade, er hätte gerne noch viele, viele Buchstaben gemalt. Statt dessen galt es nun, sie zu Worten zusammenzufügen und eine bestimmte Zeilenhöhe und den Abstand der Worte voneinander einzuhalten. Das war nicht sehr lustig. Er hätte lieber weiterhin jede Buchstabengestalt einzeln aufgebaut.
Schwerer als Lesen und Schreiben fiel ihm das Rechnen, besonders das Multiplizieren und Dividieren. Er hatte kein rechtes Vertrauen zu diesen Operationen und pflegte lange Zeit statt drei mal drei zu lernen, rasch drei und drei und drei zu zählen, wenn die Reihe an ihn kam.
Gustavs rothaariger Klassennachbar Gottschalk lud ihn in seinen Garten ein. Die Mutter gab den Knaben Schokolade zu trinken. Als sie dann ging, fragte Gottschalk: „War deine Mutter gut zu dir?“
Gustav nickte. Der andere fuhr im leisen Tone fort: „Meine ist sehr streng. Wenn ich nicht versetzt werde, geht sie mit mir zum Teich und hält mich so lange unter Wasser, bis ich ertrinke.“
Bei diesen Worten sah er dem erstaunten Kameraden lauernd ins Auge.
Später gingen sie zum Hafen spazieren. Da sollten eigentlich kleine Jungen nicht allein hin. Aber Gottschalk nahm den andern einfach mit.
Er zeigte ihm das große Chinesenschiff auf der Werft. „Siehst du die gelben Teufel klettern? Die lernen hier bei uns. Später kommen sie dann und zerstören ganz Europa.“ Dabei kniff er ihn in den Arm.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: