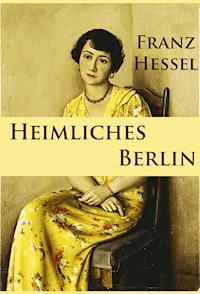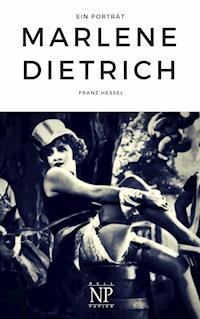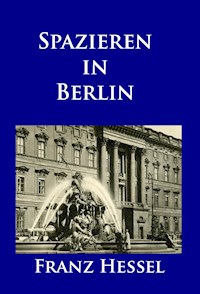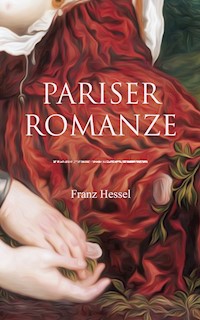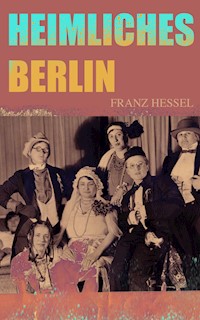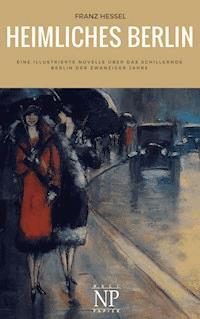
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schlüsselroman aus den Zwanziger Jahren Mit zahlreichen Fotoaufnahmen aus dem Berlin der 1920er. Zwischen den Weltkriegen gibt es nicht nur das arme, düstere, hoffnungslose Berlin eines Hans Fallada, es gibt auch das sprühende, lebendige, promiske Berlin eines Franz Hessel. Die "Wilden Zwanziger", in denen ein Taumel der Freiheit zelebriert wird. In kurzen Fragmenten erzählt "Heimliches Berlin" die ausschweifende Geschichte einer berühmten, und später zu filmischen Ehren gekommen Menage a trois zwischen Hessel, seiner Frau Helene Grund und dem Schriftsteller Henri-Pierre Roche – hier nur notdürftig mit anderen Namen und Berufsbezeichnungen der Protagonisten verschleiert. Bürgerliche und "Drop-outs" der damaligen Gesellschaft, losgelöst von den Standesdünkeln und befreit aus der Korsage des Wilhelminischen Zeitalters, vermischen sich in den Nachtklubs der damals aufregendsten Stadt des Kontinents. Alles scheint plötzlich möglich: Vergnügen, Freiheit, Zwanglosigkeit. Und immer wieder ist man beim Lesen dieses damaligen Szene- und Kultromans überrascht, wie frei die deutsche Gesellschaft vor Hitler war. Und man ertappt sich ein ums andere Mal bei dem Gedanken, wie Deutschland, wie Europa, ohne den österreichischen Gefreiten hätte gedeihen können. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Hessel
Heimliches Berlin
Eine illustrierte Novelle über das schillernde Berlin der Zwanziger Jahre
Franz Hessel
Heimliches Berlin
Eine illustrierte Novelle über das schillernde Berlin der Zwanziger Jahre
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: E. Rowohlt, Berlin, 1927 (182 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-13-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Xll
XIII
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zum Buch
Zwischen den Weltkriegen gibt es nicht nur das arme, düstere, hoffnungslose Berlin eines Hans Fallada, es gibt auch das sprühende, lebendige, promiske Berlin eines Franz Hessel. Die »Wilden Zwanziger«, in denen ein Taumel der Freiheit zelebriert wird.
In kurzen Fragmenten erzählt »Heimliches Berlin« die ausschweifende Geschichte einer berühmten, und später zu filmischen Ehren gekommen Menage a trois zwischen Hessel, seiner Frau Helene Grund und dem Schriftsteller Henri-Pierre Roche – hier nur notdürftig mit anderen Namen und Berufsbezeichnungen der Protagonisten verschleiert.
Bürgerliche und »Drop-outs« der damaligen Gesellschaft, losgelöst von den Standesdünkeln und befreit aus der Korsage des Wilhelminischen Zeitalters, vermischen sich in den Nachtklubs der damals aufregendsten Stadt des Kontinents. Alles scheint plötzlich möglich: Vergnügen, Freiheit, Zwanglosigkeit.
Und immer wieder ist man beim Lesen dieses damaligen Szene- und Kultromans überrascht, wie frei die deutsche Gesellschaft vor Hitler war. Und man ertappt sich ein ums andere Mal bei dem Gedanken, wie Deutschland, wie Europa, ohne den österreichischen Gefreiten hätte gedeihen können.
I
Bis zum Frühjahr 1924 lebte in Berlin ein junger Mensch, dessen Erscheinung die Männer und Frauen seines Bereiches erfreute, ohne dass sie seinem Wesen tiefer nachforschten. Erst als er fortging, erregte er bei einigen ein schwer zu erklärendes Abschiedsweh. Bei denen ändert sich jetzt Miene und Tonfall, wenn sie von ihm sprechen, sie denken oft an ihn und ordnen ihn in Zusammenhänge und Schicksale ein, die er kaum gestreift hat.
Unvergesslich ist Wendelins Auftreten in der Galauniform seines Urgroßvaters, des Kammerherrn von Domrau, an dem Abend bei Margot kurz vor seiner Abreise. Margot hatte gebeten, man solle sich verkleiden. Das hatten aber nur einige von den Frauen ernst genommen, von den Männern außer Wendelin keiner. Zwischen den dunklen Tuchen und bunten Seiden wirkte sein soldatisch enganliegender Rock mit dem verschossenen Braunrot, wie man es nur noch in alten handkolorierten Kinderbüchern findet, farbiger als alles umher; in den engen weißen Hosen, die mit Stegen um die Schuhe griffen, schienen seine Beine nicht durchaus auf dem Boden, sondern beim Gehen und Tanzen in einer Luftschicht zu enden, beim Stillstehen wie auf einem Zinnsoldatenbrettchen zu ruhen. Der hohe Tressenkragen vermehrte die schüchterne Noblesse seiner Haltung und trennte schwertscharf den rotblonden hellhäutigen Kopf vom Rumpfe.
Er trank nur wenig, sah aber schon nach dem ersten Glase Menschen und Dinge in der flächigen Ferne, die ein glücklicher Rausch ihnen gibt, fühlte sich allen, die ihn ansahen, ansprachen, anfassten, wunderbar und gleichmäßig hingegeben, sprach selbst leise und wenig und erwiderte die Berührungen der anderen kaum. So verging ihm der Abend in schöner Undeutlichkeit, und was mit ihm geschehen, erlebte er eigentlich erst, als er am nächsten Morgen erwachte. Schwermütig, weil er bald fort sollte aus einer ihm liebgewordenen Welt, tauchte er noch einmal zurück in die sanfte Brandung des Schlafs und die Tiefe des Traums, erst noch nicht des Augentraums, sondern nur dessen, den Gehör und Geruch, Haut und Blut träumen, er fühlte Weichheit fremder Kissen, duftend aufsteigenden Staub und an der Innenhand nasse Kühle des Weinglases, er roch den Heugeruch in Margots Haar und Karolas Kiefernduft. Dann fing sein Gesicht an zu träumen, und er sah über weggewandten Schultern und nah herschauenden befreundeten Köpfen die Unbekannte, die mit Sebald gekommen war, ihren hohen weißen Federhelm über dem länglichen Antlitz mit den Backenknochen eines heldischen Jünglings. Hatte sie ihn einmal ins Auge gefasst? Zu ihm gesprochen? Er wusste es nicht. Wie war ihre Stimme?
Als er diese Gestalt träumte und genauer und näher träumen wollte, als er anfing Hüften aufzubauen, die er nur im Umriss, nicht in der Tiefe wusste, und nach der Form der Hände schon halb mit Bewusstsein suchte, wachte er ganz auf und fand sich in dem schmalen Holzbett des kleinsten Zimmers der kleinen Pension, die vier Stock hoch über Läden und Kontoren nahe der Friedrichstraße an den Linden lag und wohl noch liegt. Gedämpft und harmonisch klang der wirre Lärm der Stadt herauf; das vielerlei Leben da unten ward zum Herzschlag eines Wesens, das sanft empordrang in seine königliche junge Ruhe auf der armseligen dreigeteilten Matratze des Mietbettes. Er richtete sich auf und stützte den Kopf in die Hand. Auf dem Sessel lag der wunderliche Festrock von gestern und als weißer Fleck darauf der Brief der Mutter, der ihn fortrief von hier.
Die liebe Stadt verlassen! Nicht mehr auf langen Straßen im Laternenschein das Pflaster sehen vor den Schritten der Freunde, nicht mehr Donaths hellgemalte Zimmer voll Holzheiliger, Glastiere, Porzellanchinesen und Spiegel, nicht mehr Clemens’ geneigtes Profil unter der Studierlampe in dem abgelegenen Hinterzimmer, Karola nicht mehr auf dem tiefen Diwan unter dem Bild des strengen Römerkaisers. Und Margot auf der Reitbahn, Margot in ihrem Pavillon! Er machte in Gedanken noch einmal den Weg von gestern Abend, von der Potsdamer Brücke in die stille Nebenstraße, unter das lange Torgewölbe, das dunkle Stück Hof bis zu dem Hühnergarten und die Stiege hinauf ins Parterre des niedrigen Gartenhauses, das vielleicht Überbleibsel eines stattlichen Besitzes an der alten Potsdamer Landstraße war, kam auf den Vorplatz mit den zerbrochenen Steinvasen, an die Holztür – klassisch gefeldert wie Tempeltüren, aber blassgrün altbürgerlich gestrichen –, betrat die Glasveranda, Margots Esszimmer, mit Aussicht auf die grünüberwucherte Nachbarwand, und blieb dann in dem großen, matt erleuchteten, etwas kahlen Zimmer mit der immer zum Tanzen leeren Mitte und den vielen Polsterbänken und Sitzen rings an den Wänden. Da ging Donath bequem und geschäftig in seinem Smoking, der ihn umgab wie ein weiches Hauskleid die reiche Frau. Karola kam wieder im weißen Turban und eng umwunden von weißen Tüchern und fasste ihn an. Sie schien ihn im Tanze zu überwachsen, obwohl sie kleiner war als er. Ihr großer Blick war ihm so nah wie noch nie in den zwei Jahren ihrer Freundschaft. Warum hatte sie ihn dann so plötzlich verlassen? Was redete Margot so eifrig auf ihn ein von einer reichen Fabrikantenfrau, der er den Hof machen müsse? Er hörte nicht genau zu. Er sah ihren Hals rötlich gesund aus dem weitoffenen Kragen des Männerhemds leuchten, die kurzen Bewegungen der graden Schultern, das köstliche etwas zerrissene Innenleder der Hose, die schmalen Füße in den hohen Stiefeln. Sie sprach so energisch mit ihm, als wollte sie ihn ausschelten, und das war angenehm. –
Zoologischer Garten. Der Mamorsaal im Zoo.
›Auf die Reitbahn könnt ich wirklich noch einmal gehen‹ dachte Wendelin. ›Vielleicht macht Margot einen Abschiedsritt mit mir durch den Tiergarten, wenn ich ihr sage, dass ich fort muss.‹ Das hatte er noch niemandem gesagt, gestern.
Mit diesem Gedanken fuhr er aus dem Bett und in ein Paar sehr bunter Hausschuhe, denen es anzusehen war, dass sie nicht fertig gekauft, sondern von liebender Hand gestickt waren. Maja hatte sie ihm geschenkt, Maja von der Tanzgruppe, und das war sehr anzuerkennen, denn sie machte sonst nie Handarbeiten. Maja war seine einzige ›Eroberung‹ in diesen zwei Studentenjahren. Die vielen anderen wohlwollenden Frauen, denen er nahe gekommen war, hatten es gerade an der kleinen Feindseligkeit und Kampfbereitschaft fehlen lassen, die wohl zum Erobern notwendig sein mag. Viele von ihnen glaubten auch, er sei mehr ihrer Freunde als ihr eigener Freund; und wie weit sie damit recht hatten, wusste Wendelin nicht. Nur eben dieses tüchtige Mädchen hatte feindlich mit ihm angefangen und dann leider auch feindlich und plötzlich aufgehört, und er musste sich sagen, dass die Umstände ihr recht und ihm Schuld gaben, obgleich er eigentlich in diese Schuld ebenso unschuldig geraten war wie vorher in Majas Gunst.
Wendelin ging in die Alkovenecke zum Waschtisch. Unter kalten Güssen schloss er die Augen. Das war immer eine selige Minute, mochte er auch vor- und nachher noch so schwermütig sein. Das Frottiertuch tat wohl wie der Mull von Karolas Tüchern.
Es klingelte draußen, und nach einer Weile klopfte es an seine Tür. Rasch zog er den Schlafanzug über und öffnete. Vor ihm stand niemand. In den milchigen Glasscheiben der Korridortür war ein Schimmer, an dem er spürte, dass es Frühling wurde. Und als er dann zur Seite sah, regte sich im Spiegel schräg gegenüber ein pelzener Abhang von winterschläfriger Süße. – Karola wandte sich zu ihm um.
»Gut, dass du da bist«, sagte sie. »Wer weiß wo hin ich gelaufen wäre, wenn ich dich nicht getroffen hätte.«
›Es ist noch nicht Tag‹, dachte er, ›der Traum geht weiter‹ und barg seinen Kopf an ihrer Pelzschulter. Er wäre so noch lange in der Tür stehen geblieben, aber Karola trat bei ihm ein.
»Was für ein jungenhaftes Zimmer du hast!«
»Du kennst es noch gar nicht? Ich war so oft bei dir, du nie bei mir.«
Er tat die große ärmlich geblümte Pensionsdecke über das Bett und holte das Kissen vom Sessel.
»Ja, gib mir ein bisschen zu liegen.«
Sie streckte sich aus, Wendelin breitete ein Plaid über sie. »Das erinnert an Reisen«, sagte sie und schloss die Augen.
Wendelin legte sich zu ihren Füßen quer über das Lager und sah in ihr Gesicht hinauf. Die Lippen waren aufeinander gepresst wie von einem Entschluss, die Brauen zogen sich herrisch und schmerzlich zusammen, aber in die golddunkle Blässe der Schläfen spielte weich und zärtlich das helle Haar.
»Wie geht es dir seit gestern?« fragte er etwas verlegen, als sie die Augen aufschlug. Diese Frage kam ihm selbst töricht vor, aber sie wollte wohl so gefragt sein, denn sie antwortete ausführlich:
»Nicht gut, Wendelin, ich kann nicht mehr so weiterleben, es muss etwas geschehen, ich will fort. Kannst du mir nicht helfen, mit mir verreisen? Unter deinen Onkeln und Vettern sind doch viele Diplomaten. Können die dich nicht ins Ausland schicken? Ich bin dann deine alte Sekretärin. Wenn es drauf ankommt, bin ich sicher ganz praktisch, man lässt mich nur nie etwas Vernünftiges tun. Ich kann gut Englisch und Französisch, sogar etwas Italienisch, und Schreibmaschine, langsam allerdings. Du lachst, mir ist gar nicht zum Lachen. Nimm es lieber ernst, dass ich gerade zu dir komme. Das ist doch sonderbar, da du so jung bist und noch gar nichts bewiesen hast. Aber gestern beim Tanzen fühlte ich, dass du vielleicht der einzige unter uns bist, der noch nicht resigniert, noch nicht weise ist.«
Berlin, Tanztee im »Esplanade«
Er wollte nach ihren Händen fassen, aber sie legte sie unter den Kopf, die Arme auf den Pelz bettend.
»Jetzt siehst du mich an wie mein junger Bruder, der verstorbene. Der hätte es nicht zugelassen, dass ich so verkomme. Weggenommen hätte er mich von denen, die mich verkommen lassen. Das tun sie nämlich alle zu Hause, mein Mann, meine Schwester, mein Kind, Clemens mit seiner ewigen Güte, Oda mit ihrer täglichen Sorgfalt und selbst mein kleiner Erwin – sie erlauben nicht, dass ich etwas Nützliches tue, sie wollen, dass ich immer nur da sei und mich verwöhnen lasse. Als ich mich anzog gestern Abend, um recht gut auszusehen bei Margot, denn bei ihr hat man den Ehrgeiz, möglichst schön und vollkommen zu sein, weil sie selbst so streng mit sich ist, – ihre Kritik ist mir viel maßgebender als die Anerkennung der Männer, die doch fast alle ungenau sind, – als ich mich anziehen wollte und nicht das Rechte fand unter diesen allerlei Tüchern und Schals, die bei uns noch nicht ganz Armen und nicht mehr Kaufenden herumliegen und voll Erinnerungen sind wie alle Reste, ging ich hinüber in das Zimmer, wo das Kind schläft, und geriet über eine Schublade, in der sein Babyzeug zwischen Lavendelkissen aufbewahrt liegt – wozu aufbewahren? Man sollte alles Erledigte verschenken oder verkaufen. Da kramte ich herum; der Kleine wachte auf, hob sich in seinem Bettchen in die Höhe. ›Schläfst du noch nicht?‹ fragte ich hinüber. ›Darf ich dein Kleinkinderzeug anziehen?‹ Und als ich dann vor dem Spiegel anfing, mich weiß zu umwickeln und zu schleiern, fragte der Erwin ganz erstaunt: ›Willst du denn ein kleines Kind werden, Mama?‹›Ja‹, sagte ich, ›ich will noch einmal von vorn anfangen und ganz anders werden.‹ Da sah ich im Glas, wie sein Gesichtchen, das erst gelacht hatte, sich zusammenzog, wie er stutzte vor dem Gedanken, dass ich noch andere Möglichkeiten habe als nur – seine Mutter zu sein.«
»– eigentlich nur Mama. Die richtige Mutter im Hause ist Oda. Ich wollte mir eine Stirnbinde machen. Denn wenn ich nun auch schon kurzes Haar trage, so weiß ich doch nie, soll ich die Stirn nackt zeigen oder das Haar hineinkämmen. Färben müsst ich es auch, ich habe schon weiße Strähnen.«
»Die sind besonders schön in deinem hellen Blond.«
»Oh, sag das nicht, sonst muss ich besonders leiden.«
»Erzähl von der Stirnbinde.«
»Die wand ich mir aus Erwins Babymull und ließ sie in Zipfeln auf die Schultern hängen. Da kam der Clemens hinzu in seinem blauen Schlafrock mit der Pfeife im Mund, die er immer leer raucht, du kennst seine schreckliche Gewohnheit; kennzeichnend ist sie für ihn, die leere Pfeife. Er braucht keinen Tabak, er raucht Illusion. Er ist ganz üppig vor lauter Entsagung. Ich sah mich nach ihm um und fragte: ›Bin ich zu hässlich so?‹ ›Du bist pharaonisch, herrlich wie eine Mumie‹, sagte Clemens. Ist das nicht ein Todesurteil?«
Wendelin streichelte andächtig die Decke über ihren Füßen.
»Und Oda kam und packte mich in den Mantel. Sie ist doch viel schöner als ich und geht nie auf ein Fest. Da führt sie den Haushalt, erzieht das Kind und macht noch obendrein ihre Tapetenmuster und Körbchen und Puppen. Und mich schicken sie weg, ein unnützes Ding, zum Tanzen.«
»Euer Zusammensein ist mir immer vorbildlich erschienen.«
»Ich bin so überflüssig.«
»Du bist die Mitte, du bist der Sinn des Ganzen, bist wie ein Traum der drei anderen.«
»Ach, wenn ich tot wäre, könnten sie besser von mir träumen. Ein Luxus bin ich und möchte doch einem Menschen sein wie das tägliche Brot.«
Wendelin fühlte sein Herz gegen die Hülle ihrer Füße schlagen. Er richtete sich ein wenig auf und sank dann mit dem Kopf in ihren Schoß. Während er so lag, fiel ihm ein Wort seines Freundes Clemens ein: ›Je mehr wir rühmlich verarmen, umso mehr fühlen wir, dass der Luxus viel notwendiger ist als das tägliche Brot.‹ Das hätte er eigentlich einwenden können, aber er lag so herrlich, fühlte ihre Hand auf seinem Haar und hörte ihre weiche Stimme, die auch in der Klage schmeichlerisch klang.
»Clemens pflegt mich wie eine Pflanze, bald ängstlich im Treibhaus, bald, geduldig auf die Jahreszeit vertrauend, im Garten. Ich müsste aber gehalten werden wie ein treues Tier, streng und liebevoll und immer in Bewegung. Ich muss fort, noch einmal fort in das, was wir die weite Welt nennen und die Freiheit und die Gefahr, ehe ich mich endgültig drein ergebe, denen zu Haus ihre Träume noch eine Weile vorzuspielen und alt zu werden, ach, hoffentlich nicht zu alt.«
Wendelin hob den Kopf, ergriff ihre Hände, die sie ihm jetzt überließ.
»Liebe, liebe Karola, dass ich das alles von dir nie gewusst habe! Und jetzt kommst du zu mir, jetzt da ich fort soll.«
»Du? Wohin denn?«
»Zu dem Onkel aufs Land, bei dem meine Mutter lebt. Ich soll Landwirt werden, soll das Studium aufgeben.«
Da glitt ein Brief durch die Türspalte. Wendelin sah sich um, wollte ihn dann aber nicht beachten. Allein Karola sagte: »Bitte lies ihn.«
»Jetzt, wo du da bist; der hat doch Zeit.«
»Sieh wenigstens, von wem er ist.«
Er stand auf und nahm den Brief. »Von meiner Cousine Jutta.«
»Lies ihn, sonst musst du immerzu an ihn denken, und ich habe noch viel mit dir zu sprechen.«
Er setzte sich vor dem Bett auf den Boden, den Schopf an Karolas Knie gelehnt und las:
Lieber Wendel!
Schilleninken, den 25. April
Solange habe ich nichts von Dir gehört. Als ich auf der Hochzeitsreise war, schriebst Du mir an jede Poststation; seit ich zurückgekehrt bin, vernachlässigst Du mich. Ich sitze hier in dem Belvedere, das mir die Schröders tatsächlich auf Lebenszeit überlassen haben. Sie sind wirklich rührend, die guten Leute, auch jetzt noch, nachdem das verarmte Fräulein von Domrau eine bürgerliche Bankiersgattin geworden ist. Heimlich hat Eißner sich wohl mit dem großzügigen Plan getragen, das ganze Gut zurückzukaufen, aber er ist fein genug zu ahnen, dass diese plötzliche Morgengabe etwa nicht nach meinen Geschmack sein könnte. Ein wenig müssen wir doch die Dehors dieser Neigungsehe wahren. Seine Ritterlichkeit ist übrigens unanfechtbar. Er lässt mir, da ich es so möchte, den ganzen Frühling meine liebgewohnte Zurückgezogenheit. Du bist nicht hier gewesen seit unserm denkwürdigen Gespräch über Ehe nach der roten Jagd, weißt Du noch? Ach, Wendelin, hättest Du mir damals ernstlich abgeraten – aber Du hast es gewollt, und ich habe Deiner blutjungen und bluturalten Weisheit vertraut, und vielleicht war das gut so.