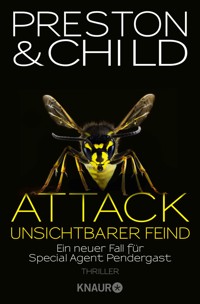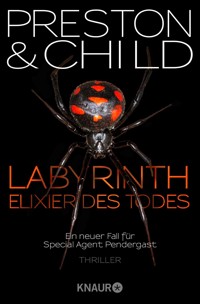6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
CIA-Agent Wyman Ford hat einen neuen Auftrag: In Kambodscha wurden rauchfarbene Diamanten entdeckt, die radioaktiv sind. Fallen sie Terroristen in die Hände, könnten sie zu einer gefährlichen Waffe werden. Als Ford den Ursprungsort der Steine findet, steht er vor einem Rätsel – die Diamanten stammen aus einem merkwürdigen Krater. Es sieht so aus, als wäre hier etwas mit größter Gewalt aus dem Erdinneren nach außen geschlagen. Noch ahnt Ford nicht, dass es auch in Amerika einen solchen Krater gibt – und beide die Vorboten einer schrecklichen Katastrophe sind … Platz 4 der amerikanischen Bestsellerliste: Virtuos vereint Douglas Preston wissenschaftliche Fakten und rasante Spannung. Der Krater von Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Ähnliche
Douglas Preston
Der Krater
Thriller
Aus dem Englischen von Katharina Volk
Knaur e-books
Für Tony und Petra O’Brien, Kiera, Liam und Brenna
Mein Dank gilt Lincoln Child, Eric Simonoff, Bob Gleason, Tom Doherty, Matthew Snyder, Bobby Rotenberg, Claudia Rülke, Jon Couch, Selene Preston und Isaac Preston für ihre wertvolle Hilfe.
TEIL I
1
April
Jetzt kam es darauf an, durch die Hintertür nach drinnen und mit dem Karton die Treppe hinaufzukommen, und zwar lautlos. Das Haus war zweihundert Jahre alt, und man konnte kaum einen Schritt tun, ohne dass es irgendwo knarrte und quietschte. Abbey Straw zog leise die Tür hinter sich zu und schlich über den Teppich im Flur zum Fuß der Treppe. Sie konnte ihren Vater in der Küche herumwerkeln hören, und im Radio lief leise der Kommentar eines Red-Sox-Spiels.
Sie drückte den Karton mit beiden Armen an sich, stellte den Fuß auf die erste Stufe, verlagerte langsam das Gewicht darauf, dann auf die nächste, und die nächste. Die vierte Stufe ließ sie aus – die kreischte wie eine alte Hexe – und rückte zur fünften, der sechsten, der siebten vor … Und als sie schon dachte, sie hätte es geschafft, gab die Stufe einen Knall von sich, so laut wie ein Schuss, gefolgt von einem langgezogenen Todesstöhnen.
Verdammt.
»Abbey, was ist in der Kiste?«
Ihr Vater stand in der Küchentür, noch in den orangefarbenen Gummistiefeln, und sein kariertes Hemd war fleckig von Dieselöl und Hummerköder. Seine von Wind und Sonne verbrannte Stirn runzelte sich argwöhnisch.
»Ein Teleskop.«
»Ein Teleskop? Was hat es gekostet?«
»Ich habe es von meinem eigenen Geld gekauft.«
»Schön«, sagte er, und seine rauhe Stimme klang gereizt, »wenn du das College nie wiedersehen und für den Rest deines Lebens Kellnerin bleiben willst, gib dein ganzes Geld für Teleskope aus.«
»Vielleicht will ich ja Astronomin werden.«
»Weißt du, wie viel ich für dein Studium bezahlt habe?«
Sie wandte sich ab und ging weiter die Treppe hinauf. »Du erwähnst es ja nur fünfmal am Tag.«
»Wann nimmst du endlich Vernunft an?«
Sie knallte die Tür zu und blieb einen Moment lang keuchend in ihrem kleinen Zimmer stehen. Mit einem Arm schob sie die Stofftiere von der Tagesdecke und legte den Karton aufs Bett. Dann ließ sie sich daneben fallen. Warum war sie ausgerechnet von weißen Leuten in Maine adoptiert worden, dem weißesten Staat in ganz Amerika, und in einem Ort, wo jeder weiß war? Hatte denn nicht irgendwo ein schwarzer Hedgefonds-Manager ein Adoptivkind gesucht? »Und wo kommst du her?«, fragten die Leute immer, als wäre sie erst kürzlich aus Harlem angereist – oder aus Kenia.
Sie drehte sich auf dem Bett herum und betrachtete den Karton. Dann fischte sie ihr Handy aus der Tasche und wählte. »Jackie?«, flüsterte sie. »Wir treffen uns um neun am Kai. Ich habe eine Überraschung.«
Eine Viertelstunde später öffnete Abbey, das Teleskop an sich gepresst, die Schlafzimmertür einen Spalt weit und lauschte. Ihr Vater rumorte immer noch in der Küche herum und erledigte den Abwasch, den sie heute Morgen hätte machen sollen. Das Spiel lief noch, und die nervtötende Stimme des Sportreporters Dave Goucher plärrte aus dem billigen Radio. Da sie ihren Vater ein paarmal fluchen hörte, nahm sie an, dass die Sox wohl gegen die Yankees spielten. Gut, das würde ihn ablenken. Sie schlich die Treppe hinunter, trat vorsichtig auf, damit die alten Stufen aus Kiefernholz nicht knarzten, huschte an der offenen Küchentür vorbei und war auch schon aus dem Haus und auf der Straße.
Sie legte sich das Stativ über die Schulter und sauste am Anchor Inn vorbei zum Kai. Der Hafen war so still wie ein Mühlteich, eine riesige schwarze Wasserfläche, die sich bis zum vagen Umriss von Louds Island hinzog. Die Boote lagen da wie weiße Gespenster. Die Boje, die den Kanal an der Ausfahrt des schmalen Hafens markierte, blinkte vor sich hin. Am Himmel darüber waberte das schwache Licht der natürlichen Phosphoreszenz.
Sie lief schräg über den Parkplatz, an der Fischereigenossenschaft vorbei und weiter zum Kai. Der starke Geruch von Heringsköder und Tang in der feuchten Nachtluft kam von einem Stapel alter Hummerfallen am Ende des Kais. Die Hummerbude war nur in der Sommersaison geöffnet, und ihre Picknicktische waren noch aufgestapelt und am Geländer festgekettet. Hinter sich auf dem Hügel konnte sie die Lichter des Ortes sehen und den Kirchturm der Methodisten-Kirche, eine schwarze Nadel vor der Milchstraße.
»Hi.« Jackie trat aus dem Schatten, und die glimmende Spitze ihres Joints hüpfte in der Dunkelheit. »Was ist das?«
»Ein Teleskop.« Abbey nahm den Joint entgegen und tat einen kräftigen Zug, begleitet vom Knistern brennenden Tabaks. Sie atmete aus und gab ihn zurück.
»Ein Teleskop?«, wiederholte Jackie. »Wofür?«
»Was kann man hier schon machen, außer sich die Sterne anschauen?«
Jackie brummte zustimmend. »Was hat es gekostet?«
»Siebenhundert Dollar. Hab’s bei eBay gefunden, ein Celestron Acht-Zoll-Cassegrain mit automatischer Nachführung, Kamera und allem Drum und Dran.«
Ein leiser Pfiff. »Du musst im Landing ja tolle Trinkgelder bekommen.«
»Die lieben mich da. Ich könnte nicht mehr Trinkgeld kriegen, wenn ich den Gästen einen blasen würde.«
Jackie prustete vor Lachen, verschluckte sich am Rauch und hustete. Sie gab den Joint zurück, und Abbey zog noch einmal lange.
»Randy ist aus dem Maine State Prison raus«, bemerkte Jackie mit gesenkter Stimme.
»O Gott. Randy kann sich von mir aus auf eine Hummerboje setzen und im Kreis herumpaddeln.«
Jackie unterdrückte ein Lachen.
»Was für eine Nacht«, sagte Abbey, die zur riesigen Himmelskuppel voller Sterne hochschaute. »Wir machen ein paar Bilder.«
»Im Dunkeln?«
Abbey prüfte mit einem Blick zu Jackie, ob das ein Scherz sein sollte, doch auf deren Lippen lag kein ironisches Lächeln. Zuneigung zu ihrer dümmlichen, liebenswerten Freundin wallte in Abbey auf. »Ob du es glaubst oder nicht«, sagte sie, »Teleskope funktionieren im Dunkeln sogar besser.«
»Klar. Wie dämlich.« Jackie schlug sich an die Stirn. »Hallo?«
Sie gingen zum Ende des Piers. Abbey baute das Stativ auf und vergewisserte sich, dass es sicher auf den Holzplanken stand. Sie konnte Orion tief am Himmel hängen sehen und richtete das Teleskop dorthin aus. Es verfügte über einen computergesteuerten Sucher, und sie brauchte nur eine voreingestellte Position auszuwählen. Mit leisem Surren des Schneckengetriebes richtete sich das Teleskop von selbst so aus, dass es auf eine Stelle an der Schwertspitze des Orion deutete.
»Was schauen wir uns denn an?«
»Den Andromedanebel.«
Abbey blickte durch das Okular, und die Galaxie sprang förmlich auf sie zu, ein strahlender Wirbel aus fünfhundert Milliarden Sternen. Der Gedanke, wie gewaltig diese Galaxie war und wie winzig sie selbst, schnürte ihr die Kehle zu.
»Lass mal sehen«, sagte Jackie und strich sich das lange, widerborstige Haar zurück.
Abbey trat zurück und bot ihr mit einer Geste das Okular an. Jackie drückte das Auge daran. »Wie weit ist es weg?«
»Zweieinviertel Millionen Lichtjahre.«
Jackie starrte eine Weile schweigend durch das Teleskop und richtete sich dann auf. »Glaubst du, dass es da draußen Leben gibt?«
»Natürlich.«
Abbey justierte das Teleskop neu, zoomte zurück und vergrößerte das Sichtfeld, bis fast das ganze Schwert des Orion zu sehen war. Andromeda war zu einem kleinen Watteknäuel geschrumpft. Sie drückte den Fernauslöser am Kabel und hörte das leise Klicken, mit dem sich der Blendenverschluss öffnete. Die Belichtungszeit war auf zwanzig Minuten eingestellt.
Eine leichte Brise wehte vom Meer herein und ließ die Takelage eines Segelboots klirren, und alle Boote im Hafen schwangen einhellig herum. Der Windhauch fühlte sich an wie der Vorbote eines Sturms, trotz des vollkommen stillen Wassers. Ein einsamer Seetaucher rief draußen auf dem Wasser, und ein zweiter, noch weiter weg, antwortete ihm.
»Zeit für die nächste Tüte.« Jackie begann einen Joint zu drehen, leckte über das Papier und steckte ihn zwischen die Lippen. Ein Klicken, und die Flamme des Feuerzeugs erhellte ihr Gesicht, die blasse, sommersprossige Haut, die grünen, irisch wirkenden Augen und das schwarze Haar.
Abbey sah den plötzlichen Lichtschein, ehe sie das Ding selbst sah. Es kam hinter der Kirche hervor, und der Hafen war augenblicklich taghell erleuchtet. Lautlos wie ein Geist raste es über den Himmel, und dann erschütterte ein gewaltiger Überschallknall den Kai, gefolgt von einem Brüllen wie aus einem Hochofen. Das Ding schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit über den Ozean hinweg und verschwand hinter Louds Island. Einem letzten Aufblitzen folgte lautes Donnergrollen, das über das weite Meer hinwegrollte, bis es verklang.
Hinter ihr, oben im Ort, begannen Hunde hysterisch zu bellen.
»Was …?«, sagte Jackie.
Abbey konnte sehen, dass das ganze Dorf aus den Häusern gestürzt kam und auf der Straße zusammenlief. »Weg mit dem Gras«, zischte sie.
Die Straße zum Hafen herunter füllte sich mit Menschen, deren aufgeregte, erschrockene Stimmen durcheinanderschwatzten. Die Leute strömten zum Kai, mit blinkenden Taschenlampen und zum Himmel zeigenden Fingern. Abbey war klar: Dies war das größte Ereignis, das Round Pond, Maine, gesehen hatte, seit eine verirrte Kanonenkugel im Britisch-Amerikanischen Krieg 1812 das Dach der Kongregationalistenkirche durchschlagen hatte.
Plötzlich fiel Abbey ihr Teleskop wieder ein. Die Blende war offen, die Aufnahme lief. Mit zitternder Hand fasste sie nach dem Auslöser und beendete sie. Gleich darauf erschien das Bild auf dem kleinen LCD-Bildschirm des Teleskops.
»O Gott, sieh mal.« Das Ding war mitten durch das Bild gerast, ein strahlend weißer Streifen zwischen ein paar verstreuten Sternen.
»Es hat dein Bild verdorben«, sagte Jackie, die ihr über die Schulter spähte.
»Machst du Witze? Es ist das Bild!«
2
Am nächsten Morgen schob Abbey sich mit einem Stapel Zeitungen unter dem Arm durch die Tür des Cupboard Café. Das fröhliche Blockhaus mit seinen karierten Vorhängen und marmornen Tischplatten war fast leer, aber Jackie saß in ihrer angestammten Ecke und trank Kaffee. Ein feuchter Morgennebel drückte sich an die Fensterscheiben.
Abbey eilte hinüber und klatschte die New York Times so auf den Tisch, dass der Artikel auf der unteren Hälfte der Titelseite vor ihrer Freundin lag. Sie las vor:
Meteorit erleuchtet Küste von Maine
Portland, Maine. Um 21.44 Uhr zog ein großer Meteorit über den Himmel von Maine und erzeugte eine der bemerkenswertesten Leuchterscheinungen, die man seit Jahrzehnten in Neuengland gesehen hat. Zeugen aus so weit entfernten Orten wie Boston oder Nova Scotia meldeten Sichtungen des spektakulären Feuerballs. Bewohner der Region Midcoast Maine hörten Überschallwellen.
Die Aufzeichnungen eines Beobachtungssystems an der University of Maine in Orono weisen darauf hin, dass der Meteorit um ein Vielfaches heller war als der Vollmond und möglicherweise bis zu fünfzig Tonnen wog, als er in die Erdatmosphäre eintrat. Die einzelne Lichtspur, die Zeugen beschreiben, deutet darauf hin, dass es sich um einen Meteoriten vom Eisen-Nickel-Typ handelte, da hier die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper im Flug in mehrere Teile zerfällt, wesentlich geringer ist als bei den häufiger vorkommenden Stein-Eisen-Meteoriten oder Chondriten. Seine Geschwindigkeit berechneten die Wissenschaftler auf zirka 48 km pro Sekunde – dreißig Mal schneller als eine gewöhnliche Gewehrkugel.
Dr. Stephen Chickering, Professor für Astrogeologie an der Boston University, sagte dazu: »Das ist keine gewöhnliche Sternschnuppe. Das ist der größte und hellste Meteorit, den man an der Ostküste in Jahrzehnten gesehen hat. Seine Flugbahn führte ihn aufs Meer hinaus, wo er im Ozean landete.«
Er erklärte darüber hinaus, dass bei der Reise durch die Erdatmosphäre ein Großteil der Masse verglühte. Das Objekt, das schließlich ins Meer stürzte, wog seiner Ansicht nach wahrscheinlich weniger als 50 Kilogramm.
Abbey brach ab und grinste Jackie an. »Hast du verstanden? Er ist im Meer gelandet. Das steht in sämtlichen Zeitungen.« Sie lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und genoss Jackies verwunderten Blick.
»Okay«, sagte Jackie. »Ich sehe dir an, dass du irgendeine Idee hast.«
Abbey senkte die Stimme. »Wir werden reich.«
Jackie verdrehte theatralisch die Augen. »Das habe ich doch schon mal gehört.«
»Diesmal meine ich es ernst.« Abbey sah sich um, dann zog sie ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Tasche und breitete es auf dem Tisch aus.
»Was ist das?«
»Das ist der Ausdruck der Daten der GoMOOS-Wetterboje vier-vier-null-drei-zwei zwischen einundzwanzig Uhr vierzig und zweiundzwanzig Uhr vierzig. Das ist diese Messboje draußen am Webber Sunken Ledge.«
Jackie starrte auf das Blatt und runzelte die sommersprossige Stirn. »Die kenne ich.«
»Sieh dir mal die Wellenhöhe an. Völlig still. Keinerlei Veränderung.«
»Und?«
»Ein fünfzig Kilo schwerer Meteorit schlägt mit um die fünfzig Kilometer pro Sekunde auf und macht keine Wellen?«
Jackie zuckte mit den Schultern. »Wenn er nicht im Meer gelandet ist, wo dann?«
Abbey beugte sich vor, faltete die Hände und zischelte mit vor Triumph geröteten Wangen: »Auf einer Insel.«
»Und?«
»Und wir borgen uns das Boot meines Vaters, suchen die Inseln ab und holen uns den Meteoriten.«
»Borgen? Du meinst stehlen. Dein Vater würde dir niemals sein Boot borgen.«
»Borgen, stehlen, requirieren, wie auch immer.«
Jackies Miene verfinsterte sich. »Bitte, nicht noch so eine sinnlose Aktion. Weißt du noch, wie wir nach Dixie Bulls Schatz gesucht haben? Und was für Ärger wir bekommen haben, weil wir in den indianischen Grabhügeln gebuddelt haben?«
»Da waren wir doch noch Kinder.«
»Es gibt da draußen in der Muscongus Bay Dutzende von Inseln, wir müssten ein paar tausend Hektar Land absuchen. Wir würden nie alle schaffen.«
»Müssen wir auch nicht. Denn ich habe ja das hier.« Sie legte eine Seekarte der Muscongus Bay aus und darauf das Foto des Meteoriten. »Von diesem Foto kann man eine Linie zum Horizont ableiten, und von dem Punkt dann eine zweite Linie dorthin ziehen, wo das Foto gemacht wurde. Der Meteorit muss irgendwo auf dieser zweiten Linie gelandet sein.«
»Wenn du das sagst.«
Abbey schob ihr die Seekarte hin. »Da ist die Linie.« Sie tippte mit dem Zeigefinger auf einen Strich, den sie mit Bleistift eingezeichnet hatte. »Schau. Sie quert nur fünf Inseln.«
Die Kellnerin kam mit zwei riesigen Stücken Nusssplitter-Kuchen. Abbey bedeckte rasch Karte und Foto und lehnte sich lächelnd zurück. »Ah, danke.«
Sobald die Kellnerin weg war, deckte Abbey die Karte wieder auf. »Das ist alles. Der Meteorit ist auf einer dieser fünf Inseln.« Sie tippte mit dem Zeigefinger auf eine Insel nach der anderen, während sie die Namen nannte: »Louds, Marsh, Ripp, Egg Rock und Shark. Die könnten wir in nicht mal einer Woche absuchen.«
»Wann? Jetzt?«
»Wir müssen bis Ende Mai warten, wenn mein Vater wegfährt.«
Jackie verschränkte die Arme. »Was zum Teufel sollen wir denn mit einem Meteoriten?«
»Ihn verkaufen.«
Jackie starrte sie an. »Der ist etwas wert?«
»Nur so ungefähr eine Viertelmillion, vielleicht auch eine halbe, mehr nicht.«
»Du willst mich verarschen.«
Abbey schüttelte den Kopf. »Ich habe mir die Preise bei eBay angesehen und mit einem Meteoritenhändler telefoniert.«
Jackie lehnte sich zurück, und langsam breitete sich ein Grinsen über ihr sommersprossiges Gesicht. »Ich bin dabei.«
3
Mai
In Glendale, Kalifornien, stieg Dolores Muños die steinernen Stufen zum Bungalow des Professors hinauf. Ihre üppige Brust wogte atemlos, und sie ruhte sich einen Moment lang unter dem Vordach aus, ehe sie den Schlüssel zückte. Das Knirschen des Schlüssels im Schloss, das wusste sie, würde ein furioses Gekläffe auslösen, denn Stamp, der Jack-Russell-Terrier des Professors, drehte immer durch, wenn sie kam. Sobald sie die Tür öffnete, würde die kleine Fellkugel wie aus der Pistole geschossen herausgerast kommen und wüst bellend im kleinen Vorgarten hin und her flitzen, als müsste er wilde Bestien oder gefährliche Verbrecher daraus vertreiben. Dann würde er seine Runde machen und das kleine Beinchen an jedem traurigen Busch und jeder verdorrten Blume heben. Wenn er seine Pflicht erfüllt hatte, würde er schließlich zu ihr gelaufen kommen, sich vor sie hinlegen, auf den Rücken rollen und mit angezogenen Pfötchen und heraushängender Zunge auf sein morgendliches Kraulen warten.
Dolores Muños liebte diesen Hund.
Mit einem leichten Lächeln der Vorfreude steckte sie den Schlüssel ins Schloss, klapperte ein bisschen damit und wartete auf die explodierende Aufregung von drinnen.
Nichts.
Sie hielt inne und lauschte, dann drehte sie den Schlüssel um und rechnete jeden Augenblick mit freudigem Gebell. Doch es kam immer noch nichts. Verwundert trat sie in den kleinen Vorraum. Das Erste, was ihr auffiel, war die offene Schublade des Ablagetischchens und die auf dem Boden verstreuten Briefe.
»Professor?«, rief sie mit hohler Stimme, und dann: »Stamp?«
Keine Antwort. In letzter Zeit war der Professor immer später aufgestanden. Er gehörte zu den Leuten, die zum Abendessen viel Wein tranken, und danach noch ein paar Gläser Cognac, und das war in letzter Zeit richtig schlimm geworden, vor allem, seit er nicht mehr zur Arbeit ging. Und dann die Frauen. Dolores war nicht prüde und hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn es immer dasselbe Mädchen gewesen wäre. Aber es war immer eine andere Frau, und manchmal waren sie zehn, zwanzig Jahre jünger als er. Na ja, der Professor war ein gutaussehender, gesunder Mann im besten Alter, der sich in fließendem Spanisch mit ihr unterhielt und sie dabei stets höflich siezte, was sie sehr zu schätzen wusste.
»Stamp?«
Vielleicht waren die beiden spazieren gegangen. Sie trat in den Hausflur, spähte ins Wohnzimmer und sog scharf den Atem ein. Papiere und Bücher waren über den Fußboden verstreut, eine Lampe umgeworfen, und vom hinteren Bücherregal hatte jemand alle Bücher einfach heruntergefegt, so dass sie in wirren Haufen am Boden lagen.
»Professor!«
Nun begriff sie, welches Grauen das bedeutete. Der Wagen des Professors stand in der Einfahrt, er musste zu Hause sein – warum antwortete er ihr nicht? Und wo war Stamp? Ohne recht darüber nachzudenken, fummelte sie mit einer dicklichen Hand das Handy aus ihrem grünen Kittel, um den Notruf zu wählen. Sie starrte auf das Tastenfeld und brachte es nicht fertig, die Ziffern einzugeben. Sollte sie sich wirklich in so etwas verwickeln lassen? Die Polizei würde kommen und ihren Namen und ihre Adresse aufschreiben und sie überprüfen, und ehe sie wusste, wie ihr geschah, würden sie sie nach El Salvador abschieben. Selbst wenn sie von ihrem Handy aus anonym anrief, würde die Polizei sie trotzdem aufspüren, weil sie Zeugin eines … sie weigerte sich, diesen Gedanken zu vollenden.
Grauen und Unsicherheit packten sie. Der Professor könnte oben sein, ausgeraubt, geschlagen, verletzt, vielleicht im Sterben liegend. Und Stamp, was hatten sie mit Stamp gemacht?
Panik erfasste sie. Sie blickte hektisch um sich, und ihre großen Brüste hoben und senkten sich rasch, als sie zu keuchen begann. Tränen traten ihr in die Augen. Sie musste etwas tun, sie musste den Notruf wählen, sie konnte nicht einfach weggehen – wie kam sie nur auf diese Idee? Er könnte schwer verletzt sein. Sie musste sich zumindest umsehen, feststellen, ob er Hilfe brauchte, und sich dann überlegen, was sie unternehmen konnte.
Sie ging auf das Wohnzimmer zu und sah darin etwas auf dem Boden liegen, wie ein zerknautschtes Kissen. Mit unerträglicher Furcht im Herzen trat sie einen Schritt vor, dann noch einen, setzte sehr vorsichtig einen Fuß nach dem anderen auf den weichen Teppich, und gab dann ein leises Stöhnen von sich. Es war Stamp, der mit dem Rücken zu ihr auf dem Perserteppich lag. Er hätte schlafen können, wie er da lag und ihm die kleine rosa Zunge aus dem Maul hing, aber seine Augen waren weit aufgerissen und blind, und auf dem Teppich unter ihm war ein dunkler Fleck.
»Ohhh, ooohh«, drang es unwillkürlich aus ihrem offenen Mund. Hinter dem kleinen Hund lag der Professor auf den Knien, beinahe als bete er, als wäre er noch am Leben, eigenartig aufgerichtet und im Gleichgewicht, als sollte er jeden Moment umfallen, aber sein Kopf hing zur Seite und war halb abgetrennt wie der einer kaputten Puppe. Von dem halb durchtrennten Hals baumelte eine Drahtschlaufe, deren Enden um zwei kurze Holzpflöcke gewickelt waren. Blut war wie aus einem Schlauch über die Wände und an die Decke gespritzt.
Dolores Muños schrie und schrie. Ihr war vage bewusst, dass diese Schreie ihre Abschiebung bedeuteten, doch sie konnte nicht damit aufhören, und es war ihr gleich.
4
Wyman Ford betrat das elegante, an der 17th Street gelegene Büro von Stanton Lockwood III., wissenschaftlicher Berater des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er erinnerte sich noch von seinem letzten Auftrag an diesen Raum: die Selbstdarstellungswand, die Fotos von der Ehefrau und den flachsblonden Kindern, die Antiquitäten im Washingtoner-Machtmenschen-Stil.
Lockwood, mit silbernem Haar und Lachfältchen um die blauen Augen, kam um den Schreibtisch herum. Seine Schritte dämpfte ein teurer Sultanabad-Teppich. Er packte Fords Hand mit dem typischen Politiker-Händedruck. »Schön, Sie wiederzusehen, Wyman.« Er erinnerte Ford an Peter Graves, den weißhäuptigen Mann, der in der alten Fernsehserie Kobra, übernehmen Sie den Leiter des Agententeams gespielt hatte.
»Freut mich auch, Sie wiederzusehen, Stan«, entgegnete Ford.
»Da drüben sitzt es sich angenehmer«, sagte Lockwood und wies auf zwei lederne Ohrensessel, die ein Louis-XIV-Tischchen flankierten. Ford ließ sich nieder, und Lockwood setzte sich ihm gegenüber, wobei er leicht an den Bügelfalten seiner Gabardinehose zupfte. »Wie lange ist das jetzt her, ein Jahr?«
»Mehr oder weniger.«
»Kaffee? Pellegrino?«
»Kaffee, gerne.«
Lockwood gab seiner Sekretärin einen Wink und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Der alte Handschmeichler, ein Trilobit, erschien in seiner Hand, und Ford beobachtete, wie er ihn nachdenklich zwischen Daumen und Zeigefinger rieb. Er bedachte Ford mit einem professionellen Washington-Lächeln. »Irgendwelche interessanten Fälle in letzter Zeit?«
»Ein paar.«
»Haben Sie Zeit für einen neuen?«
»Falls er auch nur ansatzweise dem letzten ähnelt, nein danke.«
»Glauben Sie mir, dieser Auftrag wird Ihnen gefallen.« Lockwood wies mit einem Nicken auf ein Metallkästchen auf dem Tisch. »Die nennt man ›Honeys‹. Schon mal davon gehört?«
Ford beugte sich vor und spähte durch eine dicke Glasscheibe im Deckel des Kästchens. Drinnen blinkten ein paar tief orangerote Edelsteine. »Kann ich nicht behaupten.«
»Sie sind vor etwa zwei Wochen in Bangkok auf den Markt gekommen. Sind ein großes Geschäft – tausend Dollar pro Karat, geschliffen.«
Ein Servicemitarbeiter kam mit einem kleinen Wägelchen mit silberner Kaffeekanne, Kandiszucker, Sahne und Milch in silbernen Kännchen und Porzellantassen herein. Der kleine Servierwagen klapperte und quietschte. Er parkte ihn neben Ford.
»Sir?«
»Schwarz, ohne Zucker, bitte.«
Der Mann schenkte Kaffee ein. Ford lehnte sich mit der dampfenden Tasse zurück und trank einen Schluck.
»Ich lasse die Kanne hier, wenn der Herr vielleicht noch einen möchte.«
Falls der Herr noch einen möchte, dachte Ford, leerte das kleine Porzellantässchen auf einen Zug und schenkte sich nach.
Lockwood rieb den Trilobiten in seiner Hand. »Ein Team am Lamont-Doherty-Institut in New York versucht bereits festzustellen, was genau sie sind. Die Steine weisen eine ungewöhnliche Zusammensetzung auf, einen höheren Brechungsindex als Diamanten, relative Dichte dreizehn Komma zwei, Härte neun. Diese satte Honigfarbe ist fast einmalig. Ein wunderschöner Stein – mit einer netten Besonderheit. Die Dinger enthalten Americium-zweihunderteinundvierzig.«
»Das radioaktiv ist.«
»Ja, mit einer Halbwertszeit von vierhundertdreiunddreißig Jahren. Es strahlt nicht genug, um einen sofort umzubringen, aber bei längerer Einwirkung wird es problematisch. Wenn man eine Kette aus diesen Dingern um den Hals trägt, gehen einem nach ein paar Wochen die Haare aus. Und wenn man sie zwei, drei Monate lang in der Hosentasche mit sich herumgetragen hat, zeugt man womöglich den Kiemenmenschen aus Der Schrecken vom Amazonas.«
»Entzückend.«
»Die Steine sind hart, aber spröde und lassen sich leicht pulverisieren. Man könnte ein paar Pfund dieser Edelsteine zermahlen, sie mit C-vier in einen Sprengstoffgürtel packen und sich im Battery Park damit in die Luft jagen. Wenn der Wind gerade von Süden weht, könnte man so eine hübsche radioaktive Wolke über die Wall Street ziehen lassen, binnen einer halben Stunde zig Milliarden Dollar US-Aktienkapital vernichten und die untere Hälfte von Manhattan für ein paar Jahrhunderte unbewohnbar machen.«
»Netter Plan, wenn man da herankommt.«
»Die Homeland Security geht die Wände hoch.«
»Wissen die Händler in Bangkok, dass die Dinger so heiß sind?«
»Die seriösen Großhändler rühren sie nicht an. Sie fließen durch die Gossen des Edelsteinmarkts.«
»Gibt es irgendeine Erklärung dafür, wie diese Steine entstanden sind?«
»Wir arbeiten daran. Americium-zweihunderteinundvierzig ist ein Element, das von Natur aus nicht auf der Erde vorkommt. Bisher ist nur eine Möglichkeit bekannt, wie es entsteht: als Nebenprodukt eines Kernreaktors, der waffenfähiges Plutonium herstellt. Diese ›Honeys‹ könnten also ein Hinweis auf eine illegale Atomwaffen-Produktion sein.«
Ford trank seine zweite Tasse Kaffee aus und schenkte sich eine dritte ein.
»Alles weist darauf hin, dass die Steine aus einer einzigen Quelle in Südostasien kommen, höchstwahrscheinlich Kambodscha«, fuhr Lockwood fort.
Ford leerte die dritte Tasse und lehnte sich zurück. »Worin besteht also der Auftrag?«
»Ich möchte, dass Sie undercover nach Bangkok fliegen, die Spur dieser radioaktiven Steinchen zurückverfolgen, die Quelle lokalisieren und dokumentieren und wieder verschwinden.«
»Und dann?«
»Kümmern wir uns um das Problem.«
»Warum ich? Warum nicht die CIA?«
»Das ist eine hochsensible Angelegenheit – Kambodscha ist ein befreundeter Staat. Wenn Sie erwischt werden, müssen wir alles abstreiten können. Solche Operationen sind nicht gerade eine Stärke der CIA – klein und schnell, rein und raus. Ein Ein-Mann-Job. Ich fürchte, auf die Unterstützung der CIA werden Sie dabei verzichten müssen.«
»Danke für das Angebot.« Ford stellte die Kaffeetasse hin und erhob sich.
»Der Präsident hat der Operation persönlich zugestimmt.«
»Ausgezeichneter Kaffee.« Er ging zur Tür.
»Ich verspreche Ihnen, wir werden Sie nicht übermäßig in Gefahr bringen.«
Ford zögerte.
»Es ist ganz einfach: Sie gehen rein, finden die Mine und verschwinden wieder. Sie tun absolut nichts. Sie rühren diese Mine nicht an. Wir sind immer noch dabei, die Steine zu analysieren – sie könnten sich als äußerst wichtig erweisen.«
»Ich will nicht zurück nach Kambodscha«, sagte Ford, die Hand schon am Türknauf.
»Sie erweisen dem Andenken Ihrer Frau keinen guten Dienst, indem Sie weiterhin vor der Vergangenheit davonlaufen.«
Diese unerwartet einfühlsame, schmerzliche Bemerkung überraschte Ford. Er seufzte und verschränkte die Arme.
»Die Bezahlung ist gut«, erklärte Lockwood, »die CIA wird sich nicht einmischen, Sie allein bestimmen über die Mission und Ihre eigenen Leute. Das Oval Office steht hinter Ihnen – was wollen Sie mehr?«
»Wie sieht meine Tarnung aus?«
»Amerikanischer Großhändler am Edelstein-Schwarzmarkt.«
Ford schüttelte den Kopf. »Würde nicht funktionieren. Ein Großhändler würde sich nicht um die Quelle scheren – er würde sich damit zufriedengeben, von Mittelsmännern zu kaufen. Ich werde als kleiner Betrüger auftreten, der nur schnell reich werden will und eine einmalige Chance wittert – der Typ, der sich für besonders schlau hält und glaubt, er könnte einen besseren Preis bekommen, indem er die Großhändler meidet und direkt an die Quelle geht.«
»Ist das ein Ja?«
»Verschaffen Sie mir eine Polizeiakte mit einer Verhaftung wegen Kokainschmuggels, Verfahren aufgrund eines Formfehlers eingestellt.«
»Wollen Sie dringend umgebracht werden?«
»Und zwei Mordanklagen mit Freispruch. Dann werden die es sich zweimal überlegen.«
»Wenn Sie es so haben wollen, schön.«
»Ich muss hier und da mit Gold um mich werfen. American Eagles.«
»Bekommen Sie.«
»Ich will Übersetzer rund um die Uhr in Bereitschaft haben, die die gebräuchlichsten südostasiatischen Sprachen beherrschen, vor allem Thai. Und ich brauche ein paar Hightech-Geräte.«
»Kein Problem.«
»Wenn ich versage, begraben Sie mich auf dem Arlington-Friedhof, mit einundzwanzig Salutschüssen und allem Drum und Dran.«
»Das wird sicher nicht nötig sein«, entgegnete Lockwood, dessen dünne Lippen sich zu einem freudlosen Lächeln spannten. »Bedeutet das, Sie sind dabei?«
»Was bekomme ich dafür?«
»Hunderttausend. Wie beim letzten Mal.«
»Machen Sie zwei daraus, damit ich meine Sekretärin krankenversichern kann.«
Lockwood streckte die Hand aus. »Zwei.«
Sie gaben sich die Hand darauf. Als Ford das Büro verließ, bemerkte er, dass Lockwoods manikürte Hand den Trilobiten unablässig kreiseln ließ.
5
Mark Corso betrat sein bescheidenes Apartment und schloss die Tür. Er blieb noch einen Moment lang stehen, als sähe er seine Wohnung zum ersten Mal. Babygeschrei drang durch die Wände, und ein schwerer Geruch nach gebratenem Speck hing in der abgestandenen Luft. Die Klimaanlage, die ein Drittel des Fensters einnahm, klopfte und wackelte und blies einen schwachen Luftstrom aus. Von draußen drang leise Sirenengeheul herein. Das Panoramafenster vor ihm bot einen Ausblick auf eine vielbefahrene Kreuzung mit einer Autowaschstraße, dem Drive-In einer Burger-Kette und dem großen Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers.
Zum ersten Mal empfand Corso eine grimmige Befriedigung über die schäbige Wohnung, die papierdünnen Wände, die Flecken auf dem Teppichboden, den verdorrten Ficus in der Ecke und die deprimierende Aussicht. Vor einem Jahr hatte er das Apartment unbesehen aus der Ferne gemietet, weil er auf die glühende Beschreibung und die aus kunstvollen Winkeln aufgenommenen Fotos in einer Internet-Anzeige hereingefallen war. Von Greenpoint, Brooklyn, aus hatte es ausgesehen wie der wahr gewordene Traum von Kalifornien, ein großes Ein-Zimmer-Apartment, »lichtdurchflutet«, mit privatem Garten, Swimmingpool, Palmen und (das Allerbeste) einem Parkplatz in der Tiefgarage.
Jetzt konnte er sich endlich von dieser Bruchbude verabschieden.
In den letzten paar Monaten war in der National Propulsion Facility die Hölle los gewesen, weil sein alter Professor und Mentor Jason Freeman gefeuert und dann auch noch tragischerweise im eigenen Haus ermordet worden war. Seit dem Tod seines Vaters hatte Corso nichts so sehr erschüttert. Mit Freeman war es schon eine ganze Weile bergab gegangen, er war zu spät zur Arbeit gekommen, hatte wichtige Besprechungen abgesagt und sich mit Kollegen gestritten. Corso hatte Gerüchte über Frauen und zu viel Alkohol gehört. Das bekümmerte ihn sehr, denn Freeman, der damals am MIT seine Diplomarbeit betreut hatte, war derjenige gewesen, der ihn zur Marsmission an der NPF geholt hatte.
Heute Vormittag hatte Corso erfahren, dass er auf Freemans Posten befördert werden sollte. Das war ein gewaltiger Karrieresprung mit einem neuen akademischen Titel, mehr Geld und Prestige. Er war noch nicht einmal dreißig, jünger als die meisten seiner Kollegen, ein aufgehender Stern. Doch dass sein Glück auf dem Unglück und Versagen seines geliebten Lehrers fußte, löste widerstreitende Gefühle in ihm aus.
Er wandte sich vom Fenster ab und schob die Gewissensbisse beiseite. Freemans Schicksal war tragisch, aber willkürlich, etwa so, wie vom Blitz erschlagen zu werden, und Corso hatte sein Möglichstes für ihn getan. Er hatte Freeman unter Kollegen immer verteidigt und versucht, ihn davor zu warnen, was mit ihm geschah. Freeman schien von irgendeiner übermenschlichen Macht besessen gewesen zu sein, die ihn in den Abgrund gezogen hatte, trotz Corsos Bemühungen.
Diese Beförderung bedeutete, dass er endlich genug Geld haben würde, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hier auszuziehen. Dadurch würde er zwar die Kaution verlieren, aber er konnte sich etwas Besseres suchen. Das war hier kein Problem – Pasadena war nicht Brooklyn, es gab Tausende andere Apartments zu mieten. Nachdem er nun ein Jahr lang hier gewohnt hatte, kannte er die Stadt gut genug, um zu wissen, wo er suchen und welche Gegenden er besser meiden sollte.
Diese Gedanken wurden von einem schüchternen Klopfen an der Wohnungstür unterbrochen. Corso wandte sich vom Fenster ab, spähte durch den Türspion und sah den Hausmeister davorstehen, mit irgendetwas in der Hand. Er öffnete die Tür, und der rundliche kleine Mann streckte einen haarigen Arm mit einem kleinen Pappkarton aus. »Päckchen.«
Corso nahm es, bedankte sich und schloss die Tür. Anscheinend ein Paket von Amazon … doch als er näher hinsah, lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter. Der Karton war ein zweites Mal benutzt worden – der Absender war Jason J. Freeman.
Einen verrückten Augenblick lang dachte Corso, Freeman sei vielleicht doch nicht tot, sondern hätte sich voller Gram über seinen tiefen Fall nach Mexiko abgesetzt. Doch dann fiel ihm der Poststempel auf, der zehn Tage alt war, und der »Media Mail«-Stempel auf dem Karton. Zehn Tage … Freeman hatte das Päckchen zwei Tage vor seinem Tod aufgegeben, und da er den langsamsten, aber günstigsten Versand gewählt hatte, war es seither unterwegs gewesen.
Mit hämmerndem Herzen nahm Corso ein Obstmesser aus der Küche und schlitzte das Päckchen auf. Er holte zusammengeknülltes Zeitungspapier heraus und brachte einen Brief zum Vorschein, und darunter eine Festplatte mit extremer Datendichte und dem Logo der Mars-Mission darauf. Als er sie herausholte, erkannte er mit einem flauen Gefühl im Magen, dass sie als geheim eingestuft war.
#785A56H6T 160TB
GEHEIM: DUPLIZIEREN VERBOTEN
Eigentum der NPF
California Institute of Technology
National Aeronautics and Space Administration
Mit zitternder Hand legte Corso die Festplatte auf den Couchtisch und schlitzte den Briefumschlag mit dem Fingernagel auf. Darin lag ein handgeschriebener Brief.
Lieber Mark,
ich bedauere, Dich hiermit belasten zu müssen, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ich habe nicht viel Zeit zum Schreiben, also komme ich gleich zur Sache. Chaudry und Derkweiler sind himmelschreiende Idioten, politische Taktierer durch und durch und unfähig, die Bedeutung meiner Entdeckung zu begreifen. Diese Sache ist gigantisch, unglaublich. Ich werde sie nicht diesen Dreckskerlen überlassen, schon gar nicht, nachdem sie mich so mies behandelt haben. Die NPF ist die reinste Schlangengrube, und das verdanken wir nur diesen wichtigtuerischen, schleimigen, mit Scheiße verkrusteten Arschlöchern. Alles dreht sich um Politik und Karriere, nichts mehr um die Wissenschaft. Ich habe das einfach nicht mehr ertragen. Man kann dort unmöglich arbeiten.
Um es kurz zu machen, ich habe Lunte gerochen und diese Festplatte herausgeschmuggelt, ehe ich gefeuert wurde.
Irgendwann werde ich Dir bei ein paar Martinis davon erzählen, aber jetzt bitte ich Dich aus einem anderen Grund um Deine Hilfe. In meiner letzten Woche bei der NPF habe ich etwas sehr Dummes, ausgesprochen Kompromittierendes getan, und deshalb muss ich diese Festplatte jetzt Dir anvertrauen. Bewahre sie eine Weile für mich auf, nur vorsichtshalber, bis sich die Wogen geglättet haben. Tu es für mich, Mark, ich bitte Dich. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann.
Nimm keinen Kontakt zu mir auf, ruf mich nicht an, verhalte Dich ganz ruhig. Du wirst bald von mir hören. Und dann wüsste ich gern, was Du von den Daten zur Gammastrahlung hältst, falls Du dazu kommst, einen Blick hier hineinzuwerfen.
Jason
Und dann, ganz unten hingekritzelt wie ein nachträglicher Einfall, stand das Passwort für die Festplatte.
Einen Augenblick lang konnte Corso keinen klaren Gedanken fassen. Er starrte nur auf den Brief, bis er bemerkte, dass der in seiner zitternden Hand flatterte.
Das war eine Katastrophe. Eine Katastrophe von ungeheurem Ausmaß. Eine Sicherheitslücke, die alle Beteiligten ruinieren konnte. Das hier würde alles in den Dreck ziehen. Es war nicht nur in höchstem Maße illegal, dass diese als geheim eingestufte Festplatte sich außerhalb des Institutsgebäudes befand – die Tatsache, dass Freeman es geschafft hatte, sie herauszuschmuggeln, würde für einen gewaltigen Aufruhr sorgen. Die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit geheimen Informationen waren ihnen vom ersten Tag an eingebleut worden. Da gab es absolut null Toleranz. Er erinnerte sich an den Skandal in Los Alamos in den neunziger Jahren, als eine einzige klassifizierte Festplatte verschwunden war. Die Nachricht erschien auf dem Titel der New York Times, der Direktor wurde praktisch zum Rücktritt gezwungen, Dutzende Wissenschaftler wurden gefeuert. Das war ein Blutbad gewesen.
Er setzte sich, begrub den Kopf in den Händen und raufte sich die Haare. Wie hatte Freeman das Ding rausgeschafft? Diese Datenträger mussten jeden Abend versiegelt, in einem Kontrollbuch eingetragen und in einem Safe eingeschlossen werden. Sie waren so gut verschlüsselt, wie man überhaupt etwas verschlüsseln konnte, und außerdem mit einer physischen Sicherung versehen. Jeder Gebrauch wurde aufgezeichnet und in der Security-Akte des Nutzers festgehalten. Wenn man sie weiter als eine festgelegte Distanz von ihrem genehmigten Server entfernte, wurde Alarm ausgelöst.
Freeman hatte all das irgendwie umgangen.
Corso rieb sich mit den Handflächen die Augen und versuchte, sich zu beruhigen. Wenn er das der NPF meldete, würde es einen Skandal geben, der einen schwarzen Schatten über die gesamte Mars-Mission warf und den Ruf aller Kollegen schädigte – vor allem aber seinen. Freeman und er kannten sich schon sehr lange. Freeman hatte ihn an Bord geholt und ihn als Mentor unterstützt; Corso war als Freemans Protegé bekannt. Während Freemans Absturz in den vergangenen Monaten hatte Corso versucht, ihm zu helfen, und keinen Hehl daraus gemacht.
Aber natürlich musste er das einzig Richtige tun und diese Verletzung der Datensicherheit melden. Ihm blieb gar keine andere Wahl.
Oder doch? War es besser, richtig zu handeln oder klug?
Allmählich verstand er, warum Freeman ihm das Ding als gewöhnliches Päckchen auf dem Landweg geschickt hatte statt per Express oder Paketdienst. Keinerlei Aufzeichnungen. Der Empfänger brauchte nichts zu unterschreiben, und es gab keine Nummer, mit der man die Sendung nachverfolgen könnte.
Wenn Corso die Festplatte zerstörte und so tat, als hätte er sie nie bekommen, würde niemand davon erfahren. Irgendwann würden sie wohl feststellen, dass der Datenträger fehlte und Freeman ihn hatte mitgehen lassen, doch Freeman war tot, und damit war die Sache beendet. Es gab keine Spur, die zu Corso führte.
Er fühlte sich schon etwas ruhiger. Das Problem war durchaus zu handhaben. Er würde es auf die einzig vernünftige Weise lösen – die Festplatte zerstören und so tun, als hätte er sie nie bekommen. Morgen würde er in die Berge fahren, eine kleine Wanderung machen, sie in Stücke schlagen, verbrennen und die Reste vergraben.
Er war augenblicklich erleichtert. Natürlich, das war die einzig richtige Art, dieses Problem anzupacken.
Er stand auf, ging in die Küche, holte sich ein Bier, trank einen eiskalten Schluck und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Er starrte die Festplatte an, die da auf seinem Couchtisch lag. Freeman war leicht erregbar, ein bisschen verrückt, aber auch brillant. Was war das für eine große Sache, diese Geschichte mit der Gammastrahlung? Corsos Neugier war geweckt.
Ehe er die Festplatte vernichtete, würde er nur einen kurzen Blick auf die Daten werfen – nur mal sehen, was zum Teufel Freeman gemeint hatte.
6
Abbey steuerte das Hummerfangboot auf den Steg zu, warf einen Fender über die Reling und legte sauber längsseits an. Siehst du das, Dad?, dachte sie. Ich bin sehr wohl in der Lage, dein Boot zu steuern. Ihr Vater war zu seinem alljährlichen Besuch bei seiner verwitweten älteren Schwester nach Kalifornien abgereist und würde eine Woche lang dort bleiben. Sie hatte ihm versprochen, sich um das Boot zu kümmern, danach zu sehen und jeden Tag die Bilge zu kontrollieren.
Das hatte sie auch vor – auf dem Wasser.
Sie erinnerte sich noch an die Sommer, als sie dreizehn, vierzehn gewesen war – damals hatte ihre Mutter noch gelebt. Morgens war sie mit ihrem Vater zum Hummerfang hinausgefahren. Sie hatte als sein »stern man« gearbeitet, die Fallen mit Köder versehen, die Hummer vermessen und sortiert und die zu kleinen wieder ins Meer geworfen. Es hatte sie gewurmt, dass er sie nie ans Steuer gelassen hatte – niemals. Und nachdem ihre Mutter gestorben war, seit sie zur Uni ging, hatte er einen neuen Helfer eingestellt und sich geweigert, sie wieder an Bord arbeiten zu lassen, wenn sie in den Ferien nach Hause kam. »Das wäre Jake gegenüber nicht fair«, hatte er gesagt. »Er verdient sich damit seinen Lebensunterhalt. Du gehst aufs College.«
Sie schüttelte diese Gedanken ab. Das Meer, noch dunkel vor dem Morgengrauen, war so still wie ein Spiegel, und da heute Sonntag und damit das Fischen verboten war, waren keine Hummerfangboote unterwegs. Der Hafen war still, das Städtchen schwieg.
Sie warf Jackie ein paar Leinen zu, und die befestigte das Boot an Pollern. Ihre Ausrüstung war schon auf dem Schwimmsteg angehäuft: eine riesige Kühlbox, eine kleine Gasflasche, ein paar Flaschen Jim Beam, zwei Seesäcke, Kartons voll Camping-Mahlzeiten, wetterfeste Kleidung, Schlafsäcke und Kissen. Zu zweit begannen sie die Sachen in der kleinen Kajüte zu verstauen. Während sie arbeiteten, ging die Sonne über dem Ozean auf und warf einen Goldglanz aufs Wasser.
Als Abbey aus der Kajüte kam, hörte sie die Fehlzündung eines Autos und ein knirschendes Getriebe vom Kai über ihnen. Gleich darauf erschien eine Gestalt am Kopf der Rampe.
»O nein, schau mal, wer da ist«, sagte Jackie.
Randall Worth schlenderte die Rampe herab. Obwohl es nur zehn Grad warm war, trug er ein Tanktop, so dass man seine erbärmlichen Knast-Tattoos sehen konnte. »Nein, so was. Da sind ja Thelma und Louise.«
Er war groß und sehnig mit fettigem, schulterlangem Haar, Schorf im Gesicht und Stoppeln am Kinn. Er trug ordinäre Motorradstiefel mit baumelnden Ketten daran, obwohl er noch nie im Leben auf einem richtigen Motorrad gesessen hatte. Er grinste und entblößte dabei zwei Reihen brauner, fauliger Zähne.
Abbey belud weiter das Boot und ignorierte ihn. Sie kannte ihn fast schon ihr Leben lang und konnte immer noch nicht glauben, in welches Verderben der fröhliche, dumme, sommersprossige Junge – immer der schlechteste Spieler in der Baseballmannschaft, doch er hatte nie aufgegeben – sich selbst gestürzt hatte. Vielleicht lag es an dem fast unvermeidlichen Spitznamen, den sie von seinem Nachnamen abgeleitet und bei den Baseballspielen immer übers Feld gebrüllt hatten: Worthless! Worthless!
»Fährst du in Urlaub?«, fragte Worth sie.
Abbey schwang einen Seesack aufs Seitendeck, und Jackie schob ihn in die Ecke der Steuerkabine.
»Du hast mich nicht ein Mal besucht, seit ich aus dem Maine State raus bin. Das hat mich wirklich verletzt.«
Abbey schwang den zweiten Seesack hoch. Sie waren fast fertig. Sie konnte es kaum erwarten, von Worth fortzukommen.
»Ich rede mit dir.«
»Jackie«, sagte Abbey, »fass mal mit an.«
»Na klar.«
Sie packten je einen Henkel der Kühlbox und wollten sie gerade über das Seitendeck wuchten, als Worth vor sie trat und ihnen den Weg versperrte. »Ich habe gesagt, ich rede mit dir.« Er ließ die Muskeln spielen, doch an seinem ausgezehrten Körper war die Wirkung lächerlich. Abbey stellte die schwere Kiste ab und starrte ihn an. Auf einmal stieg große Traurigkeit in ihr auf.
»Oh, bin ich etwa im Weg?«, fragte Worth mit schmierigem Grinsen.
Abbey verschränkte die Arme und wartete mit abgewandtem Gesicht.
Worth trat direkt vor sie hin und beugte sich über sie, so dass sein Gesicht ihrem ganz nahe war und sein übler Körpergeruch sie einhüllte. Er verzog die rissigen Lippen zu einem schiefen Lächeln. »Hast du gedacht, du könntest so einfach Schluss machen?«
»Ich habe nicht mit dir Schluss gemacht, weil zwischen uns überhaupt nichts war«, erwiderte Abbey.
»Ach so? Wie nennst du dann das hier?« Er schob obszön die Hüften vor und zurück und stöhnte mit Fistelstimme: »Tiefer, tiefer.«
»Sehr komisch. Die Mühe hätte ich mir sparen können, hat ja nichts gebracht.«
Jackie lachte schallend.
Er schwieg kurz. »Was soll das heißen?«
Abbey wandte sich ab, jegliches Mitgefühl war verflogen. »Nichts. Geh mir einfach aus dem Weg.«
»Wenn ich ein Mädchen ficke, gehört sie mir. Wusstest du das nicht, du Nigger-Schlampe?«
»He, halt dein dreckiges Maul, du rassistisches Arschloch«, fuhr Jackie auf.
Warum, warum war sie so dumm gewesen, sich mit ihm einzulassen? Abbey packte den Griff und hob die Kühlbox wieder hoch. »Gehst du jetzt aus dem Weg, oder muss ich die Polizei rufen? Wenn du gegen deine Bewährungsauflagen verstößt, sitzt du gleich wieder im Maine State.«
Worth rührte sich nicht.
»Jackie, häng dich ans Funkgerät. Kanal sechzehn. Ruf die Polizei.«
Jackie sprang ins Boot, schlüpfte in die Steuerkabine und zog das Sprechgerät aus der Deckenhalterung.
»Fick dich doch«, sagte Worth und trat beiseite. »Vergiss die Bullen. Na los, ich halte dich nicht auf. Ich sage dir nur eines: Du servierst mich nicht ab.« Er hob den Arm und zeigte mit gerecktem Zeigefinger auf sie hinab. »Weil du dunkle Eiche bist. Und man sagt doch so schön: Wenn du was für deine Axt suchst, nimm dunkle Eiche.«
»Du bist so was von arm.« Mit glühendem Gesicht schob Abbey sich an ihm vorbei, hievte die letzte Kühlbox aufs Seitendeck und verstaute sie in der Kabine. Sie übernahm das Steuer und legte die Hand auf den Schalthebel.
»Leinen los, Jackie.«
Jackie löste die Leinen von den Pollern, warf sie ins Boot und hüpfte hinterher. Abbey fuhr langsam los, ließ das Heck ein Stück ausdrehen, schaltete und fuhr rückwärts an.
Worth stand auf dem Steg, klein und mager wie eine Vogelscheuche, und versuchte, knallhart zu klingen. »Ich weiß, was du vorhast«, rief er. »Alle Welt weiß, dass du wieder nach diesem alten Piratenschatz suchst. Du kannst niemandem was vormachen.«
Sobald die Marea die Boje an der Hafeneinfahrt passiert hatte, fuhr sie einen scharfen Bogen steuerbords und hielt aufs offene Meer zu.
»Was für ein Arschloch«, bemerkte Jackie. »Hast du seinen Meth-Mund gesehen?«
Abbey sagte nichts.
»Beschissener Rassist. Nicht zu fassen, dass er dich eine Nigger-Schlampe genannt hat. Weißer Abschaum, der Wichser.«
»Ich wünschte … ich wäre ein Nigger.«
»Was redest du denn jetzt für einen Blödsinn?«
»Ich weiß nicht. Ich fühle mich so … weiß.«
»Na ja, du bist ja auch irgendwie weiß. Ich meine, du tanzt wirklich beschissen.« Jackie lachte verlegen.
Abbey verdrehte die Augen gen Himmel.
»Im Ernst, nichts an dir wirkt schwarz, nicht so richtig. Weder die Art, wie du redest, noch deine Herkunft oder deine Freunde … nimm’s mir nicht übel, aber …« Ihre Stimme erstarb.
»Das ist ja das Problem«, sagte Abbey. »Nichts an mir wirkt richtig wie ich. Ich bin phänotypisch schwarz, in jeder anderen Hinsicht aber weiß.«
»Wen kümmert das? Du bist, was du bist, scheiß auf alles andere.« Nach einem peinlichen Schweigen fragte Jackie: »Hast du wirklich mit ihm geschlafen?«
»Erinnere mich bloß nicht daran.«
»Wann?«
»Auf dieser Abschiedsparty bei den Lawlers, vor zwei Jahren. Ehe er mit Meth angefangen hat.«
»Warum?«
»Ich war betrunken.«
»Ja, aber mit ihm?«
Abbey zuckte mit den Schultern. »Er war der erste Junge, den ich geküsst habe, damals in der sechsten Klasse …« Sie sah Jackie feixen. »Schon gut, ich bin dämlich.«
»Nein, du hast nur einen schlechten Geschmack, was Männer angeht. Ich meine, einen sehr schlechten Geschmack.«
»Danke.« Abbey öffnete das Fenster, und die Seeluft strich ihr übers Gesicht. Das Boot durchschnitt den schillernden Ozean. Nach einer Weile kehrte ihre gute Laune zurück. Das hier war ein Abenteuer – und sie würden dabei reich werden. »He, Erste Offizierin!« Sie hob die Hand.
Jackie klatschte sie ab, und Abbey jubelte laut. »Romeo Foxtrott, wollen wir tanzen?« Sie steckte ihren iPod ins Bose-Dock ihres Vaters, wählte den »Walkürenritt« aus und drehte die Lautstärke voll auf. Das Boot donnerte durch den Muscongus Sound, und Wagner schallte übers Wasser.
»Erste Offizierin?«, sagte sie. »Eintrag ins Logbuch. Marea, fünfzehnter Mai, sechs Uhr fünfundzwanzig, Treibstoff einhundert Prozent, Bourbon einhundert Prozent, Gras einhundert Prozent, Motorbetriebsstunden neuntausendeinhundertvierzehn, Wind vernachlässigbar, Seegang eins, Kurs null sieben null Grad bei zwölf Knoten auf Louds Island auf der Suche nach dem Muscongus-Bay-Meteoriten!«
»Aye, aye, Frau Kapitänin. Soll ich uns als Erstes eine Tüte drehen?«
»Kapitaler Einfall, Erste Offizierin!« Abbey stieß erneut ein Jubelgeheul aus, und Worth war gänzlich aus ihren Gedanken verschwunden. »Schöner kann das Leben gar nicht sein.«
7
Ford bezahlte den Taxifahrer und schlenderte den Gehweg entlang. Das Edelsteinviertel von Bangkok war ein Gewirr von Straßen abseits der Silom Road, nicht weit entfernt vom Fluss. Es bestand aus einer Mischung aus riesigen, kaufhaus-ähnlichen Großhändlern und den hässlichen kleinen Ladenfronten der Betrüger und Geldwäscher. Die Straße war grundsätzlich verstopft, die schmalen Bürgersteige von verbotenerweise geparkten Autos blockiert, die Gebäude zu beiden Seiten billig, modern und geschmacklos. Bangkok gehörte weiß Gott nicht zu Fords Lieblingsstädten.
An der Ecke Bamroonmuang Road traf er auf ein niedriges Gebäude in dunkelgrauem Backstein. Auf dem Schild über der Tür stand PIYAMANEE LTD., und in den verdunkelten Fensterscheiben sah er nur sein Spiegelbild.
Ford kämmte sich mit den Fingern das Haar zurück und zog sein rohseidenes Jackett zurecht. Er war aufgemacht wie ein Drogendealer, das Seidenhemd bis zum Brustbein offen, Goldkettchen, Bollé-Sonnenbrille, Dreitagebart. Er schob die Hände in die Taschen, schlenderte durch die offene Tür nach drinnen, blieb stehen und sah sich um. Das Licht war schummrig, so dass man die Steine nicht allzu genau untersuchen konnte, und es roch ganz leicht nach Chlorreiniger. Gläserne Ladentheken mit anämischer Beleuchtung bildeten ein riesiges offenes Rechteck. Ein junges amerikanisches Pärchen, offensichtlich auf Hochzeitsreise, betrachtete eine Auswahl trüber Sternsaphire, die auf schwarzem Samt ausgelegt waren.
Sofort eilten zwei Verkäuferinnen auf ihn zu, von denen keine älter sein konnte als sechzehn.
»Sawasdee! Willkommen, liebster Freund!« Eine hielt ihm einen Mango-Drink hin, mit Blume und Schirmchen. »Sie kommen letzte Tag Sonderexport von Regierung zu kaufen Edelsteine, Sir?«
Ford ignorierte sie.
»Sir?«
»Ich will den Besitzer sprechen.« Er sprach in die Luft etwa dreißig Zentimeter über ihren Köpfen, ohne die Sonnenbrille abzunehmen, die Hände noch in den Taschen.
»Sir wünschen Willkommen Drink?«
»Sir nicht wünschen Willkommen Drink.«
Die Mädchen zogen enttäuscht ab, und gleich darauf erschien ein Mann aus dem Hinterzimmer. Er trug einen makellosen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und grauer Krawatte und verbeugte sich mehrmals unterwürfig mit zusammengelegten Händen, während er sich Ford näherte. »Willkommen, liebster Freund! Willkommen! Woher kommen Sie? Amerika?«
Ford musterte ihn mit strengem Blick. »Ich will mit dem Besitzer sprechen.«
»Thaksin, Thaksin, zu Diensten, Sir!«
»Scheiß drauf. Ich rede nicht mit Lakaien.« Ford wandte sich zum Gehen.
»Einen Moment, Sir.« Ein paar Minuten vergingen, und ein sehr kleiner, müder Mann kam aus den hinteren Räumen. Er trug einen Trainingsanzug und ging leicht gebeugt, ohne die Eile der anderen, und er hatte Tränensäcke unter den Augen. Als er Ford erreichte, hielt er inne und musterte ihn mit undurchdringlich ruhiger Miene von oben bis unten. »Ihr Name, bitte?«
Anstelle einer Antwort holte Ford einen orangefarbenen Stein aus der Tasche und zeigte ihn dem Mann.
Der trat beiläufig einen Schritt zurück. »Gehen wir in mein Büro.«
Das Büro war klein und mit billigem Furnier getäfelt, das sich in der feuchten Luft verzogen und teilweise abgelöst hatte. Es stank nach Zigaretten. Ford hatte schon früher Geschäfte in Südostasien getätigt und wusste, dass ein schäbiges Büro oder die schlecht geschnittene Kleidung eines Mannes keinen Hinweis darauf darstellte, wer die Person war; ein völlig heruntergekommenes Büro konnte der Arbeitsplatz eines Milliardärs sein.
»Ich bin Adirake Boonmee.« Der Mann streckte eine kleine Hand aus und schüttelte Fords mit leichtem Druck.
»Kirk Mandrake.«
»Dürfte ich diesen Stein noch einmal sehen, Mr. Mandrake, Sir?«
Ford holte den Stein hervor, doch der Mann nahm ihn nicht.
»Legen Sie ihn doch auf den Tisch.«
Ford legte ihn hin. Boonmee musterte ihn lange, rückte näher, griff dann danach und hielt ihn in einen starken Lichtstrahl, der aus einer Ecke in den Raum fiel.
»Er ist falsch«, sagte er. »Ein bedampfter Topas.«
Ford täuschte einen Augenblick der Verwirrung vor, von der er sich rasch erholte. »Natürlich, das ist mir klar«, sagte er.
»Natürlich.« Boonmee legte den Stein auf ein Filztablett auf seinem Schreibtisch. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich habe einen großen Kunden, der eine Menge von diesen Steinen will. Honeys. Echte. Und er ist bereit, einen Spitzenpreis zu bezahlen. In Goldmünzen.«
»Was hat Sie auf den Gedanken gebracht, wir könnten solche Steine verkaufen?«
Ford griff in seine Tasche, zog ein Röhrchen American Eagles heraus und ließ die Münzen auf den Filz fallen, so dass eine nach der anderen mit dumpfem Klimpern aufschlug. Boonmee schien die Münzen keines Blicks zu würdigen, aber Ford konnte an seiner Halsschlagader sehen, wie sich der Puls beschleunigte. Schon komisch, dass der Anblick von Gold das oft bewirkte.
»Damit möchte ich ein Gespräch eröffnen.«
Boonmee lächelte, ein eigenartig unschuldiger, liebenswerter Ausdruck, der sein kleines Gesicht erstrahlen ließ. Er schob die Hand über die Münzen und steckte sie sich in die Tasche. Dann lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück. »Mr. Mandrake, ich glaube, wir werden ein gutes Gespräch führen.«
»Mein Kunde ist ein Großhändler in den USA, der mindestens zehntausend Karat Rohsteine kaufen möchte, um sie selbst zu schleifen und zu verkaufen. Ich selbst bin kein Edelsteinhändler – ich könnte einen Diamanten nicht von einem Glassplitter unterscheiden. Ich bin das, was man vielleicht einen ›Importvermittler‹ nennen könnte, wenn es darum geht, äh, Lieferungen durch den amerikanischen Zoll zu bekommen.« Ford legte einen gewissen prahlerischen Unterton in seine Stimme.
»Ich verstehe. Aber zehntausend Karat sind unmöglich. Jedenfalls kurzfristig.«
»Warum das?«
»Die Steine sind selten. Sie kommen langsam zutage. Und ich bin nicht der einzige Edelsteinhändler in Bangkok. Ich kann Ihnen für den Anfang ein paar hundert Karat liefern. Dann sehen wir weiter.«
Ford rutschte auf dem Stuhl herum und runzelte die Stirn. »Sie werden mich mit gar nichts ›für den Anfang‹ abspeisen, Mr. Boonmee. Das ist ein einmaliges Geschäft, alles oder nichts. Zehntausend Karat, oder ich gehe in den nächsten einschlägigen Laden.«
»Wie lautet Ihr Preis, Mr. Mandrake?«
»Zwanzig Prozent mehr, als allgemein gezahlt wird: sechshundert amerikanische Dollar für das ungeschliffene Karat. Das sind sechs Millionen Dollar, falls Mathematik nicht Ihre Stärke sein sollte.« Ford begleitete das mit einem angemessen dümmlichen Grinsen.
»Ich werde jemanden anrufen. Haben Sie eine Karte, Mr. Mandrake?«
Ford holte eine beeindruckende Karte hervor, wie sie in Asien üblich war, auf feinstem, schwerem Karton mit goldenem Prägedruck, auf der einen Seite in Englisch, auf der anderen in Thai beschriftet. Er überreichte sie Boonmee mit großer Geste. »Sie haben eine Stunde, Mr. Boonmee.«
Boonmee neigte den Kopf.
Nach einem abschließenden Händedruck verließ Ford das Geschäft, blieb an der Ecke stehen, hielt Ausschau nach einem Taxi und winkte die Tuk Tuks weiter. Zwei illegale Taxis hielten, doch auch da winkte er ab. Nachdem er zehn Minuten lang frustriert auf und ab gelaufen war, holte er seine Brieftasche hervor, schaute hinein und ging wieder in den Laden.
Sofort stürzten sich die jungen Verkäuferinnen auf ihn. Er ging einfach an ihnen vorbei zur hinteren Tür und klopfte an. Gleich darauf erschien der kleine Mann.
»Mr. Boonmee?«
Der Händler sah ihn überrascht an. »Gibt es ein Problem?«
Ford lächelte verlegen. »Ich habe Ihnen die falsche Karte gegeben. Eine alte. Darf ich …?«
Boonmee ging zu seinem Schreibtisch, nahm die alte Karte und reichte sie ihm.
»Ich bitte um Verzeihung.« Ford hielt ihm die neue Karte hin, steckte sich die alte in die Brusttasche und eilte wieder hinaus in die heiße Sonne.
Diesmal fand er sofort ein Taxi.
8
Erstaunlich, dass solche Institute immer gleich aussehen, dachte Mark Corso, während er einen der langen, polierten Flure der National Propulsion Facility entlanglief. Obwohl er sich jetzt am anderen Ende des Kontinents befand, rochen die Flure der NPF genauso wie die im MIT – eigentlich auch in Los Alamos oder im Fermilab. Es war die gleiche Mischung aus Bohnerwachs, warmer Elektronik und staubigen Fachbüchern. Und sie sahen auch gleich aus mit ihrem welligen Linoleum, billigen Wandverkleidungen aus hellem Holz und summenden Leuchtstoffröhren zwischen Akustikdeckenplatten.
Corso berührte den glänzenden neuen Institutsausweis, der an einer Plastikschnur um seinen Hals hing, beinahe wie einen Talisman. Als kleiner Junge hatte er Astronaut werden wollen. Der Mond war erobert, aber da war ja noch der Mars. Und der Mars war sogar besser. Jetzt, mit dreißig Jahren, war er der jüngste Leitende Techniker der gesamten Marsmission, und das zu einem Zeitpunkt, wie ihn die Menschheit noch nie erlebt hatte. In weniger als zwei Jahrzehnten – noch ehe er fünfzig war – würde er am größten Ereignis in der Geschichte der Entdeckungen teilhaben: den ersten Menschen auf einen anderen Planeten schicken. Und wenn er es geschickt anstellte, könnte er sogar Leiter dieser Mission werden.
Corso blieb vor einem leeren Schaukasten im Flur stehen, um sein Spiegelbild zu überprüfen: makellos sauberer Laborkittel mit lässig geöffneten obersten Knöpfen, frisch gebügeltes weißes Hemd und Seidenkrawatte, Gabardinehose. Er war fast pedantisch, was seine Kleidung anging, und mied sorgfältig jeden Anschein des trotteligen Wissenschaftlers. Er betrachtete sein Spiegelbild und stellte sich vor, er sähe sich selbst zum ersten Mal. Sein Haar war kurz (sprich: zuverlässig), er trug einen Bart (unkonventionell), aber säuberlich getrimmt (nicht zu unkonventionell), seine Gestalt war schmal und athletisch (nicht verweichlicht). Er war ein gutaussehender Typ, mit dunklem Teint und italienischen Zügen – fein gemeißeltes Gesicht, große braune Augen. Die teure Armani-Brille und die gut geschnittene Kleidung verstärkten noch den Eindruck: ganz sicher kein Sonderling.
Corso holte tief Luft und klopfte selbstsicher an die geschlossene Bürotür.
»Entrez«, hörte er eine Stimme.
Corso schob die Tür auf, betrat das Büro und blieb vor dem Schreibtisch stehen. Es gab keine Sitzgelegenheit – das Büro seines neuen Vorgesetzten, Winston Derkweiler, war klein und beengt, obwohl ihm als Teamleiter ein viel größerer Raum zugestanden hätte. Doch Derkweiler gehörte zu jenen Wissenschaftlern, die stets ihre Verachtung für Vergünstigungen und Äußerlichkeiten der Rangordnung demonstrierten. Seine etwas ungehobelte Art und der schlampige Look verkündeten aller Welt seine reine Hingabe an die Wissenschaft.
Derkweiler lehnte sich auf dem Bürostuhl zurück, an dessen Konturen sich seine weiche, korpulente Gestalt schmiegte. »Gewöhnen Sie sich gut ein im Irrenhaus, Corso? Sie haben ja jetzt einen großen neuen Titel, neue Aufgaben.«
Es gefiel ihm nicht, Corso genannt zu werden, doch er hatte sich damit abgefunden. »Ganz gut, ja.«
»Schön. Was kann ich für Sie tun?«
Corso holte tief Luft. »Ich bin da ein paar Daten zur Gammastrahlung des Mars durchge-«
Derkweiler unterbrach ihn mit gerunzelter Stirn. »Gammastrahlungsdaten?«
»Äh, ja. Ich habe mich mit meinen neuen Aufgaben vertraut gemacht, und als ich mir die älteren Daten angesehen habe …« Er machte eine Pause, während der Derkweiler weiterhin demonstrativ die Stirn runzelte. »Verzeihung, Dr. Derkweiler, stimmt etwas nicht?«
Der Projektleiter sah ihn an und nicht den Ausdruck, den Corso ihm hingelegt hatte. Er faltete nachdenklich die Hände. »Wie lange haben Sie sich mit alten Gammastrahlungsdaten befasst?«
»Die vergangene Woche lang.« Corso war auf einmal besorgt – vielleicht hatten Derkweiler und Freeman sich wegen dieser Daten gestritten.
»Jede Woche kommt hier ein halbes Terabyte an Radar- und Bilddaten rein, die sich unbesehen anhäufen. Die Daten zur Gammastrahlung sind die unwichtigsten.«
»Ich verstehe, aber die Sache ist so …« Corso wurde nervös. »Ehe Dr. Freeman, äh, die NPF verließ, hat er an einer Analyse der Gammastrahlungsdaten gearbeitet. Ich habe seine Arbeit auf diesem Gebiet ja nun geerbt, und als ich sie durchgesehen habe, sind mir einige Anomalien in den Ergebnissen aufgefallen …«
Derkweiler faltete die Hände und beugte sich über den Schreibtisch. »Corso, wissen Sie, worum es bei unserer Mission geht?«
»Mission? Sie meinen …?« Corso ertappte sich dabei, dass seine Wangen heiß wurden – er errötete wie ein Schuljunge, der seine Vokabeln vergessen hat. Es war lächerlich, einen Leitenden Techniker so zu behandeln. Freeman hatte sich des Öfteren bei ihm über Derkweiler beklagt.
»Ich meine …« Derkweiler breitete mit einem Lächeln die Arme aus und ließ den Blick durch sein Büro schweifen. »Hier sitzen wir im wunderschönen Pasadena, Kalifornien, in der großartigen National Propulsion Facility. Machen wir hier Urlaub? Nein, machen wir nicht. Was machen wir dann hier, Corso? Wie heißt die Mission?«
»Die des Mars Mapping Orbiter oder der NPF im Allgemeinen?« Corso bemühte sich, eine neutrale Miene zu wahren.
»Die des MMO! Wir sind hier kein Online-Game, Corso!« Derkweiler kicherte.
»Die Oberfläche des Mars zu erkunden, nach darunter gelegenen Wasservorkommen zu suchen, Mineralien zu analysieren, das Terrain zu kartografieren …«
»Ausgezeichnet. All das zur Vorbereitung auf zukünftige Marslandungen. Vielleicht haben Sie noch nichts davon gehört, dass wir uns in einem neuen Wettrennen ins All befinden – diesmal gegen die Chinesen?«
Corso war überrascht, das in so krassen Begriffen aus der Zeit des Kalten Krieges formuliert zu hören. »Die Chinesen sind nicht einmal in der Nähe der Startlinie.«
»Nicht an der Startlinie?« Derkweiler sprang beinahe vom Stuhl. »Ihr Hu-Jintao-Satellit ist nur noch ein paar Wochen von der Marsumlaufbahn entfernt!«
»Wir haben schon seit Jahrzehnten Orbiter auf einer Marsumlaufbahn, wir haben Sonden dort landen lassen, die Oberfläche mit Rovers erforscht …«
Derkweiler brachte ihn mit einem Wink zum Schweigen. »Ich rede von den langfristigen Perspektiven. Die Chinesen haben den Mond übersprungen und steuern gleich den Mars an. Unterschätzen Sie ja nicht, wozu die in der Lage sind – vor allem, da die USA so zaghaft mit ihrem Raumfahrtprogramm sind.«
Corso nickte höflich.
»Und Sie spielen hier mit Gammastrahlen herum. Was haben irgendwelche verirrten Gammastrahlen mit der Marsmission zu tun?«
»Der MMO hat einen Gammastrahlungsdetektor«, entgegnete Corso. »Die Analyse dieser Daten gehört zu meinem Aufgabenbereich.«
»Dieser Detektor wurde im allerletzten Moment drangehängt«, erklärte Derkweiler. »Von Dr. Freeman, gegen alle meine Einwände und aus keinem erkennbaren Grund. Gammastrahlen waren Dr. Freemans kleines Steckenpferd. Hören Sie – ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie versuchen, das Chaos aufzuräumen, das Dr. Freeman hinterlassen hat, und die Prioritäten sind Ihnen noch nicht klar. Darf ich also vorschlagen, dass Sie sich an die Arbeit für die Mission halten – die Radardaten des SHARAD?«
Corso bemühte sich, sein bestes Speichellecker-Lächeln aufzusetzen, nahm die Gammastrahlenunterlagen und steckte sie in den Umschlag zurück. Er würde mit Derkweiler auskommen, ganz gleich, was dazu nötig sein sollte. »Dann mache ich mich gleich an die Arbeit«, erklärte er forsch.
»Ausgezeichnet. Ihre erste Präsentation auf Führungsebene ist in einer Woche – ich möchte, dass Sie Ihre Sache gut machen. Der erste Eindruck und so weiter. Sie verstehen?«
»Ja. Vielen Dank.«
»Sie brauchen mir nicht zu danken. Es ist mein Job, Leuten auf die Zehen zu treten.« Ein weiteres Kichern.
»Natürlich.«
Als Corso sich zum Gehen wandte, sagte Derkweiler: »Da wäre noch etwas.«
Er drehte sich um.
»Das interessiert Sie vielleicht.« Er warf einen dünnen, gehefteten Stapel Papier so über den Schreibtisch, dass er vor Corso landete. »Das ist der abschließende Polizeibericht über den Mord an Dr. Freeman. Es war ein Einbrecher – sieht so aus, als wäre Dr. Freeman zum falschen Zeitpunkt nach Hause gekommen. Ein Haufen Zeug wurde gestohlen, eine Rolex, Schmuck, Computer … Ich dachte, Sie würden das vielleicht gern sehen. Ich weiß, dass Sie ihm nahestanden.«
»Danke.« Corso nahm die Unterlagen.