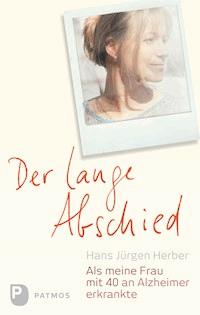
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wenn eine Frau mit 40 Jahren die Diagnose einer unheilbaren Krankheit erhält und ihr Mann ihr das Versprechen gibt, sie durch alles hindurch zu begleiten, dann klingt das wie eine Selbstverständlichkeit. Wenn diese Krankheit die geliebte Frau aber nicht nur schwächt, sondern sie vor seinen Augen als Person verschwinden lässt wie eine Bleistiftzeichnung unter dem Radiergummi, dann ist das eine andere Dimension. Hans Jürgen Herber erzählt mutig und mit entwaffnender Offenheit, was es bedeutet, seine junge Frau und die Mutter seines Sohnes nach und nach an Alzheimer zu verlieren. Er beschreibt eine Beziehungsreise, die berühren, aber auch irritieren oder gar provozieren mag. Vielleicht macht sie auch Mut, nach ungewöhnlichen Lösungen zu suchen. Ein Buch, das einen nicht mehr loslässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autoren
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Bildteil
HAUPTTITEL
Hans Jürgen Herber mit Ulrich Beckers
Der lange Abschied
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
Der Tag der Diagnose
Frühe Jahre
Freie Fahrt
Mein Weg zu Yvonne
Yvonne bekommt Probleme
Yvonnes Herz
Welpenschutz
Ausgebrannt
Nach der Diagnose
Neue Hoffnung
Big Family Business
Immunglobulin
USA
Gentest
Auf der Geschlossenen
Alina
Eine Form von Liebe
Das Ende vor Augen
Spezialauftrag
Letzte Reise
Abschied
Bildteil
Buch lesen
Für Marc
Vorwort
Wenn wir verliebt sind, erfasst uns die große Welle der Euphorie. Es ist eine Begeisterung, die zwei Menschen glauben macht, dass es nichts gibt, was sie je trennen wird, was sie aufhalten könnte oder aus der Bahn schießt. Wie wunderbar.
Die Frage, warum die Natur der Liebe so gebaut ist, dass sie uns diese Extraportion an Lust- und Liebesgefühl, diesen Vorschuss aus Glückshormonen und Übermut gleich zu Beginn unserer Beziehungskarriere beschert, quasi als einmaligen Kredit aufs gemeinsame Konto überweist, und das ganz ohne Gegenleistung, diese Frage sei dahingestellt. Gilt nicht im sonstigen Leben immer noch die Formel: »Erst die Arbeit und dann …«? Nicht so in der Liebe.
Vielleicht brauchen wir diesen Urknall des Verliebtseins, um wirklich in Bewegung zu geraten, um uns zu trauen. Und um Jahre später auf etwas zurückgreifen zu können: Wenn es irgendwann unweigerlich eng wird, der Weg steil wird und der Wind von vorne bläst. Sicher ist, dass jede Liebesbeziehung, die reift und dauert, die Verantwortung übernimmt, erst recht wenn sie zu »Familie« wird, irgendwann von diesem Depot profitiert, an diesem Vorrat an Optimismus knabbern wird.
Wenn ein Mann, dessen Frau im Alter von vierzig Jahren eine unheilbare Diagnose bekommt, ihr das Versprechen gibt, sie nicht alleine zu lassen und sie durch alles hindurch zu begleiten, was immer auch kommen mag, klingt das zuerst einmal nach einer Selbstverständlichkeit. Wahre Liebe, das weiß jeder, bewährt sich erst in der Krise, eben dann, wenn sie neben den guten auch die schlechten Zeiten übersteht.
Alzheimer ist anders. Alzheimer verändert alles.
Es gibt eine Vielzahl von Krankheiten, die ohne Heilungsperspektive verlaufen, die tödlich enden. Doch wenn diese Krankheit deinen geliebten Partner nicht einfach nur schwächt, aus dem Alltag nimmt und lebensuntüchtig macht, sondern auch als Person, als dein Gegenüber erodieren lässt, dann ist das eine neue, eine andere Dimension. Der geliebte Mensch, der mit Geist und Seele ein Teil deines Lebens war, verschwindet vor deinen Augen wie eine Bleistiftzeichnung unter dem Radiergummi, verweht wie eine Düne im Sandsturm.
Gespräche verfangen sich in Endlosschleifen, zerfallen in absurde Bestandteile, werden zu verzweifelten Monologen. Erinnerungsdepots, einst die Verankerungen des gemeinsamen Glücks, stehen plötzlich leer wie verrottende Industriebauten. Dein Partner entgleitet dir vor deinen Augen in einen anderen, namenlosen Kosmos, zu dem dir der Zugangscode fehlt. Und nicht nur das. Der geliebte Mensch wird streitsüchtig, infantil, inkontinent. Aus dem Geliebten wird der Betreute.
Was wird jetzt aus der Liebe? Wie geht jetzt »Familie«? Wo gibt es Hilfe?
Hans Herber erzählt die Geschichte von Yvonne, die auch seine Geschichte ist. Mutig und mit entwaffnender Offenheit beschreibt er, was es bedeutet, seine junge Frau und die Mutter seines Sohnes an Alzheimer zu verlieren. Es ist eine Beziehungsreise, die berühren, aber auch irritieren oder gar provozieren mag. Vielleicht macht sie aber auch Mut, nach ungewöhnlichen Lösungen zu suchen. Es ist auch die Geschichte von Sandra, von Marc, Dominik und Max. Von Gabi und Bubi, Alina, Maria und Luca. Und den vielen anderen Menschen, die für Yvonne Familie waren. Es ist die Geschichte, die Yvonne nicht mehr erzählen kann.
Der Tag der Diagnose
Der 22. Juni 2010 ist ein sonniger Dienstag. Am Kap der Guten Hoffnung trägt die Fifa die Fußballweltmeisterschaft aus; Gastgeber Südafrika scheidet an diesem Tag aus, nach einem tapferen Eins-zu-null gegen Frankreich.
Der Bundespräsident, Horst Köhler, ist gerade erst zurückgetreten, in acht Tagen wird Christian Wulff das höchste Amt im Staate übernehmen; zeitgleich herrscht in Berlin »Gauckomania«: Im überfüllten Deutschen Theater hält Joachim Gauck, der Präsidentschaftskandidat von SPD und Grünen, eine umjubelte Grundsatzrede.
Europa kämpft immer noch mit der Eurokrise, Griechenland pumpt sich weitere 45 Milliarden Euro.
Klaus Maria Brandauer und Meryl Streep haben heute Geburtstag. Für Yvonne und mich ist es der Tag der Wahrheit.
Draußen herrscht Bilderbuchwetter: 25 Grad und blauer Himmel. Endlich schmeckt die Luft nach Sommer, macht die Sonne ernst mit ihren Versprechungen. Der Juni zwanzigzehn ist ein warmer und freundlicher Monat und bringt Trost für den bis dahin verregneten und zu kalten Mai.
Yvonne und ich sitzen am großen Holztisch, der unsere geräumige und lichte Wohnküche beherrscht. Der Tisch ist der Mittelpunkt unseres häuslichen Lebens; hier wird gekocht, gegessen, beratschlagt, gespielt, gefeiert. Hier ist auch Platz für alle anderen Hausbewohner.
Aber jetzt ist das Haus still: Marc, unser elfjähriger Sohn, ist in der Schule; Gabi, meine Schwester, und Schwager Bubi, die oben im Haus wohnen, sind bei der Arbeit.
Wir sind gerade erst die wenigen Kilometer von der Uniklinik bis hierhin nach Schwanheim gefahren, keine zwölf Minuten von hier, den sommerlichen Main entlang.
Yvonne nimmt schweigend den Kaffee in Empfang, den ich ihr auf den Tisch stelle. Wir sind beide ratlos. Wie erschlagen.
Yvonne wird in einem Monat 42 Jahre alt. Yvonne hat Alzheimer. Ich betrachte meine Frau und bringe es nicht zusammen. Es ist genauso wahr, wie es absurd ist.
Monate der Ungewissheit, der Spekulationen und medizinischen Vermutungen sind mit einem Schlag beendet. Und trotz dieser Diagnose wissen wir beide genau genommen doch weniger als vorher. Alzheimer: Was hat das überhaupt zu bedeuten?
Was kommt jetzt auf uns zu? Wie verläuft diese Krankheit? Und wie lange werden wir in der Lage sein, hier im Haus eine Art Normalität zu wahren? Wann wird es damit vorbei sein? Wann kommt der Tag, an dem Yvonne Marc und mir entgleitet? Und zu guter Letzt: Gibt es nicht doch noch irgendeine Hoffnung für Yvonne – von medizinischer Seite?
Alzheimer verläuft umso drastischer, je früher diese Krankheit ausbricht. Morbus Alzheimer zerstört schrittweise alle Funktionen des Gehirns, die Krankheit endet tödlich, eine wirksame Therapie ist – trotz aller Forschungsbemühungen auf diesem Gebiet – bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Die Ärzte geben Yvonne eine maximale Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren. Ist das jetzt das berühmte halbvolle Glas – oder nur noch der letzte Schluck?
Yvonne hat seit langem mit unerklärlichen Problemen zu kämpfen – und sie leidet selbst am meisten darunter. Sie verlegt Dinge, vergisst ihre PIN, ihre Geldbörse, lässt Checkkarte und Autoschlüssel sonst wo liegen. Unsere Ehe und unser familiäres Leben geraten mehr und mehr aus dem Tritt: Auf Yvonne ist kein Verlass mehr, sie hält sich kaum an Zeiten, Vereinbarungen, sie hat Schwierigkeiten beim Einkaufen wie beim Kochen, denn immer fehlt etwas. Nichts geht mehr reibungslos, zu viele Haushalts-to-dos bleiben an mir hängen, alles muss nachkontrolliert werden. Wäsche bleibt in der Maschine, Rechnungen werden vergessen. Ich bin zunehmend genervt. Auf meine Vorwürfe reagiert Yvonne ihrerseits mit Rechtfertigungen und Gegenangriffen. Auch zwischen Yvonne und Marc ist das Verhältnis seit Wochen gespannt. Streitereien sind an der Tagesordnung: Unser familiärer Zusammenhalt steht vor der Zerreißprobe.
Die Schwierigkeiten, die sie bei der Arbeit hat, im Einkauf der Mainova, sind genau von derselben Sorte. Und sie gehen ihr auch dort sehr nahe, bringen sie langsam zur Verzweiflung. Sie stellt Kollegen dieselbe Frage dreimal am Tag, erledigt Aufgaben halb oder gar nicht. Vor vielen Monaten hat das schleichend eingesetzt. Im Betrieb war man bemüht, sie zu halten, ihr einen adäquaten Posten zu suchen; Yvonne hat mittlerweile eine wahre Odyssee hinter sich.
Begonnen haben die Probleme bei ihrem eigentlichen Job im Einkauf, wo sie mal als Fachkraft geglänzt hat; doch irgendwann nahm ihre Vergesslichkeit schrittweise zu, die Kollegen protegierten sie, solange das möglich war, aber bald war sie für die Abteilung einfach nicht mehr tragbar. Sie wurde durch alle erdenklichen anderen Sparten geschleust – hat im Lager, in der Autowerkstatt gearbeitet, doch fand nirgendwo Halt, alles blieb ohne Erfolg. Es war wie freier Fall.
An Alzheimer hat dabei niemand gedacht.
Vor zwei Monaten hatte Yvonne dann einen Zusammenbruch und musste in eine Klinik. Der erste Verdacht der betreuenden Ärzte ging in eine andere Richtung. Im Arztbericht heißt es: »Die Aufnahme der Patientin erfolgte bei depressiver Dekompensation im Sinne einer Anpassungsstörung vor dem Hintergrund subjektiv wahrgenommener Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen.«
Arbeitshypothese: Pseudodemenz als Begleitsymptom einer reaktiven Depression. Soll heißen: Eine seelische Krise kann eben auch die Leistungs- und Merkfähigkeit beeinträchtigen, zumindest phasenweise.
Und tatsächlich schien einiges für diese Hypothese zu sprechen. Yvonne hatte sich in der stationären Behandlung tatsächlich wieder stabilisiert. Medikamente und Psychotherapie hatten bei ihr das Gefühl der Depression und Hilflosigkeit größtenteils eingedämmt. Sie wirkte auf alle gesundet, ihre Gemütslage hatte sich wieder aufgehellt. Allein die anhaltenden Merkstörungen blieben den behandelnden Ärzten ein Rätsel. Entsprechende Tests zeigten messbare kognitive Beeinträchtigungen insbesondere in den Bereichen Gedächtnis, Sprachproduktion und visuell-räumliche Fähigkeiten, die mit einer Depression allein nicht zu erklären waren. Und so ging die Suche nach der Ursache weiter. Die Ärzte nahmen eine Liquorpunktion vor, eine Untersuchung des Hirnwassers soll Klärung bringen. Danach steht fest: »Es gibt deutliche Hinweise auf das Vorliegen einer Alzheimer-Demenz.«
Yvonne hat ihren Kaffee nicht angerührt. Sie ist aufgestanden, schaut aus dem breiten Küchenfenster.
»Und jetzt?«, fragt sie mich. Ihre Stimme klingt wie von weit weg. Sie blickt in den blühenden Vorgarten.
Ja, was jetzt? Ich bin befangen, gebe mir einen Ruck und stehe auf, lege ihr den Arm um die Schulter.
»Jetzt – sollten wir vor allem sehen, dass wir das Leben genießen, das wir noch zusammen haben. Die Zeit, die uns bleibt.«
»… was wissen wir schon, wie viel Zeit das ist?«, geht Yvonne dazwischen.
Sie ist aufgelöst vor Angst, weint. Sie stellt die Fragen, die sie erdrücken: Wann wird der Tag kommen, an dem sie mich oder Marc nicht mehr erkennt? Wie werden wir damit umgehen?
»Yvonne, du sollst wissen, dass ich dich – egal was kommt – nicht alleine lassen werde. Ich werde für dich da sein.« Sie schaut mich an. Gibt mir einen Kuss. Dann sagt sie leise »Ich weiß« und »danke«.
Ich schaue auf die Küchenuhr. Es ist bald eins, Marc wird in einer Viertelstunde hier sein. Jemand muss es ihm sagen.
Yvonne errät meine Gedanken.
»Ich werde mit Marc reden. Kann ich etwas für dich tun, mein Herz?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nichts, alles okay so weit. Ich werde mich hinlegen.«
Ich nicke, sie geht und lässt mich allein zurück an der großen Familientafel.
Nächste Woche werden wir zusammen in unseren lang geplanten Sommerurlaub fahren, nach Italien. Es wird ein Urlaub unter neuen Vorzeichen …
Aber meine Geschichte mit Yvonne beginnt viel früher. Dafür muss ich zurückblicken in meine Vergangenheit. Ich möchte Sie einladen, mich zu begleiten …
Frühe Jahre
Ich stamme, wie man so sagt, aus einfachen Verhältnissen. Aufgewachsen bin in Frankfurt-Schwanheim, in der Ingelheimer Str. 67. Kein sozialer Brennpunkt, eher die klassische Arbeitersiedlung in der nüchternen Bauweise der Siebzigerjahre: fünfgeschossige, biedere Mietshausblocks in paralleler Aufstellung, dazwischen in großzügiger Anordnung Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Spiel- und Bolzplätze.
Diesen Teil meiner Kindheit in Schwanheim habe ich als ausgesprochen glücklich in Erinnerung, vor allem wegen unserer lebendigen Nachbarschaft: Die ganze Siedlung war durchweg bevölkert mit jungen Familien. Und das hieß: Es gab jede Menge Kinder. Wir waren eine quicklebendige Hausgemeinschaft, haben zusammen gespielt, gefeiert, sind sogar ab und an zusammen verreist. Wenn es mir in dieser Zeit an etwas nicht gemangelt hat, dann an Gleichaltrigen.
Und der Spaß begann direkt vor unserer Tür. Kein umständliches Verabreden, kein Simsen, keine Eltern, die einen erst von hier nach dort bringen mussten. Alles war einfach und zum Greifen nah: Das große Spielparadies lag direkt im Hof. Ich habe ausgiebigen Gebrauch davon gemacht, ein bisschen zu sehr vielleicht, meiner schulischen Karriere hat es fast den Hals gebrochen.
Und so beginnt für mich das Glück jeden Tag um die Mittagszeit, wenn ich der Tortur der Schule einmal mehr entkommen bin: Ich renne von der Penne heimwärts, sperre die Haustür auf, hetze die paar Stufen hinauf in den ersten Stock, im Flur schleudere ich den zentnerschweren Ranzen in den dunkelsten Winkel. Ich habe einen Mörderkohldampf, aber da ist niemand, der auf mich wartet. Im Kühlschrank steht der kleine blaue Emailletopf bereit: mein Mittagessen, das meine Mutter mir zurückgestellt hat. Sie arbeitet ganztägig im Tapeten- und Farbenhaus »Henrich« bei uns im Viertel und kommt erst spät um sieben nach Hause. Also wärme ich mir das Mahl selber auf dem Elektroherd auf, blättere währenddessen in ein paar Comics oder im »Kicker«. Während ich das Essen lauwarm in mich hineinschaufle, dribbeln meine Füße bereits mit dem Lederball unterm Küchentisch. Den Schulranzen und die lästigen Pflichten habe ich schon jetzt vergessen: Es kommt vor, dass ich wochenlang keine Hausaufgaben mache. Warum auch: Ich bin allein und niemand macht mir deswegen ein schlechtes Gewissen. Ich stelle den dreckigen Teller in die Spüle, ein Blick aus dem Küchenfenster verrät mir, was draußen gespielt wird. Drei, vier Jungs warten bereits im Sportdress im Hof. Ich klopfe an die Scheibe, gebe den anderen ein Zeichen, steige rasch in Turnhose, Jacke und Fußballschuhe, hänge mir den Wohnungsschlüssel um und renne, den Ball unterm Arm, das Treppenhaus hinab. Gegenüber unserer Siedlung liegt das große Stoppelfeld, wildes Brachland: unser Stadion.
Per »Gänsefüßchen« machen die beiden Ältesten unter sich aus, wer als Erster seine Mannschaften zusammenstellen darf. Und dann kicken wir.
Fußball gespielt habe ich als Kind, solange ich zurückdenken kann – und das jeden Tag, sommers wie winters, stundenlang bis in die Dunkelheit, oft bis zum Umfallen. Später gehe ich in einen echten Verein, den »FC Germania Schwanheim«. Wir sind sehr erfolgreich, gewinnen sogar zwei Meisterschaften unserer Klasse. Am schlimmsten sind für mich die spielfreien Wochenenden: Ein Samstag ohne Match ist für mich eine Katastrophe, ereignislos und öde. Ein Trost ist nur die »Sportschau«, die meine Mutter mit leichtem Murren über sich ergehen lässt.
Als meine Mutter, Helga Herber, geboren 38, mit mir schwanger wurde, da war die Ehe meiner Eltern im Grunde schon am Ende. Meine Schwester war bereits seit acht Jahren auf der Welt und die Temperatur zwischen meinen Erzeugern hatte sich nach ihrer Geburt empfindlich abgekühlt.
Mag sein, dass meine Ankunft als neuer Erdenbürger die beiden nochmal zusammengebracht hat. Oder zumindest ihrer Ehe eine neue Überschrift gegeben hat. Aber lange konnte das nicht gut gehen.
Mein Vater, Helmut Herber, geboren 33, war ein tüchtiger Exportkaufmann und hat vierzig Jahre lang in Frankfurt-Höchst geschafft; er war zuständig für die Geschäfte mit Brasilien und genoss in seiner Firma einen guten Ruf. Allerdings war er zeit seines Erwachsenenlebens auch ein starker Raucher und Trinker. Das hatte unweigerlich Folgen: Mit sechzig hat man bei ihm Zungenkrebs diagnostiziert. Da haben sie ihn dann in die Frührente entlassen.
Dass er ernsthaft krank war, kann ihn nicht wirklich überrascht haben. Er hatte wohl schon längst gespürt, dass etwas bei ihm im Argen war, aber mein Vater war nun mal die Sorte Mann, die nie zum Arzt geht, sondern lieber alles mit sich selbst ausmacht. Er hat bis zum Ende seiner Tage nie im Krankenhaus gelegen, erst, als es dann mit ihm zu Ende ging, hat er zum ersten und letzten Mal ein Hospital von innen gesehen. Mit gerade mal 61 Jahren ist er gestorben.
Auch meine Mutter hatte dem Sog des Alkohols wenig entgegenzusetzen. Sie war wie mein Vater ganztägig berufstätig, als Filialleiterin in besagtem Tapeten- und Farbenhaus, eine Art lokalem Minibaumarkt in unserem Kiez. Auch sie hat ihren Job sehr ordentlich und ohne Tadel erledigt, bis das Trinken sie an den Rand gebracht hat und sie irgendwann für den kleinen Familienbetrieb nicht mehr tragbar war. Sie wurde gefeuert und das war dann auch schon der Anfang vom Ende ihrer beruflichen Karriere. Alle Bemühungen, in einer anderen Anstellung Fuß zu fassen und es wieder zu etwas zu bringen, hatten nur noch kurzen Erfolg und fielen früher oder später ihrer Sucht zum Opfer.
Als ich fünf war, hatten meine Eltern einen Streit, der einfach nicht enden wollte. Nicht dass sich meine Eltern sonst nicht gestritten hätten; Streitereien im Hause Herber waren für meine acht Jahre ältere Schwester und mich fast schon Routine.
Immer mal wurde es laut zwischen den beiden, es ging um Themen, die ich als Kind nicht nachvollziehen konnte: das Haushaltsgeld, etwaige Neuanschaffungen, die Kindererziehung und das demonstrative Desinteresse meines Vaters an all diesen Themen. Der Suff tat ein Übriges: Wann immer meine Eltern beide unter Strom standen – und das war irgendwann so etwas wie der Normalfall –, dann lief die Sache vorhersagbar aus dem Ruder.
Und dann kam eben dieser Abend. La grande finale. Die Mutter aller Krisen.
Ich erinnere mich: Ich bin fünf, sitze kauernd oben im Etagenbett, meine Schwester in der Parterre desselben Bettes; die Decke bis unter das Kinn gezogen belausche ich das aufziehende Unwetter; das Zanken und Streiten, das zur Raserei anschwillt, das Crescendo der Stimmen, das Knallen der Türen. Vorwürfe werden zu Beleidigungen, Beschimpfungen eskalieren zu Wortsalven. Dann fliegen die ersten Gegenstände durch die Wohnung: Kleiderbügel, Bücher, Tassen und Teller. Ein Knall, ein Bersten, dann das Rieseln der Glassplitter: Der schwere Aschenbecher hat die gläserne Wohnzimmertür glatt durchschlagen. An diesem Abend ahne ich: Das ist das Ende unserer Familie.
Als ich am anderen Morgen zum Bad stelze, verstört, unausgeschlafen und sorgfältig darauf bedacht, nicht in die wild umherliegenden Splitter zu treten, schläft meine Mutter noch. Ich schleiche mich vorbei an der Küche, wo ich meinen Vater sitzen sehe, wie er rauchend und schweigsam in der Zeitung blättert. Seine beiden Koffer stehen bereits an der Garderobe nebeneinander, gepackt und abreisebereit wie zwei schweigsame Dissidenten. Ich gehe nicht zu meinem Vater, ich stelle keine Fragen. Ich weiß auch so, dass er heute gehen wird, dass es vorbei ist.
Meine Schulzeit beginnt ein Jahr später, und wie nicht anders zu erwarten, geht es von Anfang an schief: Ich bin zappelig, unkonzentriert und albere herum während des Unterrichts. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom plus Hypermotorik, das wäre heute die Diagnose. »Klassenclown« nannte man das damals. So überspiele ich die schlechten Noten, als seien sie nicht mein Thema, und nehme das alles mit demonstrativer Lässigkeit. Ich habe Glück: Frau König, meine Klassenlehrerin, ist zwar wenig erbaut von meinen Leistungen, aber sie kann mich gut leiden und so sorgen meine Kaspertiraden für gelegentliches Gelächter und wecken kein böses Blut. Nach der Schule kehre ich allein zurück in die leere Wohnung und verbringe die Nachmittage ohne Aufsicht; selten hält es mich in der Wohnung, fast immer bin ich draußen und eigentlich nie am Schreibtisch.
Meine Zensuren zeigen schon früh eine deutliche Tendenz nach unten, meine Mutter treibt es zur Verzweiflung. Aber zum einen ist sie nie da, zum anderen ein schwacher Charakter mit Hang zur Schwermut. Sie hat weder die Kraft, sich mit mir zu streiten, noch bringt sie die Energie auf, mich fürs Lernen zu begeistern.
Wenig später gibt es Konsequenzen. Schon in der dritten Klasse liegen meine Leistungen jenseits der Toleranzgrenze und ich muss eine Ehrenrunde drehen.
Von der Schwanheimer August-Gräser-Grundschule wechsele ich wenig später auf die Minna-Specht-Förderschule und das ist nicht unbedingt das, was man einen Karrieresprung nennen würde.
Aber das kann mir nichts anhaben, denn ich habe einen Traum, der den schlechten Noten trotzt: Ich werde Fußballprofi. Torwart, um genau zu sein. Um ehrlich zu sein: Ich stelle mich freiwillig ins Tor, weil ich als Feldspieler einfach nichts Glanzvolles zustande bringe. Meine Technik ist verbesserungswürdig, meine Spielübersicht sehr begrenzt und vor dem Tor fehlt mir die Coolness im Abschluss. Also werde ich Keeper: Hinten im Gehäuse habe ich einen klaren Auftrag, dort fühle ich mich zu Hause.
Aber es gibt noch einen anderen Grund und der kommt nicht von ungefähr. Auch mein Vater war ehemals Keeper mit Leib und Seele, ein extrem guter sogar. Und, nebenbei bemerkt: Auch mein Sohn ist auf dem besten Weg, einer zu werden. Das scheint bei den Herbers eine genetische Disposition zu sein, den Laden hinten dicht zu halten, sich fliegenden Lederkugeln furchtlos entgegenzuwerfen, bei Wind und Wetter durch den Dreck zu robben, egal ob der Platz matschig oder gefroren ist.
Den »Schlussmann« zu spielen ist schon eine seltsame Profession. Dazu muss man geboren sein. Da stehen elf auf dem Platz und für alle gelten die selben Regeln, nur einer hat Sonderrechte. Er darf und muss die Kugel in die Hand nehmen. Die meiste Zeit des Spiels ist ein Feldspieler in Bewegung, rennt, läuft, sprintet; der Keeper steht im Kasten, hält sich warm, bewahrt die Ruhe und fiebert doch seinem großen Moment entgegen. Der kommt so sicher wie das Amen in der Kirche – und dann kommt es nur auf ihn an. Er hält die Bude dicht – oder lässt die Dinger durchrollen. Er hechtet in den Winkel und fischt die Pocke heraus, die alle schon drin gesehen haben. Und dann, Momente später, bückt er sich vielleicht nach einem harmlosen Roller, greift daneben und das Ei kullert an ihm vorbei ins Netz. Das sind böse Momente. Die Trennlinie zwischen »Held« und »Horst« ist bei keiner anderen Position auf dem Platz so dünn: Es ist eine wenige Zentimeter breite Kalkspur in der Wiese, die Torlinie.
Mein Vater war als Torwart ein Riesentalent, eine große Nummer, er hatte Profiqualitäten. Er hat mal in einer lokalen Auswahl zwischen den Pfosten gestanden, die gegen Fritz Walter auf dem Platz war. Zeitweise konnte er mit seinem Talent sogar ein saftiges Taschengeld einfahren, das wir dann für Urlaube oder andere Anlässe als Bonus zur Verfügung hatten.
Auch mein Ehrgeiz als Torwart ist irgendwann geweckt. Vom Bolzplatz wechsele ich zu »Germania«. Stets pünktlich erscheine ich zum Training, oft als Erster, wenn der Platzwart noch dabei ist, die Umkleidekabine mit dem alten Holzofen vorzuheizen. Auch an den Wochenenden bin ich dabei, zu jedem Spiel, ich schmeiße mich rein in jeden Schuss und gebe keinen Ball verloren. Mein Trainer sieht neben einem gewissen Talent auch meinen Willen und die Disziplin; er beginnt, an mich zu glauben. Und so bekomme ich den Posten zwischen den Pfosten und setze mich gegen die Konkurrenz durch. Wenn wir an den Wochenenden auswärts spielen, entlockt der Name »Herber« den Älteren ehrfürchtiges Raunen: Der Nimbus meines Vaters schwebt noch immer über dem Platz, reist mit zu jedem Match. Und ich fühle mich in der Pflicht, diesen Namen nicht verblassen zu lassen. Die Querlatte liegt bei 2,44 Meter. Für mich liegt sie gefühlt ein ganzes Stück darüber.
Das Interesse meines Vaters an meiner sportlichen Karriere ist erstaunlich dürftig. Nur wenige Male sehe ich ihn bei einem unserer Spiele als Zuschauer am Spielfeldrand. In den seltensten Fällen bleibt er bis zum Abpfiff. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er mir und sich mal den Moment gönnt, sich die Kugel schnappt und mir ein paar trockene Schüsse aufs Gehäuse gibt, seinen Sprössling mal testet. Einfach so, aus Freude an der Sache. Aber das ist nicht ein Mal vorgekommen. Und so sind die Momente, die sich mein Vater mal einfach mit mir beschäftigt hat, rar gesät …
In einem Urlaub in Kroatien – wir sind bereits auf dem Nachhauseweg und machen Station in Österreich – stehen wir zusammen in einem alten Schuppen; draußen ist es sommerlich heiß und die Werkstatt spendet uns Kühle. Mein Vater kramt in einer Kiste mit Holzresten, sucht sich ein paar Werkzeuge zusammen: eine Handsäge, eine Feile, ein Schnitzmesser. Ich stehe als kleiner Dotz auf dem Hocker neben ihm, um nichts zu verpassen, und schaue gebannt zu, wie er werkelt und zaubert; aus einem alten Stück Holz wird ein Spielzeugschwert – für mich! Ich bin glücklich. Das Schwert wird mein Schatz und bekommt in meinem Zimmer einen Ehrenplatz.
Ab und an kommt mein Vater auch einmal an einem Wochenende bei uns vorbei, in der Ingelheimer Straße. Jedes Mal bin ich vorher fast krank vor Aufregung: Wird er mir was mitbringen, was werden wir zusammen anstellen? Herb ist dann die Enttäuschung, wenn kurz vorher das Telefon klingelt und es heißt: Papa kommt nicht, der hat noch was anderes zu erledigen. Leider passiert genau das viel zu oft.
Einmal kommt er ohne Anmeldung. Es ist ein sonniger Samstag, Papa trägt Motorradjacke, Sonnenbrille und Helm: Er sieht ziemlich lässig aus. Und einen zweiten Helm hat er unterm Arm – in meiner Größe! Mutter ist nicht begeistert.
Draußen parkt seine kleine Honda Dax, wir machen uns startklar. Der Helm passt. Papa kickt den winzigen Motor an, lässt ihn ein paarmal aufheulen und verfrachtet mich auf den Sozius. Mama brüllt von oben ihr letztes Veto aus dem Küchenfenster. Papa stellt sich taub und grinst, dann steigt er auf, kickt den Gang rein und wir brausen los.
Von hinten klammere ich mich an seine riesige Lederjacke, wir cruisen durchs sonnige Schwanheim, cooler als »Easy rider«, ich platze fast vor Stolz. Die Honda röhrt durch die Häuserschluchten, der Wind zerrt an meinem Anorak. Das ist mein Papa – und das ist sein Motorrad – mit mir hintendrauf! Als Scheidungskind bin ich in den Siebzigern immer noch ein Exot: der einzige Junge in der Klasse aus gebrochenen Verhältnissen, das arme Schwein, der ohne Vater. Ich halte Ausschau nach irgendwelchen Kumpels, Freunden, bekannten Gesichtern … Irgendjemand muss das jetzt doch sehen, wahrnehmen, weitererzählen: Hans und Papa, zusammen unterwegs. Es ist wie ein Fluch, aber die Straßen sind leer: Da ist niemand, der mein Glück bezeugen kann. Für mich bleibt es unvergesslich.
Als ich in die Pubertät komme, rückt mein Interesse an Papa und den gemeinsamen Wochenenden deutlich in den Hintergrund. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann den Mut und die Kraft habe, mich mit ihm anzulegen, ihm mal Kante zu zeigen. Es kommt zum Streit und der hat gleich Folgen: Unserem Disput folgt eine eineinhalbjährige Generalpause … bis wir uns zufällig in einer Kneipe wiederbegegnen und ich auf ihn zugehe. Wer weiß, wie lange die Funkstille sonst gedauert hätte. Obwohl wir danach wieder miteinander reden, kommt es nie zu einem echten Gespräch. Immer sind andere dabei, alles bleibt an der Oberfläche, vieles bleibt ungesagt.
Mein erstes Auto ist ein Ford Capri 2,3 Liter, ein echter Angeberschlitten. Dasselbe Modell hat einmal mein Vater gefahren. Als ich ihm irgendwann stolz und ein bisschen sentimental mein Auto präsentiere, bleibt er betont wortkarg. Na ja, ein Ford Capri halt. Wenn du meinst.
Als ich später mit meiner eigenen Familie nach Kroatien und Pichl in Österreich reise, zieht es mich magisch an die Orte meiner Kindheit, so als gäbe es dort eine lang ersehnte Antwort.
Die Antwort bleibt aus. Wenige Tage vor meiner Hochzeit stirbt mein Vater, Helmut Herber, an Krebs. Dass er nicht dabei sein kann, wirft einen dunklen Schatten auf dieses Freudenfest.
Freie Fahrt
Meine Jugend beginnt an dem Tag, als mir mein Opa Hans Hoevel, Polizist und Vater meiner Mutter, ein Mofa verspricht. Einfach so. Ein neues noch dazu!
Als Opa mir dieses Geschenk in Aussicht stellt, kann ich es zuerst gar nicht richtig glauben. Was hat den sonst eher knauserigen Alten geritten, dass er unverhofft so spendabel wird? Ich will es gar nicht wissen, ich will nur, dass dieser Traum real wird – und nicht doch noch zerplatzt wie eine Seifenblase.
Irgendwann, nach quälenden Tagen des Wartens, ist es dann tatsächlich so weit. Opa Hans kommt und holt mich wie versprochen ab. Pünktlich ist er da, am Samstag um zehn, ich stürme die Treppe hinab, nehme Platz auf dem sofabreiten Beifahrersitz seines Opel Admiral und wir schippern feierlich den Weg nach Höchst, zum Zweiradfachgeschäft. Ich bin sprachlos vor Aufregung.
Wir betreten den Laden, die Türklingel bimmelt, mein Opa geht auf einen der Verkäufer zu und lässt mich mitten im Geschäft alleine stehen. Es ist ein magischer, fast heiliger Moment: der Geruch von Benzin, Gummireifen und Öl umweht mich, chromblitzend steht ein gutes Dutzend Maschinen in zwei Reihen von der Tür bis zum Verkaufstresen. Ich schreite durch das Spalier der Zweiräder, ehrfürchtig und tief beeindruckt nehme ich die Parade der Kreidlers, Hondas und Zündapps ab wie ein König einen Empfang mit militärischen Ehren.





























