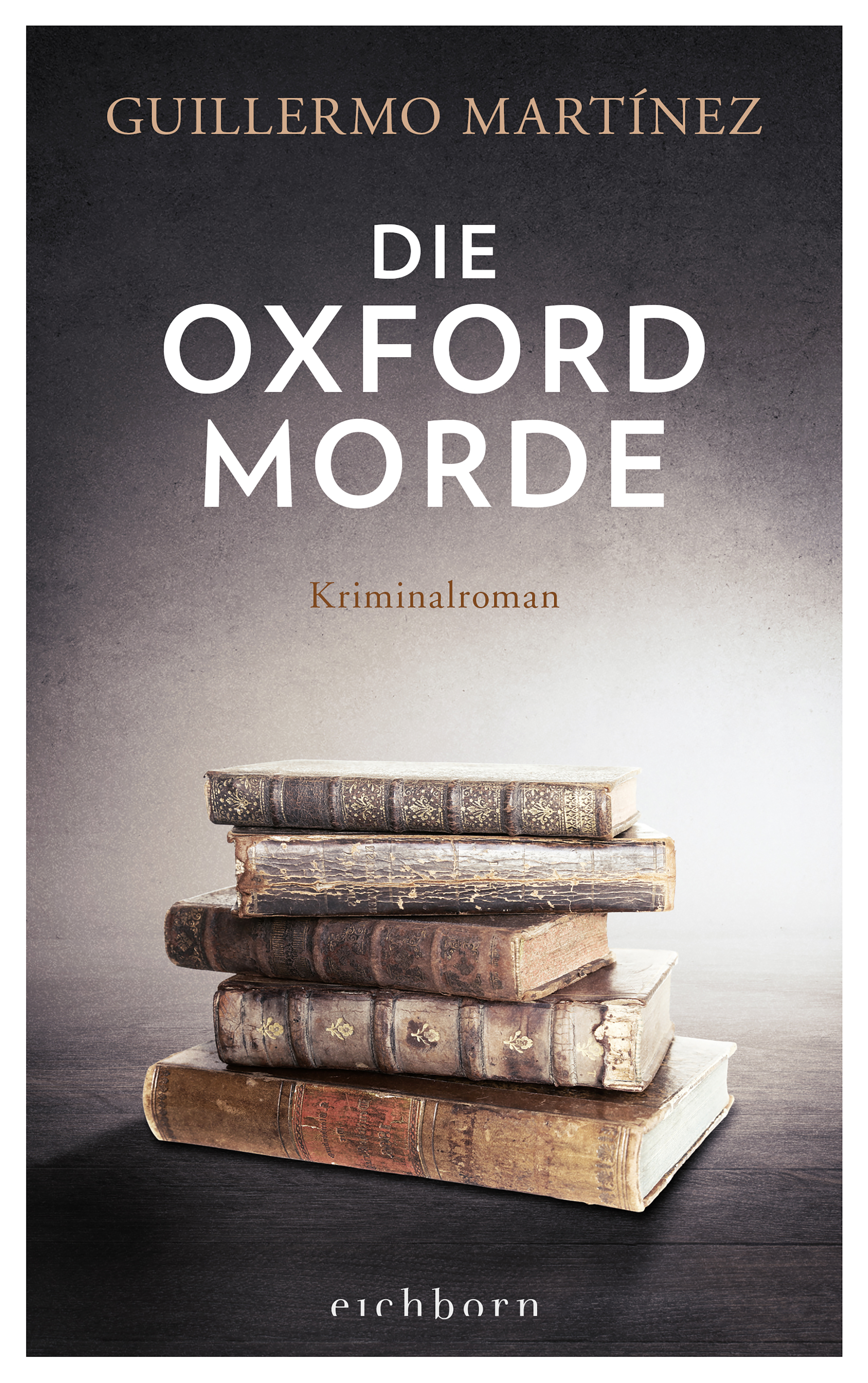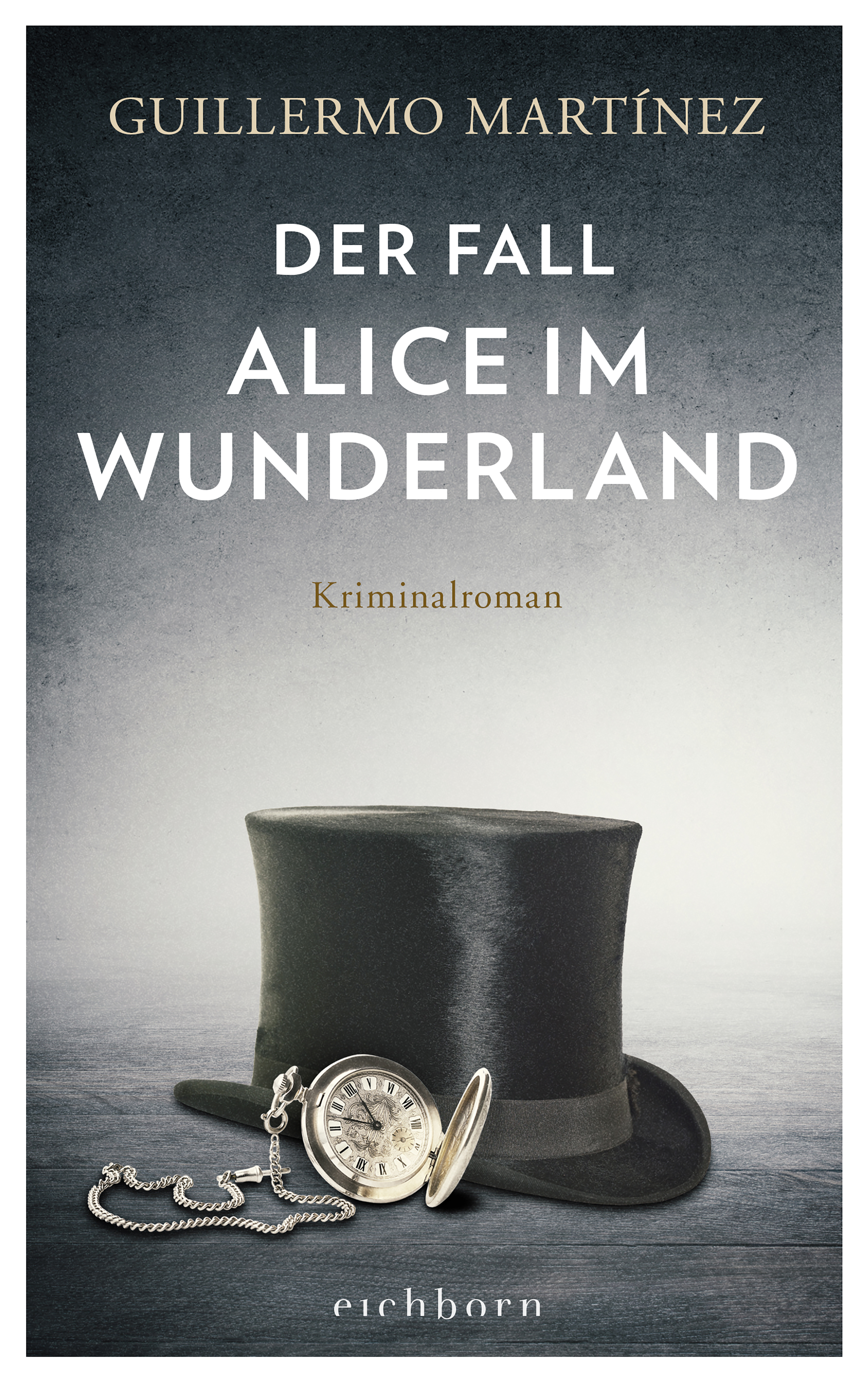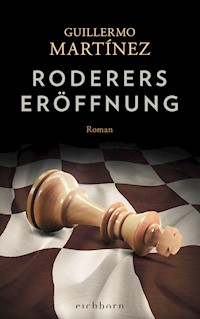9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Luciana B. ist eine schöne und intelligente Studentin. Nebenbei arbeitet sie als Sekretärin bei dem berühmten Krimiautor Kloster. Als dieser ihr eindeutige Avancen macht, zeigt Luciana ihn an und zerstört damit seine Ehe. Als dann innerhalb weniger Jahre ihr Verlobter auf rätselhafte Weise ertrinkt, ihre Eltern an einer Pilzvergiftung sterben und ihr Bruder brutal ermordet wird, steht für Luciana fest: Hinter all ihrem Unglück steht Kloster, der ihr nie verziehen hat und sich grausam rächt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Luciana B. ist eine schöne und intelligente Studentin. Nebenbei arbeitet sie als Sekretärin bei dem berühmten Krimiautor Kloster. Als dieser ihr eindeutige Avancen macht, zeigt Luciana ihn an und zerstört damit seine Ehe. Als dann innerhalb weniger Jahre ihr Verlobter auf rätselhafte Weise ertrinkt, ihre Eltern an einer Pilzvergiftung sterben und ihr Bruder brutal ermordet wird, steht für Luciana fest: Hinter all ihrem Unglück steht Kloster, der ihr nie verziehen hat und sich grausam rächt …
Über den Autor
Guillermo Martínez, geboren 1962, lebt in Buenos Aires und ist promovierter Mathematiker. Zwei Jahre seiner Doktorandenzeit verbrachte er an der Universität Oxford. Für seinen Krimi »Die Oxford-Morde« erhielt er 2003 den Premio Planeta; der Roman wurde in über 40 Sprachen übersetzt und 2008 fürs Kino verfilmt. Der Nachfolgeband »Der Fall Alice im Wunderland« wurde mit dem Premio Nadal 2019 ausgezeichnet.
GUILLERMO MARTÍNEZ
DER LANGSAMETOD DER
LUCIANA B.
Kriminalroman
Übersetzung aus demargentinischen Spanisch von Angelica Ammar
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der spanischen Originalausgabe:
»La muerte lenta de Luciana B.«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Guillermo Martínez
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ilona Jaeger, Berlin
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: nevodka | Rawpixel.com | AKaise | Super8
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0742-8
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
»In der Physik folgt auf jeden Stoß ein Gegenstoß;aber im Moralischen ist die Reaktion noch stärker.Die Reaktion auf den Betrug ist die Verachtung,die Reaktion auf die Verachtung ist der Hass,und der Hass führt zum Mord.«
Giacomo Casanova, »Erinnerungen«
1
Das Telefon riss mich an einem Sonntagmorgen aus dem Tiefschlaf. Eine dünne Stimme wisperte ängstlich Luciana, als müsste das genügen, um mich an sie zu erinnern. Verunsichert wiederholte ich den Namen, und sie fügte ihren Nachnamen hinzu, der eine ferne, vage Reminiszenz in mir wachrief, bis sie mich in einem beklommenen Tonfall daran erinnerte, wer sie war. Luciana B. Die junge Frau, die zum Diktat gekommen war. Natürlich erinnerte ich mich an sie. Waren seitdem tatsächlich zehn Jahre vergangen? Ja, fast zehn Jahre, bestätigte sie, und sie sei froh, dass ich immer noch in derselben Wohnung wohne. Dabei hörte sie sich alles andere als froh an. Sie verstummte kurz. Ob sie mich treffen könne? Sie müsse mich treffen, verbesserte sie sich mit einem verzweifelten Unterton, der jedes Missverständnis im Vorfeld ausräumte. Ja, natürlich, sagte ich, etwas alarmiert, wann? Sobald du kannst, so schnell wie möglich. Ich blickte zweifelnd um mich, auf die Unordnung meiner Wohnung, die den schleichenden Kräften der Entropie ausgesetzt war, und schaute auf die Uhr neben dem Bett. Wenn es um Leben und Tod geht, sagte ich, wie wäre es denn mit heute Nachmittag, hier, um vier Uhr zum Beispiel? Ich hörte einen erstickten Laut am anderen Ende der Leitung, wie sie stoßweise ausatmete, als unterdrückte sie ein Schluchzen. Entschuldige, murmelte sie beschämt, aber ja, es geht um Leben oder Tod. Du weißt nichts davon, oder? Niemand weiß Bescheid. Niemand bekommt es mit. Wieder schien sie fast in Tränen auszubrechen. Es folgte ein Moment des Schweigens, in dem sie sich einigermaßen fasste. Noch leiser, als fiele es ihr schwer, den Namen auszusprechen, fuhr sie fort: Es hat mit Kloster zu tun. Und bevor ich noch irgendetwas hinzufügen konnte, sagte sie rasch, als befürchtete sie, ich könnte es mir anders überlegen: Um vier bin ich bei dir.
Zehn Jahre zuvor hatte ich mir bei einem dummen Unfall das rechte Handgelenk gebrochen, und ein unerbittlicher Gips machte meine Hand bis zum letzten Fingerknöchel bewegungsunfähig. Ich sollte zu der Zeit meinen zweiten Roman abgeben, hatte jedoch bislang nur ein in meiner Krakelschrift geschriebenes Manuskript, zwei dicke Spiralblöcke voller Durchstreichungen, Pfeile und Korrekturen, die niemand anders hätte entziffern können. Campari, mein Verleger, hatte mir nach kurzem Überlegen eine Lösung für mein Problem vorgeschlagen: Seit einiger Zeit, erinnerte er sich, sei Kloster dazu übergegangen, seine Romane zu diktieren, er habe dafür eine junge Frau engagiert, die offenbar in jeder Hinsicht so perfekt sei, dass Kloster sie inzwischen als unverzichtbar für sein Schaffen betrachte.
»Aber warum sollte er sie mir dann leihen wollen?«, fragte ich, noch ungläubig über diesen Glücksfall. Klosters Name, von Campari so selbstverständlich erwähnt und aus unerreichbaren Höhen herabgeholt, hatte mich gegen meinen Willen ein wenig beeindruckt. Wir befanden uns in Camparis großem Büro, in dem ein Druck der Titelseite von Klosters erstem Roman unübersehbar an einer Wand hing, das einzige dekorative Zugeständnis des Verlegers.
»Nein, ich bin mir sicher, dass er sie dir nicht leihen würde. Aber Kloster kommt erst Ende des Monats nach Argentinien zurück, er ist in einer dieser Künstlerresidenzen, in die er sich für die letzten Korrekturen an seinen Romanen vor der Veröffentlichung zurückzuziehen pflegt. Seine Frau hat er nicht mitgenommen, insofern glaube ich nicht«, Campari zwinkerte mir zu, »dass sie seine Sekretärin mitfahren ließ.«
In meinem Beisein rief er bei Kloster zu Hause an, begrüßte überschwänglich offenbar Klosters soeben erwähnte Ehefrau und hörte sich mit resignierter Miene eine Reihe von Klagen an, die sie anscheinend vorbrachte, wartete geduldig, bis sie den Namen im Adressbuch gefunden hatte, und notierte schließlich die Telefonnummer auf einem Zettel.
»Sie heißt Luciana«, sagte er zu mir, »aber Vorsicht. Du weißt, Kloster ist unsere heilige Kuh. Du musst ihm die Frau am Ende des Monats heil zurückgeben.«
Dieses kurze Gespräch hatte mir einen unverhofften Einblick in das zurückgezogene und öffentlichkeitsscheue Leben des einzig wirklich schweigsamen Schriftstellers eines Landes gegeben, dessen Autoren sich vor allem durch Redseligkeit auszeichnen. Die Unterhaltung mit meinem Verleger bescherte mir eine Überraschung nach der anderen, und unwillkürlich sprach ich meine Gedanken laut aus. Kloster, der fürchterliche Kloster, hatte also eine Frau? Und sogar etwas so Unvorstellbares, so unglaublich Bürgerliches wie eine Sekretärin?
»Und eine kleine Tochter, die er anbetet«, ergänzte Campari. »Ich habe ihn ein paarmal getroffen, als er mit ihr in den Park ging. Ja, er ist ein liebevoller Familienvater, wer hätte das gedacht?«
Kloster war damals zwar noch nicht von einem breiten Publikum »entdeckt« worden, doch bereits seit geraumer Zeit, vor allem seit der Veröffentlichung seiner Tetralogie, wurde er von vielen insgeheim als der Schriftsteller gehandelt, den es zu entthronen galt. Von seinem ersten Buch an war er einfach zu groß gewesen, zu herausragend, zu bedeutend. Das Schweigen, in das er zwischen seinen Romanen verfiel, wirkte fast bedrohlich auf uns; als liege die Katze auf der Lauer, während die Mäuse vor sich hin veröffentlichten. Bei jeder Neuerscheinung von Kloster drängte sich uns schon nicht mehr die Frage auf, wie er es zustande gebracht hatte, sondern wie er es erneut zustande gebracht hatte. Zu unserem Leidwesen war er nicht einmal besonders alt oder unserer Generation fern, wie es uns lieb gewesen wäre. Wir trösteten uns mit der Schlussfolgerung, dass Kloster einer anderen Spezies angehören musste, irgendeiner Teufelsbrut, verstoßen von den Menschen, abgeschottet auf einer Insel aus verhärmter Einsamkeit, vermutlich ebenso grässlich anzusehen wie seine eigenen Figuren. Wir stellten uns vor, er könnte, bevor er Schriftsteller wurde, Gerichtsmediziner gewesen sein, Leichenbalsamierer in einem Museum oder Bestattungswagenfahrer. Schließlich hatte er selbst einem seiner Bücher den verächtlichen Satz von Kafkas Hungerkünstler als Motto vorangestellt: »Ich hungere, weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle.« Auf der Innenklappe seines ersten Romans hieß es diplomatisch, Klosters Ausdrucksweise habe etwas »Ungnädiges«, doch man musste nicht lange lesen, um zu erkennen, dass Kloster nicht ungnädig war – er war gnadenlos. Von den ersten Absätzen an blendeten einen seine Romane, wie die Scheinwerfer eines Autos in der Nacht, und zu spät merkte man, dass man sich selbst in einen vor Schreck starren, zitternden Hasen verwandelt hatte und zu nichts anderem mehr fähig war, als hypnotisiert die Seiten umzublättern. Es lag eine beinahe physische Grausamkeit darin, wie seine Geschichten unter die Oberfläche drangen und tief sitzende Ängste aufwühlten, als setzte Kloster einen unheilvollen Meißel an, dessen Bann der Leser sich nicht entziehen konnte. Seine Romane waren nicht besonders blutrünstig, es wurde niemand zerstückelt. Sie waren auch keine richtigen Krimis (sodass wir ihn beruhigt als einfachen Krimiautor hätten abtun können). Aus ihnen sprach schlicht und ergreifend – das Böse. Und wäre das Wort nicht durch all die Seifenopern im Fernsehen verwässert und unbrauchbar gemacht worden, wäre dies vielleicht die beste Definition für seine Romane gewesen: Sie waren böse. Der Beweis dafür, wie übermächtig er bereits damals auf uns wirkte, war die verstohlene Art und Weise, in der wir von ihm sprachen, als ginge es darum, ein Geheimnis eifersüchtig vor »Außenstehenden« zu hüten. Auch die Kritiker wussten im Grunde nicht, was sie von ihm halten sollten, und griffen, um sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er ihnen imponierte, auf Anführungszeichen zurück, wenn sie unbeholfen konstatierten, Kloster schriebe »zu« gut. Darin hatten sie recht: Seine Texte waren zu gut. Außerhalb unserer Reichweite. Jede Szene, jede Dialogzeile, jede Auflösung barg die gleiche entmutigende Lektion, und sooft ich auch versucht hatte, ihre Mechanismen zu »durchschauen«, war ich doch nur zu dem Schluss gekommen, dass hinter alldem ein obsessiver Fantast stecken musste, der gnadenlos über Leben und Tod verfügte, ein absoluter Megalomane. Es ist also nicht verwunderlich, dass ich vor zehn Jahren mehr als neugierig darauf war, wer die »in jeder Hinsicht perfekte« Sekretärin dieses manischen Perfektionisten sein könnte.
Kaum zu Hause angelangt, rief ich sie an – am anderen Ende der Leitung antwortete mir eine gelassen heitere, höfliche Stimme –, und wir vereinbarten ein erstes Treffen. Als ich dann hinunterging, um die Tür zu öffnen, sah ich mich einer großen, schlanken Frau gegenüber, lächelnd und doch ernst, mit hoher Stirn und braunem Pferdeschwanz. War sie attraktiv? Sehr attraktiv. Und vor allem schrecklich jung, sie wirkte wie eine Studentin im ersten Jahr, die gerade aus der Dusche kam. Locker über die Jeans fallende Bluse. Bunte Bänder an einem Handgelenk, Turnschuhe mit einem Sternchen. Wir lächelten uns in der Enge des Fahrstuhls schweigend an; gleichmäßige sehr weiße Zähne, das Haar an den Spitzen noch leicht feucht, Parfum … In meiner Wohnung angekommen, wurden wir uns schnell über Bezahlung und Arbeitszeiten einig. Ganz selbstverständlich hatte sie sich auf den Schreibtischstuhl vor dem Computer gesetzt, ihre Tasche auf einer Seite abgestellt, und während unseres Gesprächs drehte sie mit ihren langen Beinen den Stuhl leicht hin und her. Braune Augen, intelligenter, rascher, gelegentlich schelmischer Blick. Lächelnd, und doch ernst.
An diesem ersten Tag diktierte ich ihr zwei Stunden lang. Sie war schnell, sicher, und aus irgendeinem wundersamen Grund war ihr jede Art von Rechtschreibfehlern fremd. Ihre Hände schienen sich auf der Tastatur meines Computers kaum zu bewegen. Sie hatte sich sofort meiner Intonation und Sprechgeschwindigkeit angepasst und verlor nie den Faden. Also in jeder Hinsicht perfekt? Dazu muss ich sagen, dass mein Blick auf Frauen, je näher mein dreißigster Geburtstag rückte, zunehmend melancholisch und grausam »vorausgreifend« wurde, und ich konnte nicht umhin, mir im Geiste weitere Notizen zu machen. Ich hatte bemerkt, dass ihr hoch in der Stirn ansetzendes Haar vielleicht eine Spur zu fein und brüchig war, und von oben gesehen (ich diktierte ihr im Stehen) teilte es sich in einen etwas zu breiten Scheitel. Ebenso hatte ich festgestellt, dass die Linie ihres Kinnes nicht so konturiert war, wie man es hätte erwarten können, sondern eine leichte Wölbung aufwies, die drohte, sich mit den Jahren in ein Doppelkinn zu verwandeln. Und bevor sie sich hinsetzte, war mir nicht entgangen, dass sie von der Taille abwärts die typische Asymmetrie der Argentinierinnen aufwies, die noch kaum wahrnehmbare, aber lauernde Disproportion etwas zu kräftiger Hüften. Doch all das würde sich erst sehr viel später bemerkbar machen, im Augenblick herrschte allein ihre Jugend vor. Als ich den ersten Notizblock zum Diktat aufschlug, reckte sie den Rücken gegen die Lehne, und etwas betrübt sah ich bestätigt, was ich bereits auf den ersten Blick erahnt hatte: Ihre Bluse fiel ziemlich gerade über ihrer Brust ab. Aber war nicht vielleicht ebendas Kloster sehr gelegen gekommen, womöglich sogar ausschlaggebend für ihn gewesen? Kloster war verheiratet, wie ich nun erfahren hatte, und er hätte seiner Frau schwerlich eine achtzehnjährige Nymphe präsentieren können, die noch dazu atemberaubende Kurven hatte. Doch ganz abgesehen davon, wenn der Schriftsteller tatsächlich ohne Ablenkung arbeiten wollte, war es dann nicht das bestmögliche Arrangement, sich mit der jugendlichen Grazie dieses Gesichts zu umgeben, dessen Profil er ungestört die ganze Zeit betrachten konnte, und von vornherein jede sexuelle Anziehung zu verbannen, die sich unvermeidlich einstellen würde, hätte er ebenfalls die ganze Zeit ein weitaus gefährlicheres Profil vor Augen? Ich fragte mich, ob Kloster wohl diese Art von Überlegungen, von heimlichen Erwägungen angestellt hatte, und sinnierte auch darüber – wie Pessoa –, ob nur ich so niedrig war, im wahrsten Sinne des Wortes. In jedem Fall befand ich seine Wahl jedoch für gut.
Irgendwann schlug ich vor, Kaffee zu machen, und mit der gleichen Ungezwungenheit, mit der sie sich zum Arbeiten eingerichtet hatte, stand sie auf und sagte, auf meinen Gips deutend, das übernehme sie, wenn ich ihr zeigte, wo alles sei. Sie erwähnte, dass Kloster einen Kaffee nach dem anderen trinke (tatsächlich sagte sie nicht Kloster, sondern nannte ihn bei seinem Vornamen, und ich fragte mich, wie vertraut ihr Verhältnis wohl sein mochte) und dass seine erste Unterweisung in einem Vortrag über dessen richtige Zubereitung bestanden habe. Ich wollte sie an jenem ersten Tag nicht weiter über Kloster ausfragen, eben weil er mich so brennend interessierte, dass ich es vorzog zu warten, bis wir uns besser kannten. Dafür erfuhr ich, während wir in der Küche Tassen und Untertassen zusammenstellten, so gut wie alles, was ich über Luciana wissen sollte. Sie war in der Tat an der Uni, im ersten Jahr. Sie hatte sich für Biologie immatrikuliert, vielleicht würde sie nach dem allgemeinen Grundstudium aber auch das Fach wechseln. Vater, Mutter, ein älterer Bruder, der gerade sein Medizinstudium abgeschlossen hatte, eine sieben Jahre jüngere Schwester, die sie mit einem mehrdeutigen Lächeln erwähnte, als handelte es sich um einen liebenswerten Störenfried. Eine Großmutter, die vor einiger Zeit ins Altersheim gekommen war. Ein diskret ins Gespräch eingestreuter namenloser Freund, mit dem sie seit einem Jahr zusammen war. Ob sie mit diesem Freund wohl schon alle Erfahrungen gemacht hatte? Ich riss ein paar etwas zynische Witze und lauschte ihrem Lachen. Innerlich bejahte ich meine Frage, doch, zweifellos. Sie hatte Ballett getanzt, aber damit aufgehört, als sie zu studieren anfing. Man sah es noch an der leicht auswärts gedrehten Stellung ihrer langen Beine. Einmal war sie mit einem Schüleraustausch in den USA gewesen, ein Stipendium ihres zweisprachigen Gymnasiums. Kurz und gut, dachte ich, ihren Erzählungen lauschend, ein vorbildlich erzogenes, perfektes Produkt der argentinischen Mittelklasse, eine Tochter aus gutem Hause, die vielleicht nur etwas früher als ihre Freundinnen auf Arbeitssuche ging. Ich fragte mich, ohne ihr diese Frage zu stellen, warum so früh, doch es mochte ein Zeichen ihrer Reife und Unabhängigkeit sein. Jedenfalls schien sie auf die kleine Summe, die wir vereinbart hatten, ganz und gar nicht angewiesen zu sein: Sie war noch braun gebrannt von den langen Sommerferien in dem Haus am Meer, das ihre Eltern in Villa Gesell besaßen, und allein ihre Handtasche hatte fraglos mehr gekostet als mein alter Computer, der vor ihr stand. Während der zwei Stunden, in denen ich ihr diktierte, zeigte sie nur einmal ein Anzeichen der Ermüdung: Bei einer meiner Pausen ließ sie rasch ihren Kopf von einer Seite zur anderen kreisen, und ihr Hals, ihr hübscher Hals, ließ ein dumpfes Knacken vernehmen. Als die Zeit um war, stand sie auf, trug die Tassen in die Küche, wusch sie ab und gab mir zum Abschied einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
Das war von nun an unsere kleine Routine: Wangenkuss zur Begrüßung, Tasche in einer Sofaecke abgelegt, fast abgeworfen, zwei Stunden Diktat, ein Kaffee und eine kurze Unterhaltung in der engen Küche, zwei weitere Stunden Diktat und irgendwann, unweigerlich, das halb schmerzvolle, halb kokette Kopfkreisen und das dumpfe Knacken ihrer Halswirbel. Mit der Zeit kannte ich ihre Kleidung, die verschiedenen Ausdrücke ihres Gesichts, manchmal verschlafener als sonst, ihre unterschiedlichen Frisuren und Haarspangen, ihre Art, sich zu schminken. Irgendwann fragte ich sie nach Kloster, als sie mich bereits wesentlich mehr interessierte als er, als sie auch mir langsam in jeder Hinsicht perfekt erschien und ich mir die unwahrscheinlichsten Szenarien ausdachte, wie ich sie bei mir behalten könnte. Doch Kloster war als Arbeitgeber offensichtlich auch in jeder Hinsicht perfekt. Er zeige sich äußerst rücksichtsvoll an Prüfungstagen, und dezent ließ sie mich wissen, dass er beinahe doppelt so viel zahlte, wie sie mit mir vereinbart hatte. Aber wie war er als Mensch, dieser mysteriöse Mr K., insistierte ich. Was ich denn wissen wolle, fragte sie verunsichert. Natürlich alles, sagte ich. Ob ihr nicht bekannt sei, dass wir Schriftsteller professionelle Klatschmäuler seien? Niemand kennt ihn, erklärte ich ihr, er gibt keine Interviews, und in seinen Büchern findet sich kein Foto mehr von ihm. Sie wirkte tatsächlich überrascht. Es stimme, dass sie ihn mehrmals Interviews habe ablehnen hören, doch niemals habe sie gedacht, dass es irgendetwas Mysteriöses an ihm geben, er irgendein Geheimnis verbergen könnte. Er sei etwas über vierzig, groß und schlank, in seiner Jugend sei er Langstreckenschwimmer gewesen, sein Arbeitszimmer sei noch voller Fotos, Pokale und Medaillen aus dieser Zeit, und nach wie vor schwimme er manchmal abends in einem Klub in der Nähe.
Sie hatte ihre Beschreibung mit Bedacht kurz gehalten, als sollte sie so neutral wie möglich klingen, und ich fragte mich, ob sie ihn wohl in irgendeiner Hinsicht anziehend fand. Groß, schlank und mit einem breiten Schwimmerrücken also, rekapitulierte ich. Attraktiv?, platzte ich heraus. Sie lachte, als hätte sie diesen Gedanken schon gehabt und wieder verworfen: Nein, nicht für meinen Geschmack zumindest, sagte sie und fügte leicht entrüstet hinzu: Er könnte mein Vater sein. Außerdem, fuhr sie fort, sei er sehr seriös. Auch mit ihm arbeitete sie vier Stunden am Stück, jeden Vormittag. Er hatte eine entzückende vierjährige Tochter, die ihr immer Zeichnungen schenkte und die sie am liebsten als Schwester adoptiert hätte. Das kleine Mädchen spielte in einem an das Arbeitszimmer im Erdgeschoss angrenzenden Raum, während sie arbeiteten. Seine Frau tauchte niemals auf, das war vielleicht das einzig Mysteriöse, sie hatte sie gerade zweimal gesehen. Manchmal rief sie ihrer Tochter aus dem ersten Stock etwas zu oder beorderte sie zu sich. Möglicherweise war sie depressiv oder litt an irgendeiner anderen Krankheit, denn offenbar verbrachte sie den Großteil des Tages im Bett. Er war es, der sich in erster Linie um die Tochter kümmerte, sie hörten immer rechtzeitig auf zu arbeiten, damit er noch mit ihr in den Park gehen konnte. Und wie arbeitete er? Er diktierte ihr vormittags, genau wie ich, nur dass er von Zeit zu Zeit in langes Schweigen versank. Ohne Unterlass wanderte er im Zimmer auf und ab wie in einem Käfig, in einem Moment befand er sich am anderen Ende des Raumes, im nächsten stand er plötzlich hinter ihr. Und wie gesagt trank er viel Kaffee. Selten schafften sie mehr als eine halbe Seite pro Tag. Etliche Male korrigierte er jedes einzelne Wort, ließ sie jeden Satz wieder und wieder vorlesen. Und woran schrieb er? An einem neuen Roman? Was war das Thema? Es war ein Roman, ja, über eine Mördersekte. So schien es zumindest bislang. Sie hatte ihm sogar eine kommentierte Bibel ihres Vaters geliehen, damit er in einer weiteren Übersetzung nachschlagen konnte. Und wie sah er sich selbst? Was ich damit meine, war ihre Gegenfrage. Ob er sich für überlegen hielt. Sie dachte einen Augenblick nach, als versuchte sie, sich an irgendeine Begebenheit zu erinnern, irgendeine Bemerkung, einen unüberlegten Satz in einem Gespräch. Ich habe ihn nie etwas über seine eigenen Bücher sagen hören, antwortete sie schließlich zögernd, aber als wir einmal zum zehnten Mal mit demselben Satz begonnen haben, hat er gesagt, ein Schriftsteller müsse gleichzeitig Gott und ein Skarabäus sein.
Als ich sie nach einer Woche bezahlte, bemerkte ich in der jähen Konzentriertheit, mit der sie auf die Geldscheine blickte, und in der zufriedenen Sorgfalt, mit der sie sie verwahrte, eine Interessiertheit, die sie mir für einen Moment in einem anderen Licht erscheinen ließ; ihre Bemerkung über Klosters Bezahlung fiel mir wieder ein, und verblüfft, auch ein wenig alarmiert, zog ich für mich den Schluss, dass der schönen Luciana Geld ganz und gar nicht gleichgültig war.
Was geschah dann? Es geschah … einiges. Eine Reihe sehr heißer Tage brachte einen unverhofften Nachklang des Sommers mitten im März, und Luciana ersetzte ihre Blusen durch kurze Tops, die einen guten Teil ihres Bauches und Rückens frei ließen. Wenn sie sich vorbeugte, um vom Bildschirm abzulesen, konnte ich die sanfte Wölbung ihrer Wirbelsäule sehen, und in dem Zwischenraum von Rücken und Hose eine feine Spirale hellbrauner, fast blonder Härchen, die sich nach unten fortsetzten, wo das – aus meiner Perspektive nicht zu übersehende – verwirrende, winzige Dreieck ihres Slips hervorlugte. Machte sie das mit Absicht? Natürlich nicht. Alles war ganz unschuldig, wir sahen uns immer noch mit denselben unschuldigen Augen an, und in meiner engen Küche waren wir weiterhin sorgsam darauf bedacht, uns nicht zu berühren. Jedenfalls war es ein sehr angenehmer neuer Anblick.
An einem dieser heißen Tage las ich über ihre Schulter hinweg einen Satz auf dem Bildschirm nach und stützte dabei mit unveränderter Unschuld meine linke Hand auf der Lehne ab. Sie saß nach vorne gebeugt, doch plötzlich lehnte sie sich zurück, und ihr Rücken klemmte sanft meine Finger ein. Eine ganze Weile machte keiner von uns beiden eine Regung, um dieser Berührung – dieser sachten und doch so in die Länge gezogenen ersten Berührung – ein Ende zu bereiten; bis zu unserer ersten Pause diktierte ich weiter, reglos unmittelbar hinter ihr stehend, während meine Finger wie ein pulsierendes geheimes Signal die Wärme ihrer Haut zwischen Nacken und Schultern strömen fühlten. Zwei Tage später diktierte ich ihr die erste wirklich erotische Szene des Romans. Als ich fertig war, bat ich sie, mir die Passage laut vorzulesen, woraufhin ich einige Worte durch noch direktere ersetzte und sie dann aufforderte, alles noch einmal vorzulesen. Sie tat es mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie immer, ohne dass ihre Stimme an den verminten Stellen irgendeine Verwirrung verraten hätte. Trotzdem hatte die Beschreibung die Atmosphäre mit einer gewissen sexuellen Spannung aufgeladen. Um irgendetwas zu sagen, bemerkte ich, Kloster unterziehe sie hoffentlich nicht solchen Diktaten. Sie warf mir unbefangen einen leicht ironischen Blick zu und sagte, daran sei sie gewöhnt, Kloster diktiere ihr wesentlich schlimmere Dinge. Dabei betonte sie das »schlimmere« so, als meinte sie tatsächlich bessere. Ein angedeutetes Lächeln in ihren Mundwinkeln vermittelte mir den Eindruck, als riefe sie sich eine bestimmte Erinnerung ins Gedächtnis, was ich als Herausforderung empfand. Während ich weiter diktierte, wartete ich geduldig, bis sie ihren Kopf kreisen ließ, und als ich endlich ihren Hals knacken hörte, ließ ich meine Hand in die Nackenmulde unter ihrem Haar gleiten und übte einen sanften Druck auf ihre Wirbel aus. Ich glaube, sie erschrak ebenso wie ich über diese nicht rückgängig zu machende Aufhebung unserer Bemühungen, den anderen unter keinen Umständen zu berühren, über diese so zielgerichtete Berührung, auch wenn ich versuchte, die Geste ganz beiläufig wirken zu lassen. Mit angehaltenem Atem blieb sie regungslos sitzen, die Hände neben der Tastatur, ohne sich zu mir umzudrehen, und ich konnte nicht ausmachen, ob sie sich etwas mehr oder etwas weniger erhoffte.
»Wenn der Gips ab ist, bekommst du eine Massage von mir«, sagte ich und zog meine Hand zurück auf die Lehne.
»Wenn der Gips ab ist, wirst du mich nicht mehr brauchen«, antwortete sie, immer noch ohne sich umzudrehen, mit einem nervösen, vielsagenden Lächeln, als ergriffe sie die Gelegenheit, rechtzeitig zu entkommen, ohne sich ganz schlüssig zu sein, ob sie wirklich entkommen wollte.
»Ich kann mir jederzeit wieder den Arm brechen«, sagte ich und sah ihr in die Augen. Rasch wich sie meinem Blick aus.
»Das würde nichts nützen. Wie du weißt, kommt Kloster nächste Woche zurück«, sagte sie in einem neutralen Ton, als wollte sie mich behutsam davon überzeugen, von ihr abzulassen. Oder führte sie dieses weitere Hindernis nur an, um mich auf die Probe zu stellen?
»Kloster, Kloster«, protestierte ich. »Ist es nicht ungerecht, dass Kloster alles hat?«
»Ich glaube nicht, dass er alles hat, was er gern hätte.«
Mehr sagte sie nicht, und ihr Tonfall war so neutral wie zuvor, doch schwang ein rätselhafter Anflug von Stolz in ihrer Stimme mit. Ich glaubte zu verstehen, was sie mir bedeuten wollte. Doch wenn es als eine Art Trost gedacht war, brachte sie mich damit nur noch mehr in Rage. Kloster, der ach so seriöse Kloster, hegte schließlich und endlich also auch gewisse Hoffnungen bei Luciana. Aus ihren Worten schloss ich, dass er womöglich bereits einen ersten Versuch unternommen hatte. Und Luciana, weit davon entfernt, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen, war kurz davor, zu ihm zurückzukehren. Kloster, der niemals mehr beneidete Kloster, hatte zwar noch nichts erreicht, doch jeden Tag würde sich ihm eine neue Gelegenheit bieten. Und sicherlich war Luciana nicht nur stolz darauf, ihn zurückzuweisen, sondern auch, ihn seine Versuche nicht aufgeben zu sehen. Befand sie sich nicht noch in dem Alter, in dem junge Mädchen, gerade erst zur Frau geworden, ihre Anziehungskraft auf die Männer erproben?
All das mutmaßte ich infolge des kaum hörbaren Untertons in ihrer Stimme, ohne Luciana jedoch mehr entlocken zu können. Ehe ich weiter nachfragen konnte, errötete sie leicht und sagte, sie meine nur, dass niemand, nicht einmal Kloster, alles haben könne. Dass sie nun alles leugnete, war für mich nur eine neuerliche Bestätigung, die ich nicht bis zur letzten Konsequenz auszuloten vermochte, die mir jedoch endgültig den Wind aus den Segeln nahm. Ein unbehagliches Schweigen stellte sich daraufhin zwischen uns ein, bis sie mich fragte, es klang beinahe flehend, ob wir nicht mit dem Diktat fortfahren wollten. Etwas beschämt suchte ich in meinem Manuskript den nächsten Satz. Ich ärgerte mich vor allem über mich selbst; mir war bewusst, dass ich, indem ich mich zu sehr auf Kloster versteift hatte, womöglich meine eigene Chance verspielt hatte. Aber hatte ich tatsächlich jemals eine gehabt? Ja, bei dieser ersten Berührung war es mir so vorgekommen, trotz ihrer jähen Erstarrung. Letztendlich hatte sie sich mir nicht entzogen, sondern offenbar abgewartet, was ich als Nächstes tun würde. Ich selbst hatte schließlich einen Rückzieher gemacht. Doch jetzt, während ich weiterdiktierte, schien alles verflogen zu sein, als hätte jeder von uns wieder freiwillig seinen alten Platz auf dem Spielbrett eingenommen. Wenngleich ich in dem Blick, mit dem sie beim Gehen nach ihrer Tasche griff, eine gewisse Neugierde zu lesen vermeinte oder den Impuls, diesem unterbrochenen Kontakt nachzuspüren; allerdings war dieser Blick so zweideutig, dass er mich nur noch mehr verunsicherte, da er ebenso gut bedeuten konnte, dass sie mir nicht böse war, das Ganze aber lieber vergessen wollte oder dass die Tür trotz allem doch nicht endgültig geschlossen war.
Ungeduldig sehnte ich den nächsten Tag herbei. Der Monat war zu schnell vergangen, und mir wurde bewusst, dass mir nur noch zwei Tage blieben, bis Luciana aus meinem Leben verschwinden würde. Als ich ihr am nächsten Morgen aufmachte, überprüfte ich, ob sich etwas in ihrem Gesicht oder ihrer Aufmachung verändert hatte, ob ihre Schminke vielleicht etwas stärker aufgetragen oder ihre Kleidung etwas freizügiger war, doch sollte sie sich – erfolgreich – um etwas bemüht haben, dann darum, genauso wie immer auszusehen. Und dennoch war nichts wie immer.
Wir nahmen unsere jeweiligen Plätze ein, und ich begann, ihr das letzte Kapitel des Romans zu diktieren. Ich fragte mich, ob die Tatsache, dass wir fast am Ende angelangt waren, nicht auch Luciana in irgendeiner Form nahegehen mochte, doch als wäre sie ganz darauf konzentriert, ihre Rolle als Sekretärin zu erfüllen, schienen ihre Finger, ihr Kopf, ihre ganze Aufmerksamkeit nur darauf bedacht, meiner Stimme zu folgen. Je weiter der Vormittag voranschritt, desto deutlicher wurde mir bewusst, dass ich auf eine ganz bestimmte Bewegung von ihr lauerte. Es war wie eine seltsame Form der Bewusstseinsspaltung. Während ich weiter den Anblick, der sich mir wie üblich bot, registrierte, den Zwischenraum von Hose und Rücken mit dem hervorlugenden Slip, ihre verführerisch gerunzelte Stirn, ihre Zähne, die sich von Zeit zu Zeit auf die Lippen bissen, die sich vor- und zurücklehnenden Schultern, schien mir all das merkwürdig fern, so fixiert war ich auf ihren Nackenansatz. Mit der schmerzvollen Gespanntheit eines pawlowschen Hundes harrte ich des Moments, in dem sie ihren Kopf würde kreisen lassen. Doch das Signal kam nicht, als wäre auch sie sich der Macht, oder der Gefahr, bewusst geworden, die diesem kleinen Knacken innewohnte. Bis zuletzt wartete ich ungläubig, fühlte mich schließlich beinahe um etwas betrogen, doch ihr Hals, ihr hübscher kapriziöser Hals, weigerte sich hartnäckig, sich zu bewegen, und so musste ich diesen Tag wohl oder übel verstreichen lassen.
Der nächste Vormittag war der letzte, und als Luciana kam und nachlässig ihre Tasche ablegte, erschien es mir schlichtweg unvorstellbar, dass ich sie nicht mehr um mich haben und all unsere kleinen Routinen sich in Luft auflösen würde. Zwei unerträgliche Stunden vergingen. In der Pause stand Luciana wieder auf, um in der Küche Kaffee zu machen. Auch das würde sie zum letzten Mal tun. Ich folgte ihr und bemerkte halb ironisch, halb geschlagen, dass sie ab der nächsten Woche wieder gute Romane diktiert bekäme. Ich erzählte ihr, dass Campari mir ihre Telefonnummer mit der Warnung gegeben habe, ich müsse sie heil wieder zurückgeben, und fügte hinzu, dass ich dem ja wohl leider nachgekommen sei. Keines meiner Worte entlockte ihr mehr als ein verlegenes Lächeln. Wir machten uns wieder an die Arbeit; es blieben nur noch ein paar Seiten Epilog. Etwas verdrossen dachte ich, dass wir an diesem Tag vielleicht sogar früher fertig würden. Auf einer der letzten Seiten kam ein deutscher Straßenname vor, und nachdem Luciana ihn getippt hatte, bat sie mich zu überprüfen, ob sie ihn richtig geschrieben habe. Ich beugte mich über ihre Schulter, um auf den Bildschirm zu sehen, wie ich es so viele Male in dieser Zeit getan hatte, und wieder stieg mir aus ihrem Haar ihr Parfum entgegen. Und als ich meine Hand gerade von der Stuhllehne nehmen wollte, legte sie wie eine verspätete Ermunterung, mit der ich schon nicht mehr gerechnet hatte, ihren Kopf zurück, bis er mich fast berührte, und drehte ihn dann zur Seite. Ich hörte das Knacken ihres Halses und schob meine Hand unter ihr Haar, ertastete die Mulde ihres Nackenwirbels, wie in einer Fortsetzung des ersten Males. Sie gab einen kurzen Seufzer von sich und lehnte ihren Kopf zurück, um den Druck zu verstärken. Erwartungsvoll wandte sie mir ihr Gesicht zu. Ich gab ihr einen Kuss. Ihre Augen schlossen sich und öffneten sich dann wieder einen Spalt. Ich küsste sie eindringlicher und ließ meine linke Hand unter ihr Oberteil gleiten. Wegen des Gipses an meiner rechten konnte ich sie nicht umarmen, sodass sie sich ohne Schwierigkeiten von mir losmachte, indem sie mit dem Schreibtischstuhl ein wenig zurückrollte.
»Was ist los?«, fragte ich überrascht und streckte meine Hand nach ihr aus, doch etwas in ihr schien sich zurückzuziehen, und ich hielt auf halber Strecke inne.
»Was los ist?« Sie lächelte nervös und amüsiert zugleich, während sie sich das Haar glattstrich. »Ich habe einen Freund, das ist los.«
»Aber den hattest du doch auch vor zehn Sekunden«, sagte ich, ohne ganz zu verstehen.
»Vor zehn Sekunden … habe ich das für einen Moment vergessen.«
»Und jetzt?«
»Jetzt habe ich mich wieder daran erinnert.«
»Was war das dann? Ein plötzlicher Gedächtnisverlust?«
»Keine Ahnung«, sagte sie und hob den Blick, als wäre das Ganze es nicht wert, ihm so viel Bedeutung beizumessen. »Du schienst es so sehr zu wollen.«
»Ach«, sagte ich verletzt. »Nur ich wollte es.«
»Nein«, erwiderte sie verwirrt. »Ich war auch … neugierig. Und du wirktest so eifersüchtig auf Kloster.«
»Was hat Kloster damit zu tun?«, fragte ich, inzwischen wirklich verärgert. Gegen zwei Männer gleichzeitig anzutreten überforderte mich ein wenig.
Sie schien zu bereuen, dass sie ihn erwähnt hatte. Erschrocken sah sie mich an, vermutlich, weil sie zum ersten Mal erlebte, wie ich die Stimme erhob.
»Nein, er hat gar nichts damit zu tun«, sagte sie, als könnte sie damit alles zurücknehmen. »Ich glaube, ich wollte nur, dass irgendetwas geschieht, damit du dich an mich erinnerst.«
Auch diese Art von Tricks hatte sie also schon raus, dachte ich ernüchtert: Sie sah mich aus großen Augen bekümmert an, schien gleichzeitig zu lügen und die Wahrheit zu sagen.
»Keine Sorge, ich werde mich ganz bestimmt an dich erinnern«, sagte ich in dem Versuch, meinen verletzten Stolz ein wenig wiederherzustellen. »Es ist das erste Mal, dass man mich aus Mitleid geküsst hat.«
»Können wir jetzt bitte zum Schluss kommen?«, bat sie und schob den Stuhl behutsam wieder an den Schreibtisch, als fürchtete sie, ich könnte meinen Unmut an ihr auslassen.
»Natürlich, kommen wir zum Schluss«, sagte ich.
Ich diktierte ihr die letzten beiden Seiten, und als sie schließlich nach ihrer Handtasche griff, hielt ich ihr stumm ihr Wochenhonorar hin. Zum ersten Mal verstaute sie die Geldscheine, ohne einen Blick darauf zu werfen, als wollte sie nur noch so rasch wie möglich die Flucht ergreifen.
Das war meine letzte Begegnung mit Luciana, vor zehn Jahren, als sie nur eine hübsche, entschlossene und unbeschwerte junge Frau wie viele andere war, die sich in den ersten Verführungskünsten übte und weder vom Leben noch vom Tod bedroht zu sein schien.
Und als es nun, fünf Minuten vor vier, klingelte und ich nach unten fuhr, um ihr zu öffnen, konnte ich nicht umhin, mich mit einem Blick auf mein von den Jahren gezeichnetes Gesicht im Spiegel des Aufzugs zu fragen, wie ich sie wohl vorfinden würde.