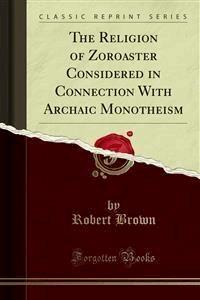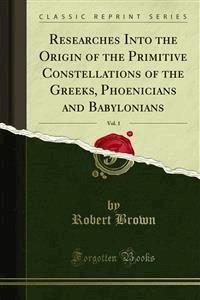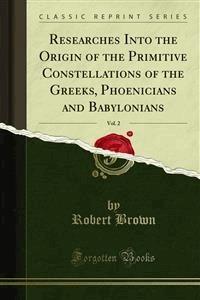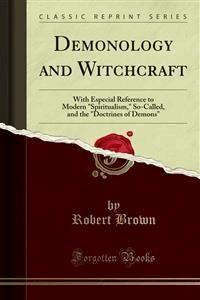Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eddie Keeper und seine Frau bereiteten sich auf den Zusammenbruch der Zivilisation vor. Sie rüsteten ihre Ranch fürs Überleben aus, bauten Verteidigungsanlagen und lagerten Vorräte für Jahre. Doch als der Kollaps in Form einer schrecklichen Krankheit statt eines Finanzdebakels hereinbricht, werden ihre Pläne, sich zu verstecken, bis die Ordnung wiederhergestellt ist, über den Haufen geworfen. Denn in dieser neuen Welt überlebt nur, wer tötet. Kriminelle erheben sich zu Herrschern - und über allem steht die Bedrohung durch Untote, welche die Lebenden unermüdlich jagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER LETZTE ATEMZUG
Robert Brown
übersetzt von Andreas Schiffmann
This Translation is published by arrangement with SEVERED PRESS, www.severedpress.com Title: THE LAST BLADE OF GRASS. All rights reserved. First Published by Severed Press, 2015. Severed Press Logo are trademarks or registered trademarks of Severed Press. All rights reserved.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE LAST BLADE OF GRASS Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Mark Freier Übersetzung: Andreas Schiffmann Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-213-1
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhalt
Kapitel 1
Die Reise nach Hause
Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Ich wusste schon immer, dass etwas hinter dieser Binsenweisheit steckt, hätte mir aber nie erträumt, dass Zombies meinen Wunsch nach einem weltweiten Neubeginn erfüllen würden. Na gut, ich sollte nicht so tun, als wäre ich nie darauf gekommen. Immerhin war ich vor dem Untergang ein großer Fan von Zombie-Romanen und -Filmen. Was ich damit meine, ist vielmehr: Ich bin ein Realist und Skeptiker, also fand ich die Vorstellung, dass es Zombies geben könnte, zwar einmal recht unterhaltsam, wusste aber zugleich auch, dass die Chancen dafür, dass sich eine Art Krankheit durchsetzt, die man im Sinne einer Zombie-Epidemie verstehen könnte, extrem schlecht waren.
Die Menschheit kann froh sein, dass die Schar der Zombies ähnelnden Infizierten der Darstellung in klassischen Genre-Filmen entspricht, was ihre Bewegungen angeht. Sie pirschen sich langsam und leise an, wobei sie sich manchmal bereits preisgeben, indem sie röcheln oder einen Fuß hinter sich herziehen. Ihre schlurfende Gangart macht sie nicht schneller als eine reguläre; diese Trägheit half Gruppen von Überlebenden wie uns dabei, der schieren Unzahl befallener Menschen zu trotzen, die sich dort draußen tummeln.
Von Glück reden können wir insofern, als dass es sich bei den Infizierten eigentlich nicht um auferstandene wandelnde Tote handelt. Es ist letzten Endes nur eine Krankheit, eine vorsätzlich verbreitete Infektion mit allerdings unbeabsichtigten Folgen, nämlich dass die Bevölkerung in zombie-ähnliche Kannibalen verwandelt wurde. Das spielt aber momentan keine große Rolle mehr.
Anhand dessen, was wir von anderen Überlebenden weltweit über Amateurfunk herausfinden konnten, scheinen wie bei uns die meisten Menschenmassen in den Ballungsräumen innerhalb der ersten Woche nach Ausbruch des Leidens krank geworden zu sein.
Der Hauptgrund dafür, dass sich so viele ansteckten, bestand in dem Unvermögen der Leute, sich nachdrücklich gegen die Infizierten zu wehren. Ohne Gefahr zu laufen, sich selbst etwas einzufangen, kann man nämlich nur auf eine einzige Art und Weise zurückschlagen: Indem man Abstand wahrt, und Schusswaffen einsetzt, denn jeder Körperkontakt mit einer betroffenen Person birgt das Risiko in sich, mit infiziertem Blut oder Speichel in Berührung zu kommen.
Dass in den meisten Staaten nur wenige Personen Waffen besaßen und in diesem Zusammenhang strenge Gesetze für die Allgemeinbevölkerung galten, rächte sich nun an den Menschen, weshalb auch diejenigen Nationen, US-Regionen und -Städte die höchsten Infektionsraten verzeichneten, wo die wenigsten Waffenbesitzer lebten. Aber selbst mit Schusswaffen gestaltete sich der Kampf äußerst schwierig, denn jeglicher Lärm – besonders die lauten Schüsse – lockten die Kranken sofort scharenweise an.
Nun da wir schon acht Monate in dieser Situation leben, hat sich die Zahl der gesunden und auch der infizierten Menschen drastisch verringert. Der strenge Winter, den wir gerade in den USA und anderen Ländern auf der Nordhalbkugel überstanden haben, tötete viele, die es bis dahin geschafft hatten, sich gegen die Kranken zu behaupten. Wir sind den Alltag ohne die Bequemlichkeiten der Elektrizität und Öl- oder Erdgasheizungen einfach nicht mehr gewöhnt. Darum starben die Leute plötzlich wie die Fliegen; hier in Oregon entsprachen die Temperaturen eher jenen, die wir seinerzeit in Süddakota hatten, sie lagen bei -9 bis -23 Grad, und zwar mehrere Wochen am Stück. Auch jetzt im Juni ist es immer noch ungewöhnlich kalt.
Hier kauere ich jetzt also, acht Monate nach den ersten Berichten von Ausschreitungen, gemeinsam mit meiner Familie in einem verlassenen Geschäft verschanzt. Meine Frau und unsere fünf Kinder sind gewissermaßen auf einer Mission, um unsere Vorräte aufzustocken und um sicherer in dem zu werden, was sie bislang gelernt hatten. Seit es weniger Infizierte geworden sind und das Wetter zusehends besser wird, suchen wir auch nach anderen Zusammenschlüssen von Menschen, nach Neuigkeiten oder einfach nach Lebensmitteln sowie jeder unüblich hohen Konzentration von verbliebenen Kranken, die uns Sorgen bereiten könnten. Wir befinden uns mittlerweile auf dem Rückweg zu unserem Haus, wo mehrere andere Familien darauf warten, dass wir bald wiederkommen.
Auf diesem Abstecher hatten wir allerdings nur wenig Glück, was andere Überlebende angeht. Gestern stießen wir in einer Kleinstadt im Umland von Medford in Oregon auf einen Mann namens Jim Margrove. Er lag leider bereits im Sterben, nachdem er sich durch eine Schnittwunde angesteckt hatte. Wie er uns erzählte, sei er letzte Woche bei einer Schlägerei ziemlich übel zugerichtet und dabei infiziert worden. Da er sich ein Bein gebrochen hatte, konnte er nicht ohne Weiteres Medikamente suchen gehen, und wir sahen bereits schwarze Adern an seinem rechten Oberschenkel, die sich wie Spinnennetze bis zum Unterbauch ausbreiteten. Die Blutvergiftung war also schon zu weit fortgeschritten, um noch mit Antibiotika entgegenwirken zu können. Er konnte genauso wenig wie wir fassen, dass sich jemand acht Monate lang durch die Zombie-Apokalypse schlägt und dann einfach an einer eigentlich geringfügigen Entzündung infolge einer Schnittwunde stirbt.
Bedauernswert an dieser Lage war vor allem die Tatsache, dass sich Jim nicht im Kampf mit einem Infizierten angesteckt hatte. Er lief nur zufällig jemandem über den Weg, der von der Beschreibung her ein Junkie gewesen sein könnte. Damit meine ich die Süchtigen nach illegalen Substanzen von früher, doch diese Definition ließ sich nicht mehr auf die neue Bedrohung münzen, der wir uns nun stellen mussten. Darum sind wir dazu übergegangen, nur die alten Rauschmittelkonsumenten als Junkies zu bezeichnen, damit wir sie von denjenigen unterscheiden konnten, die einfach nur vollkommen wahnsinnig geworden sind, weil sie seit Beginn der Endzeit ständig kämpfen und dem Tod ins Auge blicken müssen. Junkies sind somit Personen, die sich zugeknallt haben, um in der Gesellschaft richtig funktionieren zu können. Jeder kennt sie – die schwer Paranoiden, Schizophrenen und Manisch-Depressiven …
Nicht dass uns Letztere erhebliche Schwierigkeiten machen würden … Wer von ihnen die erste Angriffswelle überlebt hat, dem konnten nicht einmal seine Medikamente gegen das seelische Trauma helfen, das er erlitten hatte, weil er mit ansehen musste, wie Menschen, die er kannte, überrannt und verzehrt wurden. Verdammt, es war für niemanden von uns leicht, doch neigt man in harten Zeiten aufgrund psychischer Veranlagung eh schon zu Niedergeschlagenheit, hat man keine sonderlich hohe Lebenserwartung, wenn die Welt buchstäblich vor die Hunde geht und man nicht mehr auf die moderne Medizin zurückgreifen kann, um seine Stimmungsschwankungen auszugleichen.
Wirklich sorgen müssen wir uns allerdings wegen der echten Schizophrenen, und einer von ihnen wurde vermutlich auch Jim zum Verhängnis. Sollte hingegen eines dabei nützen, eine Zombie-Epidemie apokalyptischen Ausmaßes zu überstehen, dann sind es Paranoia wegen allem und jedem. Die Schizophrenen halten in dieser Hinsicht sozusagen ein Monopol inne. Damit will ich sagen, dass viele während der Frühphase des Ausbruchs starben, weil sie unter Medikamenten standen und die blutbesudelten, leichenhaften Gestalten, die auf sie zukamen, einfach nur für Hirngespinste hielten. Bedauerlicherweise kamen sie also massenweise um, weil sie gelernt hatten, Dinge einfach zu ignorieren, die ihres Erachtens nicht real sein konnten.
Ich hingegen sollte nicht »bedauerlicherweise« sagen, denn ganz im Gegenteil, dürfen wir eigentlich ein großes Kreuz machen, weil jetzt nicht mehr viele von ihnen frei herumlaufen. Die Schizophrenen sind nämlich erstaunliche Überlebenskünstler. Ihr tief verwurzelter Instinkt, sich zu verstecken, zu misstrauen, zu plündern und töten scheint in dieser Welt geradezu zu florieren. Sobald die Medikamente nicht mehr wirkten, die sie gewohnt waren zu nehmen und die zur Unterdrückung ihrer Halluzinationen beitrugen, kam ihnen fortan jeder ihrer Mitmenschen wie ein Infizierter vor.
Ich schimpfe nun also über Menschen, die einst als geisteskrank galten, und wäre zu Zeiten, als noch alles in Butter gewesen ist, nie damit durchgekommen, sie auf diese Weise zu diskriminieren, doch andererseits gab es damals ja auch noch keinen Grund dazu. Jetzt bin ich einfach nur angepisst, weil ich mir den Kopf nicht nur über Heerscharen von infizierten Kannibalen oder Verbrecherbanden und gewalttätige Opportunisten zerbrechen muss, sondern auch noch über sie. Denn das betrifft auch all jene, die einfach vollkommen verrückt sind, voller Eifer sich auf dich zu stürzen, als sei es ein schöner Morgen und wer weiß wie toll, einen anderen Menschen zu sehen, dann ein Messer oder einen Knüppel zu zücken und zu versuchen, ihn kaltzumachen.
Jims Pech macht mich noch immer wütend, weil ich mir die Schmerzen vorstellen kann, die er vor seinem Tod durchmachen musste. Es beschränkte sich ja nicht nur auf den Beinbruch und den Schnitt infolge der Schlägerei, auch seine Frau war dabei ums Leben gekommen. Die beiden hatten sich aus quasi den gleichen Gründen wie wir durch die Stadt Central Point nach Medford durchgeschlagen: um Proviant zu suchen, Gleichgesinnte zu finden und sich vielleicht auch ein wenig Klarheit verschaffen zu können.
Die beiden begegneten auf ihrem Weg einem jungen Mann, der vor einem Haus auf der Treppe saß. Nachdem sie ihn begrüßt hatten, fing er an zu weinen und wollte wissen, ob sie wirklich »echt« seien. Eine solche Frage, die einen eigentlich stutzig machen sollte, liegt mittlerweile sehr nahe, weil die meisten Menschen inzwischen isoliert, heimatvertrieben und monatelang ohne Kontakt mit Nichtinfizierten auf sich allein gestellt sind. Tritt eine normale Person also an einen anderen Überlebenden heran, halten beide den jeweils anderen für eine Wunschvorstellung oder im schlimmsten Fall sogar lediglich für eine schwache Halluzination.
Als der Kerl Jim und seiner Frau diese Frage stellte, danach in Tränen ausbrach und auf sie zuging, wähnten sie sich nicht in Gefahr, sondern glaubten, sie müssten diesen Bruder im Geiste nun trösten. So brüderlich war er jedoch nicht, denn sobald sie ihm entgegengekommen waren, zog er plötzlich schnell wie der Blitz ein Messer und schnitt Susan die Kehle durch. Jim erzählte uns, der Kampf mit ihm habe nicht lange gedauert – zwanzig, vielleicht dreißig Sekunden vom ersten Angriff gegen Susan bis hin zu dem Moment, als er den Angreifer getötet hat. Während er mit ihm rang, wurde er aber leider ebenfalls geschnitten und fiel danach so unglücklich, dass sein Bein brach. Er schaffte es jedoch trotzdem noch, sein eigenes Messer zu ziehen und den Kerl zu erstechen. Leider war danach aber alles schon verloren.
Ich ärgere mich, weil ich Jims Geschichte jedes Mal erneut rekapituliere, wenn wir eine Pause machen und ich etwas Zeit zum Nachdenken habe. Ich trauere um seinen Verlust genauso wie er selbst, so als sei meine Frau Simone diejenige, die von einem Fremden umgebracht worden war. Teilweise rührte meine Wut aber auch von Gewissensbissen her. Ich glaube, das gilt für die meisten Situationen, in denen man wütend ist, doch was mich betrifft, so fühle ich mich gerade schlecht, weil ich mich nicht beklagen kann, denn meine ganze Familie hat diese Menschheitskatastrophe bislang komplett überlebt. Natürlich gehörte ich auch zu denjenigen, die sich vorbereitet hatten, doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle so lang durchhalten würden, war überhaupt nicht hoch, auch trotz der ganzen Vorkehrungen.
Wir sind also zu siebt und reisen stets gemeinsam, seit dieser Winter hoffentlich sein Ende gefunden hat und man immer seltener Infizierten sieht. Meine Frau und ich rechnen damit, dass jeder Tag der letzte sein kann, weshalb wir zusammen sein wollen, wenn es einmal so weit ist. Also sterben wir entweder alle auf einmal oder wir wissen wenigstens, was mit unseren Lieben geschieht, wenn sie es tun müssen.
Natürlich klingt es komplett irre, kleine Kinder mit hinaus in diese kranke Welt zu nehmen, doch dies ist nun einmal die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, und sie sind mit dem Wissen darum aufgewachsen, was sie manchmal zum Überleben tun müssen. Dabei fällt mir ein Film ein, den ich mir vor dem Zusammenbruch mit meiner Frau angeschaut habe. Er war wirklich gut, turnte uns aber irgendwie beide ab, weil der Hauptdarsteller darin so gut wie gar nicht auf seine Umgebung gefasst war, in der er sich irgendwann wiederfand. Als wir den Streifen gesehen haben, waren unsere Kids schon bestens für ein solches Desaster gewappnet und dabei nicht einmal hineingeboren worden wie derjenige in dem besagten Film.
Weil wir tatsächlich ernst nahmen, wie unser Dasein möglicherweise ins Negative abgleiten könnte, und sie deshalb darauf vorbereiteten, hielten wir das Drehbuch für umso unglaubwürdiger, denn welcher Mensch, der nach dem Ende der Welt geboren wird, würde nicht von seinen Eltern abgehärtet werden, um unter den neuen Umständen überleben zu können?
Früher, bevor die Menschheit in den Abgrund gestürzt ist, haben unsere Kinder nicht nur Geldsparen gelernt und darauf zu achten, in welchem Supermarkt die Milch am günstigsten war; dabei handelte es sich letztendlich nur um alltägliche Kniffe in der Moderne. Wir brachten ihnen zum Beispiel auch bei, sich bei einer drohenden Gefahr absolut still zu verhalten, sich gut zu verstecken und selbstverständlich auch sowohl das Schießen als auch den direkten Nahkampf.
Auch wenn sich nicht alles zerschlagen hätte, wäre die Welt trotzdem voller Mörder und Vergewaltiger gewesen, nicht zu vergessen die tollwütigen Tiere oder Berglöwen beim Wandern. Meine Frau und ich gingen einfach davon aus, in den afrikanischen Steppen groß gewordene Kinder, die Löwen, Elefanten und Nilpferde um sich herum hatten, seien schon mit den Fertigkeiten ausgestattet, die sich unsere fünf Kids erst noch aneignen mussten. Dass nicht mehr Leute ihren Nachwuchs zu einem richtigen Verständnis der Gefahren der Welt erzogen, sondern stattdessen versuchten, sie selbst vor der Erwähnung jeglicher Übel abzuschotten, ist wirklich unglaublich schade.
Wenn ich die Blicke der Meinen ringsherum in der Halle erwidere, hoffe ich stets, dass meine Kinder so lange aushalten werden, bis der Grundstein einer neuen Gesellschaft gelegt ist. Ich habe getan, was ich tun konnte, um sie auf die richtige Spur zu bringen, jetzt muss ich sie nur noch beschützen, damit sie irgendwann zu gefestigten Erwachsenen werden. Das bedeutet bei den gegenwärtigen Verhältnissen natürlich, dass sie plündern und töten müssen, um am Leben zu bleiben.
Sie sind alle noch sehr jung. Hannah ist zwölf, Olivia zehn, William sieben, Amelia fünf und Benjamin erst ein Jahr alt. Er wurde nur vier Monate vor dem Ausbruch dieser Krankheit geboren. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass die Ältesten die höchsten Überlebenschancen haben, aber ich bin mir nicht so sicher, was diese Welt betrifft.
Unsere vier Ältesten können sich noch genauso wie Simone und ich daran erinnern, wie schön und locker das Leben in Amerika einst gewesen war. Wir haben unsere Kleinen mit tonnenweise Spielsachen verwöhnt, Ausflüge zu Seen und an Strände gemacht, sind Bergsteigen gegangen, haben gemeinsam mit ihnen am Computer gespielt oder sind einfach nur ins Kino gegangen.
Wir haben nach wie vor eine Menge Lebensmittel auf Vorrat und müssen deshalb nicht hungern, doch Sandwiches bei Subway oder kurz mal bei IHOP aufkreuzen, um Pfannkuchen und Eier zu essen, kommt natürlich nicht mehr infrage – und auf Fahrten in Spielzeugläden, um den neuesten Plastiktand aus China zu kaufen, müssen sie seitdem auch verzichten. Die Welt, die wir für selbstverständlich hielten, veränderte sich, und damit hadern wir wohl offensichtlich immer noch.
Unser Jüngster, Benjamin, hingegen kennt keine andere Welt als diese. Wir wollen natürlich unser Bestes geben, um ihm zu beschreiben, wie es einmal gewesen ist, doch er wird sich anders als wir niemals nach dem sehnen können, was wir früher hatten. Ich schätze mal, das wird ihn letztendlich sogar stärker machen. Wir alle müssen mit dem Hier und Jetzt klarkommen, wobei die kurzen Momente der Zerstreuung beim Lesen oder Singen, falls sie sich mal ergeben, nur einen kleinen Teil des Alltags unserer Kids ausmachen, statt dass sie der Norm entsprechen so wie damals vor dem Kollaps.
Die Infizierten passieren jetzt endlich das Gebäude, in dem wir uns verstecken, in ihrem stetigen und trägen Schritttempo. Wahrscheinlich sind sie hinter uns her gewesen, haben aber nicht gesehen, wie wir uns versteckt haben, weil Benjamin sie schon bemerkt hatte, bevor sie uns zu nahe kamen, und uns – auf seine ganz eigene Weise – darauf hinwies. Er mag vielleicht erst ein Jahr alt sein, knurrt aber, sobald er einen Kranken entdeckt. Also drehten wir uns alle in die Richtung um, in die er schaute, als wir sein »GRRR« hörten. Weit unten auf der Straße bewegten sich zwei Infizierte. Normalerweise können wir sie abhängen, auch wenn wir langsamer sind, weil wir den Proviant immer auf unseren Fahrrädern und Anhängern dabeihaben. Zum Glück sind es dieses Mal nur zwei, also machen wir sie besser jetzt sofort unschädlich, statt später mit ihnen aufräumen zu müssen.
Nun als sie endlich am Eingang des Geschäfts vorbeigegangen sind, in dem wir uns verbergen, ist es an der Zeit dafür. Meine Aufgabe besteht darin, hinter ihnen auf die Straße zu treten und sie zu töten, bevor sie sich umdrehen und sich gegen mich wenden können. Das ist eine simple Angriffsmethode, die sich regelmäßig bewährt hat, seit wir unterwegs sind. Wir könnten auch unsere Pistolen benutzen, aber ich würde lieber keine anderen Infizierten oder auch andere Überlebende, wenn wir schon einmal dabei sind, auf uns aufmerksam machen, vor allem weil wir mit all diesem Zeug nur schwerlich vorankommen.
»Ich liebe dich, Simone! Ich liebe euch, Kinder. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ich es nicht schaffe?«, frage ich ruhig.
»Wir wissen, was zu tun ist, Eddie«, antwortet meine Frau. »Pass einfach nur auf dich auf und mach schnell; wir bleiben hier und beobachten dich.«
Also werfe ich noch einen Blick auf meine Frau und Kinder, die mich teilweise verhalten anlächeln, und verlasse das Gebäude. Für gewöhnlich verwende ich für solche Überfälle aus unmittelbarer Nähe gern mein Minischwert, das eigentlich eine sechzehn Zoll lange Machete ist. Sie eignet sich bestens für Hiebe, doch ich habe die Klinge auch vorn angespitzt, um damit zustechen zu können. Vier schnelle Schritte mache ich nun, womit ich zu dem langsameren Kranken aufschließe, und dann hole ich mit ordentlich viel Schwung aus. Der Treffer sitzt perfekt: Genau gegen den Hinterkopf direkt unter das Ohr, sodass die Waffe sofort ins Kleinhirn schneidet und das Rückgrat durchtrennt. Er bricht augenblicklich zusammen.
Der andere Infizierte ist eine Sie und will sich gerade umdrehen, bekommt jedoch, weil sie so schwerfällig ist, nicht einmal die Arme hoch, um mich angreifen zu können, bevor ich noch einmal aushole. Meine Bewegungen sind jetzt, nachdem ich mich nach dem Schlag gegen den Mann zurückgezogen habe, nicht mehr ganz so fließend. Dass sie sich linksherum dreht, ist mein Glück, denn dabei wendet sie mir ihr Genick so zu, dass ich als Rechtshänder genau darauf schlagen kann.
Während ich die Machete erneut schwinge, höre ich meine Frau von drinnen »Nein« schreien und zucke leicht zusammen, was schon genügt, um meinen Hieb ein wenig abzulenken; der Winkel verändert sich, weshalb die Klinge im Hals stecken bleibt, statt hindurchzugehen. Sie klemmt nun zwischen den Wirbeln der Kranken und scheint zumindest, als diese in die Knie sinkt, insoweit etwas bewirkt zu haben, dass ihre Beine offenbar nun gelähmt sind. Welches meiner Kinder auch schuld daran ist, dass Simone »Nein« ruft, und mich, damit beim Töten Infizierter ablenkt: Er oder sie wird gehörig etwas zu hören bekommen, wenn ich erst mal hier fertig bin.
Die kranke Lady schlägt am Boden auf, die Machete ragt aus ihrem Hals, während ihr Kopf von dem Geschäft weggedreht ist. Ich will mich gerade über ihr aufbauen, um mit rechts auf ihren Rücken zu treten und meine Waffe auszuhebeln, da erwischt es mich!
Einen Sekundenbruchteil vorher habe ich noch einen Ruf aus dem Laden gehört, doch selbst wenn ich dazu gekommen wäre, zu meinem Angreifer aufzuschauen, hebe ich ja gerade ein Bein über einer Leiche, also fehlt mir das Gleichgewicht, um ausweichen oder mich verteidigen zu können. Ein wuchtiger Mann rempelt mich plötzlich an. Er wiegt bestimmt dreihundertzwanzig Pfund und war – was sonst? – wohl einmal Sportler. Er kam wie aus heiterem Himmel aus ungefähr derselben Richtung wie die beiden anderen und bedrängt mich nun von links. Da er sich also von der Nordseite des Geschäfts her genähert hat, konnte man ihn durch dessen Fenster nicht sehen, bis es bereits zu spät war.
Selbst unter normalen Bedingungen kann ein stehender Angreifer eine Entfernung von zwanzig Fuß zurücklegen und dich packen, bevor du auch nur eine Pistole ziehen und auf ihn feuern kannst. Meine Familie hatte einfach zu wenig Zeit, um genau zu zielen und auf den Mann schießen zu können, der außerdem auch noch im vollen Lauf in mich hineinrannte.
Mag sein, dass es sich um einen Junkie oder Schizo handelt, denn mir fällt keine andere Erklärung dafür ein, dass sich jemand rennend gegen mich wirft, während ich gerade dabei bin zwei offensichtlich Infizierte zu beseitigen. Die Verrückten sind niemals Fettsäcke oder ehemalige Büroarbeiter gewesen; mir kommen sie sehr athletisch vor. Sie sind meistens im High-School- oder College-Alter und ein absolutes Ärgernis. Ich meine, ich bin fünfundvierzig, demnächst sechsundvierzig und muss mich mit einem psychotischen Trottel jüngeren Alters auseinandersetzen, der noch dazu bestimmt fünfzig Pfund mehr auf die Waage bringt als ich …
Dass ich meinen linken Arm, als der Typ mit mir zusammenstößt, unter seinem Kinn gegen den Hals drücke, wo er fortan eingeklemmt ist, ist hingegen einfach nur Pech. Er trifft mich mit solcher Wucht, dass sich die Machete aus der Wirbelsäule meines jüngsten Überfallopfers löst, doch ich kann sie nicht festhalten, als ich zu Boden gehe, weil der Mann auf mir so schwer ist.
Er schnappt bereits nach mir und will in mein Gesicht beißen.
»Halt, Moment mal!« Als ich in seine Augen schaue, erkenne ich plötzlich, dass er weder ein Psycho noch ein Junkie ist. Er hat die Krankheit … doch das kann nicht sein, wenn er so schnell ist! Immerhin ist er wohl, so schnell er konnte gelaufen, als er mich niederriss, so hat es sich jedenfalls angefühlt. Es tat weh, und ich denke nicht, dass das allein an seiner stämmigen Figur lag.
Ich fange nun an, hektisch mit meinem rechten Arm herumzufuchteln, um an das kleinere Messer zu gelangen, das an meinem Bein befestigt ist, während er über mir weiterhin mit den Zähnen klappert und mir mit beiden Händen ins Gesicht fassen will. Endlich kann ich die Waffe ziehen und ramme sie ihm mitten in sein blödes Maul. Sie bleibt darin stecken und es sieht aus, als würde er obszön mit irgendeiner Designer-Metallzunge wackeln, wobei sich sein Unterkiefer aber weiterbewegt, sodass er schließlich auf den Griff beißt. Ich kann ihn nur entsetzt anstarren und habe weiterhin große Mühe, ihn von mir fernzuhalten, nicht zu vergessen wieder Luft zu bekommen, die er mir mit dem Sturz geraubt hat.
Das größte Problem mit den Infizierten besteht abgesehen davon, dass sie überhaupt existieren, in ihrer Anzahl. Im Zuge des Ausbruchs haben wir alle sehr schnell begriffen, dass man die Kranken entweder töten oder sich fressen lassen muss – oder sich ebenfalls ansteckt. Allein sich der Infizierten zu erwehren war für die meisten schon schwierig genug und für einige sogar unmöglich, doch sich vor einer langsamen Gruppe von ihnen zu verteidigen ist durchaus möglich, sogar vor Hunderten oder Tausenden von Infizierten, wenn man nur die richtige Position dabei einnimmt.
Bisher sind wir nur trägen und äußerst langsamen Infizierten begegnet. Niemand auf der Welt ist bislang auf irgendeine andere Art gestoßen, wobei wir natürlich nicht mit allen Überlebenden draußen sprechen konnten und in den letzten zwei Monaten ohnehin so gut wie gar nichts mehr gehört haben. Doch dass es laufende und sogar rennende Kranke gibt, ist uns noch niemals zuvor zu Ohren gekommen.
Jetzt stehen wir also offenbar vor der Schwierigkeit, dass sie sich verändern. Entweder ist der Parasit mutiert, oder sie passen sich einfach im Laufe der Zeit an. Das Blatt wendete sich an dem Tag gegen die Menschheit, als das Leiden zum ersten Mal auftrat, und nun in diesem Augenblick direkt über mir – er hockt immer noch auf meinem Bauch – sehe ich die jüngste Entwicklungsstufe der infizierten Art. Keiner der Kranken, die ich bisher erlebt habe, würde das Messer auch nur zur Kenntnis nehmen, das diesem hier im Mund steckt. Ich habe schon welche mit Stichwunden gesehen und versetzte manchen von ihnen selbst mehrere Stiche, doch vorausgesetzt, man drischt nicht mit einem stumpfen Gegenstand auf ihren Kopf ein oder bricht ihnen das Genick, macht ihnen keine dieser Verletzungen etwas aus.
Dieser betroffene Mann bemerkt das Messer in seinem Rachen allerdings und er weiß, dass er deshalb nicht zubeißen kann. Genauso wie die anderen zuckt er nicht oder lässt sich überhaupt etwas anmerken, als ich zugestochen habe, aber jetzt lässt er kurz von meinem Gesicht ab, um sich aufrecht hinzusetzen, nachdem er sich über meinen Kopf gebeugt hat, und macht sich daran, die Waffe aus seinem Mund zu ziehen. Er begreift also ganz offensichtlich, was ihn stört, und er weiß, wie es sich wieder beheben lässt.
Das sollte eigentlich nicht passieren. Niemand hat sich nach der Ansteckung je so schnell bewegt und darf auch seinen gesunden Menschenverstand nicht wiedergewinnen, sobald das Fieber erst einmal eingesetzt hat. Wir haben manche von ihnen untersucht, um herauszufinden, was genau geschieht, wenn sie erkranken. Der Parasit löst zuerst ein starkes Zittern am ganzen Körper und einen Temperaturanstieg bis über dreiundvierzig Grad aus. Dieses Fieber wütet im Endeffekt so lange, bis die meisten normalen Erkenntnisfunktionen und der Bewegungsapparat praktisch durchgebrannt sind.
Auf einmal knallt es über mir laut. Simones Baseballschläger federt vom Schädel dieses Mistkerls hoch, der daraufhin sogleich auf mir zusammensackt.
»Hast du das gerade gesehen?«, schreien wir uns gegenseitig an. Unsere zweiten Sätze decken sich zwar nicht, zeugen aber gleichermaßen von unserer Beunruhigung. Während ich: »Der hat gerade das Messer aus seinem Mund gezogen!«, rufe, meint sie: »Dieses Ding ist tatsächlich gerannt!«
Einen Moment lang schauen wir zwei uns nur fassungslos an und verinnerlichen diese neue Entwicklung im Stillen.
Schließlich hebe ich meinen Rücken wieder vom Gehsteig, um mich unter meinem übereifrigen Bewunderer herauszuwinden. So wie es aussieht, hat er allerdings beschlossen, mich nicht ohne Abschiedskuss ziehen zu lassen, oder genauer gesagt ohne Abschiedsbiss.
Er schnappt plötzlich nach meinem linken Unterarm und treibt seine Zähne unmittelbar unter dem Ellbogen durch meinen Hemdsärmel bis ins Fleisch. Das tut höllisch weh, und das Blut sowohl an seinen Lippen als auch im Stoff beweist deutlich, dass er mich tatsächlich verwundet hat.
Noch zwei Mal knallt es schnell hintereinander, dann hat Simone ihm den Schädel endgültig eingeschlagen, doch das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, das erkennen wir beide. Ich kremple langsam den Ärmel hoch. Die Zahnabdrücke sind deutlich zu sehen, und das Gewebe ist leicht zerfranst, weil der Infizierte den Kopf zurückgezogen hat, als der Schläger auf ihn niederging. Ich wurde also gebissen! Meine Kinder kommen jetzt hinter Simone zusammen. Hannah und Olivia verharren mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen. William ist wie meine Frau drauf und dran, in Tränen auszubrechen. Benjamin gluckst »Oh-oh, aua« und zeigt auf meinen blutenden Arm. Nur Amelia steht stoisch ruhig da und beteuert immer wieder: »Das wird schon wieder, Daddy … wie immer bei dir.«
»Simone! Kinder! Seht euch um, falls da noch mehr von denen sind«, verlange ich, da mir bewusst wird, dass wir jetzt vor dem Geschäft auf dem Präsentierteller stehen und bei dem Kampf ziemlich viel Lärm verursacht haben. »Dass ich gebissen wurde, ändert überhaupt nichts. Ihr alle müsst trotzdem die Augen nach weiteren Kranken aufhalten, okay?«
Die Frau, der ich ins Genick geschnitten habe, ist vom Hals abwärts gelähmt, schnappt aber noch immer mit ihren Zähnen nach mir, während ihr Blick zwischen uns herumirrt, sichtlich vor Sehnsucht nach einem Happen von wem auch immer. Simone schlägt daraufhin auch ihr den klappernden Schädel ein. Während sie wiederholt zuschlägt, erkennt man in ihrem Gesicht, wie ängstlich und zugleich wütend sie momentan ist. Sie gibt ein furchterregendes Bild ab, dem ich nie gegenübertreten wollte.
So einfach komme ich anscheinend nicht unter dem Idioten heraus, der mich gebissen hat. Aufzustehen ist äußerst schmerzhaft, aber nicht nur wegen der Wunde an meinem Arm, mein Kreuz bringt mich nach dem Fall auch fast um, und bestimmt habe ich auch zahlreiche Abschürfungen am Rücken, weil ich bei der Landung ein wenig gerutscht bin. Hannah sagt als Erstes, dass keiner in der Nähe ist und Simone bestätigt es kurz darauf.
»Also gut«, antworte ich. »Alle wieder zurück in den Laden. Dass ich gebissen wurde, ist schon fast eine Viertelstunde her, also könnte ich mich jederzeit verwandeln. Bleibt einfach fünf Minuten drin und behaltet mich dabei im Auge.«
Die Zeit vergeht, während ich draußen sitzen bleibe und darauf warte, dass ich mich verändere. Da nichts geschieht, stehe ich irgendwann auf und gehe in das Geschäft, um zu überlegen, was wir als Nächstes tun sollen, und um die Wunde nun zu säubern.
Ich habe ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Desinfektionsmittel, Verbänden und Nähzeug dabei. Während Simone den Biss säubert und näht, bespreche ich mit ihnen allen, wie es nun weitergehen soll. »Ich wurde gebissen, und bis nach Hause sind es noch ungefähr vier Stunden, wenn wir weiterhin so langsam vorankommen. Ich habe mich nicht sofort verwandelt, weshalb uns also noch ungefähr sechs Stunden bleiben, die es in dem Fall dauert, bis das Fieber ausbricht. Falls das immer noch so ist, genügt uns diese Zeit vollkommen, um zur Ranch zurückzukehren. Außerdem scheint es mittlerweile ungefähr Mittag zu sein, sodass wir noch eine Menge Tageslicht haben, um mühelos ans Ziel gelangen zu können.«
»Wir könnten die Räder und Hänger hierlassen, dann sind wir schneller. Wenn wir uns beeilen, könnten wir es in zwei Stunden schaffen, falls wir das wollen«, schlägt Olivia vor.
»Ich werde nicht die ganze Bogenausrüstung einfach aufgeben, denn in ihr liegt die Zukunft unserer Verteidigung. Zügiger heimzukommen wäre natürlich angebracht, wenn ich aufgrund meiner Verletzung schneller Hilfe bräuchte«, erwidere ich, »aber eure Mom hat sie nicht weniger gründlicher desinfiziert, wie wir es auch zu Hause hätten tun können, und sie näht die Wunde gerade. Uns bleibt also noch eine Menge Zeit, um es mit allem zu schaffen, was wir zusammengesucht haben. Außerdem befürchte ich sowieso, dass sich der Parasit rascher ausbreiten wird, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich würde also lieber so ruhig wie möglich bleiben, um sicherzugehen, dass ihr alle unbescholten heimkommt.«
»Dass wir alle unbescholten heimkommen«, berichtigt mich meine Frau.
»Reißen wir uns einfach zusammen und nehmen uns vor, unser Zuhause heil zu erreichen, in Ordnung?« Ich lächele, nachdem ich es gesagt habe, bin aber insgeheim besorgt und sehe an Simones Blick, dass es ihr ebenso geht. Um sie aufzuheitern, füge ich deshalb hinzu: »Wir sollten uns merken, wo dieser Schuhladen steht, damit wir uns, wenn wir das nächste Mal hier entlangkommen, mit Ersatzpaaren für alle eindecken können, und überhaupt um bei allem aufzustocken und in Zukunft etwas zum Tauschen zu haben.«
Normalerweise hätte ich ihnen nahegelegt, dass wir sofort alles durchsuchen sollen, um alles Brauchbare zusammenzutragen, aber ich will das Risiko vermeiden, sie nicht nach Hause und zu den anderen Familien bringen zu können, bevor ich Fieber bekomme. Außerdem sind unsere Fahrräder und Anhänger sowieso schon voll beladen mit allem, was wir bereits gefunden haben, also steht das Stapeln von Schuhkartons definitiv außer Frage, falls wir nichts anderes zurücklassen möchten.
Als wir den Laden und die drei leblosen Körper davor hinter uns lassen, schweife ich in Gedanken ab zu glücklicheren Zeiten unseres Lebens. Ein großer Lichtblick infolge der Apokalypse ist auf jeden Fall die gesündere Ernährung. Klar vermisse ich Fast Food oder Schokoladenkringel, und meine Frau sehnt sich unglaublich nach Eiscreme, aber da wir immer irgendwie mit einem Debakel gerechnet haben, horteten wir schon länger Nahrungsmittel und sind deshalb nun recht gut versorgt. Zu Hause haben wir eimerweise abgepackten Reis, Bohnen und Trockenkartoffeln, Tausende Konserven, Gläser und Dosen mit Rindfleisch, Geflügel, Fisch und die gleiche Menge – falls nicht sogar noch mehr – Gemüse und Obst. Sehr wichtig finde ich es auch, dass wir auf eine Fülle von Gewürzen verschiedener Art zurückgreifen können, um keinen ungesalzenen Reis oder fades Hühnchen essen zu müssen.
Mir ist bewusst, dass Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen momentan nicht nur versuchen, den Infizierten zu entrinnen und dieses Weltuntergangsszenario auszusitzen, sondern währenddessen auch Hunger leiden. Sie tun mir leid, ganz ehrlich, und wenn uns gute Leute über den Weg gelaufen sind, haben wir ihnen nach Möglichkeit auch immer geholfen, indem wir uns bemüht haben, ihnen den richtigen Weg in ein neues Leben zu zeigen, falls sie nicht bereit oder außerstande gewesen sind, bei uns auf der Ranch zu bleiben. Andererseits mag ich zwar großes Mitgefühl für die Bedürftigen der Welt empfinden, habe aber auch eine weniger teilnahmsvolle Seite, die sich von jeher gewünscht hat, dass sich die vorherrschenden Umstände verschlimmern würden … nicht in solchem Maße, aber wenigstens so weit, dass sich die Menschen wieder daran entsinnen, wie kostbar das Leben ist, und es wieder zu schätzen lernen, was sie besitzen.
Wenn ich an Lebensmittel denke, muss ich kurz lachen und rufen: »Simone, wenn wir wieder daheim sind und das Fieber überstanden ist, hätte ich gern ein richtig fettes Steak.«
»Hoffentlich vom Rind«, entgegnet sie – eine Anspielung darauf, dass ich im Zuge der Erkrankung Menschenfleisch wollen könnte.
Wir beide amüsieren uns köstlich darüber, doch die Kinder können oft nicht nachvollziehen, warum wir manche Dinge witzig finden.
Auf dem letzten Abschnitt unseres Nachhausewegs geschieht im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Welt nur wenig. Wir begegnen niemand Gesundem und müssen nur noch eine weitere Infizierte umbringen. Ich führe unsere Gruppe an und schaffe es, sie sauber mit Hannahs Hacke zu fällen; das ist ein langer Reifenhebel ohne Winkelansatz, den wir ebenfalls zugespitzt haben. Das Ende geht glatt durch den Kopf der Frau – links neben der Nase rein und hinten wieder raus. Sie ist etwa 1,70m groß und wiegt vielleicht hundertzwanzig Pfund, also halte ich es für ratsam, in Bewegung zu bleiben und kurzen Prozess mit ihr zu machen, sobald wir nahe genug an ihr dran sind. Die Leiche zu durchsuchen ist unnötig, weil sie dem Anschein nach, beim Ausruhen zu Hause angefallen und infiziert wurde, denn sie trägt noch einen zerfetzten Pyjama.
Im Laufe des vierstündigen Marsches lasse ich die Ereignisse der vergangenen fünf Tage, als wir weg von zu Hause waren, immer wieder Revue passieren. In erster Linie natürlich das, was heute geschehen ist. Auf der Ranch haben wir im Laufe der Zeit schon viele Mitbewohner an die Seuche verloren, genauso wie insgesamt ein Großteil der Menschheit davon befallen ist oder dahingerafft wurde. Aber egal, wie schlimm es bislang ausartete, bestand doch stets die Hoffnung, sie auszurotten und einen Neuanfang machen zu können. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit wir noch hoffen können, wenn die Infizierten jetzt rennen und ihre Hände zu mehr als grundlegenden Greifbewegungen gebrauchen können. Werden sie irgendwann auch lernen, wie man Tore und Zaungatter öffnet? Wäre es denkbar, dass sie Werkzeuge einsetzen, um Verteidigungsmaßnahmen zu überwinden? Wie viele Läufer gibt es schon dort draußen? Zu viele Fragen und kaum eine Antwort …
Simone und ich haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir verwunden hatten, dass es sich bei diesen Gestalten nicht mehr um Menschen handelt. Wir hielten und halten weiter an der reuevollen Vorstellung fest, dass es nach Ausbruch des Fiebers einfach Hirngeschädigte waren – Behinderte mit einem extremen Hang zur Gewalt, aber nichtsdestotrotz Menschen, die in früheren Zeiten wegen schlimmer Leiden oder Erkrankungen behandelt worden wären. Wer nun davon betroffen ist, hätte die gleichen Rechte und Schutz genossen wie alle anderen Bürger dieser ehemaligen Vereinigten Staaten. Womöglich wäre es auch wirklich genau so gekommen, hätte sich die Sache nicht so schnell und verheerend ausgebreitet; ein Haufen durchgedrehter Brutalos, die in Kliniken eingesperrt und regelmäßig von Angehörigen besucht werden würden.
Unsere Kinder scheinen keine Schwierigkeiten damit zu haben, das Ganze zu verdauen. Sie sind noch jung, also lern- und aufnahmefähiger, was diese neuen Lebensinformationen angeht. Unsere älteren Kinder schienen innerlich förmlich einen Hebel umzulegen, woraufhin sie es einfach so hinnahmen. Im Grunde genommen hätte es mehr Geschrei und Geheule geben sollen, doch auch wenn es nicht vollkommen ausblieb, war es weitaus weniger, als ich selbst gedacht hätte.
Als verantwortungsbewusster Vater hatte ich mir auch schon vor dem Zerfall Erwachsenenfilme mit den Kindern angesehen. Ich habe ihnen von den Zombie-Romanen erzählt, die ich gelesen hatte, oder sie haben meine Videospiele gesehen, wo ständig Blut spritzte und Köpfe rollten. Ich habe nicht versucht, sie von der Gewalt abzuschotten, so wie es manche irrigerweise tun; vielmehr setzte ich sie ihr aus und erläuterte ihnen, was sie sahen, falls es einer Erläuterung bedurfte. Wissen ist wirklich Macht, und nicht zu wissen, wie es auf der Welt zugeht – wie brutal sie sein kann –, stellt beim Überleben ein wirkliches Handicap dar.
Als irgendwann alles kaputtging und wir endlich wussten, womit wir es zu tun hatten, belog ich meine Familie nicht, dass alles wieder gut werden würde. Ich kündigte ihnen an, dass wir kämpfen müssten, um es durchzustehen, und erklärte Hannah, Olivia und William sofort, dass uns eine infizierte Person, die sie sehen, sofort bemerken und dann töten wird, wenn sie schreien oder zu weinen anfangen. Von da an achteten sie augenblicklich darauf, leise zu sein, wenn wir sie dazu aufforderten.
Bei Amelia und Benjamin geht es mir hauptsächlich darum, dass sie am Leben bleiben. Sie beobachten ihre älteren Geschwister natürlich und ahmen sie nach, so wie es alle kleineren Kinder tun. Dieser Tage beläuft sich das jedoch auf Leisetreten und Mundhalten, statt zum Beispiel so zu tun, als würden sie ein Telefongespräch führen. Dies ist nun einmal die einzige Welt, die sie kennenlernen werden, also werden sie nicht zu der Geisteshaltung erzogen, frei herumlaufen und grölen zu dürfen, wann immer sie es wollen, so wie wir es in unserer Kindheit taten.
Kapitel 2
Tod und Abschied
Jetzt sind wir nahe genug, um den Zaun zu sehen, und stehen plötzlich vor einem weiteren Hindernis.
Wir haben nur zehn Minuten länger als die anberaumten vier Stunden gebraucht, um unser Gut zu erreichen. Vor unserem Kauf gehörte das Land zu einem Reithof mit Stallungen. Es erstreckt sich über hundertzwanzig Morgen und sollte unser Rückzugspunkt für den Fall sein, dass es einmal so zu Ende gehen würde, wie wir es befürchtet haben. Das Gut liegt weit genug außerhalb des Einzugsgebietes von Medford, und zwar nicht nur rein von der Entfernung her, sondern auch dank der verschlungenen, kurvenreichen Zufahrt, wegen der man es mit dem Auto nur sehr schwer findet. Außerdem ist es auch zu Fuß wegen der Hügel und des Waldes nicht leicht erreichbar, wenn man es nicht konzentriert darauf anlegt. Gleichzeitig ist man dort aber trotzdem nicht zu weit ab vom Schuss, dass regelmäßige Reisen in die Stadt nicht zu bewältigen wären. Wenngleich wir es auch zu unserem Hauptwohnsitz hätten machen können, fanden wir es praktischer, es als Ausweichstelle zu nehmen. Noch dazu haben wir das Gelände als Ausbildungslager für Interessierte benutzt, die etwas vom Leben in der Wildnis und der Überlebenskunst generell erfahren wollten.
Das Haus, in dem wir bis zum Ausbruch der Krankheit gewohnt haben, steht am Stadtrand von Medford. Ich habe mir dort eine begehbare Geschäftsfläche eingerichtet, um quasi von daheim aus arbeiten zu können und meine Kinder dabei stets um mich haben zu können.
Als das Ganze losging, mussten wir das Haus schließlich aufgeben, weil die Stadt einfach zu nahe war. Im Nachhinein bezweifle ich aber, dass wir es geschafft hätten, aus Medford auf unser Gut zu fliehen, wenn wir nur einen Tag länger geblieben wären, als es letztlich der Fall war. An jenem ersten Tag brach alles unheimlich schnell zusammen. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir eine alternative Unterkunft hatten und es nun unser eigenes, selbst bestücktes Überlebenstrainingslager ist.
Auf dem Grundstück stehen mehrere Anlagen und Nebengebäude, doch das Haupthaus befindet sich ungefähr hundert Yards hinter dem Zaun. Wir entschieden uns nach einem heftigen Angriff von Infizierten dazu, ihn weiter von den Gebäuden wegzuziehen. Es handelt sich dabei um eine Konstruktion aus Maschendraht, die knapp dreißig Morgen Land umgibt. Dazu gehören das Haupthaus, die Schlafstätten, zwei Mobilheime und mehrere Schuppen. Außerdem eine Scheune sowie der Reitstall, Lagerräumlichkeiten und verschiedene kleinere Unterbringungsmöglichkeiten für weitere Überlebende.
Rings um den Zaun herum haben wir im Abstand von zwanzig Yards weitere unterschiedliche Arten von Barrieren errichtet, um alle Person oder Kranke, die neugierig sind, zum Haupteingangsbereich zu lotsen. Inner- und außerhalb der Umfriedung haben wir außerdem Gärten mit Obstbäumen angelegt, wobei diese nicht näher als etwa fünfundzwanzig Yards zum Zaun gepflanzt wurden, um zu verhindern, dass sich jemand allzu leicht unbemerkt nähern kann. Hinter dieser Grenze befinden sich noch einige Gräben, Baumgruppen und hohe Felshaufen, die wir als Defensivstellungen nutzen können, falls es wieder einmal jemand auf unser Zuhause abgesehen hat.
Insgesamt sind das schon ganz anständige Voraussetzungen für jemanden, der sich auf eine Katastrophe vorbereitet hat und seinen Besitz vor Eindringlingen oder umherziehenden Infizierten schützen will. Es erweist sich allerdings als deutlich weniger ideal, wenn man vom Hamstern zurückkehrt und jemanden hinter dem Zaun Wache stehen sieht, den man überhaupt nicht kennt, während auch sonst kein vertrautes Gesicht in der Nähe ist. Und genau das, ist das Hindernis und potenzielle Problem, vor dem wir jetzt stehen.
»Simone, ich kann weder Arthur, Greg noch einen der anderen auf dem Grundstück entdecken. Hannah, was sagt dein Fernglas?«
»Nichts, Dad. Ich sehe nur diesen einen Mann, und soweit ich sagen kann, rührt sich im Haus auch niemand.«
Ich beschließe, dass wir erst einmal die Köpfe zusammenstecken und in Ruhe unsere Optionen gegeneinander abwägen. »So haben wir uns das offensichtlich nicht vorgestellt, aber wir brauchen ja trotzdem nicht gleich vom Schlimmsten auszugehen. Der Fremde geht eher spazieren, als dass er irgendetwas bewachen würde, mir kommt er sogar ein bisschen geistesabwesend vor. An dieser Seite des Hauses deutet nichts auf irgendeinen Streit oder eine Auseinandersetzung hin, zumal dies der direkteste Zugang ist, also schlage ich Folgendes vor. Jeweils einer von uns geht am Wald entlang um das Gelände herum und sucht nach Toten oder Anzeichen dafür, dass es eine Schießerei gegeben hat. Dieser Mann hier ist seinen Bewegungen und seinem Aussehen nach zu urteilen definitiv gesund, weshalb wir uns sicher sein können, dass das Gut nicht von Infizierten überlaufen wurde. Wäre dies ein feindlicher Übergriff, würden wir sofort erkennen können, dass sich unsere Mitbewohner mit Waffengewalt zur Wehr gesetzt hätten. Darum suchen wir wie gesagt nach Spuren eines Kampfes. Klingt das logisch für euch?« Ich warte. »Ihr nickt einhellig, also wer geht freiwillig?«
Alle außer Benjamin bieten sich sofort an.
»Simone und Olivia, ihr beide solltet es tun. Simone, nimm William mit. Das wird eine gute Übung für ihn sein, um mehr über das Schleichen und Beobachten zu lernen. Olivia, du schlägst die Gegenrichtung ein, und wenn ihr zwei euch auf der gegenüberliegenden Seite trefft, geht ihr trotzdem weiter für den Fall, dass der jeweils andere auf dem Hinweg etwas übersehen hat. Hannah, du bleibst bei mir. Falls uns jemand vom Grundstück aus Ärger bereiten will, bin ich in der Lage, jedem Angriff standzuhalten. Du wirst Amelia und Benjamin nach Osten zu unserer ersten Notfallstellung bringen, dort treffen wir uns hinterher alle wieder … und Hannah: Sollte mir etwas zustoßen, passt du bitte auf deinen Bruder und deine Schwester auf. Nimm sie jetzt beide mit. Habt ihr das alle verstanden?«
»Dir wird schon nichts zustoßen, Eddie!«, meint meine Frau für meinen Geschmack ein wenig zu ängstlich.
»Simone, ich wurde vor über vier Stunden von einem Kranken gebissen, der aktiv war und rennen konnte. Wir wissen deshalb nicht, ob wir an der Grenze von sechs Stunden festhalten können oder ob ich vorher Fieber bekomme. Ich verlasse mich einfach darauf, dass du dich um die Kinder kümmerst und Hannah mich aufhalten wird, falls sie es muss. Aus diesem Grund bleibt sie bei mir. Simone, ich liebe dich und ich bin mir sicher, dass du recht hast, aber uns rennt die Zeit davon, also packen wir's an.«
Ich sehe an ihrem Blick, wie gekränkt und traurig sie ist, aber sie kennt die Wahrheit genauso gut wie ich. Unser Heim gewährleistet nun einmal das Überleben unserer Familie. Selbst nachdem wir überlaufen wurden und viele unserer Gefährten verloren haben, bleibt es für uns immer noch ein Ort der Sicherheit.
Wir haben geheime Vorratskammern und Verstecke für den Notfall auf dem weitläufigen Gelände eingerichtet, aber nichts darüber hinaus. Dass unsere ganze Familie unversehrt bleiben wird, ist seit jeher unwahrscheinlich, doch das sollte uns recht sein. Ohne auf mich bauen zu können, brauchen die anderen das Haus und die Nutzmittel darin dringend, um weiter bestehen zu können, ganz zu schweigen von den anderen Familien, mit denen wir unsere Überlebenserfahrungen und Vorräte geteilt haben. Außerdem, um es mal plump auszudrücken, wurde ich sowieso gebissen und habe keine zwei Stunden mehr, um sie dort hineinzukriegen, ehe das Fieber bei mir ausbricht … falls es noch ausbricht, wohlgemerkt.
Simone und William brechen nun nach rechts auf, Olivia nach links. Alle drei verschwinden nach zwanzig Yards zwischen den Bäumen. Während sie ihrer Wege gehen, tritt Hannah etwa zehn Fuß hinter mir zurück, um Benjamin und Amelia in einen kleineren Karren zu legen, den wir an den Fahrradanhängern festgemacht haben. Sie koppelt ihn daraufhin ab und lässt sich mit ihrer Ruger 10/22 daneben nieder.
»Danke, Hannah. Deine Mutter hat vermutlich wie immer recht, aber achte bitte trotzdem auf mich, in Ordnung? Auch wenn wir zum Zaun gehen, behältst du mich die ganze Zeit im Blick, während Mom und ich mit dem Fremden dort sprechen, klar?«
Sie spannt ihre Züge zu einer angestrengten Miene an und nickt schließlich.
Hannah war schon immer ein kluges Ding, um genau zu sein, ist keines unserer Kinder auf den Kopf gefallen, doch ich bedauere es trotzdem zutiefst, dass sie einfach nicht das Mädchen bleiben konnte, das bockig wurde und zu weinen anfing, wenn es ein neues Wort nicht lesen konnte oder die Regeln eines Spiels nicht sofort verstand. Jetzt nimmt sie in einer Welt der anhaltenden Schrecken bereits eine Erwachsenenrolle ein. Möglicherweise muss sie mich heute mit einem Schuss töten, um sich selbst sowie ihre Brüder und Schwestern vor dieser verdammten Krankheit schützen zu können. Dennoch akzeptiert sie stoisch wie ein kampferprobter Veteran, was ihr vorgesetzt wird und statt sich zu beschweren oder zu jammern, dass sie es nicht kann, weil ich ihr einfach zu viel bedeute, stellt sie sich ihrer Verantwortung in diesem neuen Leben. Sie macht mich damit ungeheuer stolz. Sollte sie dieses Chaos tatsächlich überstehen, werden sie und alle anderen, die es schaffen, ein deutlich robusteres Volk bilden, als es die kaputte jetzige Generation gewesen ist.
Der Mann hinter dem Zaun benimmt sich zweifelsohne äußerst merkwürdig. Ich beobachte ihn, während ich darauf warte, dass die anderen ihre Runde um den Zaun gedreht haben, und dieser Kerl kommt mir einfach komplett unberechenbar vor. Er soll hier draußen anscheinend Wache halten, dreht sich aber immer wieder zum Haus um und benimmt sich wie einer jener erwartungsvollen Väter im Fernsehen, die nervös vor einem Entbindungssaal im Krankenhaus auf und ab gehen. Dennoch höre ich nichts Ungewöhnliches und sehe auch keine anderen Bewegungen auf dem Grundstück.
Zumindest weiß ich so wenigstens, dass ich mir keine Sorgen um andere herumstreifende Patrouillen machen muss, wenn ich mich gleich dem Zaun nähere, um mit ihm zu reden, denn die hätte ich nämlich mittlerweile längst gesehen. Das umzäunte Gelände ist nicht so weit, dass sich jemand darin unerkannt bewegen könnte, jedenfalls nicht beim Beobachten bestimmter Stellen im vorderen Bereich des Grundstücks, und jeder andere, der ringsherum entlanggehen würde, hätte diesen Teil hier längst wieder erreicht. Also bin ich ungestört mit ihm und werde ihn einfach fragen, wer er ist und was er auf meinem Land zu suchen hat und wo alle anderen abgeblieben sind.
»Marco?«, ruft nun eine Stimme aus dem Wald.
»Polo«, antworte ich.
Olivia tritt von rechts hervor, und Simone sollte auch bald mit William wieder zurückkehren. Wir verwenden dieses simple Passwort, um uns zu erkennen zu geben, wenn wir uns einmal trennen müssen, so wie jetzt, was allerdings nur sehr selten vorkommt. Wie wir finden, eignet sich »Marco Polo« gut zum Unterscheiden Gesunder von Kranken und kündigt außerdem an, dass jemand aus unserer Gruppe im Anmarsch ist.
Die Infizierten können nicht sprechen, wenigstens jetzt im Augenblick noch nicht, und ich hoffe, dass sie diese Fähigkeit auch nicht wiedererlangen werden. Das Einzige, was sie von sich geben, ist ein entsetzliches Schmatzen. Man kann es als Mischung aus Knurren und Gurgeln bezeichnen: kehlig und gluckernd wie jemand mit Flüssigkeit im Rachen. Es klingt zutiefst verstörend und sollte eigentlich von keinem Menschen erzeugt werden können. Sie tun es jedoch, wann immer sie auf Beute stoßen, die sie nicht fassen können. Das hängt wohl mit ihrem Jagdinstinkt zusammen, schätze ich.
Wenn sie das Gefühl haben, einen gesunden Menschen, oder auch Tiere, schnappen zu können, bleiben sie ganz still. Dann kriechen sie geradezu heran in der Hoffnung, uns überraschen zu können, so als würden sie nicht weiter auffallen. Halten wir uns hinter einer Mauer oder anderen Hindernissen auf, gelingt es den Infizierten allerdings nicht, diese zu überwinden oder zu umgehen. Sie stoßen dann diese Laute aus, die ich außerdem als eine Art Ruf interpretiere, um anderen Kranken zu vermitteln, dass Nahrung in der Nähe ist und sie Hilfe benötigen. Immerhin tauchen stets auch andere auf, wenn dieser Ruf ertönt.
»Hast du etwas gesehen, Olivia?«, frage ich.
»Ja, hinter dem Haus steht ein kleiner Zugwagen mit ein paar Sachen darauf. Ich habe ihn noch nie zuvor hier gesehen, also gehört er wahrscheinlich diesem Mann. Er hat den üblichen Kram geladen, den man beim Stöbern entdeckt, aber dort liegt auch eine Stoffdecke mit Blutflecken.«
»Marco?«, hören wir von rechts.
»Polo«, rufe ich Simone zu.
»Noch etwas, Olivia?«
»Nein, Dad, keine Spuren von einem Kampf. Keine Patronenhülsen auf der Erde und keine Schäden am Haus oder Löcher im Zaun. Alles sieht irgendwie verlassen aus.«
Simone stellt sich nun neben William und sagt: »Hallo Schatz. Freut mich, dass du noch da bist.« Sie lächelt verschmitzt, aber unterschwellig gequält.
»Erzähl schnell, ich gebe ja bald den Löffel …«, beginne ich zu scherzen, bringe es aber einfach nicht über die Lippen, nicht einmal mit der Absicht, die Stimmung ein wenig aufzulockern.
Dass ich gebissen wurde, passt mir ganz und gar nicht, wobei ich dank unserer Erlebnisse während der letzten Monate wenigstens weiß, was mir blüht. Simone hat als Krankenschwester in einer der örtlichen Kliniken gearbeitet, als die Leitung eines Tages das ganze Personal vor Personen gewarnt hat, die mit einer bestimmten Art von Fieber oder Menschenbissen ähnelnden Verletzungen auftauchen würden. Jeder von ihnen erfuhr daraufhin, dass die Seuchenschutzbehörde dies als ernste Bedrohung für unsere Region einstufte, und Simone rief mich sofort nach dem Ende ihrer Besprechung an. Wir unterhielten uns kurz, und als sie mir von der Gefahr erzählt hatte, verlangte ich von ihr, dass sie mir versprach, sofort nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Ausrede sie angegeben hat, doch sie meldete sich auf der Stelle für ein paar Wochen ab.
So undenkbar es auch wirkte, konnte sie sich, weil ich ihr von den Büchern erzählte, die ich gelesen hatte, gut vorstellen, wie sich eine potenzielle Zombie-Epidemie gestalten könnte. Infolge der Nachrichten von Ausschreitungen, willkürlichen Gewaltakten und Hungersnöten in anderen Ländern aufgrund des Zusammenbruchs der Weltwirtschaft saß sowieso schon jedermann auf glühenden Kohlen. Zum Glück ließ sich Simone schneller als ich davon überzeugen, dass uns die Apokalypse bevorstand. Als sie mich zu Hause anrief und meinte, in den Krankenberichten sei die Rede von Zombies, dachte ich zuerst, sie wolle mich verarschen. Dann jedoch gab sie wieder, was die Krankenhausleitung ihr und den anderen Mitarbeitern erzählt hatte.
In der Warnmeldung des Seuchenschutzes wurden Gewaltbereitschaft, Fieber und Schüttelfrost mit dem Hinweis erwähnt, die Symptome würden an Tollwut erinnern, denn alle beobachteten Infizierten hätten versucht, andere Menschen zu beißen und anschließend zu essen. Am Schlimmsten war der Umstand, dass die Verwaltung der Klinik den Kontakt zum Sprecher der Behörde verlor, nachdem Geschrei am anderen Ende der Telefonleitung ausgebrochen war, und sie auch nicht mehr zu anderen Einrichtungen im Umland durchkamen.
Mir graut deshalb vor dem Fieber und den Schüttelkrämpfen, vor allem aber vor der Verwandlung und dem neuen Hunger, der sich nach einem Biss einstellt. Im Moment will ich aber nur eines: Meine Familie ins Haus schaffen.
»Mein Plan sieht so aus, Leute«, sage ich, und sofort hören mir alle zu. »Hannah hält sich mit dem Laser an ihrer 10/22 bereit. Schalte ihn ein, falls der Mann den Eindruck erweckt, aggressiv zu werden oder wenn ich auf ihn anlege. Ziele aber nur auf seine Brust, damit er den Punkt sieht. Ihr anderen werdet hier außer Sicht bleiben. Ich gehe los und rufe nach ihm. Wir dürften an seiner Reaktion auf mich ziemlich schnell erkennen, ob er uns gefährlich werden kann. Ist dem nicht so, nähere ich mich dem Zaun weiter, um eine Unterhaltung mit ihm zu beginnen. Dabei erkläre ich ihm, wer ich bin, entriegele das Tor und trete ein … oder ich erschieße ihn und entriegele dann das Tor, um einzutreten. Sollte ich die Waffe früher oder später benutzen müssen, seid darauf gefasst, mir entweder Feuerschutz geben zu müssen oder euch zurückzuziehen je nachdem, was genau passiert. Könnt ihr mir so weit alle folgen? Noch irgendwelche Unklarheiten … nein? Gut. Denkt daran, ich wurde schon gebissen, also möchte ich keine Heldentaten sehen, um mich zu retten, falls plötzlich eine Armee aus dem Haus oder den Nebengebäuden auf mich zurollt.« Ich schaue jeden Einzelnen von ihnen mit einem strengen Blick an.
»Simone und Olivia, haltet eure Gewehre bereit und stellt euch darauf ein, zum Haus hinaufzulaufen, wenn ich euch grünes Licht gebe. William, du schaust weiter durch den Feldstecher auf alles außer mich und den Fremden. Du musst voraussehen, ob sich eine böse Überraschung anbahnt, klar? Und gib Mom oder Olivia sofort Bescheid, sobald du etwas oder jemanden bemerkst. Ich verlasse mich auf dein Urteilsvermögen, wenn es darum geht, auf den Mann zu schießen oder nicht. Er ist nach wie vor ein Mensch, aber wie du weißt, muss er deshalb längst nicht freundlich gesinnt sein. Denk bloß an die Geschichte, die uns Mr. Mangrove über seine Begegnung erzählt hat, und auch an die Männer, die versucht haben, uns zu ermorden. Traust du dir das zu, oder soll das lieber deine Mutter übernehmen?«
Sie gibt mir eine harte, verbindliche Antwort, die eine Zwölfjährige nicht über die Lippen bringen sollte: »Hab's verstanden, Daddy. Bleib einfach nur aus meiner Schusslinie.«
Ich gerate immer noch ein wenig aus der Fassung, wenn ich so etwas aus dem Mund eines meiner Kinder höre. Immer wieder nehme ich mir vor, diesen jungen Menschen mehr Hochachtung dafür entgegenzubringen, dass sie mit den Zuständen in dieser Welt umgehen können. Schon vor Beginn dieses Überlebenskampfes gab es Zwölf- bis Vierzehn-Jährige, die sich wie Erwachsene grässlicher Taten schuldig gemacht haben, harte Drogen nahmen oder vergewaltigten und einander die Köpfe einschlugen. Kids und Teenager sind ebenso zu extremen Gewalttaten fähig. Meine Kinder wohnten jedoch nicht in einer Stadt, wo Gewalt an der Tagesordnung war, und pflegten auch keinen Umgang mit dem Schlag, der Verbrechen beging; das traf auf uns alle zu. Dementsprechend erschüttert mich dieser Wandel in ihnen, zum Ernst und zweckmäßigen Denken hin, wobei sie nicht einmal vor der Ermordung eines Mitmenschen zurückschrecken. Darum gilt auch das Sprichwort, die Unschuld sei stets das erste Opfer eines Krieges.
»Hannah, Olivia, William: Ich möchte, dass ihr wisst, wie stolz ich auf euch drei bin. Eure Mom und ich haben Dinge von euch verlangt und erwartet, dass ihr Verantwortung übernehmt, die für uns in eurem Alter überhaupt nicht infrage gekommen wären. Ich weiß deshalb, dass ich mich um keines meiner Kinder sorgen muss, sobald ihr wieder im Haus seid, denn ihr haltet immer zusammen und versteht euch unglaublich gut. Wenn ich euch allerdings einen letzten Rat geben darf, bevor ich losgehe, dann diesen: Bitte lasst einander in Zukunft stets wissen, was euch besorgt und womit ihr hadert, verstanden? Stellt Fragen und verlasst euch nicht immer auf den Plan, der zuerst vorgeschlagen wird. Meine eigenen Pläne sind auch nicht immer die besten. Ich vergesse oft Aspekte, die ich eigentlich hätte bedenken sollen. Solltet ihr also jemals skeptisch werden oder Vorschläge haben, seht zu, dass ihr euch Gehör verschafft, denn eure Ideen könnten eines Tages jemandes Leben retten. Nun gut, hat noch irgendjemand etwas zu sagen, bevor wir anfangen?«
Hannah hatte es offenbar. »Ich finde, ich sollte an deiner Stelle gehen, Dad. Wenn du mich fragst, greifen du und Mom nicht oft genug auf uns zurück, wenn ihr auf Fremde zugehen wollt. Wir wirken schließlich nicht so bedrohlich, und in diesem speziellen Fall könnte ich mich dem Haus nähern, ohne dass der Kerl ausflippt, wo ein anderer Erwachsener bestimmt viel eher als Gefahr angesehen werden würde.«
Ich lächele kurz Simone an und überlege schnell, wie ich Hannah die Gründe dafür darlegen soll, dass ich gehen werde und nicht sie. »Dass du weniger bedrohlich wirken würdest, ist richtig, Hannah, aber es ist ja nicht so, dass ihm dieses Grundstück gehören würde. Er ist ein Eindringling, weshalb ich sogar will, dass er sich bis zu einem gewissen Grad bedroht fühlt. Der Eindruck, den ich bei ihm hinterlassen will, und dein Laserpunkt an seiner Brust sollen ihm begreiflich machen, dass er seine Waffe besser auf den Boden legt und nichts Dummes versucht. Würdest du zu ihm gehen, wäre das genauso, als wolle man jemanden mit einer Minipistole in Schach halten. Die mag zwar genauso tödlich sein wie eine größere, doch was imposanter aussieht, wird oft auch als schwerere Bedrohung angesehen … Nimm nur den Unterschied zwischen einem kräftigen, dicken Infizierten und einem kleinen, kranken Kind. Größe trägt seit jeher im Wesentlichen dazu bei, wie wir etwas wahrnehmen.«
Sie nickt, aber ich spüre, dass sie nicht vollends überzeugt ist.
»Außerdem übernehme ich es auch aus dem Grunde selbst, weil ich gebissen wurde. Falls eine Gefahr von unserem Haus ausgeht, könnte diese so groß sein, dass niemand, der dort unten am Tor erscheint, lebendig davonkommt. Ich würde euch nur vorschicken, um mit einem Fremden zu sprechen, nachdem wir sie sehr lange beobachtet und herausgefunden haben, wie sie ihrerseits auf Fremde reagieren. Letzten Endes ist dein Leben einfach viel wertvoller als meines.« Ich mache eine Pause, ehe ich hinzufüge: »Wenn du gebissen worden wärst, würde ich dich vermutlich wirklich lassen, okay?«
Daraufhin scheinen keine Fragen mehr offen zu sein. Nach einem schnellen Ich liebe euch, seit vorsichtig und Macht es gut in die Runde begebe ich mich zum Tor und rufe: »Hallo, Sie da hinter dem Zaun.«
Wir können kurz aufatmen, denn der Mann hält sich eine Hand über die Augen, um zu den Bäumen hinüberzuschauen, wo er meine Stimme gehört hat, statt in Erwartung eines Kampfes sofort zu seiner Waffe zu greifen.
»Ich komme jetzt aus dem Wald zu Ihnen«, lasse ich ihn wissen, während ich mich lässig nähere und dabei deutlich mache, dass er derjenige ist, der sich hier zu erklären hat. »Ich heiße Eddie Keeper und bin der Eigentümer dieses Grundstücks, auf dem Sie gerade stehen. Ich komme nicht allein und möchte, dass Sie sich mir gegenüber in keiner Weise aggressiv zeigen, haben Sie mich verstanden?«