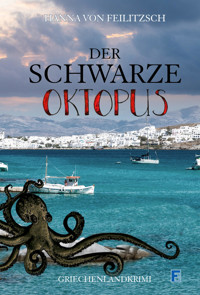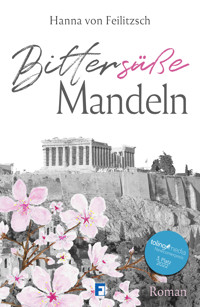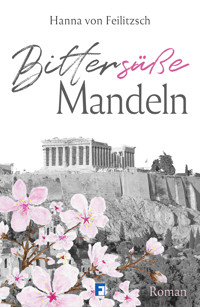11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feilitzsch-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
MORD AM SEHNSUCHTSORT Frühling auf Páros. Ruhig und friedlich plätschert das Leben dahin. Christína Strátou, die nach mehrjähriger Pause ihren Dienst bei der griechischen Polizei wieder aufnimmt, findet bei einer Wanderung die Leiche einer jungen Frau. Obwohl der Fundort abgelegen ist, hat sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Kollegen von der Polizei Páros schießen sich schnell auf eine Tat aus Eifersucht ein, schließlich ist der Ehemann der Toten spurlos verschwunden. Christína glaubt nicht an dieses Motiv. Zu leicht scheinen sich die Indizien ineinander zu fügen. Der Ermittlungsleiter lässt ihre Einwände nicht gelten und hält sie von dem aktuellen Geschehen fern. Sie ermittelt auf eigene Faust und kommt zu ganz anderen Schlüssen. Für sie ist der Ehemann nicht der Hauptverdächtige, sondern der wichtigste Zeuge. Bald ist sie der Wahrheit auf der Spur. Da taucht eine geheimnisvolle Frau auf, und plötzlich ist nicht mehr klar, wer Jäger und wer Gejagter ist. Als die Polizistin kurz vor der Aufklärung des Falls steht, begibt sie sich in große Gefahr. Kann Christína gerettet werden oder bezahlt auch sie mit ihrem Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hanna von Feilitzsch lebt mit ihrer Familie in Oberfranken und am Tegernsee. Die Autorin hat bisher zahlreiche Drehbücher für das Fernsehen geschrieben und mehrere Bücher veröffentlicht. Hanna von Feilitzsch ist Halbgriechin. »Der letzte Ouzo« ist ihr erster Griechenlandkrimi.
Hanna von Feilitzsch
Der letzte Ouzo
Griechenlandkrimi
Feilitzsch Verlag
© Feilitzsch Verlag Rottach-Egern
© Hanna von Feilitzsch
Überfahrtstraße 2
83700 Rottach-Egern
3. Auflage 2024
Coverdesign: Irene Repp
https://daylinart.webnode.com/
Illustration: © Nathalie Waldschmidt
© Anna-f – pixabay.com
© dimitrisvetsikas1969 – pixabay.com
Absatztrenner: © Sophia von Feilitzsch Thiele
Satz und E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
ISBN 978-3-930931-10-1
www.Feilitzsch-Verlag.com
Instagram: ©feilitzschverlag
©hannafeilitzsch
Páros, Sehnsuchtsort
Weiße Perle der Ägäis
Feine Sandstrände, malerische Dörfer
Enge Gassen und weiß getünchte Häuser
Ein wunderschöner Fleck Erde
Komm zum Byzantinischen Weg. Bitte. Um 9 Uhr an der Brücke. Pennys Tod war kein Unfall. Ich habe Beweise.
Die SMS flimmerte vor ihren Augen. Sie las die Worte und begriff den Inhalt nicht. Es war morgens, vielleicht acht Uhr, und das Geräusch der eingehenden Nachricht hatte sie aus dem Tiefschlaf geholt. Ihr Kopf fühlte sich leer an, brummte. Das war kein Wunder, nach der kurzen Nacht. Gestern Abend im Hafenrestaurant war es spät geworden. Jede Menge Alkohol geflossen, Wein und immer wieder Oúzo. Sie las die SMS ein weiteres Mal. Ihr wurde übel. Ohne den Absender zu sehen, wusste sie, dass sie von Léna stammte.
Unter dem Kopfkissen lagen ihre Beruhigungstabletten. Hastig griff sie danach, drückte eine Tablette aus dem Blister, schluckte sie hinunter. Sie verharrte eine Weile, nahm panisch eine weitere, wartete auf die Wirkung. Nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, setzte sie sich auf, tastete nach der Kopfschmerztablette, die auf dem Nachttisch neben der Wasserflasche bereitlag, spülte sie mit einem Schluck hinunter. Dann stieg sie aus dem Bett, eilte ins Bad und zog sich an.
Leise überquerte sie den Hof. Ein Vogel zwitscherte im Maulbeerbaum, sonst war kein Laut zu hören. Es war auch niemand zu sehen, noch nicht einmal ihr Bruder, der häufig um diese Zeit im Stall arbeitete.
Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass genug Zeit blieb, den Weg zum Treffpunkt zu Fuß anzutreten. Das würde ihr guttun, den Kopfschmerz endgültig vertreiben.
Langsam ging sie die Hauptstraße entlang. Es war kühl, windig. Sie schaute zum Himmel. Dunkle Wolken zogen sich zusammen, schienen ein schlechtes Omen zu sein. Bange schritt sie voran, in Richtung Léfkes, einem Bergdörfchen in der Inselmitte. Sie dachte an Léna, wie sie gestern am Nachbartisch eng umschlungen mit ihrem Mann Dragos saß, ihren Hochzeitstag feierte. Obwohl sie wusste, dass Dragos keiner geregelten Arbeit nachging, hielt er auch ihre Gesellschaft frei. Léna strahlte, lachte fröhlich, bis die Stimmung kippte. Irgendwann ging sie zu den Waschräumen, und Léna war ihr gefolgt, wollte mit ihr reden. Widerwillig war sie der Bitte nachgekommen, ahnte sie doch, worum es gehen würde. Penny. Der Gedanke an Penny ließ sie auch jetzt erschaudern. Seit Pennys Tod war ihr Leben komplett aus den Fugen geraten. Seitdem musste sie sich selbst bestrafen, sich Schmerzen zufügen, mit einer Rasierklinge Schnitte in die Oberarme ritzen, um die Schuld besser zu ertragen. »Ich brauche Hilfe. Penny …« Dann war der Kellner zu ihnen gestoßen, erzählte eine belanglose Geschichte und geleitete sie zurück zum Tisch. Beim Gedanken an diese Worte wurde ihr heiß und kalt. Wurde sie von Léna verdächtigt? Ein Gefühl der Machtlosigkeit stieg in ihr auf.
Wenige Meter, bevor sie Léfkes erreichte, heftete sich ein herrenloser Hund an ihre Seite. Manchmal lief er ein Stück voraus, dann kam er hechelnd zurück, mit verhangenem Blick. Er schien zu sagen: Geh nicht zu dem Treffen, sie davon abhalten zu wollen. Sie liebte Tiere. Vor allem Hunde. Ein paarmal streichelte sie ihm über den Rücken. Sie spürte die Knochen unter seinem struppigen Fell. Wie gerne hätte sie ihm etwas zu Fressen gegeben.
Sie ließ Léfkes hinter sich, die Kirche der Agía Triáda, der Hund noch immer neben ihr. Die Marmorfliesen des Byzantinischen Weges waren glitschig vom Morgendunst, die Luft frisch und klar. Die schweren Wolken verdunkelten den Himmel und tauchten die Gegend in ein gespenstisches Licht. Olivenbäume, niedrige Vegetation und Ackerland wechselten sich ab. Dazwischen schlängelte sich der alte Wanderweg bis hinunter zum Meer. Sie versuchte, nicht auszurutschen, dachte ein weiteres Mal an den vorangegangenen Abend. Léna durfte nicht zur Polizei gehen. Sie würde es zu verhindern wissen.
Der Hund sah sie an, als ob er Gedanken lesen könnte. Er war ihr mit einem Mal unheimlich. Sie machte ihm ein Zeichen, dass er gehen solle. Er reagierte nicht.
»Fíge!«, rief sie. »Hau ab!« Das Tier ließ sich nicht beeindrucken. Den Kopf schiefgelegt, schaute er sie mit seinen dunklen Augen an. Niemals würde sie diesen Blick vergessen. Sie atmete schneller, ging weiter, bis sie den Treffpunkt erreichte. Der Hund blieb weiterhin an ihrer Seite.
Léna schien noch nicht da zu sein. Sie schaute sich um. Überhaupt war keine Menschenseele zu sehen. Sie lehnte sich an die niedrige Brückenmauer. Der Hund sah sie wieder mit diesem durchdringenden Blick an. Stupste jetzt mit der Schnauze gegen ihr Knie, als ob er sie zurückdrängen wollte. Mit jeder Berührung wuchs die Furcht. Für den Notfall hatte sie die Beruhigungstabletten eingesteckt. Sie tastete nach der Packung und drückte eine Pille aus der Folie. Keine kluge Entscheidung, es würde alles durcheinanderbringen. Sie hatte heute bereits eine doppelte Dosis genommen. Wahnvorstellungen könnte sie vom übermäßigen Gebrauch bekommen, hatte der Arzt ihr zu verstehen gegeben. Aber sie konnte sich gegen den inneren Aufruhr nicht anders wehren.
Sie sah auf die Armbanduhr. Wenige Minuten vor neun Uhr. Sie beschirmte die Augen, um besser sehen zu können, suchte den Weg ab, bis hinein nach Léfkes. Die Sonne brach durch die Wolken und der Ort strahlte jetzt fast schon mystisch im Morgenlicht. Es kam ihr vor, als ob sie allein auf der Welt wären, der Hund und sie. Ein weiteres Mal machte sie erfolglos den Versuch, ihn fortzuschicken. Seine Augen wurden mit einem Mal heller, sahen sie tiefgründig an. Als ob er bis in die Tiefe ihrer Seele blicken könnte.
Die Kirchturmglocken schlugen zur vollen Stunde, schallten über die gesamte Ebene. Eine Frau tauchte auf. Auch aus der Entfernung konnte sie erkennen, dass es Léna war. Mit großen Schritten lief Léna den Weg entlang, sich ständig zu einem Mann umdrehend. Er war ein ganzes Stück kleiner als sie. Dragos. Das war eindeutig Dragos.
»Verdammt. Bleib stehen. Léna …« Er wollte sie anscheinend aufhalten, aber seine Frau ließ sich nicht stoppen. Rannte ihr entgegen. Der Wind trug immer wieder Wortfetzen heran, Schreie. Plötzlich blieb Dragos stehen und Léna lief weiter.
Jetzt spürte sie Übelkeit aufsteigen. Ihre Magensäure spielte verrückt. Unkontrolliert schluckte sie. Nur keine Panikattacke bekommen. Der Hund gab ihr erneut einen Stups gegen die Kniescheibe. Eigenartig, er schien größer zu werden, gigantisch groß. Fast meinte sie, Halluzinationen zu haben. Aber der Hund war echt. Ihr wurde schwindelig. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht. War das überhaupt ein Hund? Mit dem sandgelben Fell? An den Beinen schimmerten braune Flecken. Die Ohren waren mit einem Mal rund. Auch wurde der Schwanz ständig länger. Wie der Höllenhund sah er plötzlich aus. Ja, so stellte sie sich Zérberus vor. Sie drehte sich um und sah Léna auf sich zu laufen. Mit Schwung warf sich der Hund jetzt gegen ihr Bein. Sie strauchelte, wäre fast gestürzt. Schimpfte mit dem Tier. Ihre Stimme hörte sich leise an, obwohl sie aus vollem Hals brüllte. Der Hund sah sie an und heulte. Dann sprang er sie an. Der Boden unter ihren Füßen wankte. Sie konnte sich kaum noch aufrecht halten. War das real oder träumte sie? Der Hund stand nun wieder dicht neben ihr, winselnd und jaulend. Dann bellte er anhaltend. Nein, es handelte sich nicht um Zérberus, sondern um einen schutzbedürftigen Straßenhund. Sie würde ihn mit nach Hause nehmen. Jetzt hüpfte er, einem Gummiball gleich, verfehlte sie knapp. Sie schluckte hektisch, fuhr sich nervös über die Oberarme, um sich zu beruhigen. Vergeblich. Wie ein wild gewordenes Pferd stieg der Hund nun hoch, schmetterte sich gegen sie. Dann wurde alles schwarz um sie herum.
Sie lag auf dem Rücken, mitten auf dem Byzantinischen Weg. Die Sonne brannte auf sie herunter, ließ sie blinzeln. Der stechende Kopfschmerz, der sie seit dem Aufstehen geplagt hatte, war einem dumpfen, nicht weniger schmerzhaften Gefühl gewichen. Wie lange lag sie schon hier? Sie wusste es nicht. Vorsichtig fuhr sie sich mit der Hand übers Gesicht, spürte Schrammen. Was war das? Sie tastete den Kopf ab. Am Hinterkopf fühlte sie eine Beule. Vorsichtig setzte sie sich auf. Was machte sie hier, auf dem Wanderweg? Langsam kam die Erinnerung zurück. Léna. Hatte Léna sie angegriffen? Sie sah sich um. Niemand war da. Dunkel erinnerte sie sich an den Hund. Sie rieb sich den schmerzenden Hinterkopf. Wo war das Tier? Sie schaute sich um, entdeckte einen großen Feldstein, der unmittelbar neben ihr lag. Ein Fremdkörper auf den hell leuchtenden Marmorfliesen des Byzantinischen Weges. Sie griff danach. Er fühlte sich feucht an. Sie erschrak. Blut, das war ganz eindeutig Blut. Angeekelt warf sie den Stein weg. Sie nahm ein Papiertaschentuch aus der Jackentasche, rieb sich die Hände sauber. Dann stand sie auf. Wie von einem Magneten angezogen ging sie zur Brücke zurück. Bilder blitzten auf. Wie sie sich an die Mauer gelehnt hatte, der Hund sie anstupste. Sie beugte sich nach vorne und erstarrte. Dort lag Léna, die Gliedmaßen unnatürlich verdreht. Die Augen weit aufgerissen, zum Himmel gerichtet. Der Gesichtsausdruck glich einem einzigen, stummen Schrei.
Entsetzt wandte sie sich ab, spürte Brechreiz. Léna. Das durfte nicht sein. Léna war tot. Sie hielt den Arm um die Taille, rannte den Weg entlang, in Richtung Dorf, wollte Hilfe holen. Nein! Abrupt blieb sie stehen. Vielleicht hatte sie etwas mit Lénas Tod zu tun. Für einen Moment dachte sie an Penny. Die Übelkeit nahm jetzt von ihrem gesamten Körper Besitz. Fast meinte sie, die Besinnung zu verlieren. Sie wandte sich um, lief zurück zur Brücke, sah sich wieder um. Da war niemand. Jetzt schüttelte sie ein Heulkrampf.
Vorsichtig stieg sie hinunter ins Bachbett. Sie musste Léna nach hinten ziehen. Nur ein kleines Stück unter den Ginsterbusch. Damit sie nicht sofort entdeckt werden würde und sie Zeit gewann, der Sache auf den Grund zu gehen. Herauszufinden, was geschehen war.
Kapitel 1: Καλός ήρθατε.
Kalós írthate. Herzlich Willkommen, stand in dicken Lettern auf dem Plakat in der Ankunftshalle des Inselflughafens. Das ließ Bilder von Sonne, Meer und einem Glas griechischen Wein aufblitzen, genauso, wie es sich Christína seit Wochen ausgemalt hatte; seit dem Tag, da sie wusste, dass sie ihr erster Arbeitsplatz nach zehnjähriger Berufspause bei der griechischen Polizei nach Páros führen würde. Sie hatte von Athen geträumt, von den großen Kriminalfällen, aber ihr ehemaliger Vorgesetzter Bábis Pantaléos erklärte ihr, dass sie erst nach einer Übergangszeit auf der Kykladeninsel in der Hauptstadt eine Anstellung bekommen würde.
Christína musste nicht lange warten. Das Gepäck wurde nach wenigen Minuten ausgeliefert. Kein Wunder, der Flughafen war klein. Vor der Tür herrschte mäßiges Treiben. Die wenigen Fluggäste wurden in Empfang genommen. Begrüßungsszenen spielten sich ab, Umarmungen, Wortwechsel. Christína bemerkte, dass nur einzelne Werbetafeln für Hotels oder Autovermietungen hochgehalten wurden. Ende April waren auf der Insel nicht viele Touristen zu erwarten.
Sie erspähte einen Taxistand, an welchem sie nur einen einzigen Wagen vorfand. Der Taxifahrer schüttelte den Kopf, als sie ihm die Adresse nannte.
»Bizáni Lefkón … wollen Sie nicht lieber einen anderen Wagen rufen, junge Frau.« Mit Kopfnicken deutete der Mann auf die Karosserie des Mercedes. »Das Auto ist nagelneu. Die Straßen sind um diese Jahreszeit dort oben voller Schlaglöcher.«
Christína überzeugte ihn mit Charme und vielen Worten, sie zu der Adresse zu fahren. »Das sieht nach einem längeren Aufenthalt aus«, sagte der Taxifahrer, nachdem er die drei Koffer verstaut und auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte. Christína nickte. »Ich fange am 1. Mai bei der Polizei von Páros an. Ich bin Officer Christína Strátou.« Sie streckte ihm die Hand entgegen. »Freut mich sehr. Geórgios Ragússis«, erwiderte er, als er sie ergriff. Kurz darauf bogen sie auf der Umgehungsstraße nach links ab. »Eigentlich wollte ich zurück nach Athen. Dort habe ich vor meiner Beurlaubung bei der Mordkommission gearbeitet, aber es gibt im Moment keine freie Stelle.« Sie öffnete das Fenster, hielt die Nase in den Fahrtwind. »Ich glaube, ich hab’s nicht schlecht getroffen.« Sie lachte. »Páros ist ein wunderschöner Fleck Erde. Ich kenne es von früher. Meine Großeltern haben hier ein Haus.«
Bis sie Léfkes passierten, dem Ort, der der Gegend, in der das Sommerhaus ihrer Familie lag, den Namen verliehen hatte, waren sie tiefer ins Gespräch eingestiegen. Sie erzählte Geórgios, dass ihr Mann Níkos während der Griechenlandkrise seinen Job verloren hatte. Deshalb waren sie mit den beiden Kindern nach München übergesiedelt, wo Níkos als Ingenieur eine vielversprechende Anstellung fand. »Und jetzt ist er für seinen Job nach Saudi-Arabien geschickt worden. Ein zweijähriges Projekt. Da habe ich mich entschlossen, nach Griechenland zurückzukehren. Die Kinder sind mittlerweile auf der Universität, und ich wäre sowieso allein zu Hause.« Das konnte der Taxifahrer gut verstehen. Dann erzählte er aus seinem Leben. Sie erfuhr von den Problemen, die dazu geführt hatten, dass Geórgios das Studium kurz vor dem Examen abbrechen musste. Seitdem fuhr er tagaus tagein Touristen durch die Gegend, um seine Frau und die Kinder zu ernähren. Doch er hatte es geschafft. Er nannte ein Taxi sein Eigen und war dadurch selbstständiger Unternehmer. Zu dem Zeitpunkt, als sie von der Hauptstraße abbogen, der Fahrtweg zunehmend schmaler und nach einem Kilometer zur Schotterpiste wurde, hatte sie Geórgios bereits derart mit Fragen überhäuft, dass er die anfänglichen Zweifel wohl vergaß, und einfach weiterfuhr.
Irgendwann wurden die Schlaglöcher tiefer. Stille machte sich im Inneren des Autos breit. Wie ein Schiff lenkte Geórgios den Mercedes slalomartig die Piste entlang. Immer enger wurde der Weg, fast schien es, als würde das Auto nicht mehr hindurchpassen. Hinter einer Kurve stieg der Taxifahrer auf die Bremse. Christína traute ihren Augen nicht. Ein Wald von Lupinen übersäte den gesamten Weg. Eineinhalb Meter hohe Pflanzen ragten aus dem Boden. Geórgios stieg aus dem Wagen.
»Mein schöner Mercedes. Ich kann nicht vor und nicht zurück.« Entsetzen sprach aus seinen Augen. Sie würde es sich auch nicht zutrauen, den schmalen, steil abfallenden Weg rückwärts zurückzufahren, und an Wenden war nicht zu denken. Zudem war er die einzige Zufahrt zu ihrem Haus. Kleinlaut stieg Christína aus.
Was sollte sie nun machen? Jetzt stand sie nicht weit entfernt vor ihrem Ziel, neben einem fremden Mann, zwischen all den Lupinen. Lachen oder weinen, oder ein Foto schießen und auf Instagram posten? Es würde sich ohne Frage gut machen in ihrer Story. Ein lautes »Iiiiaaah« ließ sie zusammenzucken. Ein Esel streckte den Kopf über eine niedrige Mauer am Wegesrand. Das Tier war dunkelbraun und seine langen Ohren wackelten fröhlich hin und her. Das Fell glänzte im milden Licht der Abendsonne. »Iiiiiiaaaaah«, machte er wieder, »iiaaahh«. Sogar der Esel schien sie beide auszulachen. Christína zog ihr rotes Kleid zurecht. Vorsichtig machte sie ein paar Schritte auf den Fahrer zu, darauf bedacht, mit den neuen Wedges, die sie für die Reise angezogen hatte, auf dem Schotterweg nicht umzuknicken. Sie strich eine Strähne des langen, blonden Haars aus dem Gesicht und zog ratlos die Nase kraus. Geórgios sah noch immer fassungslos auf den Lupinenwald.
»Ich werde Hilfe holen.« Sie schaute aufs Handy. »Kein Empfang.« Ihre Stimme klang kleinlaut. Geórgios zeigte hinter sich.
»Das ist der Ágios Pántes. Auch Profítis Ilías genannt. Der höchste Berg der ganzen Insel. In seinem Windschatten macht das Netz der Telefongesellschaft schon mal schlapp.«
Im Grunde spielte es sowieso keine Rolle. Wen hätte sie anrufen sollen? Ihr letzter Aufenthalt auf Páros lag etwa zwanzig Jahre zurück. Ein Wunder, dass sie den Weg zum Grundstück noch wusste. Geórgios ging um den Mercedes herum, öffnete den Kofferraum und griff in eine darin untergebrachte Eisenkiste. Der groß gewachsene Mann zog zwischen dem Werkzeug eine Brechstange heraus.
»Die habe ich immer dabei. Für alle Fälle«, erklärte er. »Auf der Insel kann man nie wissen.«
Christína hatte aus ihrem deutschen Alltag ausbrechen wollen, aus dem Job bei der Sicherheitsfirma flüchten, der ihr über die Jahre hinweg gleichförmig erschien und keine Überraschungen bereithielt, hatte Abstand gewinnen und Abenteuer erleben wollen. Nur hatte sie sich das etwas anders vorgestellt.
Sie fühlte sich wie Alice im Wunderland und sah zu, wie der Taxifahrer die Brechstange zu einer Machete umfunktionierte und auf die Lupinen einschlug. Die gesamte Schotterstraße war in einen dichten, grünen Teppich verwandelt. Der Esel machte »Iiiiaaahhh« und warf den Kopf fröhlich hin und her. Geórgios besaß eine effektive Vorgehensweise. Er schien das nicht zum ersten Mal zu machen und war bestimmt schon fünfzig Meter weit gekommen. Christínas Handy summte. Sie hatte Empfang und war somit zurück in der Jetztzeit. Sie schaute aufs Display. Níkos.
»Baby«, tönte es aus der Leitung. »Ich bin in Riad gelandet. Der Flug war entspannt. Ich habe bestimmt eine Flasche Wein getrunken. Ich weiß nicht, wie lange ich keinen Alkohol bekommen werde.« Christína runzelte die Stirn. Wenn das seine einzige Sorge war.
»Du sagst ja gar nichts.«
Geórgios hatte mit seiner Technik mittlerweile fast alle Lupinen abgemäht. Sie seufzte.
»Alles gut … Níkos. Ich bin gut gelandet und bald in unserem Haus.« Es knackte in der Leitung.
»Christína … hattet ihr Verspätung? Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Bienenschwarm?«
Sie seufzte. »Nein, das ist kein Bienenschwarm. Wir waren auf die Minute pünktlich. Ich bin fast am Haus.« Sie trat näher an Geórgios heran. Jetzt konnte sie die Schweißperlen auf dessen Stirne sehen. Das Zischen der Brechstange wurde lauter. In der Ferne blökte der Esel.
»Christína … wo bist du? Was ist das für ein Zischen?«, fragte Níkos konsterniert.
»Nichts … das ist mein neues Leben. Ich muss jetzt aufhören. Melde mich später.« Während sie den Knopf drückte, hörte sie noch, wie er ihren Namen rief. Sie steckte das Handy in die Tasche. Dann bückte sie sich, packte Lupinenbüschel und warf sie über die Steinmauer den Berg hinunter. Das Handy summte. Sie ignorierte es, schließlich wollte sie erst einmal im Haus und in ihrem neuen Lebensabschnitt ankommen.
Der Taxifahrer brachte sie direkt vor die Tür. Geórgios ließ es sich nicht nehmen, die Koffer in den Vorraum hineinzutragen. Sie verabschiedeten sich mit Handschlag und er gab ihr seine Handynummer.
»Nur für alle Fälle. Damit du hier nicht festsitzt. Ich kann dich jederzeit abholen.« Sie sah sich um und lachte.
»Was soll hier schon nicht funktionieren?« Trotzdem nahm sie seine Karte.
Ihre Mutter hatte ihr am Telefon berichtet, dass das Ferienhaus renoviert worden war und ein Auto bereitstand. Die quadratischen Fenster waren durch breite, bodenlange ausgetauscht worden, die Schlagläden blau gestrichen. Die Wand zwischen Küche und dem Esszimmer war verschwunden, der dunkle Dielenboden der Kindheit aufpoliert und die altertümlichen Möbel durch moderne ersetzt. Sie trug die Koffer in den ersten Stock und bezog ihr altes Zimmer. Jedes Möbelstück war auch hier gegen ein neues ausgewechselt worden. Vorbei die Zeiten, in denen jeder Raum mit zwei Stockbetten ausgestattet war, damit die gesamte Großfamilie und darüber hinaus noch Freunde Platz fanden. Jetzt bildete ein Himmelbett das Zentrum des Zimmers. Sie öffnete die Fensterläden, um die Sonne hereinzulassen.
Nachdem sie ihre Sachen in den nach Lavendel duftenden Schrank gehängt hatte, inspizierte sie die Küche. Tína, die Haushälterin, hatte eine Flasche Weißwein des hiesigen Winzers Moraítis kaltgestellt. Sie öffnete die Flasche, goss sich ein Glas ein. Der Spinatauflauf, den sie im Ofen vorfand, machte es ihr leicht, sich zu Hause zu fühlen. Sie setzte sich auf die Terrasse und genoss die Aussicht. Als ihr Glas geleert war, hüllte die Dunkelheit die drei alten Windmühlen, die vor ihr aus der Ebene ragten, schon lange ein. Die Lichter der Insel Náxos, die Páros wie ein Zwilling gegenüberlag, leuchteten hell.
Das ganze Wochenende war sie wie ein Tiger in seinem Käfig durchs Haus gelaufen. Rastlos, lauernd. Der Bruder und seine Frau beäugten sie misstrauisch, wollten wissen, was mit ihr los war. Aber sie schüttelte nur den Kopf, lief die Treppe hinauf, in ihr Zimmer. Sie wusste, dass Vorsicht geboten war. Der Bruder hatte lange mit den Ärzten gesprochen, nachdem feststand, dass sie nach dem Aufenthalt in der Psychiatrie nicht mehr allein leben konnte. Die Verwandten sollten sich um sie kümmern, dafür sorgen, dass sie die Medikamente gegen die Depressionen regelmäßig einnahm.
Seit Samstagmorgen konnte sie keine Minute stillsitzen. All ihre Gedanken waren bei Léna, wie sie sie im Hafenrestaurant um Hilfe anflehte, von Beweisen sprach und von Pennys Tod. Sie durchschritt das Zimmer, lehnte sich mit dem Kopf an die kühle Wand. Léna, die auf dem Byzantinischen Weg auf sie zulief. Der Hund, der fortwährend größer wurde. Wusste nicht, ob das alles ein Traum gewesen war. Sie drückte die Stirn fest gegen die kühle Wand, spürte keine Linderung, war immer noch aufgewühlt. Jetzt ging sie ein wenig zurück, schlug dann mit der Stirn dagegen. Hatte sie sich das alles nur eingebildet? Léna, tot im Ginsterbusch? Fast blieb ihr der Atem weg.
Leise ging sie aus dem Raum, über den Flur, ins Badezimmer. Sie lockerte eine Fliese im Boden, nahm die dort versteckte Rasierklinge heraus. Die Klinge fühlte sich kalt an in ihrer Hand. Sie legte sie aufs Waschbecken. Dann zog sie sich das T-Shirt über den Kopf, betrachtete sich im Spiegel. Die Druckstelle auf der Stirn, die eindeutig von eben stammte, die übermüdeten Gesichtszüge, die angstgeweiteten Augen. Ein Äderchen war geplatzt. Das kam bestimmt von den vielen Tabletten, die sie während der vergangenen zwei Tage eingenommen hatte. Der zitternde Mund. Wo war die attraktive junge Frau, die sie war? Sie wusste es nicht. Vorsichtig fuhr sie mit den Fingern über den schmalen, langen Hals, die Schultern, den linken Oberarm. Dann tastete sie nach dem Pflaster, riss es mit einem Ruck ab. Sie spürte die Krusten der heilenden Wunden. Für einen Moment ging sie in sich, dann nahm sie die Rasierklinge vom Waschbeckenrand und setzte zu einem tiefen Schnitt an. Sie spürte den Schmerz, das Blut, das jetzt bis zu ihrem Ellbogen hinablief. Sofort fühlte sie sich besser, sah alles klarer. Wusste mit einem Mal, was zu tun war. Sie würde zurück zum Byzantinischen Weg gehen, sich Gewissheit verschaffen, ob sie einer fixen Idee aufgesessen war, einer Wahnvorstellung.
Hastig öffnete sie den Badezimmerschrank, suchte in einem Täschchen nach dem Verbandszeug; säuberte die Wunde, klebte sorgfältig ein Pflaster darauf.
Obwohl es noch nicht einmal neun Uhr war, legte sie sich aufs Bett, versuchte zur Ruhe zu kommen. Erfolglos. Sie griff in die Nachttischschublade, fand ein Schlafmittel.
Erste Ausläufer des Sonnenlichts zogen über den Himmel, als sie das Haus verließ. Im Westen waren noch einige blasse Sterne zu sehen. Sie hatte sich den Trenchcoat über die Schultern geworfen, trug darunter nur ein Nachthemd. Die Füße steckten in Badeschlappen. Zielstrebig lief sie die Straße entlang, in Richtung Léfkes. Kein Auto war unterwegs. Auch das Inseldörfchen war wie ausgestorben. In der Ferne krähte ein Hahn.
Kurz darauf war sie auf dem Byzantinischen Weg. Es war mittlerweile heller geworden. Die Erde roch frisch. Die Farben waren intensiver als sonst. Die Bäume wogten leise im Wind. Sie hielt kurz inne. Hatte Angst vor dem, was sie erwartete. »Bitte, lieber Gott, lass das alles nur einen bösen Traum gewesen sein. Bitte.« Sie spürte Tränen in den Augen aufsteigen. Sie hatte Léna immer gerne gemocht. Die Freundin durfte nicht tot sein.
Wie eine Maschine setzte sie einen Fuß vor den anderen. Betete ein Gebet ihrer Kindheit. Léna. Sie bekreuzigte sich. Die Brücke war ganz in der Nähe. Sie hielt den Atem an. Bitte, flehte sie, den Blick wieder zum Himmel gerichtet. Sie atmete aus, ging zum Brückengeländer, beugte sich über die Steine. Sie sah nichts. Schnappte nach Luft. War es doch nur Einbildung gewesen? Sie spürte ein wenig Erleichterung. Da stieg hart wie ein Fausthieb die Erinnerung auf, wie sie ins Bachbett hinuntergestiegen war und Léna in den Busch gezogen hatte. Jetzt wusste sie, dass Lénas Tod kein böser Traum war. Wieder stieg Panik in ihr auf. Sie versuchte, sich zu beruhigen. Setzte sich auf die Steinmauer, dachte nach. Überlegte, noch einmal ins Bachbett hinabzusteigen, den Körper noch weiter wegzuziehen, entschied sich aber dagegen. Das eine Mal war bereits ein unüberlegter Fehler gewesen. Sie hoffte, dass der Regen der gestrigen Nacht ihre Spuren weggewaschen hatte. Der Stein kam ihr in den Sinn. Wo war der Stein? Sie hatte ihn von sich geworfen, die Böschung hinunter. Sie musste ihn suchen. Wie in Trance stand sie auf, beugte sich über die Brüstung. Da, schoss es ihr durch den Kopf, das müsste er sein. Langsam ging sie hinunter, in Richtung Bachbett. Wenig später hatte sie den Stein entdeckt. Vorsichtig hob sie ihn hoch, versuchte, das mittlerweile trockene Blut nicht zu berühren. Bevor sie wieder hinaufstieg zum Byzantinischen Weg schaute sie noch einmal zu dem Platz, an dem die tote Léna lag. Sie bekreuzigte sich ein weiteres Mal. Tränen liefen über ihre Wangen.
Jetzt lief sie den alten Wanderweg noch ein Stückchen weiter. Sie konnte die Entfernung nicht einschätzen, meinte aber, dass es fast ein Kilometer war. Abseits vom Weg vergrub sie den Stein in einer Mulde. Sie fühlte sich schlecht, so unbeschreiblich müde und ausgelaugt. Hilflos. Morgen würde sie nicht arbeiten können, sich telefonisch krankmelden. Sie dachte an ihr Handy. Mit Schrecken fiel ihr ein, dass sich Lénas Nachricht auf dem Telefon befand, ihr Hilferuf. Sie musste das Telefon vernichten, sich eine neue Nummer besorgen.
Kapitel 2: »Άι στο διάολο«
»Ai sto diávolo«, schimpfte Christína vor sich hin. »Zum Teufel noch mal.« Fluchen hatte sie von der Großmutter gelernt. »Eine Frau muss nicht nur liebenswürdig sein, sie muss auch über andere Talente verfügen. Flüche zu beherrschen ist ebenso wichtig wie kochen oder backen«, meinte die Oma. Christína und ihre beiden Schwestern hatten sich den Ausspruch schon als Teenager zu Herzen genommen.
Christína saß auf dem Fahrersitz des roten Jeeps, der im Unterstand neben dem Haus geparkt war. »Hhmpf«, machte es jedes Mal dumpf, wenn sie den Schlüssel im Zündschloss drehte. Nun fielen ihre Pläne in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Sie hatte über die Insel fahren wollen, die neue Heimat erkunden, sehen, was sich während der vergangenen Jahre verändert hatte. Der Ausflug sollte einen Besuch der Arbeitsstelle beinhalten. Die Anstellung begann schließlich an einem besonderen Tag, dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, und da wollte sie gut vorbereitet sein. Es war in Griechenland genauso, wie an vielen anderen Flecken der Erde auch. Am Tag der Arbeit hatte der größte Teil der Bevölkerung frei und deshalb lief das Land auf Sparflamme. Die Läden waren überwiegend geschlossen. Dafür war in den Cafés und Tavernen oft doppelt so viel los. Mädchen und Frauen flochten vielerorts Blumenkränze und schmückten damit die Fenster, Türen und sogar die Autos. In Athen bekam die Polizei an diesem Tag stets besonders viel zu tun. Die Griechen gingen gerne auf die Straße um an Missstände zu erinnern. So gab es am 1. Mai traditionell Demonstrationen und Kundgebungen, die an die Probleme der Arbeiterschaft erinnerten. Aber auf Páros war so etwas nicht zu erwarten. Wer sollte hier schon demonstrieren, dachte Christína.
Sie drehte den Schlüssel ein letztes Mal. »Mmpfh.« Nichts.
»So ein Mist«, fluchte sie, krempelte die Blusenärmel hoch und öffnete die Motorhaube. Auch das hatte sie der Großmutter zu verdanken. Ein Motor war kein Geheimnis für sie.
»Die Batterie!«, stieß sie heraus. »Ich hätte es mir denken können.« Ihr Telefon surrte auf dem Beifahrersitz. Níkos Bild erschien auf dem Display.
»Christína«, schallte es aus der Leitung, »wie war deine Nacht? Ich mache mir Sorgen, du allein dort oben auf dem Hügel.«
»Alles gut mein Schatz«, beruhigte sie ihn.
Níkos schien sich mit der Antwort zufriedenzugeben. Munter erklärte er, dass es ihm auch gut gehen würde.
»Die Unterkunft ist das reinste Luxushotel. Hier wird es mir an nichts fehlen.« Die Erzählung drang abgehackt an ihr Ohr. Sie hörte von der arabischen Sonne, orientalischen Düften, der für ihn neuen Kultur.
»Níkos … ich muss Schluss machen. Ich habe mir vorgenommen, in den Ort zu fahren.«
»Baby, ich vermisse dich. Ich freue mich aufs nächste Wochenende. Du und ich …« Sie hatten ausgemacht, dass er Christína auf der Insel besuchen kommen würde. Die Leitung knackte, sie legten auf.
Christína warf die Autotür zu und beschloss, sich den Tag nicht verderben zu lassen. Trotz des defekten Jeeps würde sie den Ausflug antreten, wenigstens bis zur Polizeistation.
Der Weg nach Léfkes war ein besserer Steig, der sich den Abhang zwischen Wein- und Gemüsefeldern hinunterschlängelte. Überall wucherten Disteln und Kakteen am Wegesrand. Wie gut, dass sie die Sneakers angezogen hatte. Unter ihr lag das Dorf mit seinen weißen Häusern und verwinkelten Gassen. Dominiert wurde der Ort von der Fassade der Kirche der Agía Triáda, die an der unteren Platía lag. Sogar aus der Ferne konnte sie die an den Häuserwänden hochrankenden Bougainvilleen ausmachen. Nichts ließ darauf schließen, dass während der Sommermonate im Ort das Leben tobte. Kein Supermarkt, kein Hotelkomplex trübte die Postkartenidylle.
Christína ließ den Blick in die Ferne schweifen. Felder von rotem Klatschmohn und lila blühendem Lavendel gaben der Hügellandschaft ein heiteres Erscheinungsbild. In der Ferne lag geheimnisvoll glitzernd das Meer. Sie sog den Duft des wilden Rosmarins, Oreganos und Thymians ein. Die Sonne schien, und die Ruhe, die in der Luft lag, fühlte sich gut an. Stress und Unbehagen fielen innerhalb weniger Minuten ab. Sie würde die nächsten Monate nutzen, um die Dinge zu unternehmen, die bisher während des Alltags zu kurz gekommen waren.
Das Telefon summte in ihrem Rucksack und holte sie aus den Gedanken. Níkos. Schon wieder.
»Baby«, tönte es aus dem Hörer, »was machst du? Ist alles in Ordnung? Du hast dich vorhin gestresst angehört.« Sie schloss die Augen. »Alles gut. Das Haus ist wunderschön. Es wird dir gefallen.«
»Und, läuft alles? Ich meine, Strom, Wasser? Hast du warmes Wasser? Und einen Fernseher?« Sie wusste, was er meinte. Es war nicht gewährleistet, dass in einem unbewohnten Haus, nach einem langen Winter, Strom aus der Steckdose kam. Sie hatte schon die schlimmsten Sachen gehört. Ein kleiner Kurzschluss brachte das gesamte System zum Erliegen. Ohne Elektrizität gab es kein warmes Wasser. Auch sonst waren die Bewohner dann ziemlich aufgeschmissen. Bis ein Elektriker ins Haus kam, konnte schon einmal eine Woche vergehen.
»Schatz, alles bestens … ob der Fernseher läuft, weiß ich nicht. Wer braucht denn heutzutage noch einen Fernseher? Ich habe mir zum Einschlafen eine Serie auf den Laptop geladen. Das Internet funktioniert bestens. Tína, die gute Fee des Hauses, hat mir alle Passwörter aufgeschrieben.«
Tína hatte ganze Arbeit geleistet. Neben dem selbstgepflückten Blumengruß hatte Christína einen Zettel vorgefunden, auf dem alle wichtigen Instruktionen einschließlich des WLAN-Codes vermerkt waren. Nur von einem Automechaniker war leider nichts zu lesen gewesen. Aber das musste sie Níkos nicht verraten.
»Ich bin jetzt ein paar Stunden nicht zu erreichen. Ein Lunch. Ich soll die Kollegen kennenlernen«, hörte sie Níkos’ dunkle Stimme. »Vielleicht kannst du die Kinder anrufen. Hören, ob alles in Ordnung ist.«
Der alte Kontrollfreak. Konstantína war mittlerweile 21 Jahre alt und studierte in Aachen Maschinenbau, und ihr um ein Jahr jüngerer Bruder Leftéris Jura in Passau. Sie waren erwachsen.
»Was soll denn schon sein? Es ist Montag und beide sind an der Universität. Du musst sie selbst anrufen, wenn du wissen willst, wie es ihnen geht. Bis später«, sagte sie bestimmt.
»Bis nachher. Ich lieb dich«, rief er in den Hörer, und ohne eine Antwort abzuwarten, beendete er das Gespräch.
Die Bushaltestelle lag auf der Umgehungsstraße des Ortes und war vollkommen verlassen. Christína hatte versucht, im Internet den Fahrplan der KTEL zu finden, aber die Website befand sich gerade in Überarbeitung.
»Sie haben Glück«, meinte die Verkäuferin im angrenzenden Laden, den sie aufsuchte, »der Bus kommt in etwa zwanzig Minuten. Die Strecke nach Parikiá wird momentan nur wenige Male am Tag gefahren. Es sind ja kaum Leute da.« Christína rollte den Pullover zusammen, band ihn um die Hüfte, und setzte sich auf die Stufe vor der Tür. Die Sonne schien angenehm auf ihre Nase. Sie griff nach dem Handy und überprüfte die Temperatur. Fünfundzwanzig Grad. Daran könnte sie sich gewöhnen. Im Anschluss suchte sie die Münchner Temperatur. Wolkig, zwölf Grad. Sie hatte das große Los gezogen. Was kümmerte es sie, dass Níkos in Saudi-Arabien arbeitete, wo noch nicht einmal vorgesehen war, dass er von seiner Ehefrau begleitet wurde; seine Entscheidung war ihm endgültig verziehen. Sie hatte ihr Leben endlich in die eigene Hand genommen. Während der vergangenen Jahre hatte sie sich fast fortwährend Níkos’ Lebensplan untergeordnet, nicht auf ihre innere Stimme gehört. So, wie ihre Mutter ihr das vorgelebt hatte. Und das hatte sich mit ihrem Umzug nach Páros geändert.
Die rosaroten Blütenblätter der Bougainvillea, die gekalkten Wände der kubisch gebauten Häuser, die tiefblauen Fensterläden und Türen zeigten ihr, wie einfach die Schönheit des Lebens sein konnte. All dies gehörte zu ihrem neuen Alltag. Sie machte ein Foto und postete es auf Instagram. Anschließend sah sie sich Instagramposts an, öffnete den Facebook-Account, überflog die aktuellen Geburtstage. Zwei Facebook Freunde bekamen eine knappe Nachricht, während sie für ihre Freundin Léandra einige Bilder zusammenstellte. Miss you, ließ sie in großen Lettern neben einem virtuellen Geburtstagskuchen aufpoppen.
Christína schob die Sonnenbrille in die Haare und schaute einer frühen Hummel nach. Sie zog Kreise um die Blüten eines Bougainvilleastrauches.
Was würde sie erwarten? Wie würde der Alltag bei der Polizei auf Páros aussehen? Bürodienst nach Vorschrift? Acht Stunden plus Mittagspause? Sie hatte recherchiert und herausgefunden, dass es auf Páros während der letzten Jahre nur wenige Kriminalfälle gegeben hatte. Den einen oder anderen Banküberfall hatte sie im Netz gefunden. Bei einem der Überfälle war ein Taxifahrer, der die Verbrecher stoppen wollte, ums Leben gekommen. Die Täter waren nach wenigen Stunden gefasst worden. Auf den Inseln waren die Fluchtwege naturgegeben beschränkter. Natürlich gab es gelegentlich Einbrüche oder einen gewalttätigen Übergriff. Das blieb leider fast nirgendwo aus. Die an vielen Orten zunehmende Drogenkriminalität war auf Páros hingegen niedrig. In Athen hätte Christína weitaus mehr bewirken können. In der Hauptstadt teilten sich Pakistani, Afghanen und Georgier den heiß umkämpften Drogenhandel auf. Sie sah sich auf der Insel Verwarnungen schreiben, des Nachts Touristen in Mietautos anhalten, die mit Sicherheit zu tief ins Glas geschaut hatten, oder Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis zurück in ein Lager schicken, in dem die Zustände kaum noch als menschenwürdig zu bezeichnen waren. Für die Zeit der Wiedereinarbeitung in die Polizeitätigkeit waren diese kleineren Delikte mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Es handelte sich voraussichtlich nur um wenige Monate. Danach würde sie sich in Athen den großen, den wichtigen Kriminalfällen widmen.
Die Insel besaß weitere Vorteile. Sie konnte wandern, Fahrrad fahren oder zum Schwimmen gehen. Damit würde sie den paar Kilos, die sie zu viel auf die Waage brachte, zu Leibe rücken. Die Bequemlichkeit und das häufig schwere Essen hatten ihren Tribut gefordert. Sie würde trainieren, ihren Körper wieder in Form bringen.
»Hey«, holte sie ein Aufschrei aus den Gedanken, »Sunshine, bist du das?« Eine Frau stand vor ihr, ungefähr in ihrem Alter. Sie trug das schwarz gelockte Haar zu einem lockeren Knoten gebunden und die dunklen Augen blitzten hinter einer runden Brille. Das Herrenhemd und die Jeans waren von oben bis unten mit Farbflecken überzogen. Wie lange hatte sie niemand mehr Sunshine genannt?
»Hey, erkennst du mich nicht?« Ihr Lachen war breit und noch bevor sie ihren Namen nennen konnte, sprang Christína von der Stufe vor der Busstation auf. »Geórgie … was machst du denn hier?« Seit etwa zwanzig Jahren hatte sie die Jugendfreundin nicht mehr gesehen.
»Ich dachte, du bist in London.«
Geórgie lachte. »Mein Studium ist schon lange zu Ende. Danach habe ich noch eine Ausbildung gemacht. Und nach einer Zeit in Cornwall bin ich hier hängen geblieben. Ich bin nach Páros gefahren … für einen Sommerurlaub und habe meinen Mann kennengelernt. Jetzt führe ich auf der Insel ein Atelier.« Damit weckte sie Christínas Neugier. »Bist du Künstlerin geworden?«
Geórgie lachte wieder. Nickte. »Kann man so sagen. Aber nicht …« Sie zeigte auf ihr weites Hemd. »Nein … ich bin keine Malerin, wenn du das meinst. Ich habe nur meine Teeküche gestrichen.«
Der Bus der KTEL bog um die Ecke.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich alte Freunde wiedertreffen würde.«
Geórgie lachte erneut. Sie schien immer zu lachen. Das war schon früher so gewesen.
»Du würdest staunen, wer von unseren Freunden nach Páros zurückgekommen ist. Die Insel ist wirklich nicht der schlechteste Ort zum Leben.« Der Bus hielt mit einem Quietschen, die Türen wurden geöffnet. Christína zögerte. Wie gerne würde sie mit Geórgie weitersprechen. Aber sie hatte sich vorgenommen aufs Revier zu fahren. Und wer wusste schon, wann der nächste Bus in Richtung Parikiá ging.
»Wollen Sie nun einsteigen oder nicht?«, brummte der Busfahrer ungeduldig. »Státhi, nur mit der Ruhe. Wir haben uns seit fast einem Viertel Jahrhundert nicht gesehen«, rief Geórgie dem korpulenten Mann zu. »Mach mal langsam. Du verpasst nichts.« Der Busfahrer stellte den Motor ab.
»Beeilt euch, Geórgie. Ich mache nur meine Arbeit. Ich muss den Fahrplan einhalten.« Die Freundin nickte und nach weiteren Worten der Wiedersehensfreude drückte sie Christína an sich.
»Komm mich am Abend im Atelier besuchen. Bitte.« Sie lachte glucksend. »Hier, die Straße hinunter.« Sie deutete hinter sich. »Kurz nach neun Uhr. Dann ist mein Kurs zu Ende. Wir könnten ein Glas Wein an der Platía trinken. Ich habe eine Überraschung für dich. Du wirst dich freuen«, rief Geórgie ihr nach, während Christína in den Bus stieg.
Von der Bushaltestelle an der Hauptstraße in Parikiá ging Christína direkt zum Platz des 28. Oktober, an dem die zentrale Polizeistation lag. Der Platz hatte sich während der letzten Jahre kaum verändert. Zwischen Bankfilialen, der griechischen Telefongesellschaft und Büros gab es Imbissbuden, Spielwarengeschäfte und einen Souvenirladen. Sie betrat das Polizeirevier durch den Vordereingang und stieg die Treppe hinauf, in die erste Etage des zweistöckigen Gebäudes.
Kapitel 3: »Καλημέρα«
»Kaliméra«, grüßte Christína laut vernehmlich, als sie die Tür der Polizeistation im ersten Stock öffnete. Der Empfangstresen vor der Tür war jetzt, zur Mittagszeit, nicht besetzt. »Ich bin Christína Strátou. Die neue Kollegin. Guten Tag«. Nur ein Police Officer saß an seinem Arbeitsplatz. Vor ihm stand eine Gruppe Hilfesuchender. Für einen Moment wandten sich die Köpfe der Besucher ihr zu, dann verloren sie das Interesse und redeten wild gestikulierend auf den Officer ein. Der hob die Hand in Richtung Christína und machte ihr ein Zeichen, dass sie sich gedulden solle.
Trotz der offensichtlichen Einfachheit der Einrichtung, den Schrammen und Kratzern an den Wänden und der Tür, war das Großraumbüro hell und freundlich. Vier breite, lang gezogene Fenster zeigten auf die Platía hinaus und erweckten den Anschein, dass die Polizeistation Teil des alltäglichen Geschehens vor der Tür war. Jalousien und Vorhänge waren offen, wodurch der geräumige Raum in gleißendes Sonnenlicht getaucht war. Sie trat ans Fenster und ließ den Blick über den Raum schweifen. In regelmäßigem Abstand waren Schreibtische angeordnet. Davor standen gepolsterte Drehstühle, die Christína an den Schreibtischstuhl ihrer Schulzeit erinnerten. Die Bezüge, die sich alle in Farbe und Design unterschieden, zeigten ihr, dass die Möbel wirklich aus dieser Zeit stammen könnten. Die Arbeitsplätze waren mit Bildschirmen ausgestattet, die augenscheinlich neuesten Datums waren. Wie Trophäen wirkten sie zwischen den Aktenstapeln und Dokumenten, die sich auf den Tischen türmten. Auf fast allen Arbeitsplätzen waren verwaiste Kaffeetassen und Wasserflaschen zu sehen. Nur ein Schreibtisch war aufgeräumt und mit persönlichen Dingen ausgestattet. Neben einem Bilderrahmen war eine Maus mit Kappe im Design des Union Jacks positioniert. Sicherlich ein Souvenir von einer Londonreise. An der Stirnwand des Großraumbüros stand ein durchgesessenes Sofa.
Die Stimmen der Hilfesuchenden wurden leiser. Die Parteien schienen sich beruhigt zu haben. Christína vernahm wiederholt »Danke für die Hilfe«. Der Officer, ein schmächtiger Mann in dunkler Hose und blauem Hemd, knapp einen Meter fünfundsechzig groß, stand auf und kam ihr entgegen.
»Guten Tag, Christína. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ein Verkehrsunfall in Kamáres.« Er zuckte mit den Schultern. »Wie das so ist, keiner will schuld sein … die Streife hat alles aufgenommen. Aber es gab Unstimmigkeiten.« Der Polizist verzog den Mund zu einem Lächeln. »Ich bin Stélios. Wir haben dich erst am Mittwoch erwartet.«
Christína nickte. »Ich weiß. Ich wollte schon mal Hallo sagen und die Eckdaten abklären. Damit es am Ersten Mai direkt losgehen kann.«
Stélios runzelte die Stirn. »Das wäre nicht nötig gewesen. Bei uns drehen sich die Uhren nicht so schnell. Wir hätten die Einführung auch am Mittwoch machen können.« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf das verwaiste Büro. »Die Kollegen sind zu Mittag. Sie essen heute nicht in der Kantine.« Er schien kurz nachzudenken, sah dann auf die Armbanduhr. »Komm mit. Zum Chef.« In seiner Stimme schwang Hochachtung mit.
Sie verließen das Großraumbüro und gingen einen engen Gang entlang. An den Wänden würde frische Farbe Wunder bewirken, dachte Christína. Stélios klopfte an die letzte Tür im Flur.
»Herein«, erklang eine sonore Stimme. Ihr ehemaliger Chef hatte Christína am Telefon ein paar Eckdaten zu Marcéllo Maroúli gegeben. Der Chief Officer verfügte in Kollegenkreisen über eine hervorragende Reputation. Der halbe Brasilianer galt allgemein als integer und bedacht. Während seiner mehr als dreißigjährigen Laufbahn bei der griechischen Polizei hatte er eine steile Karriere gemacht, war niemals in Korruptionsaffären oder einen anderen Skandal verwickelt gewesen. Manch einer hatte ihn bereits im Ministerium gesehen. »Dort wäre er auf dem richtigen Posten. Maroúli ist überaus charismatisch«, hatte Bábis Pantaléos gesagt. »Aber dem sollte nicht sein.« Vor etwa zehn Jahren war seine Frau Chrisúla an Multipler Sklerose erkrankt und Maroúli hatte beschlossen, seinen Lebensplan zu ändern. Er sagte Athen Adieu, der Metropole mit dem schnellen Leben und den unzähligen Kriminalfällen, die Überstunden zur Regel werden ließen, und kehrte nach Páros zurück. Seine Familie väterlicherseits stammte von der Insel. Zum Glück war gerade der Platz des Chief Officer frei geworden.
Der Polizist hinter dem Schreibtisch hatte die fünfzig überschritten. Seine Locken waren ebenso dunkel wie die Augen. Er sah sie aufmerksam durch eine Brille mit feinem Goldrand an und verzog dann sein rundes Gesicht zu einem freundlichen Lächeln, das eine Reihe makellos weißer Zähne zum Vorschein brachte. Der Chief Inspector stand auf und kam mit federndem Schritt um den Schreibtisch herum. Maroúli war groß und schmal gebaut, mit langen Gliedmaßen. Wenn Christína sich den kleinen Bauchansatz wegdachte, passte der Spitzname »Panther«, wie der Chief hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, hervorragend. Auch das hatte Pantaléos berichtet.
Stélios übernahm die Vorstellung. »Christína Strátou. Unser Neuzugang.« Er machte eine Pause, dann fuhr er beflissen fort: »Chief Inspector Marcéllo Maroúli.«
Maroúlis Lächeln wurde breiter. »Willkommen in unserem Team«, sagte er verbindlich, während er der neuen Polizistin die Hand entgegenstreckte. Christína ergriff freundlich dessen Rechte. Stélios ging in Richtung Tür. »Ich habe zu tun. Der Unfall in Kamáres. Das ist eine Menge Papierkram.«
»In Ordnung. Mimí hat heute frei … bitte bestell uns Kaffee.« Der Chef wandte sich an Christína. »Kaffee? Skéto?«, fragte er.
»Nicht schwarz. Bitte süß«, antwortete sie. Maroúli nickte anerkennend. »Gut, ich schließe mich an«, sagte er, »und etwas Baklavás.« Er lächelte verschmitzt, was sein Gesicht jungenhaft wirken ließ. »Mein brasilianisches Erbe. Ich kann Süßem nicht widerstehen«, erklärte er Christína.
Nachdem Stélios den Raum verlassen hatte, führte Maroúli Christína zum Besprechungstisch in der Ecke des Zimmers. An der Wand stand ein Zweisitzersofa, das mit grauem Stoff bezogen war. Mit den Sesseln auf der gegenüberliegenden Seite des niedrigen Glastisches bildete es ein Ensemble. Im Gegensatz zum Büro nebenan war hier Wert auf die Inneneinrichtung gelegt worden, stellte sie fest. Gerahmte Fotografien, auf denen Größen des öffentlichen Lebens abgebildet waren, zierten die Wände. Christína erkannte Konstantínos Karamanlís, Andréas Papandréou und Aléxis Tsípras. Auch Míkis Theodorákis, der große griechische Komponist, war auf einem der Bilder verewigt. Wild standen dessen Haare zu Berge, was typisch für den Künstler war. Daneben ein Foto von Maria Callas mit Aristotéles Onássis. An der Frontseite des Zimmers hing ein großes Holzkreuz, unter dem auf einem eigens dafür montierten Wandbrett eine Kerze brannte.
Maroúli nahm gegenüber von Christína Platz und erkundigte sich interessiert nach ihrer Zeit bei der Mordkommission in Athen. Aufmerksam hörte er zu, wie sie ihm einige Fälle schilderte. Gemeinsam mit dem Team hatte sie die Täter überführen können. Nur in einem Fall war es nicht gelungen. In manchen Nächten dachte sie noch immer an den toten Kranführer im Hafen von Elefsína. An dessen Frau, die am Verlust fast zerbrochen war, an den unvorstellbaren Schmerz. Wie die Ermittlungen ab einem Punkt auf der Stelle getreten waren, die Spurensicherung nicht Hand in Hand mit dem Team arbeiten konnte. Auch ungeklärte Fälle gehörten leider zum Beruf. Doch die fortschreitende Technik machte die Aufklärung zunehmend einfacher. Während der Zeit in Deutschland hatte sie in der Fachpresse die Entwicklungen verfolgt. Das würde die auf sie zukommenden Fortbildungen einfacher gestalten.
»Ich bin Bábis Pantaléos sehr dankbar, dass er Sie an uns vermittelt hat«. Aufmerksam sah er Christína an, sprach fast flüsternd weiter. »Es gibt Anzeichen, dass sich ein Maulwurf in unserem Team befindet. Bei vergangenen Fällen sind Einzelheiten durchgesickert, fast hätte man meinen können, die Presse wäre gezielt informiert worden. Ich habe mit Bábis Pantaléos darüber gesprochen, dass ich Sie im Hinblick auf diese Vermutung sensibilisiere.« Er hielt inne, lauschte. Kein Geräusch war zu hören. »Ich bitte Sie, die Augen offen zu halten. Vor allem, da ich in den nächsten Tagen nach Athen muss. Ein Drogenring hält die Polizei des gesamten Landes in Atem«. Noch bevor Maroúli weiter ins Detail gehen konnte, ließen ihn Schritte aus dem Großraumbüro aufhorchen. Er verstummte. Ein Kollege war offensichtlich aus der Mittagspause zurückgekehrt. Kurz darauf brachte der Lieferservice die Bestellung. Obwohl das Büro des Chefs am Ende des Flurs lag, war jedes Wort zu verstehen. Maroúli schien Christínas Gedanken zu lesen. »Wichtige Themen müssen leise besprochen werden.« Er zuckte mit den Schultern, lächelte jetzt. Ein Signal, dass er keine weiteren Informationen zu seinem Team geben wollte. »Die dünnen Mauern haben auch Vorteile. So bin ich stets im Bilde. Kaum etwas geht an mir vorbei.«
Wenig später öffnete sich die Tür. Ein Polizist mittleren Alters stand mit einem Tablett vor ihnen. Christína musterte den Kollegen interessiert. Er war groß und schlank. Das schmale Gesicht wurde von dunklen Augen dominiert, die unter buschigen Brauen lagen. Die vollen Locken ließen den Kopf ein wenig kleiner wirken. Als er Christínas Blick bemerkte, lächelte er. Der Chief stellte den Mitarbeiter als äußerst wichtige Kraft vor. »Fánis ist länger bei der Polizei von Páros als ich. Er hat nach Beendigung der Polizeischule bei der Mordkommission in Thessaloníki gearbeitet. Nur für zwei Jahre. Dann hat er hier angefangen und ist bis heute geblieben.« Maroúli bat Fánis Tétsos sich für einen Moment zu ihnen zu setzen. Officer Tétsos stellte Kaffee und Baklavás auf dem Tisch ab und nahm auf dem Stuhl neben dem Chief Platz. Obwohl er die beiden obersten Hemdknöpfe geöffnet und die Ärmel hochgekrempelt hatte, strahlte die gesamte Haltung Disziplin aus. Er saß aufrecht, Rücken gerade, die Schulterblätter zurückgezogen. Während Christína einen Schluck des griechischen Kaffees nahm, beschrieb Maroúli ihren Werdegang. »Christína Strátou war bei der Polizei in Athen. Erst beim Kriminaldauerdienst, dann kurzzeitig im Drogendezernat und die letzten Jahre bei der Mordkommission. Danach zehn Jahre Auszeit.« Fánis Tétsos kniff die Augen leicht zusammen und sah sie für einen Moment direkt an, dann verzog er den Mund zu einem Lächeln. »Ein beeindruckender Weg«, meinte er liebenswürdig.
Maroúli wandte sich an Christína. »Am Ersten Mai arbeiten wir vollzählig. Man kann nie wissen, was an so einem Tag passiert. In Griechenland wird der Feiertag neben den Festlichkeiten immer ein trauriges Datum bleiben.« Der Tag läutete nicht nur das Frühlingserwachen ein, sondern war auch der Gedenktag an den blutig niedergeschlagenen Arbeiteraufstand in Thessaloníki und an die Hinrichtung von zweihundert Patrioten im Jahr 1944 in Kaisarianí durch die Hände der Nazis. »An einem Tag wie diesem kann viel geschehen. Auch auf Páros.«
Obwohl Christína nicht glaubte, dass die Inselbewohner mit Spruchbändern bewaffnet, randalierend durch die Straßen ziehen, Papierkörbe anzünden oder gar Molotowcocktails werfen würden, nickte sie. »Ich werde vollen Einsatz bringen.« Chief Inspector Maroúli stand auf. »Ich habe nichts anderes erwartet. Ihr Kollege wird Ihnen die genauen Anweisungen geben.« Christína und Fánis erhoben sich und nach der Verabschiedung ging Fánis ihr voraus, den Gang entlang. Noch bevor sie das Großraumbüro betraten, wandte er sich zu ihr um.
»Unter Kollegen duzen wir uns, ich gehe davon aus, dass du nichts dagegen hast.« Er wartete Christínas Antwort nicht ab. »Ich mache eine kurze Führung durchs Haus. Und dann gebe ich dir schon mal eine Uniform. Die musst du während deiner Einarbeitungszeit tragen.« Sein Ton war längst nicht mehr so freundlich. Christína betrachtete Fánis von der Seite. Er hatte das Kinn vorgeschoben, was sein Gesicht hart wirken ließ. Auf einmal fühlte sie sich unerwünscht. Dabei stand ihr der Sinn nicht nach einem Positionskampf. Sie wollte sich die nächsten Monate nicht durch irgendeinen Kleinkrieg verderben lassen.
»Fánis«, ihre Stimme klang warm, »ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich bin von ganzem Herzen Polizistin und werde mein Bestes geben. Egal ob ich Uniform tragen soll oder nicht.«
Fánis Gesicht glich schlagartig einer Maske.
»Ich hoffe, dass ich gut aufgenommen werde«, fügte sie hinzu.
Mittlerweile hatten sie das Büro durchquert und waren im Treppenhaus angelangt. Sie blieb auf dem Treppenabsatz stehen und sah ihn freundlich an. Fánis hielt ebenfalls inne. Jetzt zog er die Mundwinkel nach oben, die Augen wirkten jedoch weiterhin kalt. Christína streckte ihm die Hand entgegen. »Freunde?« Er nickte und ergriff ihre Rechte für einen Moment. Bei der Berührung konnte sie die Ablehnung förmlich spüren.
Schweigsam gingen sie nebeneinander die Treppe hinunter. Christína hätte zu gerne Fánis Gedanken gelesen. Lag es an ihr? Oder war er bei allen neuen Kollegen voreingenommen? Auf jeden Fall hatte er sich vor Maroúli gut im Griff gehabt. Als sie am Fuß der Treppe ankamen, deutete Fánis in den hinteren Bereich des Erdgeschosses.
»Dort ist die Bereitschaftspolizei.« Von ihrem Standpunkt aus konnte Christína ein halbes Dutzend Schreibtische erkennen. Dann folgte sie dem Kollegen ins Kellergeschoss. Fánis öffnete eine Tür nach der anderen und gab Erklärungen zu den einzelnen Räumen. Auch die Verwahrzellen zeigte er ihr.
»Den Dienstausweis und die Zugangsberechtigung zum PC bekommst du am Mittwoch mit der Zuteilung des Arbeitsplatzes. Ebenso die innerdienstlichen Anweisungen und natürlich den Schlüssel.« Er zog die rechte Augenbraue nach oben. »Ein Waffenfach brauchst du noch nicht. Erst wenn du eine Dienstwaffe bekommst.«
Christína würde nach Athen oder Ermoúpolis auf Sýros fahren müssen, um ihre Fähigkeit an der Waffe auf dem Schießstand unter Beweis zu stellen. Nach einer Berufspause war das die Vorschrift. Dann erst würde sie die Waffenberechtigung wiedererlangen. Die Termine waren alle vergeben gewesen und sie musste einige Tage warten. Das war kein Problem für sie, schließlich rechnete sie auf Páros nicht damit, sich mit der Waffe verteidigen zu müssen.
Sie gingen zurück ins Erdgeschoss. Der Kollege blieb vor der Eingangstür stehen. Er musterte sie von oben bis unten.
»Warte hier.« Er verschwand in einem Raum neben dem Eingang. Ihre Freundlichkeit schien sich nicht ausgezahlt zu haben. Sie seufzte. Fánis war nicht der einzige Polizist auf Páros. Sie würde sicher nette Kollegen finden, mit denen sie gut zusammenarbeiten könnte. Wenig später kam Fánis zurück. In der Hand trug er ein in Packpapier eingeschlagenes Paket.
»Deine Uniform … medium. Sie wird dir bestimmt passen.«
Gemeinsam traten sie auf den Hof hinaus.
»Hast du ein Auto?«, fragte Fánis interessiert.
»Eigentlich ja. Im Moment funktioniert es allerdings nicht. Ich bin mit dem Bus von Léfkes hergekommen.«
Fánis sah sie an, nickte. »Okay. Ich kann dir vorübergehend ein Polizeimofa anbieten. Bis du dich organisiert hast.«
Christína freute sich über das Angebot. Damit wäre sie nicht mehr von dem eingeschränkten Winterfahrplan abhängig. Fánis ging noch einmal zurück ins Revier, kam wenig später mit einem Zündschlüssel wieder. Er brachte sie zu einem Mofa, dem Christína ansah, dass es in die Jahre gekommen war. Es würde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als zwanzig Stundenkilometer fahren. Vielleicht war der Bus doch die bessere Lösung, bis der Jeep repariert wäre.
»Hier. Dein fahrbarer Untersatz.« Er lächelte, aber seine Augen blieben weiterhin kalt. »Vergiss nicht, einen Helm zu tragen. Sonst kann dich das ein Bußgeld kosten.«
Christína nahm das Mofa ohne weiteren Kommentar entgegen. Sie warf das Paket und den Rucksack in den Einkaufskorb auf dem Gepäckträger, setzte den Helm auf und stieg auf das Gefährt. Fánis stand neben ihr.
»Und fahr am besten ganz langsam. Frauen können ja bekanntlich nicht so gut mit PS umgehen.« Für einen Moment stockte Christína der Atem. Sie dachte, sich verhört zu haben. Das süffisante Lachen verschaffte endgültige Klarheit. Der neue Kollege besaß eine spezielle Meinung über Frauen und deren Fähigkeiten. Und nicht nur das, er wollte sie das spüren lassen. Sie in die Schranken weisen, ganz nach seinem Geschmack.
Ohne auf seine unqualifizierte Bemerkung einzugehen, startete sie den Motor, der zuckelnd vor sich hin brummte. Solche Spielchen würde sie nicht mitmachen. Das würde Fánis bald zu spüren bekommen.
Kapitel 4: »Η ζωή είναι ωραία«
»I soí íne oráea«, sagte Christína zu sich, als sie das Telefongespräch mit Níkos beendete. »Das Leben ist schön.« Sie hatten über Facetime telefoniert und er war zum Greifen nah gewesen. Es fühlte sich gut an. Sie sprachen vom kommenden Wochenende, schmiedeten fröhlich Pläne.
Sie sah auf die Uhr. Es war mittlerweile halb neun Uhr. Schnell zog sie sich einen warmen Pullover über die Bluse, griff an der Garderobe nach der Lederjacke und nahm den Rucksack. Vor der Haustür war sie versucht, noch einmal den Jeep auszuprobieren, aber sie wusste, dass es sinnlos war. So ließ sie den Motor des Mofas an. Langsam fuhr sie vom Grundstück, die Anhöhe hinauf. Vorsichtig wich sie in der Dunkelheit den Löchern aus, die die Winterregen in unregelmäßigen Abständen in den Weg gewaschen hatten. Die Federn des Gefährtes ächzten jedes Mal, wenn sie einen Stein übersah, und das Licht tanzte fröhlich. Kein Laut vom Esel, er schien um diese Uhrzeit zu schlafen. Sie dachte an Níkos’ Lächeln. Die Sicherheit, die er ihr vermittelte. Ein warmes Gefühl legte sich um die Brust. In der Vergangenheit hatten sie schwere Zeiten gemeistert. Durch die leidige Wirtschaftskrise waren sie um die Zukunftschancen in ihrer Heimat beraubt worden. Trotzdem hatten sie sich nicht unterkriegen lassen. Gemeinsam waren sie nach Deutschland übergesiedelt. Für Níkos war es einfacher gewesen, durch sein Studium in der Schweiz hatte er die Sprache beherrscht. Sie hingegen hatte viel Einsatz bringen müssen. Auf eine griechische Kommissarin hatte niemand gewartet. Zudem hatte sie der Familie ein Heim schaffen müssen, die Kinder auf dem Weg in die neue Heimat begleiten. Dann erst hatte sie an sich gedacht. Nach mehreren Sprachkursen an der Volkshochschule, der Mitgliedschaft in einem Literaturkreis und in einer alpinen Wandergruppe träumte sie bald auf Deutsch. Sie entschied sich für den Job bei der Sicherheitsfirma, für den sie überqualifiziert war. Trotzdem hatten sie sich gut eingelebt und ihre Beziehung an Tiefe gewonnen. Sie würden auch die kommenden zwei Jahre gut bewältigen.
Wenig später bog Christína nach Léfkes ab. Am Ortseingang stellte sie das Mofa ab, zog den Helm aus und lief in Richtung Platía, bis die Gasse enger wurde. Sie ging nach rechts, dann die Anhöhe hinauf, folgte der Beschilderung zu Geórgies Atelier. Schon von Weitem hörte sie Kinderstimmen. Lautes Gekicher. Und immer wieder Geórgies Stimme. »Ruhe, Kinder! Leise! Bitte! Bitte!« Die Kinder nahmen die Ermahnungen nicht ernst. Gelächter und Lärm schwollen weiter an, bevor fröhlich Abschiedsrufe ertönten. Die Tür wurde aufgedrückt und ein Dutzend Mädchen und Jungen rannten hinaus in die abendliche Kühle. Das Lachen hallte ihnen nach wie ein summender Bienenschwarm. Christína stieg die Stufen zum Schmuckatelier hinauf und trat in den hellen Raum. Geórgie begrüßte sie mit einer innigen Umarmung. Was für ein Glücksfall, die Freundin nach all den Jahren wiedergetroffen zu haben. Es fühlte sich gut an, jemanden zu haben, mit dem sie die Unbeschwertheit der Jugenderinnerungen verband.
»Du bist Juwelierin geworden«, stellte Christína freudig fest. »Ja. Goldschmiedemeisterin. Ich habe eine eigene Kollektion.« Geórgie zog die Nase kraus und lachte. »Während der ruhigen Monate biete ich Kurse für Kinder und Erwachsene an. Wir schmieden allerlei schöne Dinge. Heute waren es Silberringe. Manchmal machen wir auch Emaillearbeiten oder brennen Fayencen.« Mit schnellen Bewegungen stellte sie in der angrenzenden Werkstatt Ordnung her. Im Gegensatz zu dem elegant wirkenden Ladengeschäft mit den hohen Fenstern, dem Purismus der Einrichtung, den Vitrinen, in denen zahlreiche Schmuckstücke funkelten, mutete die Werkstatt wie eine Höhle an. Obwohl der Raum riesig war, ging nur ein Fenster zum Hof hinaus. Es war mit einem grünen Stoffvorhang abgedichtet, der kein Licht durchließ. An den Wänden hingen Postkarten, Zeichnungen und diverse Fotografien. Ein Sammelsurium von Erinnerungen. Christína hätte nicht sagen können, ob die Wände vor vielen Jahren einmal weiß gewesen waren oder schon immer den verwaschenen Grauton hatten. Mitten im Raum standen Arbeitstische, unbehandelte Holzbretter, deren Füße aus Holzböcken bestanden. Davor Stühle, kunterbunt gemischt. Kein einziger glich dem anderen. Auf dem Schreibtisch in der Ecke türmte sich Papierkram. Daneben ein Sofa, auf dem eine Vielzahl gehäkelter Kissen drapiert war.
»Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten«, schwärmte Geórgie, während sie die Stühle stapelte. »Es ist toll, zu sehen, wie unkompliziert sie an die Materialien herangehen. Was für ein Geschick sie an den Tag legen.« Geórgie beschrieb, wie einsam sich das Leben auf der Insel während der Winter- und Frühjahrszeit gestaltete. Genauso hatte Christína es sich vorgestellt. Kaum Unterhaltung und die wenigsten Restaurants waren in der kalten Jahreszeit geöffnet, und wenn, dann meist nur an den Wochenenden. Jede Form der Geselligkeit wurde aufgenommen, wie ein trockener Schwamm Flüssigkeit aufsog. Somit waren Geórgies Kurse immer komplett ausgebucht. Auch die für die Erwachsenen.
»Was keinerlei Rückschlüsse auf die Qualität des Unterrichts zulässt«, scherzte sie. »Nicht, dass du das falsch verstehst, Sunshine.« Geórgie nahm ihre Tasche, löschte das Licht und schloss die Tür ab. »Peter, mein Mann, ist heute Abend in Athen.« Sie hakte sich bei der Freundin unter. »So können wir zwei in Ruhe ein Glas Wein trinken gehen.«
Einträchtig liefen sie zur unteren Platía. Nur in wenigen Häusern brannte Licht.
»Zu der Zeit, als ich zurück nach Páros gekommen bin, war der Ort im Winter wirklich wie ausgestorben.« Sie grüßte eine Gruppe entgegenkommender Passanten mit Namen. Sie schien alle Bewohner des Inselstädtchens zu kennen. Und für jeden einzelnen hatte sie persönliche Worte übrig. »Seit ein paar Jahren ist alles anders geworden. Menschen, die ihre Jobs in Athen verloren haben, sind zum Teil wieder in die Heimatdörfer gezogen. Vor allem diejenigen, die zu alt waren, um ins Ausland zu gehen. Hier ist der Alltag einfacher. Die Erde ist fruchtbar und man braucht nicht viel zum täglichen Leben«, fuhr Geórgie mit der Erklärung fort. Zwischen den gepflegten Stadthäusern waren vereinzelt Ruinen zu sehen, auf denen in dicken Lettern »Poleitaí« zu lesen stand, »Zu verkaufen«. Die Veräußerung von Grundstücken und Häusern machte auch vor Orten wie diesem nicht Halt.
»Ich lebe meinen Traum. Und das habe ich jetzt davon«, lachte sie. Schon damals, als sie als Teenager durch den Ort gestromert waren, hatte Geórgie Schmuckdesignerin werden wollen. Christína dachte an die Zeit zurück. Auch sie hatte als junges Mädchen von einem kreativen Weg geträumt. Ihre Leidenschaft hatte der Fotografie gegolten. Die Eltern hatten ihr eine teure Spiegelreflexkamera geschenkt und über die Jahre hinweg eine Dunkelkammer im Keller des Hauses in Thessaloníki eingerichtet. Unzählige Stunden hatte sie dort verbracht. Dann, mit dem Schulabschluss, hatte sich ihr Lebensplan geändert, und sie sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden. Die Fotografie war nur mehr ein Hobby geblieben. Bereut hatte sie die Entscheidung nie. Die Arbeit bei der Polizei war abwechslungsreich und forderte ihren ganzen Einsatz. An manchen Wochenenden hatte sie dennoch Zeit gefunden, ihrem Interesse nachzugehen. Später, in München, während der Tätigkeit bei der Sicherheitsfirma, hatte sie die Kamera wieder häufiger in der Hand gehabt. Das bayerische Alpenvorland mit den Seen und dem Brauchtum gab schöne Motive ab. Als die Kinder aus dem Haus waren, hatte Christína einen Kurs für Digitalfotografie belegt. Damit eröffneten sich ihr weitere Möglichkeiten. Ihr ausgeprägtes Gespür für die Einzigartigkeit des jeweiligen Objekts konnte sie nun durch schier unendliche Effekte gestalten.
Geórgie ging voran durch einen Vorgarten, in dem unter einem Bougainvilleastrauch ein runder Tisch mit zwei Stühlen stand. Auf dem Tisch flackerte einladend ein Windlicht.
»Hier sind wir schon.« Sie machte vor einer Holztür Halt, über der ein Schild mit der Aufschrift Place au Soleil prangte. Leise französische Musik drang ihnen aus dem Inneren entgegen.