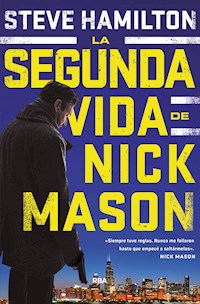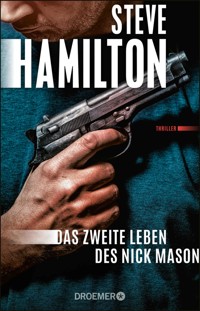4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als sein Vater Amok läuft, versteckt sich der achtjährige Michael in einem Safe, der fast zum tödlichen Gefängnis wird. Nur durch ein Wunder kommt Michael mit dem Leben davon, seither ist er verstummt. Doch ein Talent bleibt ihm: Er ist ein Genie beim Knacken von Safes. Doch schon bald werden die falschen Leute auf seine Begabung aufmerksam …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Steve Hamilton
Der Mann aus dem Safe
Roman
Aus dem Englischen von Karin Diemerling
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für die Allens
Kapitel eins
Sie erinnern sich vielleicht an mich. Überlegen Sie – Sommer 1990. Ich weiß, das ist schon eine Weile her, aber die Presseagenturen haben die Story damals verbreitet, und ich war in jeder Zeitung des Landes. Selbst wenn Sie nichts darüber gelesen haben, haben Sie wahrscheinlich von mir gehört. Von einem Nachbarn, Arbeitskollegen oder, falls Sie jünger sind, in der Schule. Man nannte mich den »Wunderjungen«. Es gab auch noch ein paar andere Bezeichnungen, erfunden von Redakteuren und Nachrichtensprechern, die sich gegenseitig übertreffen wollten. In einem der alten Zeitungsausschnitte habe ich »Wunderknabe« gelesen. »Teufelskerl« lautete eine weitere, obwohl ich damals erst acht Jahre alt war. Doch es war der Wunderjunge, der an mir hängenblieb.
Ich machte zwei oder drei Tage lang Schlagzeilen, und auch als die Kameras und Reporter sich auf etwas anderes stürzten, wirkte meine Geschichte noch nach wie nur wenige. Ich tat den Leuten leid. Wie könnte es anders sein? Wenn Sie kleine Kinder hatten zu der Zeit, passten Sie noch ein bisschen besser auf sie auf. Wenn Sie selbst noch ein Kind waren, schliefen Sie eine Woche lang schlecht.
Letztendlich konnten Sie nichts anderes tun, als mir alles Gute zu wünschen. Sie hofften, dass ich irgendwo untergekommen war und nun ein besseres Leben hatte. Sie hofften, dass mein zartes Alter mich irgendwie geschützt hatte, dass es deshalb nicht ganz so entsetzlich für mich gewesen war. Dass ich darüber hinwegkommen würde, es vielleicht sogar hinter mir lassen konnte, weil Kinder doch so anpassungsfähig und flexibel und belastbar sind. Diesen ganzen Horror. Das hofften Sie zumindest, falls Sie sich die Zeit nahmen, über mich als Menschen aus Fleisch und Blut nachzudenken, statt in mir nur das junge Gesicht in den Nachrichten zu sehen.
Die Leute schickten mir Karten und Briefe damals. Manche mit Kinderzeichnungen dabei. Wünschten mir Glück. Eine bessere Zukunft. Manche wollten mich sogar in meinem neuen Zuhause besuchen. Offenbar waren sie mit der Vorstellung nach Milford, Michigan, gefahren, sie könnten einfach jemanden auf der Straße anhalten und nach mir fragen. Aber warum eigentlich? Sie dachten wohl, ich müsse über irgendwelche besonderen Kräfte verfügen, um diesen Tag im Juni überlebt zu haben. Was das für Kräfte sein sollten oder was diese Menschen sich von mir erhofften, ist mir völlig schleierhaft.
Was ist in den Jahren seitdem passiert? Ich bin herangewachsen. Ich glaube nun an Liebe auf den ersten Blick. Ich habe dies und das ausprobiert, und wenn ich irgendwo etwas taugte, dann war es entweder etwas vollkommen Nutzloses oder etwas total Ungesetzliches. Das sagt schon mal einiges darüber, weshalb ich diesen schicken orangenen Overall trage und ihn während der vergangenen neun Jahre tagein, tagaus getragen habe.
Ich denke nicht, dass es mich besser macht, hier drin zu sein. Oder überhaupt jemanden. Es ist allerdings schon irgendwie ironisch, dass das Schlimmste, was ich je getan habe, zumindest auf dem Papier, das Einzige ist, was ich nicht bereue. Kein bisschen.
Inzwischen habe ich mir gedacht, was soll’s, da ich nun mal hier sitze, nutze ich die Zeit und blicke auf alles zurück. Ich schreibe es auf. Was im Übrigen, falls ich es wirklich tue, für mich die einzige Möglichkeit ist, die Geschichte zu erzählen. Ich habe keine andere Wahl, denn wie Sie vielleicht wissen, habe ich bei alle dem, was ich in den vergangenen Jahren so gemacht habe, eines nicht gemacht. Ich habe kein einziges Wort gesprochen.
Das ist natürlich eine Geschichte für sich. Diese Sache, die mich zum Verstummen gebracht hat, so viele Jahre lang. Eingeschlossen in mich selbst, seit jenem Tag. Ich kann sie nicht loslassen. Deshalb kann ich nicht sprechen. Ich bringe keinen Ton hervor.
Hier jedoch, auf dem Papier … da kann ich so tun, als würden wir zusammen irgendwo an einer Bar sitzen, nur Sie und ich, und uns ausführlich unterhalten. Hey, das gefällt mir. Wir beide an der Bar, wie wir einfach nur reden. Beziehungsweise ich rede, und Sie hören zu – was für ein Rollentausch das wäre. Ich meine, Sie würden mir wirklich zuhören. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die meisten Menschen nicht zuhören können. Glauben Sie mir. Meistens warten sie bloß darauf, dass der andere endlich die Klappe hält, damit sie wieder dran sind. Aber Sie … na klar, Sie sind ein ebenso guter Zuhörer wie ich. Sie sitzen da und hängen sozusagen an meinen Lippen. Wenn ich zu den schlimmen Stellen komme, halten Sie durch und lassen mich alles loswerden. Sie verurteilen mich nicht sofort. Damit will ich nicht sagen, dass Sie mir alles verzeihen werden. Ich verzeihe mir ja selbst nicht alles, darauf können Sie Gift nehmen. Aber Sie werden wenigstens bereit sein, mich ausreden zu lassen und zu versuchen, mich am Ende zu verstehen. Mehr kann ich nicht verlangen, stimmt’s?
Das Problem ist nur, wo fange ich an? Steige ich direkt in die Tränendrüsenstory ein, macht das den Eindruck, als wollte ich mich von vornherein für all das rechtfertigen, was ich getan habe. Fange ich mit dem Hardcore-Zeug an, halten Sie mich für einen geborenen Verbrecher und schreiben mich ab, bevor ich Gelegenheit hatte, meinen Standpunkt zu vertreten.
Also werde ich vielleicht ein bisschen hin- und herspringen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Erzählen, wie die ersten richtigen Jobs, an denen ich beteiligt war, abliefen. Wie es war, als der Wunderjunge aufzuwachsen. Wie alles in diesem einen Sommer zusammenkam. Wie ich Amelia kennenlernte. Wie ich mein unverzeihliches Talent entdeckte. Wie ich auf die schiefe Bahn geriet. Vielleicht sehen Sie sich das an und kommen zu dem Schluss, dass ich keine echte Alternative hatte. Vielleicht kommen Sie zu dem Schluss, dass Sie genauso gehandelt hätten.
Was ich auf keinen Fall tun kann, ist, mit jenem Tag im Juni 1990 zu beginnen. Darauf kann ich mich noch nicht einlassen. Egal, wie sehr andere Leute versucht haben, mich dazu zu überreden, und glauben Sie mir, es waren eine Menge Leute, und sie haben es verdammt angestrengt versucht … Ich kann nicht damit beginnen, weil ich hier drin schon genug Klaustrophobie bekomme. An manchen Tagen habe ich Mühe, überhaupt regelmäßig zu atmen. Aber möglicherweise gehe ich es irgendwann beim Schreiben an und sage mir, okay, heute ist es so weit. Heute kannst du dem ins Gesicht sehen. Kein Anlauf nötig. Erinnere dich einfach an diesen Tag und lass es raus. Du bist acht Jahre alt. Du hörst das Geräusch an der Tür. Und …
Scheiße, das ist noch schwerer, als ich dachte.
Ich musste eine kleine Pause machen, aufstehen und ein bisschen herumlaufen, auch wenn man hier nicht weit kommt. Ich habe meine Zelle verlassen und bin runter in den Gemeinschaftsbereich gegangen, wo ich mir im Hauptwaschraum die Zähne geputzt habe. Es war ein neuer Insasse dort, einer, der noch nichts über mich weiß. Als er hallo sagte, wusste ich, dass ich aufpassen musste. Auf einen Gruß nicht zu antworten wird draußen vielleicht höchstens als unhöflich angesehen, hier drinnen aber kann es als Beleidigung aufgefasst werden. Wenn ich in einem richtig schlimmen Knast wäre, wäre ich vermutlich längst tot. Doch selbst hier ist so etwas eine ständige Prüfung für mich.
Ich reagierte wie gewöhnlich. Zeigte mit zwei Fingern der rechten Hand auf meinen Hals und machte eine schlitzende Geste. Aus mir kommt kein Wort raus, Kumpel. Ist nicht respektlos gemeint. Offensichtlich habe ich’s überlebt, weil ich hier sitze und weiterschreibe.
Bleiben Sie also dran, denn das ist meine Geschichte, falls Sie dafür bereit sind. Vor langer Zeit war ich einmal der Wunderjunge. Später der Stumme aus Milford. Der Goldjunge. Der junge Ghost. Der Kleine. Der Schrankmann. Der Schlosskünstler. All das war ich.
Aber Sie dürfen mich Mike nennen.
Kapitel zwei
Nahe PhiladelphiaSeptember 1999
Da war ich also, unterwegs zu meinem ersten richtigen Auftrag. Seit zwei Tagen ununterbrochen auf der Straße, seit ich mein Zuhause verlassen hatte. Das alte Motorrad war kaputtgegangen, als ich gerade die Staatsgrenze nach Pennsylvania überquerte. Es ging mir schwer gegen den Strich, es dort am Straßenrand zurückzulassen, nach allem, was es für mich getan hatte. Die Freiheit. Das Gefühl, dass ich einfach aufspringen und von einem Moment auf den anderen allem davonfahren konnte. Aber verdammt, was blieb mir anderes übrig?
Ich nahm die Motorradtaschen hinten herunter und streckte den Daumen raus. Versuchen Sie mal zu trampen, wenn Sie nicht sprechen können. Nur zu, versuchen Sie es ruhig mal. Die ersten drei, die anhielten, konnten überhaupt nicht damit umgehen. Es spielte keine Rolle, dass ich ein nettes Gesicht hatte oder ziemlich fertig aussah nach all den einsamen Meilen auf der Straße. Eigentlich sollte es mich inzwischen nicht mehr überraschen, wie panisch die Leute reagieren, wenn sie jemandem begegnen, der ständig schweigt.
Folglich brauchte ich eine Weile, um dort anzukommen. Zwei Tage seit dem Anruf, inklusive einer Menge Ärger und Mühe. Dann tauchte ich endlich auf, müde, hungrig und dreckig. So viel zu einem guten ersten Eindruck.
Das hier war die Blue Crew. Die Jungs, die der Ghost als solide und zuverlässig bezeichnete. Nicht gerade als die Spitzenleute, aber als professionell. Auch wenn sie manchmal einen etwas groben Ton draufhatten. Wie die meisten Typen aus New York. Das war alles, was man mir über sie gesagt hatte. Das Übrige würde ich gleich selbst herausfinden.
Sie hatten sich in einem kleinen einstöckigen Motel am Rand von Malvern, Pennsylvania eingegraben. Es war nicht die schlimmste Unterkunft, die ich je gesehen hatte, aber man konnte wohl schon einen Koller bekommen, wenn man ein, zwei Tage länger dort festsaß als geplant. Besonders, wenn man sich nicht groß blicken lassen wollte und Pizzas bestellte, statt essen zu gehen, und sich eine Pulle hin und her reichte, statt zu gucken, was die Bars der Gegend zu bieten hatten. Aus welchem Grund auch immer, jedenfalls waren sie nicht gerade bester Laune, als ich endlich erschien.
Es waren nur zwei. Mit einem so kleinen Team hatte ich nicht gerechnet, und sie wohnten auch noch beide im selben Zimmer. Was sicher nicht zur Besserung ihrer Stimmung beitrug. Der Mann, der die Tür aufmachte, schien das Sagen zu haben. Er war kahlköpfig und hatte rund zwanzig Pfund Übergewicht, sah aber stark genug aus, um mich geradewegs durchs Fenster zu schleudern. Er sprach mit einem starken New Yorker Akzent.
»Wer bist du?« Er starrte mich fünf Sekunden lang nieder, dann ging ihm ein Licht auf. »Moment mal, bist du der Typ, auf den wir warten? Rein mit dir!«
Er zog mich ins Zimmer und machte die Tür zu.
»Du willst mich verarschen, oder? Ist das ein Witz?«
Der andere saß am Tisch, sie waren mitten in einer Partie Gin Rommé. »Was ist mit dem Kleinen?«
»Das ist der Schrankmann, auf den wir warten, siehst du das nicht?«
»Wie alt ist der, zwölf?«
»Wie alt bist du, Junge?«
Ich hielt zehn Finger in die Höhe, dann acht. Zwar wurde ich erst in vier Monaten achtzehn, aber ich dachte mir, wen schert’s. Ist ja bald.
»Sie haben gesagt, dass du nicht viel redest. Stimmt offenbar.«
»Scheiße, warum hast du so lange gebraucht?«, sagte der Mann am Tisch. Sein Akzent war noch heftiger als der des anderen. Er hörte sich an, als stünde er an einer Straßenecke in Brooklyn. Ich taufte ihn in Gedanken Brooklyn. Die richtigen Namen würde ich sowieso nie erfahren.
Ich hob den rechten Daumen und bewegte ihn langsam hin und her.
»Du musstest per Anhalter fahren? Willst du mich hochnehmen?«
Ich hob resigniert die Hände. Ging nicht anders, Jungs.
»Du siehst total scheiße aus«, sagte der Erste. »Willst du erst mal duschen oder so?«
Die Idee fand ich super. Also ging ich duschen und kramte in meiner Tasche nach etwas Sauberem zum Anziehen. Danach fühlte ich mich beinahe wieder wie ein Mensch. Als ich zurück ins Zimmer kam, merkte ich, dass sie über mich geredet hatten.
»Heute Nacht ist die letzte Gelegenheit«, sagte Manhattan – das war mein Spitzname für den Anführer. Wenn sie noch drei Typen dabeigehabt hätten, hätten wir alle fünf Bezirke abdecken können. »Bist du sicher, dass du fit genug bist?«
»Unser Mann kommt morgen früh nach Hause«, warf Brooklyn ein. »Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, war der ganze Trip für’n Arsch.«
Ich nickte. Verstanden, Jungs. Was wollt ihr noch von mir?
»Du redest wirklich nicht«, sagte Manhattan. »So was, die haben mich nicht veräppelt. Du sagst echt kein beschissenes Wort.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Kriegst du den Safe dieses Typen auf?«
Ich nickte.
»Mehr brauchen wir nicht zu wissen.«
Brooklyn sah nicht ganz so überzeugt aus, aber im Moment hatte er keine Wahl. Sie hatten auf ihren Schrankmann gewartet. Und ihr Schrankmann war ich.
Etwa drei Stunden später, die Sonne war inzwischen untergegangen, saß ich hinten in einem Lieferwagen mit der Aufschrift ELITE RENOVATIONS. Manhattan fuhr. Brooklyn saß auf dem Beifahrersitz und drehte sich alle paar Minuten zu mir um. Daran würde ich mich wohl gewöhnen müssen. Es war, wie der Ghost gesagt hatte: Diese Typen hatten schon die ganze Laufarbeit gemacht, hatten ihr Zielobjekt ausbaldowert, hatten jeden Schritt ihres Opfers verfolgt, hatten die ganze Operation von Anfang bis Ende durchgeplant. Ich war nur der Spezialist, der zum Schluss hinzugerufen wurde, um seinen Teil zu erledigen. Es sprach nicht für mich, dass ich aussah, als hätte ich noch nicht mal angefangen, mich zu rasieren, und obendrein so ein komischer Kauz war, der kein Wort herausbrachte.
Na gut. Ich nahm es ihnen nicht übel, dass sie ein bisschen skeptisch waren.
Nach dem zu urteilen, was ich aus dem Fenster sah, fuhren wir in eine Eins-a-Wohngegend hinein. Das musste die Main Line sein, von der ich gehört hatte, die feinen Vororte westlich von Philadelphia, wo der alte Geldadel wohnte. Wir kamen an Privatschulen vorbei, deren Eingänge von großen steinernen Torbögen bewacht wurden. An der Villanova University, hoch oben auf einem Hügel. Ich ertappte mich bei der Überlegung, ob sie dort wohl eine gute Kunsthochschule hatten. An einer langen, sanft abfallenden Rasenfläche mit Lichterketten und weißen Möbeln, aufgestellt für irgendein Fest. All das gehörte zu einer Welt, die ich nie auf legale, rechtmäßige Weise betreten würde.
Wir fuhren weiter, bis wir Bryn Mawr erreichten, dann noch an einem anderen College vorbei, dessen Namen ich nicht mitbekam, bis wir schließlich rechts von der Hauptstraße abbogen. Die Häuser wurden größer und größer, und doch hielt uns immer noch niemand an. Keine Uniformierten mit Blechabzeichen und Klemmbrettern, die uns nach unserer Legitimation fragten. Das war das Tolle an diesen Patrizierhäusern. Sie waren vor langer Zeit erbaut worden – lange bevor jemand von bewachten Wohnanlagen träumte.
Manhattan steuerte den Lieferwagen eine lange Auffahrt hinauf, folgte aber nicht der Schleife, die uns zum Vordereingang geführt hätte, sondern fuhr zur Rückseite des Hauses, wo es einen großen gepflasterten Hof und eine anscheinend für fünf Wagen gedachte Garage gab. Die beiden zogen ihre Latexhandschuhe über. Ich nahm das Paar, das sie mir reichten, und steckte es in die Hosentasche. Ich hatte so etwas noch nie mit Handschuhen versucht und würde jetzt nicht anfangen, damit zu experimentieren. Manhattan schien sich im Geist einen Vermerk über meine bloßen Hände zu machen, sagte aber nichts dazu.
Wir stiegen aus und gingen über eine breite Veranda zur Hintertür. Dichte Kiefernreihen umstanden den Hof. Sobald wir uns dem Haus näherten, leuchtete das Licht eines Bewegungsmelders auf, aber keiner von uns zuckte zusammen. Das Licht hieß uns ohnehin nur willkommen. Hier entlang, meine Herren. Darf ich den guten Gentlemen den Weg zeigen?
Die beiden Männer hielten an der Tür inne und warteten offensichtlich darauf, dass ich den ersten meiner Spezialistenjobs durchführte. Ich holte das Lederetui aus meiner Gesäßtasche und machte mich an die Arbeit. Nahm einen Spanner zur Hand und führte ihn in den unteren Teil des Schüssellochs ein. Dann griff ich zu einem dünnen Tropfendiamanten und begann mit dem Setzen. Tastete mich durch die einzelnen Stifte, von hinten nach vorn, und drückte jeden Stift gerade so weit hinauf, bis er die Scherlinie erreichte. Ich wusste, an einem Haus wie diesem würde das Schloss mindestens mit Pilzkopfstiften ausgestattet sein, wenn nicht gar gezackten Stiften. Als ich mit dem falschen Setzen durch war, bearbeitete ich die Stifte von neuem, schob jeden noch ein, zwei Millimeter hinauf und hielt dabei exakt die richtige Spannung, damit sie hängen blieben. Ich verbannte alles andere aus meinem Bewusstsein. Die Männer neben mir. Was ich hier eigentlich tat. Die Nacht selbst. Es gab nur mich und diese fünf winzigen Metallstücke.
Ein Stift gesetzt. Zwei Stifte gesetzt. Drei. Vier. Fünf.
Ich merkte, wie der Schließzylinder nachgab, und drückte stärker auf den Spanner, so dass er sich drehte. Wie sehr diese Männer auch an mir gezweifelt haben mochten, den ersten Test hatte ich bestanden.
Manhattan drängte sich an mir vorbei und ging direkt zur Alarmanlage. Das war der Teil, den die beiden bereits allein vorbereitet hatten. Es gab so viele Schwachstellen innerhalb eines elektronischen Alarmsystems. Man konnte die Magnetfeldsensoren an einer Tür oder einem Fenster umgehen. Das gesamte System deaktivieren oder es einfach von seiner Standleitung abtrennen. Hey, sich sogar die Person vornehmen, die im Kontrollraum der Sicherheitsfirma saß. Sobald ein Mensch aus Fleisch und Blut irgendwo in dem ganzen Kreislauf vorkommt, hat man es leichter, besonders wenn dieser Mensch aus Fleisch und Blut 6,50 Dollar die Stunde verdient.
Irgendwoher kannten diese Jungs bereits den Code, was natürlich das Einfachste von allem ist. Vielleicht hatten sie einen Kontakt im Haus, die Haushälterin oder einen Wartungsmann. Oder sie hatten schlichtweg den Eigentümer selbst mit einem starken Fernglas beobachtet, so dass sie die Tasten erkennen konnten, die er drückte. Wie sie es auch angestellt hatten, sie kannten die Zahlen, und Manhattan brauchte knapp fünf Sekunden, um das System abzuschalten.
Er gab uns das Okay mit erhobenem Daumen, worauf Brooklyn sich verzog, um Schmiere zu stehen oder was er sonst tun sollte. Das war offensichtlich Routine für die beiden, sie waren ganz in ihrem Element. Und ich? Ich befand mich inzwischen in meiner privaten kleinen Blase, spürte wieder dieses angenehme Vibrieren und wie mein Herzschlag sich beschleunigte, bis sein Rhythmus mit der ständig schlagenden Basstrommel in meinem Kopf übereinstimmte. Die Angst, mit der ich jeden Tag, jede Sekunde lebte, verließ mich endlich. Alles war friedlich und normal und im Einklang für diese paar wenigen kostbaren Minuten.
Manhattan winkte mir, ihm zu folgen. Wir gingen durch das Haus, ein so perfektes Haus, wie ich es noch nie gesehen hatte. Bei der Einrichtung hatte man mehr Wert auf Komfort als auf Repräsentation gelegt. Ein riesiger Fernseher mit Sesseln, in denen man versinken konnte. Eine bestens ausgestattete Bar mit Gläsern, die an einem Gestell darüber hingen, einem Spiegel, Barhockern, allem, was dazugehört. Wir stiegen die Treppe hinauf, kamen durch einen Flur und ins Hauptschlafzimmer. Manhattan schien sich gut auszukennen. Unser Weg endete in einem der beiden großen begehbaren Kleiderschränke, reihenweise teure dunkle Anzüge auf der einen Seite, teure Freizeitkleidung auf der anderen. Die Schuhe ordentlich in schräg stehenden Fächern arrangiert. Gürtel und Krawatten an einer elektrischen Vorrichtung, die auf Knopfdruck rotierte und die gesamte Auswahl vorführte.
Natürlich waren wir nicht wegen der Gürtel und Krawatten hier. Manhattan schob mit sicherem Griff ein paar Anzüge beiseite, und ich sah einen rechteckigen Umriss an der Wand. Er drückte darauf, so dass eine Klappe aufsprang. Dahinter befand sich der Safe.
Er trat beiseite. Nun war ich wieder dran.
Das war es, wofür sie mich tatsächlich brauchten. Die Hintertür hätten sie notfalls auch allein aufbekommen. Sie hätten vermutlich ein bisschen länger dazu gebraucht, aber diese Männer waren clever und einfallsreich und hätten eine Möglichkeit gefunden. Dieser Safe dagegen, das war etwas ganz anderes. Es lag im Bereich des Machbaren, den Sicherheitscode für das Haus herauszufinden, aber die Kombination für den im Wandschrank des Hausherrn verborgenen Safe? Nein, die existierte höchstwahrscheinlich nur in dessen Kopf. Vielleicht noch in dem seiner Frau. Ganz vielleicht noch im Kopf einer zuverlässigen dritten Person, eines Vertrauten oder Anwalts der Familie, nur für den Notfall. Ansonsten … na ja, man konnte natürlich losgehen und den Besitzer entführen, ihn mit Klebeband an einen Stuhl fesseln und ihm eine Knarre in den Mund stecken, aber dann hätte man eine vollkommen andere Operation. Wenn man sauber vorgehen wollte, dann brauchte man einen Schrankmann, der einem das Ding öffnete. Ein schlechter Schrankmann würde letztendlich wahrscheinlich die Wand durchschlagen und den Safe herausreißen. Ein besserer Schrankmann würde ihn in der Wand belassen und eine Bohrmaschine einsetzen. Ein erstklassiger Schrankmann … Tja, das war es, was ich zu demonstrieren hoffte.
Stellte sich nur das Problem – und ich war froh, dass Manhattan nichts davon ahnte –, dass ich in meinem kurzen Leben bisher noch nie einen Wandsafe geöffnet hatte. Ich meine, klar, ich wusste, dass es dasselbe Prinzip ist. Einfach ein standardmäßiger Safe, der in eine Wand eingebaut wurde, richtig? Doch ich hatte mein Handwerk an freistehenden Tresoren gelernt, an die ich mit dem ganzen Körper dicht herankommen konnte, um zu fühlen, was ich da tat. Wie der Ghost so oft gesagt hatte, wenn er mich unterrichtete – es ist, als würde man eine Frau verführen. Man muss sie auf die richtige Weise berühren. Wissen, was in ihr vorgeht. Wie soll man das machen, wenn die ganze Frau, bis auf das Gesicht, hinter einer Wand versteckt ist?
Ich schüttelte meine Hände aus und trat an die Nummernscheibe heran. Zuerst bewegte ich den Griff, um zu überprüfen, ob das verdammte Ding überhaupt verschlossen war. War es.
Ich sah das Markenschild eines Herstellers aus Chicago und wählte die beiden werkseitig voreingestellten »Probe-Kombinationen«, mit denen die Safes geliefert werden. Sie würden sich wundern, wie viele Leute die nie ändern.
Kein Glück mit beiden. Das hier war ein gewissenhafter Tresorbesitzer, der seine eigene Kombination einstellte. Nun musste ich mich also richtig an die Arbeit machen.
Ich drückte mich eng an die Wand und legte eine Wange an die Safetür. Zwar ging ich bereits von drei Sperrscheiben aus bei diesem Modell, aber da es mein erster Einsatz war, wollte ich Gewissheit haben. Ich fand den Kontaktbereich, den winzigen Bereich an der Nummernscheibe, in dem die »Nase« des Führungshebels mit der Einkerbung auf der Antriebsscheibe in Berührung kam. Nachdem ich den hatte, »parkte« ich die Sperrscheiben, das heißt, ich drehte zu einer Zahl auf der entgegengesetzten Seite des Kontaktbereichs, drehte anschließend wieder in die andere Richtung und zählte, wie viele Räder vom Mechanismus aufgenommen wurden.
Eins. Zwei. Drei. Dann war ich sicher. Drei Scheiben.
Ich drehte zurück, parkte alle Scheiben auf 0. Dann ging ich wieder zum Kontaktbereich.
Das war der schwierige Teil. Der so gut wie unmögliche, theoretisch unmögliche Teil. Aufgrund der Tatsache, dass keine Scheibe vollkommen rund ist und keine zwei Scheiben genau gleich groß sind, kommt es zu einem nicht ganz perfekten Kontakt, wenn man über die Einkerbungen an den Sperrscheiben hinwegdreht. Das ist unvermeidlich, egal wie teuer der Safe und wie gut das Kombinationsschloss gebaut ist. Wenn man also bei einer Nut angelangt ist und zum Kontaktbereich zurückgeht, wird er sich ein bisschen anders anfühlen. Der Abstand zwischen den Kontaktpunkten ist ein bisschen kürzer, da die Nase sich ein kleines Stück weiter vorn in die Antriebsscheibe senkt.
Bei einem billigen Safe spürt man das wie ein Schlagloch in einer glatt asphaltierten Straße. Bei einem guten Safe dagegen? Einem guten, teuren Safe, wie ihn der Eigentümer dieses Hauses in seinen Wandschrank hatte einbauen lassen?
Da würde der Unterschied sehr gering sein. Winzig klein.
Ich drehte auf 3. Dann auf 6. Dann auf 9. Begann mit Dreierschritten und testete den Spielraum bei jeder Zahl. Wartete auf dieses spezielle, andere Gefühl. Diese geringfügige Verkürzung im Kontaktbereich. Den hauchfeinen Unterschied, den kein Normalsterblicher wahrnehmen kann. Nie und nimmer, nicht in tausend Jahren.
12. Ja, ich war nahe dran.
Okay, weiter. 15, 18, 21.
Ich arbeitete mich durch die Nummernscheibe, drehte schneller, wenn es ging, und wurde langsamer, wenn ich jeden Bruchteil eines Millimeters ertasten musste. Ich hörte, wie Manhattan hinter mir sein Gewicht verlagerte. Ich hob die Hand, und er war wieder mucksmäuschenstill.
24, 27. Ja, hier.
Woher ich das weiß?
Ich weiß es einfach. Wenn der Abstand kürzer ist, ist er kürzer. Ich fühle das.
Es ist eigentlich noch mehr als Fühlen. Dieses kleine Stückchen Hartmetall berührt die Einkerbung um Haaresbreite eher als bei der letzten Einstellung, und ich spüre das, höre das, sehe es im Geiste.
Als ich mit der Nummernscheibe durch war, hatte ich drei angenäherte Zahlen im Kopf. Ich fing von vorn an und grenzte sie ein, bis ich die genauen Stellen hatte, ging diesmal in Einer- statt Dreierschritten vor. Als ich damit fertig war, hatte ich die drei Zahlen der Kombination: 13, 26, 72.
Der letzte Schritt ist mehr oder weniger öde Routine. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die Einstellungen nacheinander durchzuprobieren. Man beginnt also mit 13–26–72, vertauscht dann die ersten beiden Zahlen, dann die zweite und die letzte und so weiter, stellt nötigenfalls alle sechs Kombinationen ein. Wobei sechs deutlich besser ist als eine Million – so viele mögliche Kombinationen gäbe es nämlich, wenn man diese drei Zahlen nicht ermitteln könnte.
Die Kombination in diesem Fall erwies sich als 26–72–13. Zeit insgesamt, um den Safe zu öffnen? Ungefähr fünfundzwanzig Minuten.
Ich drehte den Griff und öffnete die Tür. Dabei machte ich mir den Spaß, Manhattans Gesicht zu beobachten.
»Leck mich«, sagte er. »Du könntest mich jetzt mit ’nem Knüppel ficken.«
Ich ging beiseite und ließ ihn tun, was er tun musste. Ich hatte keine Ahnung, was er dort drin zu finden hoffte. Schmuck? Bargeld? Dann sah ich, wie er etwa ein Dutzend Umschläge herauszog, von der braunen Sorte, die ein bisschen größer als die üblichen Geschäftsbriefe sind.
»Wir haben sie. Jetzt können wir los.«
Ich schloss den Safe und drehte die Wählscheibe. Manhattan stand mit einem weißen Lappen hinter mir und wischte alles ab. Dann ließ er die äußere Klappe zufallen und schob die Anzüge wieder in Reih und Glied.
Er knipste das Licht aus, und wir gingen die Treppe hinunter. Brooklyn war im Wohnzimmer und sah zum Fenster hinaus.
»Ich will’s nicht wissen«, sagte er.
»Alles paletti«, sagte Manhattan und hielt die Umschläge in die Höhe.
»Willst du mich verscheißern?« Brooklyn sah mich mit einem schiefen Grinsen an. »Ist unser Kleiner hier ein Genie oder so was Ähnliches?«
»So was Ähnliches. Gehen wir.«
Manhattan tippte den Sicherheitscode ein, um die Alarmanlage wieder einzuschalten. Dann machte er die Tür zum Hof hinter uns zu und wischte den Drehknauf ab.
Aus dem Grund hatten sie mich angefordert. Aus dem Grund hatten sie so lange auf einen Jungen gewartet, den sie nicht mal kannten und der erst durch das halbe Land fahren musste, um zu ihnen zu stoßen. Denn wenn ich bei einem Bruch dabei bin, hinterlassen sie keine Spuren. Der Hauseigentümer würde am nächsten Tag zurückkommen, seine Tür aufschließen und alles genau so vorfinden, wie er es verlassen hatte. Er würde nach oben gehen, ein paar Kleider aus dem Schrank nehmen, das Licht wieder ausschalten. Erst wenn er seinen Safe benutzen wollte, würde er die Kombination wählen, die Tür öffnen und feststellen …
Leer.
Selbst dann würde er nicht gleich darauf kommen, was passiert war. Er würde eine Weile an dem Ding herumfummeln und denken, dass er sich geirrt hat. Dass er nicht ganz klar im Kopf ist. Als Nächstes würde er seine Frau beschuldigen. Du bist der einzige Mensch außer mir, der die Kombination kennt! Oder er würde den Familienanwalt anrufen und zur Rede stellen. Wir waren eine Woche weg – Sie haben unserem Haus wohl einen kleinen Besuch abgestattet, was?
Schließlich würde es ihm dämmern. Jemand Fremdes war in seinen vier Wänden gewesen. Doch zu der Zeit würden Manhattan und Brooklyn längst wieder sicher zu Hause sein, und ich …
Ich würde dort sein, wo es mich als Nächstes hinverschlug.
Ich habe nie herausgefunden, was in diesen Umschlägen war. Es war mir auch völlig egal, weil ich wusste, dass ich pauschal bezahlt werden würde. Als wir wieder in dem Motel waren, gab Manhattan mir meinen Lohn in bar und sagte, dass es ein Vergnügen gewesen sei, mir bei der Arbeit zuzusehen.
Jetzt hatte ich wenigstens etwas mehr Geld. Genug, um mich für eine Weile mit Essen zu versorgen und eine Unterkunft zu suchen. Aber wie lange würde es reichen?
Er löste die Magnetschilder mit der Aufschrift ELITE RENOVATIONS von beiden Seiten des Lieferwagens ab und warf sie hinten hinein. Dann nahm er einen Schraubendreher und machte die Pennsylvania-Kennzeichen ab, um sie durch New Yorker Nummernschilder zu ersetzen. Er wollte sich gerade hinters Steuer setzen, als ich ihn zurückhielt.
»Was ist, Kleiner?«
Ich zog ein imaginäres Portemonnaie aus meiner Jeanstasche und klappte es auf.
»Was, du hast deinen Geldbeutel verloren? Kauf dir ’nen neuen, du bist doch jetzt flüssig.«
Ich schüttelte den Kopf und tat, als würde ich eine Karte aus dem imaginären Portemonnaie herausnehmen.
»Du hast deinen Ausweis verloren? Warum gehst du nicht dahin zurück, wo du herkommst, man wird dir einen neuen ausstellen.«
Ich schüttelte wieder den Kopf und zeigte auf die unsichtbare Karte in meiner Hand.
»Du brauchst …«
Endlich ging ihm ein Licht auf.
»Ach so, du brauchst überhaupt einen neuen Ausweis. Soll heißen, eine ganze verfluchte neue Identität.«
Ich nickte.
»Ach du Scheiße. Das ist aber ein ganz anderer Deal, Mann.«
Ich beugte mich vor und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Komm schon, Freund. Du musst mir unter die Arme greifen.
»Hör mal«, sagte er. »Wir wissen, für wen du arbeitest. Ich meine, wir schicken ihm schließlich seinen Anteil, oder? So funktioniert das Ganze. Wir werden ihn bestimmt nicht linken, weißt du. Also, wenn du ein Problem dieser Art hast, warum gehst du nicht zurück nach Hause und bereinigst es dort?«
Wie sollte ich ihm das erklären? Selbst wenn ich reden könnte? Dass ich zur Zeit total in der Luft hing. Dass ich ein Hund war, der nicht nach Hause konnte, der keinen Platz zu Füßen seines Herrn hatte. Nicht einmal in seinem Hinterhof. Ich musste ständig herumstreunen und nach Abfällen in den Mülltonnen stöbern.
Bis er mich zu sich rief. Wenn mein Herr den Kopf zur Tür raussteckte und mich rief, musste ich schleunigst gehorchen, so viel stand fest.
»Okay, ich kenne da jemanden«, sagte Manhattan schließlich. »Ich meine, wenn du wirklich in der Klemme steckst.«
Er holte sein eigenes, reales Portemonnaie heraus und zog eine Visitenkarte und einen Stift hervor. Er drehte die Karte um und schrieb etwas darauf.
»Du rufst diesen Typ an, dann wird er …«
Er hörte auf zu schreiben und sah mich an.
»Ach so. Das könnte schwierig werden. Schätze, du solltest lieber persönlich bei ihm vorbeischauen, was?«
Ich nahm das Geld heraus, das er mir gerade gegeben hatte, und begann, ein paar Scheine abzuzählen.
»Halt, halt. Warte mal.«
Er drehte sich zu Brooklyn um, und sie verständigten sich mit Achselzucken.
»Normalerweise müsstest du mir versprechen, meinem Boss nichts davon zu sagen«, sagte Manhattan. »Aber irgendwie glaube ich, dass das kein Thema ist.«
Ich stieg hinten in ihren Lieferwagen ein. So kam ich nach New York.
Kapitel drei
Michigan1991
Gehen wir ein Stück zurück. Nicht ganz bis zum Anfang, nur bis zu der Zeit, als ich neun Jahre alt war. Kurz nachdem es passiert war. Mittlerweile hatte man mich für körperlich wiederhergestellt erklärt, abgesehen von dieser einen kleinen Eigentümlichkeit, aus der niemand schlau wurde. Die Sache mit dem Nichtsprechen. Nach einigem Herumgeschobenwerden zwischen verschiedenen Betten erlaubte man mir schließlich, bei meinem Onkel Lito zu wohnen. Dem Mann mit dem machohaften Namen eines Italo-Lovers, der alles andere war als das. Er hatte zwar schwarze Haare, aber die sahen immer so aus, als wäre ein Schnitt seit mindestens einem Monat überfällig. Dazu trug er lange Koteletten, schon ergraut, und nach der Zeit zu urteilen, die er sich mit ihnen vorm Spiegel beschäftigte, hielt er sie wohl für sein größtes Plus. Wenn ich jetzt daran zurückdenke: diese Koteletten, die Klamotten, die er trug … Mann, die ganze Zusammenstellung wäre einfach nicht möglich gewesen, wenn er je geheiratet hätte. Jede Frau auf dieser Welt hätte ihn erst mal auseinandergenommen und dann neu wieder zusammengesetzt.
Onkel Lito war der ältere Bruder meines Vaters. Er sah ihm überhaupt nicht ähnlich, nicht mal im Entferntesten. Ich habe ihn nie gefragt, ob einer von ihnen adoptiert war oder gar alle beide. Die Frage wäre ihm wohl unangenehm gewesen, vor allem, als es nur noch ihn gab. Er wohnte in einem kleinen Ort namens Milford, oben in Oakland County, nordwestlich von Detroit. Eigentlich hatte ich nie viel mit ihm zu tun gehabt, als ich klein war, und selbst wenn wir uns sahen, hat er in meiner Erinnerung kein großes Interesse an mir gezeigt. Doch nachdem das alles passiert war, na ja, das hatte ihn offensichtlich verändert, obwohl er nicht direkt daran beteiligt gewesen war. Es war sein Bruder, Herrgott noch mal. Sein Bruder und seine Schwägerin. Und hier war ich, sein Neffe – acht Jahre alt und amtlich obdachlos. Der Staat Michigan hätte mich sonst einkassiert und Gott weiß wohin zu Gott weiß wem gesteckt. Kaum vorstellbar, was dann aus mir geworden wäre. Vielleicht wäre ich jetzt ein Musterbürger. Vielleicht wäre ich auch tot. Wer weiß? Jedenfalls kam es so, dass Onkel Lito mich in sein Haus in Milford aufnahm, das rund achtzig Kilometer von dem kleinen Backsteinhaus in der Victoria Street entfernt lag. Achtzig Kilometer weg von dem Ort, an dem mein junges Leben hätte enden sollen. Nach ein paar Monaten Probezeit ließ man ihn die entsprechenden Papiere unterschreiben, und er wurde mein gesetzlicher Vormund.
Mir ist klar, dass er das nicht hätte tun müssen. Er brauchte überhaupt nichts für mich zu tun. Falls Sie je ein Wort der Klage über den Mann von mir hören, verlieren Sie diese Tatsache nicht aus den Augen, okay? Hier kommt allerdings schon der erste Haken. Wenn man ein neues Leben beginnen will, muss man mehr als achtzig Kilometer weit wegziehen. Achtzig Kilometer sind nicht genug, um sein altes Leben hinter sich zu lassen oder zu vermeiden, dass alle, die man trifft, einen noch als den kennen, der man war.
Es ist nicht annähernd weit genug weg, wenn man wegen etwas berühmt geworden ist, das man für alle Zeit vergessen will.
Und dann Milford selbst … okay, ich weiß, heute ist es ein yuppiemäßiger schmucker Vorort, aber damals war es bloß ein kleines Arbeiterkaff, dessen Hauptstraße schräg unter einer Eisenbahnbrücke verlief. Egal, wie viele Warnlichter und große gelbe Schilder man aufstellte, es gab übern Daumen gepeilt durchschnittlich zwei oder drei Unfälle pro Monat. Bloß weil ein paar betrunkene Deppen den plötzlichen Knick in der Straße nicht nehmen konnten, der einen zentimeternah an den betonierten Bahndamm heranführte. Scheiße, allein die Kunden meines Onkels … sein Spirituosenladen lag nämlich direkt neben der Brücke. »Lito’s Liquors«. Auf der anderen Seite gab es ein Restaurant, das »The Flame« hieß. Wenn Sie je in einem Denny’s waren, dann denken Sie an diese kulinarische Erfahrung, nur mit doppelt so schlechtem Essen. Man sollte meinen, wir hätten nur einmal und nie wieder dort gegessen, wie die meisten Leute, aber das Flame lag eben günstig nahe am Spirituosenladen, und es gab da eine Kellnerin, für die mein Onkel eine Schwäche hatte. Jedenfalls, es klingt wie ein schlechter Witz, aber wenn mir je etwas letztendlich die Zunge gelöst hätte, dann das Essen im Flame.
Ansonsten gab es am Ende der Main Street einen Park mit rostigen alten Schaukeln und Kletterstangen, die nur ein Lebensmüder ohne Tetanusspritze angefasst hätte. Der Park zog sich bis hinunter zum Huron River, der mit alten Autoreifen, Einkaufswagen und noch zusammengebundenen Zeitungsstapeln vollgemüllt war. Unter der Brücke, wo die Eisenbahn den Fluss überquerte, hingen die Kids von der Highschool abends ab, drehten ihre Autoradios auf, tranken Bier, rauchten Pot, was weiß ich.
Sie denken vermutlich, ich übertreibe. Wenn Sie Milford heute sähen, würden Sie mich für verrückt erklären, bei all den exklusiven Wohnsiedlungen, die sie inzwischen dort haben, und der Main Street mit ihren Antiquitäten und Biosandwiches und Beautysalons. Im Park gibt es jetzt einen großen offenen Pavillon, in dem im Sommer Konzerte aufgeführt werden, und wenn man unter der Eisenbahnbrücke einen Joint rauchen würde, wären in null Komma nix die Cops da.
Es war ein ganz anderer Ort damals, will ich nur sagen. Ein einsamer Ort, vor allem für einen gerade erst neun gewordenen elternlosen Jungen. Der auf einmal in einem fremden Haus bei einem Mann wohnte, den er kaum kannte. Onkel Lito hatte ein einstöckiges Gemäuer hinter seinem Laden, ein trauriges kleines Haus mit minzgrüner Aluverkleidung. Er nahm den Pokertisch aus dem hinteren kleinen Zimmer heraus, das damit zu meinem Zimmer wurde. »Hier werden wir wohl nicht mehr pokern, schätze ich«, sagte er, als er mir den Raum zum ersten Mal zeigte. »Aber weißt du was? Ich hab sowieso meistens bloß Geld verloren, also kann ich dir dankbar sein.«
Er streckte die Hand nach mir aus, eine Geste, die mir sehr vertraut werden sollte. Was folgte, war ein gutmütiger Knuff oder ein Klaps, so wie man seinen besten Kumpel auf die Schulter haut. Sie wissen schon, so ein kleiner Schlagabtausch zwischen Jungs, aber vorsichtiger, als wollte er mich nicht zu hart anfassen. Oder als wollte er die Möglichkeit offenlassen, dass ich auf ihn zukam und er eine unbeholfene seitliche Umarmung daraus machen konnte.
Ich merkte, dass Onkel Lito sich den Kopf darüber zerbrach, was er mit mir anfangen sollte. »Wir sind halt zwei Junggesellen«, sagte er bei mehr als einer Gelegenheit. »Leben in Saus und Braus, was? Was hältst du davon, wenn wir rüber zum Flame gehen und einen Happen essen.« Als ob der Fraß im Flame als Saus und Braus hätte gelten können. Wir setzten uns dann in unsere Nische, und Onkel Lito gab mir einen detaillierten Bericht über seinen Tagesablauf, wie viele Flaschen von diesem oder jenem er verkauft hatte und was nachbestellt werden musste. Ich saß stumm wie ein Fisch dabei. Natürlich. Ob ich ihm wirklich zuhörte, schien keine große Rolle zu spielen. Er machte einfach mit seiner einseitigen Unterhaltung weiter, und das in so ziemlich jedem wachen Moment.
»Was meinste, Mike? Sollen wir heute mal ein bisschen Wäsche waschen?«
»Zeit, zur Arbeit zu gehen, Mike. Die Brötchen wollen verdient werden. Hast du Lust, ein bisschen hier hinten herumzuhängen, während ich vorne aufräume?«
»Unsere Vorräte gehen langsam zur Neige, Mike. Ich glaube, wir müssen einen Ausflug zum Supermarkt machen. Was meinste, sollen wir ein paar hübsche Mädchen aufgabeln, wenn wir schon unterwegs sind? Sie mit hierhernehmen, eine Party feiern, he?«
Diese Angewohnheit von ihm, dieses Geplapper die ganze Zeit, das sollte mir noch öfter begegnen, wohin ich auch kam. Leute, die von Natur aus gern reden, brauchen vielleicht ein, zwei Minuten, um sich an mich zu gewöhnen, und dann stellen sie die Plapperkiste an und nicht mehr aus. Bloß keinen Moment Stille, Gott bewahre.
Die schweigsamen Leute dagegen … die fühlen sich meist höllisch unwohl in meiner Gegenwart, weil sie wissen, dass sie es nicht mit mir aufnehmen können. Ich kann jeden in Grund und Boden schweigen, an jedem Austragungsort, für jeden Wetteinsatz. Ich bin der unangefochtene Champion im Mundhalten und stumm Dasitzen wie ein Möbelstück.
Okay, ich musste mir an dieser Stelle mal für ein Weilchen selbst leidtun. Den Stift absetzen und mich auf meine Pritsche legen. An die Decke starren. Das hilft immer. Probieren Sie es irgendwann mal, wenn Sie mir nicht glauben. Das nächste Mal, wenn Sie sich für ein paar Jahre in einem Käfig wiederfinden. Egal, zurück zur Geschichte. Ich werde Sie jetzt nicht mit all den Arztbesuchen anöden, die ich über mich ergehen lassen musste, all den Sprachtherapeutinnen, Sozialpädagogen, Psychologen … Wenn ich mir das im Nachhinein so überlege, muss ich ein feuchter Traum für diese Leute gewesen sein. Für jeden Einzelnen von ihnen war ich der traurige, stumme, von aller Welt verlassene Junge mit den wuscheligen Haaren und den großen braunen Augen. Der Wunderjunge, der seit dem tragischen Tag, an dem er dem Tod von der Schippe gesprungen war, kein Wort mehr gesagt hatte. Mit der richtigen Behandlung, der richtigen Therapie, der richtigen Dosis Verständnis und Ermutigung würden der Arzt, die Sprachtherapeutin, der Pädagoge oder die Psychologin den Zauberschlüssel in die Hand bekommen, mit dem sie meine verletzte Psyche aufsperren konnten, woraufhin ich mich in ihren Armen ausheulen würde, während sie mir übers Haar streichelten und sagten, dass nun alles wieder gut werden würde.
Das war es, was sie alle von mir wollten. Jeder Einzelne von ihnen. Aber glauben Sie mir, sie sollten es nicht bekommen.
Jede neue Arztpraxis verließen wir mit einer neuen Diagnose, die Onkel Lito auf dem Nachhauseweg vor sich hin murmelte. »Selektiver Mutismus«, »Psychogene Aphonie«, »Traumainduzierte Kehlkopflähmung«. Letztendlich liefen sie alle auf dasselbe hinaus. Aus welchem Grund auch immer, ich hatte schlichtweg beschlossen, nicht mehr zu sprechen.
Wenn die Leute hören, dass ich hinter einem Schnapsladen aufgewachsen bin, ist das Erste, was sie mich fragen, wie oft der Laden überfallen wurde. Immer, garantiert. Die erste Frage, die ich höre. Die Antwort? Genau einmal.
Es passierte im ersten Jahr, nachdem ich zu ihm gezogen war. An einem der ersten warmen Abende im Sommer. Der Parkplatz war verlassen, abgesehen von Onkel Litos uraltem zweifarbigen Grand Marquis mit der großen Delle in der hinteren Stoßstange. Dieser Mann kam herein und drehte eine schnelle Runde durch den Laden, um sich davon zu überzeugen, dass er wirklich so leer war, wie es den Anschein hatte. Er erstarrte, als er mich an der Tür zum Lagerraum entdeckte.
Streng genommen hätte ich natürlich überhaupt nicht dort sein dürfen. Ich war neun Jahre alt, und das war ein Spirituosengeschäft. Aber Onkel Lito hatte keine andere Möglichkeit, zumindest nicht abends. Meistens saß ich in meiner kleinen Nische im Lagerraum. Meinem »Büro«, wie Onkel Lito es nannte, mit anderthalb Meter hohen Wänden aus leeren Kartons und einer Leselampe. Dort saß ich jeden Abend und las, meistens Comics, die ich in einem Geschäft ein Stück die Straße hinunter kaufte, bis es Zeit wurde, nach Hause und ins Bett zu gehen.
Obwohl ich mich also dort nicht hätte aufhalten dürfen, schon gar nicht Abend für Abend – wer sollte uns verpfeifen? Jeder im Ort kannte meine Geschichte. Jeder wusste, dass Onkel Lito für mich tat, was er konnte, ohne Hilfe von anderer Seite. Also ließ man uns in Ruhe.
Der Mann stand lange da und sah auf mich herab. Er hatte Sommersprossen und hellrote Haare.
»Brauchen Sie Hilfe dort hinten, mein Freund?«, rief Onkel Lito von vorn.
Der Mann sagte nichts. Er nickte mir kurz zu und entfernte sich. In dem Moment wusste ich, dass er eine Waffe hatte.
Sie müssen mir das einfach abnehmen. Neun Jahre alt, und irgendwie wusste ich es. Sie denken, dass ich das nur rückblickend so sehe, dass ich diese Einzelheit aufgrund dessen, was dann geschah, in meiner Erinnerung hinzugefügt habe, mir das einbilde. Aber ich schwöre es bei Gott. Halten Sie die Zeit in dem Augenblick an – ich wusste bereits genau, was passieren würde. Er würde zurück zum Eingang gehen und die Waffe mit der rechten Hand ziehen und sie auf Onkel Litos Kopf richten und ihm befehlen, die Kasse zu leeren. Genau wie in meinen Comics.
Sobald der Mann mir den Rücken zukehrte, schloss ich die Tür. Es gab ein Telefon in diesem Lagerraum. Ich nahm den Hörer ab und wählte 911. Es klingelte zweimal, dann meldete sich eine Frauenstimme. »Hallo, möchten Sie einen Notfall melden?«
Einen Notfall. Vielleicht war es das, was ich brauchte. Wenn wirklich die dringende Notwendigkeit bestand zu sprechen, wenn ich wirklich etwas sagen musste … würden die Worte herauskommen.
»Hallo, hören Sie? Brauchen Sie Hilfe?«
Ich umklammerte den Hörer. Es kamen keine Worte heraus. Es würde nicht passieren, das wusste ich. Ich wusste es ohne jeden Zweifel, und in demselben Moment erkannte ich noch etwas anderes. Dieses grässliche Gefühl, mit dem ich gelebt hatte, diese enorme, wesenhafte Angst, die ich ständig, jede Minute des Tages empfand, sie war verschwunden. Vollkommen weg. Zumindest vorübergehend. Für die nächsten Minuten, in denen ich tat, was ich dann tat. Zum ersten Mal seit jenem Tag im Juni fürchtete ich mich vor nichts mehr.
Die Telefonistin redete immer noch, und ihre Stimme schwand zu einem fernen Quäken, als ich den Hörer fallen ließ, der am Kabel baumelte. Wie sich herausstellte, genügte das bereits, um die Polizei zu rufen. Wenn man 911 wählt und die Verbindung bestehen bleibt, müssen sie kommen und nachsehen. An diesem Abend war das allerdings nicht rechtzeitig genug, um den Überfall zu verhindern.
Ich machte die Tür auf und ging hinaus in den Laden. Durch den langen Gang aus lauter Flaschen. Ich hörte den Mann schnell und mit hoher Stimme sprechen.
»So ist’s gut, Mann. Alles Geld. ’n bisschen fix, Alter.«
Dann Onkel Litos Stimme, eine Oktave tiefer. »Ganz ruhig, Freund, okay? Kein Grund, Dummheiten zu machen.«
»Was treibt der Junge dort hinten? Wo ist er hin?«
»Machen Sie sich keine Gedanken wegen ihm. Er hat nichts mit dem hier zu tun.«
»Warum rufst du ihn nicht her? Ich werde ein bisschen nervös. Das willst du nicht.«
»Er könnte mich nicht hören. Er ist taubstumm, okay? Lassen Sie ihn einfach da raus.«
In dem Moment kam ich um die Ecke und sah sie. Ich erinnere mich noch an jede Einzelheit dieser Szene. Onkel Lito, eine Papiertüte in der einen Hand, Scheine aus der offenen Kasse in der anderen. Das Wandregal mit den Probierflaschen hinter ihm. Die Kaffeedose auf dem Tresen, mein Foto darumgeklebt, darüber das handgeschriebene Schild mit der Bitte um eine Spende für den Wunderjungen.
Dann der Mann. Der Räuber. Der Verbrecher. Wie er dastand, die Waffe fest in der rechten Hand. Einen Revolver, der im Neonlicht schimmerte.
Er hatte total Schiss, das sah ich so deutlich, wie ich sein Gesicht sah. Diese Waffe in seiner Hand sollte ihm die Angst nehmen, ihn zum Herrn der Lage machen, aber sie bewirkte gerade das Gegenteil. Sie jagte ihm eine solche Furcht ein, dass er kaum klar denken konnte. Das war mir augenblicklich eine Lehre, schon damals mit neun Jahren. Daran sollte ich mich für alle Zeit erinnern.
Der Räuber sah mich zwei Sekunden lang an und richtete in der dritten die Waffe auf mich.
»Michael!«, rief Onkel Lito. »Mach, dass du hier rauskommst!«
»Ich dachte, er ist taub«, sagte der Räuber. Er kam auf mich zu und packte mich am Hemd. Dann spürte ich, wie der Revolverlauf gegen meinen Hinterkopf drückte.
»Was machen Sie da?«, keuchte mein Onkel. »Ich sage doch, ich tue alles, was Sie wollen.«
Ich merkte, dass die Hände des Räubers zitterten. Onkel Lito war bleich geworden, und er streckte die Arme nach mir aus, als wollte er nach mir greifen. Mich von dem Mann wegziehen. Ich weiß nicht, wer von den beiden in dem Moment panischer war. Nur ich, wie gesagt, hatte keine Angst. Nicht im Geringsten. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, wenn man in beständiger Furcht lebt. Kommt dann der Zeitpunkt, an dem es wirklich angebracht wäre, sich zu fürchten, an dem man auf einmal Angst haben sollte … passiert nichts.
Mein Onkel hantierte hektisch mit dem Geld herum und versuchte, alles in die Papiertüte zu stopfen. »Hier, nehmen Sie das«, sagte er. »Um Gottes willen, nehmen Sie es einfach, und verschwinden Sie.«
Der Räuber stieß mich weg und schnappte sich die Tüte mit der linken Hand, während er mit der rechten abwechselnd auf uns beide zielte. Auf mich, meinen Onkel, wieder auf mich. Dann ging er rückwärts zur Tür, dicht an mir vorbei. Ich rührte mich nicht. Aus einem Meter Abstand sah er noch einmal kurz zu mir herunter.
Ich versuchte nicht, ihn aufzuhalten. Ich versuchte nicht, ihm das Geld wegzunehmen oder die Waffe zu entreißen. Ich steckte nicht meinen Finger in den Lauf und grinste ihn an. Ich stand einfach nur da und beobachtete ihn, als wäre er ein Fisch in einem Aquarium.
»Scheißschräges Balg.« Er stieß die Tür mit dem linken Ellbogen auf und ließ beinahe die Tüte mit dem Geld fallen. Er fing sich wieder, rannte zu seinem Auto und fuhr mit durchdrehenden Reifen auf die Main Street.
Onkel Lito stolperte hinter der Kasse hervor und lief zur Tür. Als er dort ankam, war der Wagen schon außer Sicht.
Er drehte sich zu mir um. Mittlerweile wurde so viel Adrenalin durch seinen Körper gepumpt, dass er regelrecht vibrierte.
»Was ist mit dir los, verdammt und zugenäht?«, sagte er. »Was in drei Teufels Namen …«
Er setzte sich, wo er stand, auf den Boden und atmete schwer. Dort blieb er, bis die Polizei auftauchte. Er sah mich immer wieder an, sagte aber nichts mehr. Viele Fragen schwirrten ihm durch den Kopf, da bin ich mir sicher, aber warum sich die Mühe machen, sie zu stellen, wenn er ja doch keine Antwort bekommen würde?
Ich setzte mich neben ihn, um ihm Gesellschaft zu leisten. Fühlte eine zögerliche Hand auf meinem Rücken. Wir saßen da und warteten, im Schweigen vereint.
Kapitel vier
New York CityEnde 1999
Es kam mir wie der abgelegenste Ort auf Erden vor, dieses kleine chinesische Restaurant im Erdgeschoss eines achtstöckigen Hauses in der 128th Street. Die Familie, die es führte, hatte lediglich dieses Geschoss gepachtet, und die Stockwerke darüber waren offiziell nicht zugänglich, weil der Eigentümer sie irgendwann in unbestimmter Zukunft zur Renovierung vorgesehen hatte. Natürlich wurden die Bretter, mit denen die Treppe abgeriegelt war, heruntergerissen, und verschiedene Leute zogen nach und nach dort oben ein. Zuerst Verwandte der Familie, Cousins ersten und zweiten Grades, die nach Amerika rüberkamen, um neunzig Stunden pro Woche im Restaurant zu schuften. Dann der eine oder andere Außenstehende, bei dem man darauf vertrauen konnte, dass er den Mund hielt und der Familie jeden Monat einen bestimmten Betrag zahlte. In bar, selbstverständlich.
Ich wurde an die Familie verwiesen, nachdem der Mann, der mir meine neue Identität verkauft hatte, mich an einen Bekannten verwiesen hatte, der mich wiederum an jemand anderen verwies. Mein Zimmer war dann eines im zweiten Stock. Höher wollte man auch nicht wohnen, denn die Wärme aus der Küche im Parterre kam nur bis dahin. Außerdem hatte niemand ein Verlängerungskabel, das bis in den dritten Stock reichte. Ab da war es dunkel und eiskalt, und obendrein hatten die Ratten die oberen Etagen schon für sich beansprucht.
Bisher hatte ich noch nicht daran gedacht, mein Äußeres zu verändern. Das kam später. Aber ich schätzte, da ich im Staat Michigan als flüchtig galt, meine Bewährungsauflagen verletzt und meinen ersten richtigen Bruch für Geld gemacht hatte … Dahin führte kein Weg zurück, stimmt’s? Deshalb der New Yorker Führerschein mit dem erfundenen Namen William Michael Smith und dem erfundenen Alter von einundzwanzig. Ich benutzte ihn jedoch nicht, um mir Einlass in Bars zu verschaffen. Glauben Sie mir, ich ging so wenig wie möglich aus dem Haus, weil ich fest davon überzeugt war, dass jeder Straßenpolizist, den ich sah, schon nach mir Ausschau hielt. Selbst mitten in der Nacht, wenn ich eine Sirene unten auf der Straße hörte, war ich sicher, dass sie mich aufgespürt hatten.
Es wurde von Woche zu Woche kälter. Ich blieb drinnen, zeichnete und übte mit meinem tragbaren Tresorschloss. Zu essen bekam ich von der chinesischen Familie aus dem Restaurant. Ich zahlte ihnen monatlich zweihundert Dollar bar auf die Hand für ein Zimmer, das ihnen nicht gehörte, und um ihre Toilette und die Dusche hinter der Küche benutzen zu dürfen. Ich hatte eine einzige Lampe, die ich in die Verlängerungssteckdose gestöpselt hatte. Ich hatte Papier und Zeichensachen. Ich hatte noch meine Motorradtaschen mit all meinen Kleidern darin. Ich hatte mein Safeschloss und mein Lockpicking-Set.
Ich hatte die Pager.
Es gab fünf davon, versammelt in einem zerdellten Schuhkarton. Ein Pager war mit weißem Isolierband markiert, einer mit gelbem, einer mit grünem, einer mit blauem. Der letzte mit rotem. Der Ghost hatte gesagt, wenn einer von den ersten vier klingelt, rufst du die Nummer im Display an und hörst, was man dir sagt. Sie wissen, dass du ihnen nicht antworten kannst. Sollte jemand nicht Bescheid wissen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die falsche Person am Telefon ist und du aufhängen solltest. Angenommen aber, die Leute sind im Bilde, dann hörst du dir an, was sie zu sagen haben, und triffst dich mit ihnen an dem angegebenen Ort. Wenn du immer noch den Eindruck hast, dass alles okay ist, gehst du mit ihnen und machst den Job. Du erledigst deinen Auftrag zuverlässig, dann kann jeder nur gewinnen. Sie werden dich anständig entlohnen, denn sie wissen, dass du den Pager sonst nicht anfasst, wenn sie wieder anrufen.
Darüber hinaus werden sie gewissenhaft die zehn Prozent »Benutzungsgebühr« an den Mann in Detroit schicken. Weil ihnen ihr Leben lieb ist.
Das gilt für die ersten vier Pager. Der letzte, der rot gekennzeichnete … das ist der Mann persönlich. Der Mann in Detroit. Du rufst die Nummer sofort an. Du tust, was der Mann dir sagt. Du erscheinst pünktlich genau dort, wohin er dich bestellt.
»Mit diesem Mann legt man sich nicht an.« Das waren die genauen Worte des Ghost. »Leg dich mit ihm an, dann kannst du dich auch gleich selbst umbringen und allen die Mühe ersparen.«
Ich wusste, dass er nicht übertrieb. Ich hatte genug mit eigenen Augen gesehen, um mir darüber im Klaren zu sein, dass ich seinen Rat unbedingt beherzigen musste. Doch was sollte ich so lange machen, während ich auf den nächsten Auftrag wartete? Wie lange würde ich hierbleiben und mich in diesem verlassenen Zimmer über dem Chinarestaurant in der 128th Street verstecken müssen, ehe sich wieder jemand meldete und ich ein bisschen Geld verdienen konnte?
Würde ich vorher verhungern? Oder erfrieren?
Darüber hatte der Ghost keine Auskunft gegeben.
Als es auf Weihnachten zuging, verließ ich dann doch ab und zu mal das Haus. Ich lief zu einem Park ein paar Blocks weiter südlich und setzte mich auf eine Bank. Irgendwann musste ich auch ein paar neue Sachen zum Anziehen kaufen. Ich war noch nicht pleite, wohlgemerkt. Für den Job in Pennsylvania war ich gut bezahlt worden. Aber ich konnte rechnen und wusste, dass es nicht mehr lange so weiterging.
Um alles noch einen Tick schlimmer zu machen, eröffnete mir einer der Männer aus dem Restaurant, dass ich ihm helfen müsse, wenn er mich weiter mit Essen versorgen solle. Er gab mir einen dicken Stapel Flyer mit der Speisekarte darauf und wies mich an, die Häuser in der Nachbarschaft abzuklappern, mir irgendwie Zutritt zu verschaffen und unter jede Wohnungstür einen Flyer zu schieben. Ich wusste, dass manche Gebäude einen Türsteher am Eingang hatten und dass man bei den anderen von jemandem per Sprechanlage hereingelassen werden musste. Daher war ich nicht sicher, wie ich die Dinger verteilen sollte. Ich meine, okay, ich hätte bei den meisten Häusern den Hintereingang ausfindig machen und das Schloss knacken können, aber war es das wert?
»Du hast nettes feines Gesicht«, sagte der Mann. Sein Englisch war noch nicht ganz auf der Höhe. »Leute lassen dich rein.«
Also ging ich mit meinem netten feinen Gesicht und meinem Stapel Flyer von Haus zu Haus. Ich nahm mir vor, mich gar nicht erst groß zu verstellen, sondern ganz offen zu sein mit dem, was ich da tat. Die Prospekte vorzuzeigen und pantomimisch unter eine Tür zu schieben. Dazu hier und da noch ein bisschen Gebärdensprache einzuwerfen. Es schien zu wirken. In die meisten Gebäude ließ man mich hinein.
Eines Tages, ich arbeitete mich gerade durch einen langen Etagenflur vor, ging plötzlich eine Tür auf, als ich eine Speisekarte unter ihr durchschieben wollte. Noch ehe ich mich aufrichten konnte, packten mich zwei Hände an den Schultern und stießen mich mit solcher Wucht an die Wand gegenüber, dass mir die Luft wegblieb.
Ich hob den Kopf und blickte in das Gesicht des Mannes. Es versetzte mich wieder an jenen Abend zurück, als ich neun war und dieser andere Kerl den Schnapsladen meines Onkels ausgeraubt hatte. Die gleiche animalische Furcht in den Augen. Ein ekliger Gestank nach ungewaschenen Klamotten, Urin, vielleicht auch Furcht an sich, drang auf mich ein. Ich trat nach seinen Knien, worauf er rückwärtstaumelte. Dann rannte er durch den Gang, riss die Tür am Ende auf und verschwand die Treppe hinunter.
Ich rappelte mich auf und rieb meine Schultern. Durch die offenstehende Wohnungstür sah ich die Zerstörung darin. Der Mann hatte alles auseinandergenommen bei seiner Suche nach irgendwelchen Wertgegenständen. Damit er mehr Drogen kaufen konnte oder was es sonst war, was er gerade so dringend brauchte. Der Kühlschrank stand offen, und sogar das Essen darin war durchwühlt worden und nun verdorben. Ich schloss die Wohnungstür und ging.
Als ich nach unten kam, schrieb ich die Nummer des Apartments auf die Rückseite einer Speisekarte und gab sie dem Portier. Dann ging ich zurück zum Restaurant.
Ich stieg in mein Zimmer hinauf und zählte mein übriges Geld. Ich lebe von geborgter Zeit, dachte ich. Wie lange noch, bis du so verzweifelt bist wie dieser Einbrecher?
Es wurde stetig kälter. Der erste Schnee fiel in der Nacht. Zuerst weiß, aber schmutzig am Morgen.
Ich wachte auf und hörte einen der Pager piepen.
Ich traf mich mit den Männern in einem Diner in der Bronx. Eine kleine Taxifahrt über den Hudson River. Sie hatten mich auf dem gelben Pager angerufen, und ich wusste natürlich noch, was der Ghost über den gelben Pager gesagt hatte. Das war die allgemeine Nummer, mit der mich so gut wie jeder Schwachkopf erreichen konnte. Deshalb äußerste Vorsicht walten lassen. Allerdings war ich derzeit, sagen wir mal, besonders motiviert. So betrat ich also an diesem kalten Nachmittag den Diner und stand ein paar Minuten einfach da, bis mich jemand in einer Sitznische ganz hinten neben der Schwingtür zur Küche herbeiwinkte. Drei Männer saßen dort. Einer von ihnen stand auf, packte meine Hand und zog mich in eine angedeutete Umarmung.
»Du musst der Kleine sein«, sagte er. Er trug eine grasgrüne Jacke von den New York Jets und eine Goldkette, und er hatte so einen kurzen Julius-Caesar-Haarschnitt, dem er offenbar zu viel Zeit widmete. Dazu einen rasiermesserdünnen, perfekt symmetrischen Backenbart, der in einem kleinen Unterlippenbärtchen zusammenlief. Sie wissen schon – weißer Junge, der ums Verrecken nicht weiß aussehen will.
»Das sind meine Jungs«, stellte er die anderen beiden vor. »Heckle und Jeckle.«
Damit ersparte er mir wenigstens die Mühe, Aliasse zu erfinden. Er rutschte wieder auf seine Sitzbank und machte Platz für mich.
»Willst du was essen? Wir haben gerade bestellt.« Dieses dünne Bartding ließ seinen Mund irgendwie größer wirken, und ich sollte bald feststellen, dass er ihn keine Minute lang halten konnte. Also taufte ich ihn prompt Großmaul. Er rief die Kellnerin, die mir eine Speisekarte gab. Ich zeigte auf einen Hamburger.
»Was ist, redest du nicht?«, fragte sie.
»So isses. Er redet nicht«, sagte Großmaul. »Hast du ein Problem damit?«
Sie nahm mir die Speisekarte ab und ging ohne ein weiteres Wort davon.
»Ich hab von dir gehört«, sagte er, als sie außer Hörweite war. »Du hast gerade eine kleine Nummer mit einem Freund von einem Freund von mir durchgezogen.«
Das beantwortete meine erste Frage, nämlich wieso er am Telefon schon zu wissen schien, dass ich irgendwo in der Stadt war. Unwillkürlich stellte ich mir eine Unzahl von zwielichtigen Typen dort draußen vor, die alle jederzeit meinen ungefähren Aufenthaltsort kannten.
»Verdammt, Mann«, sagte er. »Ich hab zwar gehört, dass du jung aussiehst, aber Mann, leck mich.«
Heckle und Jeckle sagten nichts. Sie hatten Milchshakes vor sich stehen, Schokolade und Vanille, wie es aussah, und gaben sich damit zufrieden, an ihren Strohhalmen zu nuckeln und zu allem zu nicken, was Großmaul von sich gab.
»Okay, die Situation ist folgende«, begann er und senkte die Stimme. »Wir haben da einen Kumpel …«
Er macht das tatsächlich hier, dachte ich. Er breitet den ganzen Plan in einem Diner aus.