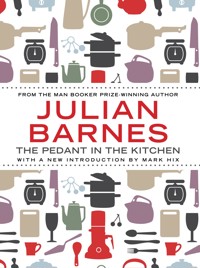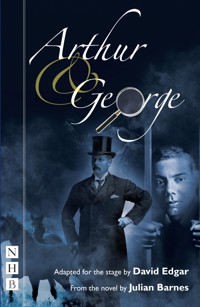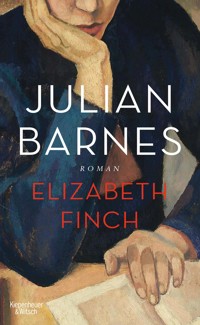9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte des französischen Arztes Samuel Pozzi und ein einzigartiger Einblick in das Paris der Belle Époque – eine Zeit des Wandels, der Wissenschaft und der Entdeckungen Dr. Samuel Pozzi (1846–1918) war Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische. Ebenso reiste Dr. Pozzi, um Erkenntnisse zu gewinnen, und stand für einen engen Austausch zwischen England und dem Kontinent. Julian Barnes beleuchtet diese fruchtbaren Beziehungen und schreibt zugleich ein spannendes Plädoyer, an der Idee Europas festzuhalten. Kenntnisreich, elegant und akribisch recherchiert, beschreibt Julian Barnes das privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt die Kulturgeschichte des Fin de Siècle und seiner Protagonistinnen und Protagonisten: Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller. Von Robert de Montesquiou und Émile Zola bis hin zu Sarah Bernhardt und Marcel Proust.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Julian Barnes
Der Mann im roten Rock
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograf, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter »Flauberts Papagei«, »Eine Geschichte der Welt in 10 ½ Kapiteln« und »Lebensstufen«. Für seinen Roman »Vom Ende einer Geschichte« wurde er mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Julian Barnes lebt in London.
Die Übersetzerin
Gertraude Krueger, geboren 1949, lebt als freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E.L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Julian Barnes lässt uns teilhaben am Leben von Dr. Samuel Pozzi (1846–1918), dem damals bekannten Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische. Julian Barnes zeichnet das Bild einer ganzen Epoche am Beispiel dieses charismatischen Mannes.
»Das meisterhaft recherchierte und geschriebene Porträt eines Intellektuellen … und mindestens drei Kulturgeschichten jener Epoche in einem … ein unvergessliches Lese- und Schauerlebnis.« Andreas Platthaus, FAZ
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Im Juni 1885 …
Ein Gerücht am Werk
Fünf Streiflichter auf Pozzi
Pozzi im Auktionshaus
Pozzi im Salon
Pozzi im Rauchsalon
Pozzi im Ausland
Pozzi auf dem Ball der Medizinstudenten
Wie man sich als Gast benimmt
Wie man mit Menschen umgeht, die einem literarisch (und gesellschaftlich) unterlegen sind
Was wir alles nicht wissen
Anmerkung des Autors
Bildnachweis
Danksagung
Literaturhinweise zur deutschen Ausgabe
– Für Rachel –
Im Juni 1885 kamen drei Franzosen in London an. Einer war ein Prinz, einer war ein Graf und der Dritte war ein einfacher Bürger mit einem italienischen Familiennamen. Der Graf beschrieb den Zweck der Reise später als »intellektuelle und dekorative Einkaufstour«.
Wir könnten auch im Sommer davor in Paris beginnen, wo Oscar und Constance Wilde ihre Flitterwochen verbringen. Oscar liest einen kürzlich erschienenen französischen Roman und gibt, des romantischen Anlasses ungeachtet, fröhlich Interviews für die Presse.
Wir könnten auch mit einer Kugel beginnen und mit der Waffe, aus der sie abgeschossen wurde. Das funktioniert eigentlich immer: Eine eherne Theaterregel besagt, wenn man im ersten Akt eine Waffe sieht, wird sie im letzten garantiert abgefeuert. Aber welche Waffe und welche Kugel? Es gab so viele zu jener Zeit.
Wir könnten sogar auf der anderen Seite des Atlantiks beginnen, in Kentucky, und schon 1809, als Ephraim McDowell, der Sohn schottischer und irischer Einwanderer, Jane Crawford bei einer Operation eine Eierstockzyste entfernt, die fünfzehn Liter Flüssigkeit enthält. Zumindest dieser Erzählstrang hat ein glückliches Ende.
Dann ist da noch der Mann, der in Boulogne-sur-Mer in seinem Bett liegt – vielleicht mit einer Frau an seiner Seite, vielleicht allein – und sich fragt, was er machen soll. Nein, das stimmt nicht ganz: Er weiß, was er machen soll, er weiß nur nicht, wann und ob er machen kann, was er machen will.
Oder wir beginnen ganz prosaisch mit dem Mantel. Falls der nicht eher als ein Morgenrock zu bezeichnen ist. Rot – genauer gesagt scharlachrot –, bodenlang vom Hals bis zum Knöchel, lässt er weißleinene Rüschen an Handgelenken und Kehle aufblitzen. Unten bringt ein einzelner Brokatpantoffel winzige Tupfer von Gelb und Blau in die Bildkomposition ein.
Ist es unfair, mit dem Rock zu beginnen statt mit dem Mann darin? Aber mit diesem Rock oder vielmehr mit dessen Darstellung ist uns der Mann bis heute in Erinnerung geblieben, wenn er uns überhaupt in Erinnerung geblieben ist. Wie er das wohl aufgenommen hätte? Erleichtert, belustigt, ein klein wenig gekränkt? Das hängt davon ab, welches Bild wir uns aus dieser Distanz von seinem Charakter machen.
Aber sein Mantel erinnert uns an einen anderen Mantel, von demselben Künstler gemalt. Er umhüllt einen gut aussehenden jungen Mann aus guter – oder jedenfalls prominenter – Familie. Doch der junge Mann ist, obwohl er für den berühmtesten Porträtmaler jener Zeit posiert, nicht glücklich. Das Wetter ist mild, aber der Mantel, den er tragen soll, ist aus schwerem Tweed und für eine ganz andere Jahreszeit gedacht. Er beklagt sich bei dem Maler über diese Wahl. Der Maler erwidert – und wir kennen nur seine Worte, können also den Ton nicht auf einer Skala von sanft-neckend über professionell-bestimmend bis autoritär-herablassend einordnen –, der Maler erwidert: »Es geht hier nicht um Sie, es geht um den Mantel.« Und es stimmt, genau wie bei dem roten Morgenrock erinnern wir uns heute eher an den Mantel als an den jungen Mann darin. Die Kunst überdauert persönliche Launen, Familienstolz, gesellschaftliche Dogmen; die Kunst hat immer die Zeit auf ihrer Seite.
Machen wir also weiter mit dem Greifbaren, dem Spezifischen, dem Alltäglichen: dem roten Rock. Denn so bin ich dem Bild und dem Mann zum ersten Mal begegnet: 2015 in der National Portrait Gallery in London als Leihgabe aus Amerika. Ich habe diesen Rock eben einen Morgenrock genannt, aber auch das ist nicht ganz richtig. Der Mann trägt wohl kaum einen Pyjama darunter – es sei denn, die spitzenbesetzten Manschetten und der Spitzenkragen gehörten zu einem Nachthemd, was eher unwahrscheinlich ist. Sollen wir ihn dann vielleicht einen Tagesrock nennen? Sein Besitzer ist wohl kaum eben erst aus dem Bett gefallen. Wir wissen, dass das Bild in den späten Vormittagsstunden gemalt wurde und Künstler und Modell danach zusammen zu Mittag aßen; wir wissen auch, dass die Frau des Modells über den großen Appetit des Malers staunte. Wir wissen, dass das Modell bei sich zu Hause ist, weil der Titel des Bildes uns das sagt. Dieses »Zuhause« ist mit einem tieferen Rotton wiedergegeben: ein burgunderfarbener Hintergrund, von dem sich die zentrale scharlachrote Figur abhebt. Da sind schwere Vorhänge, die von einer Schlaufe zusammengehalten werden, und eine weitere, andersartige Stoffbahn; das Ganze verschmilzt ohne erkennbare Trennlinie zu einem Fußboden von derselben burgunderroten Farbe. Das ist alles höchst theatralisch inszeniert: Nicht nur die Pose, auch der malerische Stil hat etwas Großspuriges.
Das Bild wurde vier Jahre vor jener Reise nach London gemalt. Das Modell – der Bürgerliche mit dem italienischen Namen – ist 35, sieht gut aus, trägt einen Bart und schaut selbstbewusst über unsere rechte Schulter. Er ist eine virile und dabei doch feingliedrige Erscheinung, und allmählich, nach dem ersten Eindruck des Bildes, bei dem wir durchaus annehmen könnten, es gehe »nur um den Mantel«, erkennen wir, dass dem nicht so ist. Es geht eher um die Hände. Die linke liegt auf der Hüfte, die rechte auf der Brust. Die Finger sind der ausdrucksvollste Teil des Porträts. Jeder einzelne ist anders gestaltet: ganz ausgestreckt, halb gebogen, ganz gebogen. Wenn wir spontan den Beruf des Mannes erraten sollten, würden wir ihn vielleicht für einen Klaviervirtuosen halten.
John Singer Sargent, Dr. Pozzi at Home (1881) © Foto: Armand Hammer Foundation, USA / Bridgeman Images
Rechte Hand an der Brust, linke Hand an der Hüfte. Vielleicht steckt aber noch mehr dahinter: rechte Hand auf dem Herzen, linke Hand an den Lenden. Lag das in der Absicht des Künstlers? Drei Jahre später malte er das Porträt einer Dame der Gesellschaft, das im Pariser Salon für einen Skandal sorgte. (Ob das Paris der Belle Époque noch zu schockieren war? Aber ja; und es konnte ebenso heuchlerisch sein wie London.) Die rechte Hand spielt mit etwas, was wie ein Knebelverschluss aussieht. Die linke Hand ist in eine der beiden Taillenkordeln des Rocks verhakt, die ein Echo der Vorhangschlaufen im Hintergrund bilden. Das Auge folgt den Kordeln bis zu einem komplizierten Knoten, an dem ein Paar fedrige, pelzige Quasten baumelt, eine über der anderen. Sie hängen eben unterhalb der Lenden, wie ein scharlachroter Stierpenis. Hat der Maler das so gewollt? Wer weiß das schon? Er hat keinen Bericht zu dem Bild hinterlassen. Aber er war nicht nur ein prachtvoller, sondern auch ein durchtriebener Maler; auch ein Maler der Pracht und Herrlichkeit, der keinen Streit scheute, ihn vielleicht sogar suchte.
Die Pose ist edel, heroisch, aber die Hände lassen sie subtiler und komplizierter erscheinen. Nicht die Hände eines Konzertpianisten, wie sich herausstellt, sondern die eines Arztes, eines Chirurgen, eines Gynäkologen.
Und der scharlachrote Stierpenis? Alles zu seiner Zeit.
Also ja, beginnen wir mit dem Besuch in London im Sommer 1885.
Der Prinz war Edmond de Polignac.
Der Graf war Robert de Montesquiou-Fezensac.
Der Bürgerliche mit dem italienischen Namen war Dr. Samuel Jean Pozzi.
Ihre intellektuelle Einkaufstour begann mit dem Händel-Festival im Crystal Palace, wo sie zur Feier des zweihundertjährigen Geburtstags des Komponisten Israel in Egypt hörten. Wie Polignac notierte, hatte »die Aufführung eine gigantische Wirkung. Die 4000 Mitwirkenden bereiteten le grand Haendel [sic] ein königliches Fest«.
Die drei Einkäufer kamen auch mit einem Empfehlungsschreiben von John Singer Sargent, dem Maler von Dr. Pozzi at Home. Es war an Henry James adressiert, der das Bild 1882 in der Royal Academy gesehen hatte und den Sargent viele Jahre später, nämlich 1913, mit seiner ganzen Meisterschaft malen würde, als Henry James siebzig war. Der Brief begann:
Lieber James,
ich erinnere mich, dass du einmal sagtest, ab und zu sei ein Franzose keine unangenehme Abwechslung für dich in London, und ich war so kühn, zwei Freunden von mir ein Empfehlungsschreiben für dich zu geben. Der eine ist Dr.S. Pozzi, der Mann im roten Rock (nicht immer), ein ganz hervorragendes Geschöpf, und der andere ist der einzigartige und höchst ungewöhnliche Mensch Montesquiou.
Seltsamerweise ist das der einzige erhaltene Brief von Sargent an James. Der Maler weiß anscheinend nicht, dass auch Polignac mit von der Partie sein würde, eine Ergänzung, die Henry James sicher gefallen und interessiert hätte. Oder auch nicht. Proust pflegte zu sagen, der Prinz sei so etwas wie »ein stillgelegter Kerker, der in eine Bibliothek verwandelt wurde«.
Pozzi war damals achtunddreißig, Montesquiou dreißig, James zweiundvierzig und Polignac einundfünfzig.
Henry James hatte für die zwei vorhergehenden Monate ein Cottage auf der Hampstead Heath gemietet und wollte schon nach Bournemouth zurückkehren, verschob dann aber seine Abreise. Zwei Tage, den 2. und 3. Juli 1885, widmete er sich diesen drei Franzosen, die, wie der Romancier später schrieb, »den sehnlichen Wunsch hatten, den Londoner Ästhetizismus zu sehen«.
Henry James’ Biograf Leon Edel beschreibt Pozzi als »Modearzt, Büchersammler und allgemein kultivierten Gesprächspartner«. Die Gespräche sind nicht überliefert, die Büchersammlung ist längst in alle Winde zerstreut, bleibt nur der Modearzt. Im roten Rock (nicht immer).
Der Graf und der Prinz entstammten alten Adelsgeschlechtern. Der Graf führte seine Abstammung auf den Musketier d’Artagnan zurück, und sein Großvater war ein Adjutant Napoleons. Die Großmutter des Prinzen war eine enge Freundin von Marie Antoinette; sein Vater war Staatsminister in der Regierung Karls X. und Verfasser der Juliordonnanzen, die mit ihrem Absolutismus die Julirevolution von 1830 auslösten. Unter der neuen Regierung wurde der Vater des Prinzen zum »bürgerlichen Tod« verurteilt, sodass er vor dem Gesetz nicht mehr existierte. Auf gut französische Art wurden dem nicht mehr existierenden Mann während der Gefangenschaft jedoch eheliche Besuche gestattet, deren Folge dann Edmond war. Auf seiner Geburtsurkunde wurde der bürgerlich tote Aristokrat in der Rubrik »Vater« als »Der Prinz namens Marquis de Chalançon, zurzeit auf Reisen« eingetragen.
Die Pozzis waren italienische Protestanten aus dem Veltlin im Norden der Lombardei. In den Religionskriegen des frühen siebzehnten Jahrhunderts war ein Pozzi unter den vielen, die 1620 ihres Glaubens wegen im protestantischen Gotteshaus von Teglio (deutscher Name: Tell) verbrannten. Kurz darauf übersiedelte die Familie in die Schweiz. Samuel Pozzis Großvater Dominique ging dann als Erster nach Frankreich, zog in Etappen langsam durch das ganze Land und ließ sich schließlich als Patissier in Agen nieder; er französisierte den Familiennamen zu Pozzy. Das letzte seiner elf Kinder – naturgemäß Benjamin genannt – wurde protestantischer Pfarrer in Bergerac. Die Familie des Pfarrers war fromm und republikanisch, gottesfürchtig und sich ihrer gesellschaftlichen und moralischen Pflichten bewusst. Samuels Mutter, Inès Escot-Meslon aus dem Adel des Périgord, brachte das bezaubernde, im achtzehnten Jahrhundert erbaute Landhaus La Graulet in die Ehe ein, wenige Kilometer von Bergerac entfernt, das Pozzi sein Leben lang hegen und pflegen und erweitern würde. Seit jeher zart und von den vielen Geburten geschwächt, starb sie, als Samuel zehn Jahre alt war; der Pfarrer verheiratete sich schnell wieder mit einer »jungen und robusten« Engländerin, Marie-Anne Kempe. Samuel wuchs zweisprachig mit Französisch und Englisch auf. Er änderte auch den Familiennamen 1873 wieder zu Pozzi.
»Was für ein seltsames Trio«, sinniert Pozzis Biograf Claude Vanderpooten über diesen Ausflug nach London. Damit meint er zum Teil die Rangunterschiede, aber vielleicht auch die Anwesenheit eines bekanntermaßen heterosexuellen Bürgerlichen neben zwei Aristokraten mit »uranistischen Neigungen«. (Und wenn sie sich wie Proust’sche Figuren anhören, dann liegt das daran, dass sie alle eine – fragmentarische, gebrochene – Verwandtschaft mit Figuren bei Proust haben.) Für Pariser Ästheten auf Besuch in London gab es damals zwei unmittelbare Ziele: Liberty & Co., 1875 in der Regent Street eröffnet, und die Grosvenor Gallery. Montesquiou hatte im Pariser Salon von 1875 Edward Burne-Jones’ The Beguiling of Merlin bewundert. Jetzt lernten sie den Maler persönlich kennen, der sie in das »Abbey-Phalansterium« von William Morris führte, wo sich der Graf einige Stoffe aussuchte, und in das Atelier von William De Morgan. Außerdem lernten sie Lawrence Alma-Tadema kennen. In der Bond Street wählten sie Tweed- und Anzugstoffe, Hüte, Mäntel, Hemden, Krawatten und Parfüms aus, in Chelsea sahen sie sich das Haus von Carlyle an, und sie suchten Buchhandlungen auf.
Henry James war ihnen ein aufmerksamer Gastgeber. Er berichtete, er finde Montesquiou »wunderlich, aber unbedeutend« und Pozzi »charmant« (Polignac bleibt offenbar wieder unbemerkt). Er führte sie zum Essen in den Reform Club aus, wo er sie Whistler vorstellte, zu dem Montesquiou eine starke Zuneigung entwickelte. Henry James arrangierte für sie auch einen Besuch in Whistlers Peacock Room im Haus des Reedereimagnaten F.R. Leyland. Doch da war Pozzi schon durch ein Telegramm der Frau eines seiner prominenten Patienten, Alexandre Dumas dem Jüngeren, nach Paris zurückgerufen worden.
Von Paris aus schrieb Pozzi am 5. Juli dem Grafen mit der Bitte, er möge noch einmal zu Liberty’s gehen und seine dort bereits aufgegebene Bestellung erweitern. Er wollte »dreißig Ballen des seetangfarbenen Vorhangstoffs, von dem ich ein Muster beilege. Bezahlen Sie bitte für mich. Dann schulde ich Ihnen dreißig Schillings [sic] und großen Dank.« Er unterzeichnete als »Der ergebene Freund Ihrer Präraffaelitenschaft«.
Als das »seltsame Trio« in London eintraf, war keiner der drei über seinen engeren Kreis hinaus bekannt. Prinz Edmond de Polignac hatte unerfüllte musikalische Ambitionen und war, auf Drängen seiner Familie, viele Jahre auf der gutmütigen, halbherzigen, theoretischen Suche nach einer Ehefrau durch Europa gereist; irgendwie gelang es ihm – mehr als der jeweiligen Dame –, sich immer wieder aus der Affäre zu ziehen. Pozzi konnte auf eine zehnjährige Karriere als Arzt, Chirurg und Salonlöwe zurückblicken, arbeitete an einem öffentlichen Krankenhaus und baute sich gleichzeitig eine illustre private Klientel auf. Beide würden in späteren Jahren ein gewisses Maß an Ruhm und Zufriedenheit erlangen. Und dieser, wenn auch bescheidene, Ruhm hatte den Vorzug, dass er sich – soweit das eben möglich ist – darauf gründete, dass man mehr oder weniger genau wusste, wer sie waren.
Bei Montesquiou lag der Fall komplizierter. Er war in der Welt, in der die drei sich zumeist bewegten, der Bekannteste von ihnen: ein Mann der Gesellschaft, ein Dandy, Ästhet, Connaisseur, geistreicher Kopf und Arbiter Elegantiarum. Er hegte auch literarische Ambitionen und schrieb parnassianische Gedichte in strengen Metren sowie satirische vers de société. Als junger Bonvivant war er im Hotel Meurice einst Flaubert vorgestellt worden. Er war so überwältigt gewesen, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte (was ausgesprochen selten vorkam); aber er tröstete sich damit, dass er »zumindest seine Hand berührt und so von ihm wenngleich keine Fackel, so doch eine einzelne Flamme« empfangen habe. Jedoch nahm für den Grafen bereits ein seltenes und wenig beneidenswertes Schicksal seinen Lauf: Er wurde im Bewusstsein der Öffentlichkeit – oder zumindest der lesenden Öffentlichkeit – mit einem Alter Ego verwechselt. Im Leben wie auch in seinem Nachleben wurde er von Schattenversionen seiner selbst verfolgt.
Montesquiou war dreißig, als er im Juni 1885 nach London kam. Genau ein Jahr zuvor, im Juni 1884, hatte Joris-Karl Huysmans seinen sechsten Roman À Rebours – übersetzt als Gegen den Strich oder Wider die Natur – herausgebracht, dessen Hauptfigur ein 29-jähriger Aristokrat ist: der Herzog Jean Floressas des Esseintes. Die fünf früheren Romane Huysmans’ waren Übungen in zolaeskem Naturalismus gewesen; jetzt warf er das alles über Bord. Gegen den Strich ist eine träumerisch-meditative Bibel der Dekadenz. Des Esseintes ist ein Dandy und Ästhet, kränklich durch zu viel Inzucht, der letzte seines Geschlechts, mit seltsamen und verderblichen Neigungen, einem Faible für Kleider, Schmuck, Düfte, seltene und prachtvoll gebundene Bücher. Huysmans, ein kleiner Beamter, der Montesquiou nur gerüchteweise kannte, hatte sich von seinem Freund, dem Dichter Mallarmé, Hintergrundinformationen über das Haus des Grafen verschafft. Der Graf hatte neuartige und idiosynkratische Vorstellungen zur Wohnungseinrichtung: Er stellte einen Schlitten auf einem Eisbärenfell, Kirchengestühl, ein Sortiment seidener Socken in einer Glasvitrine und eine lebendige, vergoldete Schildkröte zur Schau. Das Authentische dieser Details war für Montesquiou ein Ärgernis, denn einige Leser würden den Riegel eines Schlüsselromans klappern hören und alles andere in dem Roman für ebenso wahr halten. Es heißt, Montesquiou habe einst einige seltene Bücher bei einem Händler bestellt, der zufällig mit Huysmans befreundet war; als er die Bände abholen wollte, erkannte der Buchhändler den Grafen nicht und bemerkte zu dessen Verdruss: »Monsieur, diese Bücher wären eines Des Esseintes’ würdig.« (Vielleicht hatte er ihn auch erkannt.)
Und noch eine weitere Parallele. Ein Jahr, bevor Montesquiou zum ersten Mal nach London reiste, war sein fiktionales Schattenpendant mit exakt derselben Absicht aufgebrochen, und diese »Reise« gehört zu den berühmtesten Kapiteln des Romans. Des Esseintes lebt in geistiger Isolation, jedoch unweit der Hauptstadt in Fontenay; eines Morgens lässt er sich von seinem Diener einen Anzug herauslegen, den er, wie alle gut gekleideten Pariser, »einstmals in London bestellt« hatte. Er nimmt den Zug nach Paris und kommt an der Gare de Sceaux an. Das Wetter ist lausig. Er ruft einen Kutscher herbei und mietet den Wagen stundenweise. Die Kutsche bringt ihn zuerst zur Buchhandlung Galignani’s Messenger in der Rue de Rivoli, wo er sich Reiseführer von London anschaut. Beim Blättern im Baedeker entdeckt er eine Aufzählung Londoner Kunstgalerien, die ihn von moderner britischer Kunst und insbesondere von J.E. Millais und G.F. Watts träumen lässt: Die Bilder des Letzteren erscheinen ihm wie »von einem kranken Gustave Moreau skizziert«. Das Wetter ist nach wie vor abscheulich – »ein Vorschuss auf England, den er schon in Paris bekam«. Der Kutscher fährt ihn zu der »Bodega«, die ihrem Namen zum Trotz von Engländern frequentiert wird; hier finden Auslandsbriten wie Touristen die Dessertweine, die sie so lieben. Er sieht »Tisch an Tisch mit Körbchen voller Palmers-Kekse und Salzgebäck und mit Tellern, worauf sich dünne Pies und Sandwiches stapelten, die unter ihrer faden Hülle einen beißenden Senfbelag verbargen«. Er trinkt ein Glas Portwein und dann einen Sherry Amontillado. Er findet sich von Engländern umgeben, die sich in seiner Vorstellung in Gestalten von Dickens verwandeln. »Er machte es sich gemütlich in diesem fiktiven London.«
Bald meldet sich der Hunger: Des Esseintes wird zu einer Taverne in der Rue d’Amsterdam nahe der Gare Saint-Lazare gebracht, von wo später der Fährzug abfahren wird. Das ist erkennbar Austin’s Bar, auch English Tavern genannt, später dann Bar Britannia (und noch immer als Hotel Britannia erhalten). Sein Mahl besteht aus fetter Ochsenschwanzsuppe, geräuchertem Haddock, Roastbeef mit Kartoffeln, Stiltonkäse und Rhabarberkuchen; er trinkt zwei Pints Ale, ein Glas Porter, Kaffee mit einem Schuss Gin und schließlich noch einen Brandy; zwischen dem Porter und dem Kaffee raucht er eine Zigarette.
Wie in der Bodega lesen auch hier in der Taverne »Inselbewohner mit Fayenceaugen, karmesinrotem Teint und nachdenklicher oder hochmütiger Miene ausländische Blätter«; aber hier essen auch »Frauen ohne Kavaliere« zu Abend, »robuste Engländerinnen mit Knabengesichtern, Zähnen so breit wie Schaufeln, zu Apfelbäckchen gefärbten Wangen, langen Händen und langen Füßen. Mit wahrer Gier attackierten sie einen Rumpsteak-Pie.«
Giovanni Boldini, Graf Robert de Montesquiou (1897) © Foto: RMN / Musée d’Orsay, Frankreich
(Immer die englischen Frauen. In Frankreich sind sie damals Zielscheibe pauschalen Spotts, werden als große, rotgesichtige, linkische Wesen hingestellt, die sich meist im Freien aufhalten und den Französinnen nicht das Wasser reichen können, schon gar nicht den Pariserinnen, die der Inbegriff der Vollkommenheit ihres Geschlechts sind. Engländerinnen werden oft als sexuell merkwürdig unerweckt geschildert, woran wiederum nur die englischen Männer schuld sein können, die unfähig sind, bei ihren Ehefrauen – oder auch nur ihren Mätressen – sexuelle Leidenschaft zu entfachen. Die Überzeugung, dass Briten und Sex nur betrübtes Mitleid verdienen, ist ein hartnäckiges Dogma. Ich weiß noch, dass ich in Paris war, als herauskam, dass Prinz Charles während seiner gesamten Ehe mit »LaddyDi«, wie die Franzosen den Namen aussprachen, ein Verhältnis mit Camilla Parker Bowles unterhalten hatte. »Wie sonderbar«, ließ mich mehr als ein entzücktes Pariser Gemurmel wissen, »dass man sich eine Geliebte aussucht, die reizloser ist als die eigene Frau!« Also wirklich, diese Angelsachsen, ils sont incorrigibles.)
Des Esseintes hat noch genügend Zeit bis zur Abfahrt seines Zugs, ertappt sich aber bei dem Gedanken, dass bei früheren Auslandsreisen – nach Holland – seine Erwartung, das holländische Leben werde Ähnlichkeiten mit der holländischen Kunst haben, rüde enttäuscht wurde. Was, wenn das Londoner Leben ähnlich hinter seinem dickensianischen Vorverständnis zurückbliebe? »Wozu sich von der Stelle rühren«, fragt er sich, »wenn man so herrlich auf einem Stuhl reisen konnte? War er denn nicht in London?« Warum soll man sich der Realität aussetzen, wenn die Vorstellung genauso eindrucksvoll, wenn nicht noch eindrucksvoller sein kann? Und so bringt der treue, wenn auch teure Kutscher seinen Gast zur Gare de Sceaux zurück, von wo er wieder nach Hause fährt.
Montesquiou steigt in den Zug, Des Esseintes nicht; Montesquiou ist gesellig, Des Esseintes lebt wie ein Einsiedler; Montesquiou hat mit der Religion nicht viel im Sinn (außer mit ihren Artefakten), Des Esseintes wendet sich, wie sein Schöpfer, in seiner Qual wieder Rom zu. Und so weiter. Dennoch »war« Des Esseintes Montesquiou: Das wusste die ganze Welt. Und ich wusste es auch, denn als ich mir 1967 die englische Taschenbuchausgabe von À Rebours kaufte, prangte auf dem Umschlag der Kopf aus Boldinis Porträt von Le comte Robert de Montesquiou.
Des Esseintes kam nie in London an, ebenso wenig Huysmans, und À Rebours wurde erst 1922 ins Englische übersetzt, fünfzehn Jahre nach dem Tod seines Verfassers und ein Jahr nach dem Tod von Robert de Montesquiou. Doch auf andere Art überquerte das Buch sehr wohl den Ärmelkanal und erreichte London exakt am Nachmittag des dritten April 1895. Edward Carson, Kronanwalt und Mitglied des Parlaments, legt das Buch – oder zumindest seinen Titel und den Inhalt – beim zweiten der drei Prozesse von Oscar Wilde im Old Bailey als Beweismittel vor. Der Verteidiger von Lord Queensberry befragt Wilde zu einer Szene in dessen Roman Das Bildnis des Dorian Gray. Es geht um den französischen Roman, den Lord Henry Wotton dem Titelhelden geschenkt hat – was schon schlimm genug ist, könnte ein patriotisch gesinnter britischer Geschworener zu denken versucht sein. Oscar Wilde will sich erst herausreden, gibt dann aber zu, dass es sich bei dem Buch tatsächlich um Gegen den Strich handelt. Zugleich versucht er, sich von Huysmans’ Roman zu distanzieren: »Ich persönlich schätze dieses Buch nicht besonders«, und: »Ich halte es für ein schlecht geschriebenes Buch.«
Er muss wohl gehofft haben, dass die andere Seite keinen Zeitungsausschnittdienst abonniert hatte. Denn zehn Jahre zuvor hatte er in seinen Flitterwochen der Morning News (vom 20. Juni 1884) ein Interview gegeben, in dem er erklärte: »Dieses letzte Buch von Huysmans ist eins der besten, das ich je gesehen habe.« Doch Wilde log ja viel bei seinen Prozessen. Heute gilt er als schwuler Heiliger, als Märtyrer des englischen Puritanismus und der Heteronormativität. Das war er auch, aber nicht nur. Schließlich hatte er selbst überhaupt erst den Prozess gegen Lord Queensberry angestrengt. Wenn das mutig von ihm war, dann war es auch töricht, und Oscar Wilde war gefährlich eitel. Wer das Protokoll dieses zweiten Prozesses liest, erlebt einen Mann, der auf geradezu gespenstische Weise überzeugt ist, dass das geistsprühende Geplänkel, das in den Theatern des West End das Publikum entzückte, vor einem Gericht ebenso gut ankommen werde. Er führt seine Schlagfertigkeit vor; er klärt Carson gönnerhaft über Kunst und Moral auf; und er lügt skrupellos bei der Frage, um die sich alles dreht – ob er homosexuelle Handlungen vollzogen habe. Nach geltendem Recht wurde er am Ende des dritten Prozesses ordnungsgemäß verurteilt.
Er muss auch erkennen, dass ein Gerichtssaal – trotz einer historischen Überschneidung von Juristen und Dramatikern – nicht ganz dasselbe ist wie ein Theater. Wenn er also Witze reißt und Carson mit seinen Sophistereien piesackt, vergisst er zweierlei: erstens, dass auf der Geschworenenbank kein festlich gekleidetes Theaterpublikum sitzt – von den zwölf Geschworenen kamen sechs aus Clapton im Londoner Osten, und es waren ein Schuhmacher, ein Schlachter und ein Bankbote darunter; und zweitens, dass einem Kronanwalt nichts lieber ist als ein allzu selbstbewusster Zeuge, der sich für einen Star hält und daher nicht weiß, wo seine Grenzen sind.
In Das Bildnis des Dorian Gray gibt Oscar Wilde eine lyrische Zusammenfassung von Gegen den Strich, die Carson vor den Geschworenen verliest:
Es war das merkwürdigste Buch, das er [Gray] je gelesen hatte. Es schien ihm, als zögen in köstlichen Gewändern zum zarten Klange der Flöten die Sünden der Welt als Pantomime an ihm vorbei. Dinge, die er unbestimmt geträumt hatte, wurden plötzlich zur Wirklichkeit. Dinge, von denen er nie zu träumen gewagt hätte, enthüllten sich ihm allmählich. […]
Das Leben der Sinne war mit den Begriffen der mystischen Philosophie umschrieben. Man wusste manchmal kaum, ob man von den geistigen Ekstasen eines mittelalterlichen Heiligen oder die morbiden Bekenntnisse eines modernen Sünders las. Es war ein Buch, das Gift ausströmte. Ein schwerer Weihrauchduft schien über den Seiten zu schweben und das Gehirn zu verwirren.
Carson fragt, ob Gegen den Strich ein unmoralisches Buch sei. Er weiß, was Wilde antworten wird, weil sie das nicht zum ersten Mal erörtern. »Nicht sonderlich gut geschrieben«, antwortet Wilde, »aber ein unmoralisches Buch würde ich es nicht nennen. Es ist nicht gut geschrieben.« Carson hat schon zuvor konstatiert, dass es Wildes Ansicht nach keine moralischen und unmoralischen Bücher gibt, sondern nur gut geschriebene und schlecht geschriebene. Carson fragt mit gespielter Einfalt nach: »Darf ich das so verstehen, dass ein Buch noch so unmoralisch sein kann – wenn es gut geschrieben ist, dann wäre es ein gutes Buch?« Wilde erklärt ihm, dass ein gut geschriebenes Buch ein Gefühl von Schönheit hervorruft und ein schlecht geschriebenes ein Gefühl von Abscheu.
Carson: Ein gut geschriebenes Buch, das sodomitische Ansichten propagiert, kann ein gutes Buch sein?
Wilde: Kein Kunstwerk propagiert jemals Ansichten irgendwelcher Art.
Carson: Was?
Wie jeder tüchtige Anwalt wiederholt Carson den Begriff, den die Geschworenen sich einprägen sollen. »War Gegen den Strich ein sodomitisches Buch?« »War es ein Buch, Sir, das von unverhohlener Sodomie handelt?« Einmal greift Wilde zu der literarischen (und verschwurbelten) Verteidigung, zwar habe seine Beschreibung des »merkwürdigsten Buchs, das er [Dorian Gray] je gelesen hatte« eine auffallende Ähnlichkeit mit Gegen den Strich, doch wenn er dann später Stellen aus diesem französischen Roman anführe, seien das keine direkten Zitate aus Gegen den Strich, sondern von ihm erfundene. Carson erwidert ungerührt: »Eure Lordschaft, meine Frage war, ob das Buch Gegen den Strich ein Buch ist, das Sodomie darstellt.« Und so immer weiter. Die Geschworenen haben sicher verstanden.
Es ist der merkwürdigste englische Prozess um ein französisches Buch. Es geht nicht um ein importiertes pornografisches Werk, es geht um den Einfluss eines unübersetzten französischen Romans auf einen englischen Roman und um die Frage, ob folglich die Annahme korrekt wäre, dass der Verfasser des englischen Romans »ein posierender Somdomit« sei, wie es mit Lord Queensberrys berühmtem Verschreiber hieß. Leider gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob Huysmans damals wusste oder später erfuhr, dass sein Roman im Londoner Old Bailey quasi vor Gericht gestellt wurde.
Dass Frankreich generell ein Quell von Schmutz und Schund ist, war zur Zeit der Prozesse um Oscar Wilde in England bereits allgemein bekannt. Erst sieben Jahre zuvor war Edward Vizetelly, der Verleger von Zolas Romanen in (ohnehin schon leicht gesäuberter) Übersetzung, nach einer Kampagne der über die Moral wachenden National Vigilance Association gerichtlich belangt worden, weil sein Haus Die Erde herausgebracht hatte. Der Zweite Kronanwalt Mr Poland erklärte vor Gericht, der Roman sei »von A bis Z Schmutz«, und während ein landläufig schmutziges Buch vielleicht eine, zwei oder gar drei schmutzige Stellen enthalte, seien es in Die Erde nicht weniger als 21, die er den Geschworenen einzeln vorzulesen gedenke. Der Nebenrichter pflichtete ihm bei; zwar seien diese Stellen »alle zu einem gewissen Grad abstoßend«, doch sie seien »in der Anklageschrift aufgeführt und müssen belegt werden«. Ein Geschworener, den es ob der Bürde seines Amtes schauderte, fragte ängstlich nach: »Ist es denn nötig, sie alle zu verlesen?« Mr Poland führte den Geschworenen vor Augen, dass es für ihn ebenso unangenehm sei, diese Passagen zu verlesen, wie für sie, sich das alles anzuhören, schlug aber als Ausweg vor: »Falls Sie meinen, vorbehaltlich dessen, was mein kundiger Freund aufseiten der Verteidigung dazu sagt, dass diese Passagen obszön seien, werde ich unverzüglich mit dem Verlesen aufhören.«
An der Stelle erklärte Mr Williams, der Verteidiger von Vizetelly, klugerweise, sein Mandant bekenne sich schuldig, und ersparte den Geschworenen damit öffentliche Peinlichkeit. Es folgte dann einer der komischen Wortwechsel, die jedes Verfahren wegen Obszönität zieren:
Mr Williams: Ich möchte Eure Lordschaft daran erinnern, dass dies die Werke eines großen französischen Schriftstellers sind.
Der Zweite Kronanwalt: Eines überaus produktiven französischen Schriftstellers.
Der Nebenrichter: Eines populären französischen Schriftstellers.
Mr Williams: Eines Schriftstellers, der unter den Literaten Frankreichs einen hohen Rang einnimmt.
Wie auch immer, Vizetelly wurde zu einer Geldstrafe von £100 verurteilt mit der Auflage, sich zwölf Monate nichts weiter zuschulden kommen zu lassen.
Die britische Presse nahm den Fall Vizetelly mit einer Mischung aus Beifall, moralischer Empörung, Patriotismus und einer gewissen Skepsis auf: nicht hinsichtlich des Schmutzes, sondern des Schmutzanzeigers. Schließlich sah die Presse die Überwachung der Moral als eine ihrer vornehmsten Aufgaben an und wollte sie nicht einem anderen, ebenso selbst ernannten Zensor überlassen. Nachdenklichere Betrachtungen stellte der Liverpool Mercury an:
Allerdings finden wir es inkonsequent, dass diejenigen straflos ausgehen, die dieselben Werke verbreiten, solange sie in das originale Französisch gekleidet sind. Wenn die englischen Versionen gegen das Gesetz verstoßen, ist schwer zu verstehen, warum die erheblich abstoßenderen französischen Versionen im Umlauf sein dürfen. Die Wirkung auf die gebildeteren Leser ist gewiss ebenso gravierend wie auf die weniger gebildeten. Wenn ein Mensch Französisch lesen kann, macht ihn das nicht zu einem moralisch höherstehenden Wesen, und es gibt keinen logischen Grund, warum es ihm deswegen erlaubt sein soll, widerliche Früchte zu berühren und zu betrachten, die dem ausschließlich Englisch Lesenden wohlweislich verboten sind.
Das war scharfsinnig beobachtet: Vier Jahre zuvor wollte und konnte Oscar Wilde, obgleich in den Flitterwochen, einen moralisch verderblichen Roman im französischen Original lesen, und die Folgen waren nur allzu vorhersehbar und für jedermann zu erkennen.
Montesquiou und Polignac hatten sich 1875 in Cannes kennengelernt, im Landhaus von Polignacs Nichte, der Duchesse de Luynes. Montesquiou war noch keine zwanzig Jahre alt, aber sein Geschmack und seine Eitelkeit waren bereits voll entwickelt. Die beiden Männer unternahmen gemeinsame Wanderungen zwischen Cannes und Menton; bei einem Glas Sherry lasen sie einander ihre Lieblingsstellen aus der Literatur vor. Polignac machte Montesquiou mit Musik vertraut, die dieser noch nicht gekannt hatte; der Graf revanchierte sich mit Prosa und Lyrik. Trotz des Altersunterschieds von zwanzig Jahren war ihr Kunstverstand gleich gut ausgebildet, wobei die Gewissheiten des Grafen auf die Zweifel des Prinzen trafen. Als heimlicher Homosexueller sprach Polignac sicher auf Montesquious Selbstbewusstsein in diesen Dingen an; dabei bekannte sich der Graf eigentlich nicht offen zu seiner Homosexualität, er kultivierte sie eher mit Blumen und Versen und verblüffenden Farben, als wäre das normal. Pozzi kannte der Graf bei ihrem Ausflug nach London erst ein oder zwei Jahre. Was mochte ihn bewogen haben, Pozzi mitzunehmen? Sicher, Pozzi sprach hervorragend Englisch, aber das galt auch für Edmond de Polignac, der dreisprachig (mit Französisch, Englisch und Deutsch) aufgewachsen war. Eine wahrscheinlichere Erklärung liegt in der Natur des Einkaufens. Wer sich auf Einkaufstour begibt – ob in Kettenläden oder am »intellektuellen und dekorativen« Ende des Spektrums –, liebt und braucht die Gesellschaft von Gleichgesinnten, vor allem solchen, die wie Pozzi die Sache mit Hingabe, Umgänglichkeit und Geschmack (und den entsprechenden finanziellen Mitteln) angehen.
Es gibt aber noch eine andere mögliche Erklärung: Dankbarkeit. Ende Juni 1884, ein Jahr vor der Reise nach London, hatte Pozzi ein Geschenk von Montesquiou erhalten: eine luxuriöse Reisetasche aus Saffianleder von Asprey’s in Mayfair, in die oben eine Goldkrone und der Buchstabe R eingeprägt waren. Als er die Tasche öffnete, entdeckte er darin eine Reihe ineinandersteckender Briefumschläge, einer immer kleiner als der andere. Ganz innen, im kleinsten Umschlag, lag ein vom Grafen verfasstes, mit scharlachroter und violetter Tinte geschriebenes Gedicht, mit dem er sich bei Pozzi für die Behandlung seiner, wie er sich ausdrückte, »welken Lebenskraft« bedankte. Pozzis Biograf, der Arzt Claude Vanderpooten, interpretiert den Ausdruck und das Gedicht als Umschreibung sexuellen Versagens – entweder Impotenz oder vielleicht auch vorzeitige Ejakulation. Er spekuliert weiter, Pozzi habe den Zustand mit »empirischer, brüderlicher, freundlicher Psychotherapie« behandelt und die »Schwäche« sei »unterbunden« worden. Eine poetische, aber nicht unbedingt fiktionale Diagnose nach Ablauf von hundert Jahren. So oder so könnte die Einladung an Pozzi ein Dankeschön für seine Behandlung gewesen sein – und zugleich eine Gelegenheit, seine Reisetasche zu benutzen.
Doch wenn der Biograf recht hat, dann ergibt sich wieder eine seltsame Parallele. Im Vorbericht von Gegen den Strich erfahren wir, dass Des Esseintes als junger Lebemann in Paris seinen sexuellen Appetit ausgiebig gestillt hatte. Erst mit Sängerinnen und Schauspielerinnen, dann mit Mätressen, die »bereits berühmt« waren für ihre Verderbtheit, und schließlich mit Prostituierten, bis ihn Übersättigung, Selbstekel und ärztliche Warnungen vor der Syphilis zu sexueller Abstinenz bewogen. Jedoch nur vorübergehend. Nach dieser Unterbrechung wird seine Fantasie von Neuem entfacht, diesmal vom eigenen Geschlecht, von »außergewöhnlichen Liebschaften, irregeleiteten Freuden«. Wieder kommt es zu Übersättigung, nervlicher Zerrüttung und einem Verfall in Lethargie. Überdies war »die Impotenz nahe«. (Huysmans hatte, obgleich nicht so extravagant-verkommen wie die von ihm geschaffene Figur, selbst an Impotenz gelitten.)
Diese Wendung des Schicksals lässt Des Esseintes als Dandy und Nonkonformist jedoch nicht verzagen; im Gegenteil, er freut sich darüber. Schließlich ist Impotenz auch eine Art Abkehr von der Welt, und sich in größerem Stil aus der Welt zurückzuziehen ist genau das, was er vorhat. Für eine erfolgreiche Karriere als moderner Eremit ist der Verlust des sexuellen Appetits sicher hilfreich. Daher feiert Des Esseintes diese Entwicklung im ersten Kapitel des Romans mit einem »schwarzen Diner«. Es werden Einladungen verschickt, die wie Todesanzeigen gestaltet sind; Dekorationen, Blumen und Tischdecken – alles ist schwarz; ebenso das Essen und der Wein; ebenso die zur Bedienung der Gäste engagierten Frauen; und im Hintergrund spielt ein verborgenes Orchester Trauermärsche. Es ist ein theatralisch inszenierter und fröhlicher Abschied vom lästigen Druck der Potenz.
Wie Montesquiou diese Stelle des Romans auffasste, ist nicht bekannt. Er hat wohl eher eine zufällige Übereinstimmung als eine persönliche Anspielung darin gesehen. Aber ein Dandy-Ästhet setzt sich ja überhaupt gern über Normen hinweg, und Sex kann selbst in seinen eher abweichenden Erscheinungsformen normativ und somit bourgeois werden. Außerdem führt Sex zu Ehe und Familie, Verantwortung, einer Karriere und einem Sitz im Aufsichtsrat, Freundschaft mit dem Ortsbischof und dergleichen mehr. Impotenz lässt sich scherzhaft zu einem Ausdruck der Revolte gegen die verachtete Bourgeoisie und einem weiteren Beweis für die Überlegenheit des Ästheten überhöhen.
Die erste Kugel in dieser Geschichte ist historisch und ausgesprochen literarisch. Graf Robert de Montesquiou besaß eine Raritätensammlung – ja, im Grunde war sein ganzes Haus ein Kuriositätenkabinett, die äußerliche Präsentation seines inneren Ästhetizismus und seiner Kennerschaft. Léon Daudet, der ältere Sohn des Romanciers Alphonse Daudet, erinnerte sich in einem der vielen Bände seiner Memoiren, dass er einst eine Kuratorenführung von dem Grafen bekam, der ihm seine besonders wertvollen Stücke zeigte. Eins davon war »die Kugel, die Puschkin tötete«. Der Dichter war 1837 beim Duell mit Georges-Charles de Heeckeren d’Anthès ums Leben gekommen, einem französischen Offizier in der russischen Chevaliergarde. Mit dieser Todesart sollte Pozzi nur allzu vertraut werden, und er würde zeit seines Lebens versuchen, einen solchen Tod zu erleichtern oder zu verhindern. Die Kugel war in Puschkins Hüfte eingedrungen und von dort in den Bauchraum gewandert. Ein chirurgischer Eingriff war zur damaligen Zeit nicht möglich, und der Dichter starb nach zwei qualvollen Tagen. Montesquiou kam achtzehn Jahre später zur Welt. Wie die Kugel in die gräfliche Sammlung gelangte, ist nicht überliefert.
Pozzi entstammte dem Provinzbürgertum, auf das Montesquiou instinktiv herabsah. Der Graf genoss »das aristokratische Vergnügen zu missfallen« (der Ausdruck stammt von Baudelaire). Pozzi jedoch entging seiner Missbilligung und, meistens jedenfalls, seinem Snobismus. Er hatte etwas, was man »das bürgerliche Vergnügen zu gefallen« nennen könnte, und war von Anfang an ein geschickter gesellschaftlicher Taktierer.
Als er 1864 nach Paris kam, um das Studium der Medizin aufzunehmen, war er nicht ganz ohne Beziehungen. Unter seinen Kommilitonen befanden sich Freunde aus dem protestantischen Südwesten, und es gab dort schon einen Cousin, Alexandre Laboulbène, zwanzig Jahre älter als er, ein bekannter Modearzt, zu dessen Patienten die Herrscherfamilie von Napoleon III. gehörte. Pozzi war charmant und ehrgeizig, vor allem aber war er ein Elitestudent. 1872 gewann er die Goldmedaille als bester Assistenzarzt des Jahres. Sein Spezialgebiet waren Erkrankungen des Unterleibs. 1873 promovierte er über Fisteln im oberen Rektum. Seine Dissertation trug den Titel Die Bedeutung der Hysterektomie für die Therapie fibroider Tumore des Uterus. Und er fand einen wichtigen Förderer in Paul Broca (auch er ein Protestant aus dem Südwesten), einem berühmten Chirurgen am Hôpital de Lourcine-Pascal und zudem Gründer der Pariser Gesellschaft für Anthropologie, deren Mitglied Pozzi wurde. Broca schlug Pozzi als Mitübersetzer für Darwins Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren vor, das 1874 in Frankreich erschien. Als Broca 1880 im Alter von 56 Jahren plötzlich verstarb, teilten sich vier seiner Kollegen die Autopsie: Pozzi wurden Kopf und Gehirn zugesprochen. Jahre später wurde das Lourcine-Pascal in Hôpital Broca umbenannt, und Pozzi war dreißig Jahre lang dessen Kopf und Gehirn.
Sein anderer Förderer in jenen frühen Jahren war der parnassische Dichter Leconte de Lisle. Anscheinend lernten sie sich um 1870 kennen, als der Dichter und seine Frau Pozzi unter ihre Fittiche nahmen. Leconte, Sohn eines Militärarztes, setzte sich engagiert für eine Wiedervereinigung von Wissenschaft und Dichtung ein, die so lange voneinander getrennt gewesen waren. Außerdem war er Freidenker, und ihm ist es mit zu verdanken, dass jeder Rest eines religiösen Glaubens, den Pozzi aus Bergerac mitgebracht haben mochte, ausgelöscht wurde. Er führte Pozzi in literarische Kreise ein und stellte ihn Victor Hugo vor; er hörte sich Pozzis nicht besonders guten Gedichte an und ermunterte ihn, Deutsch zu lernen. Als Leconte 1894 starb, hatte er Pozzi als seinen literarischen Nachlassverwalter eingesetzt und ihm seine Bibliothek und seine Schriften vermacht.
Leconte trug entscheidend, wenn auch unbeabsichtigt, dazu bei, dass es zu Pozzis früher – ja, frühreifer – Affäre mit Sarah Bernhardt kam. Er war Mitte zwanzig und Medizinstudent, sie war zwei Jahre älter und bereits ein aufstrebender Star: eine Schauspielerin mit einer neuen Art von Natürlichkeit (obwohl diese Natürlichkeit natürlich voll und ganz kontrolliert war) und von einem anderen körperlichen Typus – schlanker und kleiner – als eine klassische Hauptdarstellerin. Ein Kommilitone erinnerte sich später, dass er und Pozzi Sarah Bernhardt zum Essen eingeladen hatten, damit sie den Dichter kennenlernen konnte. Er kam, sie trug praktisch sein halbes Œuvre aus dem Gedächtnis vor, der Dichter weinte und küsste ihr die Hände; der Abend war ein voller Erfolg. Schon bald durfte Pozzi chez Bernhardt dinieren – mit ihr und ihrem kleinen Sohn, dem Hauslehrer des Jungen und einer ihr anvertrauten Nichte. Man speiste en famille, die Kinder wurden ins Bett geschickt, und die beiden jungen Erwachsenen blieben allein. Was nun wann begann, wissen wir nicht; wir wissen auch nicht, wie lange das so ging, doch aus der Affäre erwuchs eine Freundschaft, die ein halbes Jahrhundert andauerte. Sie trugen beide einen göttlichen Beinamen: Er war für sie immer »Docteur Dieu«, während sie für (nahezu) jeden »die göttliche Sarah« war. Er hatte auch einen irdischeren Spitznamen, der ihm von der Salonnière Madame Aubernon verliehen worden war: »L’Amour médecin«. Das ist der französische Titel eines Stücks von Molière, Die Liebe als Arzt, in Pozzis Fall jedoch meist als »Doktor Liebe« wiedergegeben.
Vom Temperament her passten sie gut zusammen: leidenschaftlich, aber mit wenig ausgeprägten Besitzansprüchen in der Liebe – oder mit einer ausgeprägten Neigung zur Flatterhaftigkeit. Sarah Bernhardt verstand es, dem männlichen Ego zu schmeicheln und zugleich gockelhafte Rivalität zu entschärfen und die Dinge, wenn nötig, in der Schwebe zu halten. Beide stürzten sich gierig in immer neue Liebschaften. Pozzis Biograf stellt eine Leporelloliste der physischen Typen auf, zu denen Pozzi sich hingezogen fühlte (d.h. zu jedem Typ), und fügt dann mit eigentümlicher Prüderie (oder Naivität) hinzu: »Er meint es ernst, jedes Mal.« Und: »Eins steht fest, alle diese Frauen blieben mit ihm befreundet.« Das klingt viel zu schön, um wahr zu sein.
Die Details und sogar viele der Namen sind Spekulation. Pozzi war äußerst diskret und anscheinend nicht dem Klatsch zugeneigt; wenn doch, so wurde der Klatsch nicht aufgeschrieben. Seine Briefe an Sarah Bernhardt sind nicht erhalten, wohl aber einige ihrer Briefe an ihn. Sie sprechen von tief empfundenen Gefühlen und unmittelbaren Bedürfnissen, aber man bekommt nur schwer ein Gespür für die Art oder auch nur die Häufigkeit der Beziehung in diesen frühen Jahren. In einem Brief schreibt sie: »Ich habe dich belogen, das ist wahr, aber ich habe dich nie betrogen.« Das klingt nach einer sehr französischen Sophisterei, ist aber durchaus plausibel: Ich habe dir immer gesagt, dass ich mit anderen schlafen werde, und wenn es dazu nötig war, dir Lügen zu erzählen, dann bleibt die größere Wahrheit bestehen, auch wenn gegen die kleinere verstoßen wurde.
Sarah Bernhardt fotografiert von Nadar (ca. 1864) © Alamy Stock Photo
Ein Schlüssel zu ihrer Beziehung war, Pozzis Biograf zufolge, »die bekannte Affinität zwischen Protestanten und Juden«. (War das mehr als eine notwendige Solidarität zwischen zwei historisch ausgegrenzten Minderheiten im katholischen Frankreich?) Doch Vanderpooten zufolge ging die Sache tiefer: Seiner Ansicht nach hatte Pozzi eine »jüdische Sensibilität«. Er hatte auch »viele jüdische Freunde«, ja, »er hätte eine Jüdin heiraten sollen«.
Aber nicht Sarah Bernhardt. Sie wusste, dass sie nicht zur Ehe geschaffen war: Ihr einziger Versuch – die Hochzeit fand 1882 in London statt – war ein Fiasko. Stattdessen sah Pozzi sie sooft wie möglich auf der Bühne, lud sie in seinen Salon ein, wurde ihr Arzt und Operateur, wann immer er gebraucht wurde – notfalls sogar mittels eines transatlantischen Telegramms –, und lieh ihr Geld. Sarah Bernhardts sexuell freizügiger Lebensstil war für viele ein Skandal, aber ein Skandal von der Art, wie die wohlanständige französische Gesellschaft sie über lange Jahrhunderte hinweg von Schauspielerinnen zu erwarten gelernt hatte; ja, diese wiederholten Skandale bestätigten die Gesellschaft nur in der Richtigkeit ihrer Moralvorstellungen.
Mit Broca und Leconte als Gönnern und Sarah Bernhardt bisweilen in seinem (oder ihrem) Bett – konnte ein junger Medizinstudent einen besseren Start in Paris haben?
Merrie England, das Goldene Zeitalter, la Belle Époque: Solch glanzvolle Markennamen werden immer im Nachhinein geprägt. Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: »Wir leben in der Belle Époque und das sollten wir auskosten.« Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870–71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914–18 hielt erst 1940–41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug. Es war der Titel einer Radiosendung, die sich in eine Livemusiktheatershow verwandelte: eine Gute-Laune-Wortschöpfung und eine Gute-Laune-Zerstreuung, die zugleich mit gewissen deutschen Klischeevorstellungen vom Oh-là-là-Cancan-Frankreich kokettierte. Die Belle Époque: der Inbegriff von Friede und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz, eine letzte Blüte der Künste und letzte Blüte einer etablierten High Society, bevor dieses kuschelige Fantasiegebilde – mit einiger Verspätung – vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert hinweggefegt wurde, dem man nichts vormachen konnte und das die eleganten, launigen Toulouse-Lautrec-Poster von leprösen Wänden und stinkenden vespasiennes