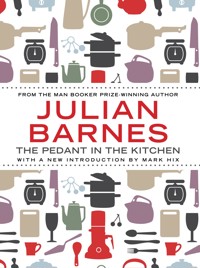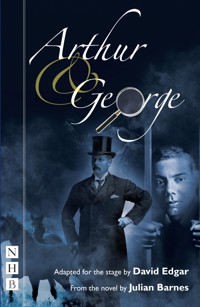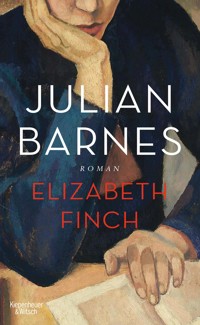
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman Julian Barnes' über eine platonische Liebe und den Tod einer besonderen Frau, der zum Anlass für die tiefere Auseinandersetzung eines Mannes mit Liebe, Freundschaft und Biografie wird. Neil, gescheiterter Schauspieler, Vater und Ehemann, besucht an der Abenduni eine Vorlesung zur Kultur und Zivilisation und ist fasziniert von der stoischen und anspruchsvollen Professorin Elizabeth Finch. Er hat zwar Affären und Liebeleien, doch prägt das Ringen um ihre Anerkennung sein Leben. Auch nach Beendigung des Studiums bleiben die beiden in Kontakt. Als sie stirbt, erbt Neil ihre Bibliothek und Aufzeichnungen - und stürzt sich in ein Studium Julian Apostatas, der für Elizabeth Finch ein Schlüssel zur Bedeutung von Geschichte an sich war: Der römische Kaiser wollte im 4. Jahrhundert das Christentum rückgängig machen. Wer war Julian Apostata? Und was wäre passiert, wenn er nicht so jung gestorben wäre? Der Schlüssel zur Gegenwart liegt nicht selten in der Verhangenheit, das zeigt dieser kenntnisreiche Roman auf unnachahmliche Weise. Das Buch ist eine intelligente Hommage an die Philosophie, ein Ausflug in die Geschichte, eine Einladung, selbst zu denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Julian Barnes
Elizabeth Finch
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter »Flauberts Papagei«, »Eine Geschichte der Welt in 10 1/2 Kapiteln« und »Lebensstufen«. Für seinen Roman »Vom Ende einer Geschichte« wurde er mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Julian Barnes lebt in London.
Gertraude Krueger, geboren 1949, lebt als freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E.L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Neil, gescheiterter Schauspieler, Vater und Ehemann, besucht an der Abenduni eine Vorlesung zur Kultur und Zivilisation und ist fasziniert von der stoischen und anspruchsvollen Professorin Elizabeth Finch. Er hat zwar Affären und Liebeleien, doch prägt das Ringen um ihre Anerkennung sein Leben. Auch nach Beendigung des Studiums bleiben die beiden in Kontakt. Als sie stirbt, erbt Neil ihre Bibliothek und Aufzeichnungen - und stürzt sich in ein Studium Julian Apostatas, der für Elizabeth Finch ein Schlüssel zur Bedeutung von Geschichte an sich war: Der römische Kaiser wollte im 4. Jahrhundert das Christentum rückgängig machen. Wer war Julian Apostata? Und was wäre passiert, wenn er nicht so jung gestorben wäre? Der Schlüssel zur Gegenwart liegt nicht selten in der Verhangenheit, das zeigt dieser kenntnisreiche Roman auf unnachahmliche Weise.
Das Buch ist eine intelligente Hommage an die Philosophie, ein Ausflug in die Geschichte, eine Einladung, selbst zu denken.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Teil EINS
Teil ZWEI
Teil DREI
Danksagung
Literaturhinweise für die deutsche Ausgabe
Für Rachel
EINS
Sie stand vor uns ohne Notizen, Bücher oder Anzeichen von Nervosität. Das Pult war mit ihrer Handtasche belegt. Sie schaute in die Runde, lächelte, schwieg und begann.
»Sie haben sicher gesehen, dass dieses Seminar den Titel ›Kultur und Zivilisation‹ trägt. Seien Sie unbesorgt. Ich werde Sie nicht mit Tortendiagrammen bombardieren. Ich werde Sie nicht mit Fakten vollstopfen wie eine Gans mit Mais; das hätte nur eine geschwollene Leber zur Folge, und das wäre ungesund. Nächste Woche bekommen Sie von mir eine Leseliste, die in keiner Weise verpflichtend ist; es gibt keinen Punktabzug, wenn Sie sie links liegen lassen, und keine Pluspunkte für beharrliche Lektüre. Meine Lehrveranstaltung richtet sich an erwachsene Menschen, was Sie zweifellos sind. Die beste Art der Bildung ist, wie schon die Griechen wussten, das kollaborative Lernen. Ich bin aber kein Sokrates, und Sie sind keine Platons, falls das der korrekte Plural ist. Dennoch werden wir einen Dialog führen. Dabei – und da Sie nicht mehr in der Grundschule sind – werde ich keine pflaumenweichen Ermunterungen und kein billiges Lob verteilen. Es kann gut sein, dass ich für einige von Ihnen nicht der beste Lehrer bin im Sinne eines Lehrers, der am besten zu Ihrem Naturell und Ihrer Denkweise passt. Ich erwähne das im Voraus für diejenigen, bei denen das so sein wird. Natürlich hoffe ich, dass Sie das Seminar interessant finden und sogar Spaß daran haben werden. Rigorosen Spaß, meine ich. Das ist kein Widerspruch. Und ich erwarte meinerseits Rigorosität von Ihnen. Flotte Sprüche sind hier fehl am Platz. Mein Name ist Elizabeth Finch. Ich danke Ihnen.«
Und sie lächelte wieder.
Niemand von uns hatte sich Notizen gemacht. Wir erwiderten ihren Blick, manche ehrfurchtsvoll, einige verwirrt bis verärgert, andere bereits halb verliebt.
Ich kann mich nicht erinnern, was sie uns in dieser ersten Sitzung beibrachte. Aber aus unerklärlichen Gründen wusste ich, dass ich zum ersten Mal im Leben am richtigen Ort angekommen war.
Ihre Kleidung. Fangen wir auf Bodenhöhe an. Sie trug feste Halbschuhe, im Winter schwarz, im Herbst und Frühjahr aus braunem Wildleder. Strümpfe oder Strumpfhosen – mit nacktem Bein sah man Elizabeth Finch nie (und konnte sie sich ganz sicher nicht in einem Strandkleid vorstellen). Knielange Röcke – sie widersetzte sich der alljährlichen Tyrannei der Rocklänge. Ja, anscheinend hatte sie ihr Aussehen schon vor geraumer Zeit festgelegt. Man konnte es noch elegant nennen; zehn Jahre später hätte es wohl als überholt oder vielleicht auch als Vintage gegolten. Im Sommer ein Rock mit Kellerfalte, gewöhnlich marineblau, im Winter Tweed. Manchmal erschien sie in einer Art Schottenrock mit Karomuster und einer großen silbernen Sicherheitsnadel (für die es bestimmt ein spezielles schottisches Wort gibt). Viel Geld wurde offenbar für Blusen ausgegeben, aus Seide oder feiner Baumwolle, oft gestreift und niemals durchscheinend. Ab und zu eine Brosche, immer klein und, wie man so schön sagt, dezent, aber irgendwie auch strahlend. Ohrringe trug sie selten (hatte sie überhaupt Ohrlöcher? Gute Frage). Am linken kleinen Finger ein silberner Ring, den wir für ein Erbstück hielten, nicht für etwas Gekauftes oder Geschenktes. Ihre Haare hatten eine Art gelblichen Grauton, waren gut geschnitten und von gleichbleibender Länge. Ich stellte mir einen regelmäßigen vierzehntägigen Termin beim Friseur vor. Nun, sie hielt viel von Künstlichkeit, wie sie uns nicht nur einmal erklärte. Und Künstlichkeit war, wie sie gleichfalls bemerkte, durchaus mit der Wahrheit vereinbar.
Obwohl wir – ihre Studenten – zwischen Ende zwanzig und Anfang vierzig waren, benahmen wir uns ihr gegenüber am Anfang wie die Schulkinder. Wir stellten Überlegungen über ihre Vergangenheit und ihr Privatleben an, warum und weshalb sie – soweit wir wussten – nie geheiratet hatte. Was sie abends machte. Bereitete sie sich ein perfektes Omelette aux fines herbes zu, trank ein einziges Glas Wein (Elizabeth Finch betrunken? Das würde die Welt auf den Kopf stellen) und las dabei den neuesten Band der Goethe-Studien? Sie sehen, wie leicht es war, in Fantasievorstellungen, ja Satire abzudriften.
Sie hat in all den Jahren, die ich sie kannte, geraucht. Und wieder hat sie nicht so geraucht wie alle anderen. Es gibt Raucher, die jeden Nikotinstoß unverhohlen genießen; andere, die mit einem gewissen Selbstekel inhalieren; manche tun so, als gehöre Rauchen zu ihrem persönlichen Stil; wieder andere behaupten steif und fest, sie würden »nur eine oder zwei am Tag« rauchen, als hätten sie ihre Sucht im Griff. Und »eine oder zwei« heißt – da alle Raucher lügen – in Wirklichkeit immer drei oder vier oder gar eine halbe Schachtel. EF dagegen ließ keine besondere Haltung zu ihrem Rauchen erkennen. Sie machte es einfach, und es bedurfte weder einer Erklärung noch Ausschmückung. Sie füllte ihre Zigaretten in ein Schildpattetui um, sodass wir uns damit vergnügen konnten, die Marke zu erraten. Sie rauchte, als ließe das Rauchen sie gleichgültig. Hört sich das sinnvoll an? Und wenn man gewagt hätte, sie zu fragen, hätte sie nicht zu Entschuldigungen gegriffen. Ja, hätte sie gesagt, natürlich sei sie süchtig; und ja, sie wisse, dass das schädlich sei und noch dazu unsozial. Aber nein, sie wolle nicht aufhören oder zählen, wie viele sie pro Tag rauchte; dergleichen stehe auf der Liste ihrer Besorgnisse ganz weit unten. Und da sie – das war meine persönliche Schlussfolgerung oder vielmehr Vermutung –, da sie keine Angst vor dem Tod hatte und das Leben für heutzutage leicht überbewertet hielt, war die Frage für sie völlig uninteressant und sollte es darum auch für Sie sein.
Natürlich litt sie unter Migräneanfällen.
Vor meinem geistigen Auge – dem Auge meiner Erinnerung, dem einzigen Ort, an dem ich sie sehen kann – steht sie übernatürlich still vor uns. Sie hatte keinen von diesen Ticks und Tricks, mit denen Dozenten bezirzen, ablenken oder Charakter zeigen wollen. Sie wedelte nie mit den Armen oder stützte das Kinn auf die Hand. Gelegentlich setzte sie wohl eine Folie zur Illustration ein, aber das war meist gar nicht nötig. Sie gebot Aufmerksamkeit mit ihrer Stille und ihrer Stimme. Es war eine ruhige, klare Stimme, durch jahrzehntelanges Rauchen angereichert. Sie gehörte nicht zu den Dozenten, die nur dann mit ihrem Publikum Kontakt aufnehmen, wenn sie von ihren Notizen aufschauen, denn sie sprach, wie gesagt, immer frei. Sie hatte alles vollständig durchdacht, vollständig ausgearbeitet im Kopf. Auch das gebot Aufmerksamkeit und verringerte die Kluft zwischen ihr und uns.
Ihre Diktion war förmlich, ihr Satzbau grammatisch perfekt – ja, man konnte die Kommas, Semikolons und Punkte beinahe hören. Sie begann nie einen Satz, ohne zu wissen, wie und wann er enden würde. Dabei hörte sie sich nie wie ein sprechendes Buch an. Ihr Vokabular kam immer aus derselben Wörterbox, egal ob sie etwas schrieb oder eine allgemeine Unterhaltung führte. Und doch wirkte das ganz und gar nicht archaisch, sondern höchst lebendig. Und bisweilen flocht sie gern – vielleicht zu ihrer eigenen Belustigung oder um uns zu überraschen – einen Ausdruck aus einem anderen Register ein.
Zum Beispiel sprach sie einmal über die Legenda aurea, diese mittelalterliche Sammlung von Wundertaten und Märtyrergeschichten. Fantastischen Wundertaten und lehrreichen Märtyrergeschichten. Ihr Thema war die heilige Ursula.
»Gehen Sie in Gedanken zurück, bitte schön, in das vierte Jahrhundert nach Christus, die Zeit, bevor die Hegemonie des Christentums unsere Gestade erreicht hatte. Ursula war eine bretonische Prinzessin, Tochter des christlichen Königs Dionotus. Sie war klug, folgsam, fromm und tugendhaft – all die üblichen moralischen Insignien solcher Prinzessinnen. Zudem noch schön, was schon problematischer war. Prinz Aetherius, der Sohn des Königs von Anglia, verliebte sich in sie und hielt um ihre Hand an. Das brachte Ursulas Vater in ein Dilemma, da die Angeln nicht nur sehr mächtig, sondern auch Götzenanbeter waren.
Ursula musste als Braut verschachert werden wie so viele vor und nach ihr; und da sie klug, tugendhaft etc. war, war sie auch einfallsreich. Nimm das Angebot vom Sohn der Macht an, riet sie ihrem Vater, aber knüpfe Bedingungen daran, die eine Verzögerung bewirken. Bitte darum, dass dir drei Jahre Aufschub gewährt werden, damit Ursula eine Wallfahrt nach Rom machen und der junge Aetherius während dieser Zeit im wahren Glauben unterwiesen und dann getauft werden kann. Für manch einen wäre der Deal damit gestorben gewesen, nicht aber für den in Liebe entbrannten Aetherius. Was der König von Anglia davon hielt, ist nicht überliefert.
Als sich die Kunde von Ursulas geplantem spirituellem Ausflug verbreitete, strömten andere gleich gesinnte Jungfrauen an ihre Seite. Und hier kommen wir an einen textuellen Knackpunkt. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, wurde Ursula von elftausend Jungfrauen begleitet; die Venedig-Kenner unter Ihnen erinnern sich vielleicht an Carpaccios Bilderzyklus zu dieser Geschichte. So eine Reisegesellschaft war eine organisatorische Herausforderung, und Mr Thomas Cook war noch gar nicht geboren. Besagter textueller Knackpunkt betrifft den Buchstaben M und was der ursprüngliche Schreiber damit meinte. Stand das M für Mille, tausend, oder stand es für Märtyrerin? Einige von uns werden letztere Interpretation einleuchtender finden. Ursula plus elf jungfräuliche Märtyrerinnen ergibt zwölf, was auch die Zahl der christlichen Apostel ist.
Dennoch, lassen wir die Geschichte in Technicolor und CinemaScope weitergehen, Techniken, zu deren Verbreitung Carpaccio viel beigetragen hat. Elftausend Jungfrauen machten sich in Britannien auf den Weg. Als sie in Köln ankamen, erschien Ursula ein Engel des Herrn mit der Botschaft, wenn sie und ihre Entourage in Rom gewesen seien, sollten sie über Köln zurückkehren, wo ihnen die heilige Märtyrerkrone zuteilwerden sollte. Die Botschaft von diesem Finale verbreitete sich unter den elftausend und wurde mit hellem Entzücken aufgenommen. Unterdessen erschien Aetherius in Britannien ein anderer dieser allgegenwärtigen Engel des Herrn und befahl ihm, seiner künftigen Braut nach Köln entgegenzureisen, wo auch ihm die Märtyrerkrone zuteilwerden sollte.
Wo immer Ursula hinkam, fand sie mehr und mehr Anhängerinnen, wenngleich die Gesamtzahl nicht überliefert ist. In Rom gesellte sich der Papst persönlich zu dieser weiblichen Pilgerschar, was ihm Schmähungen und die Exkommunikation eintrug. Wiederum unterdessen fassten zwei schurkische römische Befehlshaber aus Furcht, der hysterische Erfolg der Expedition könnte die Verbreitung des Christentums vorantreiben, den Plan, dass ein hunnisches Heer die zurückkehrenden Pilgerinnen niedermetzeln sollte. Da traf es sich gut, dass ein hunnisches Heer just zu der Zeit Köln belagerte. Wir müssen solchen erzählerischen Zufällen und Interventionen von Engeln Rechnung tragen: Schließlich ist dies kein Roman aus dem neunzehnten Jahrhundert. Obwohl es, wenn ich’s recht bedenke, in den Romanen des neunzehnten Jahrhunderts von Zufällen geradezu wimmelt.
Und so kamen Ursula und ihr riesiges Gefolge in Köln an, worauf das hunnische Heer seine Belagerungsmaschinen stehen ließ und sich daranmachte, die elftausend und mehr abzuschlachten mit – und dieser Ausdruck war schon Anno Domini 400 ein Gemeinplatz – ›der Grausamkeit von Wölfen, die über eine Schafherde herfallen‹.«
Elizabeth Finch hielt kurz inne, ließ den Blick durch den Saal schweifen und fragte: »Wie sollen wir das nun nennen?« Und in das Schweigen hinein gab sie die Antwort: »Ich würde sagen: Suicide by Cop.«
Elizabeth Finch war in keiner Hinsicht eine Person des öffentlichen Lebens. Wer sie googeln will, erhält ein mageres Ergebnis. Wenn ich sie beruflich einordnen sollte, würde ich sie als Privatgelehrte bezeichnen. Das hört sich vielleicht euphemistisch oder gar nichtssagend an. Doch bevor das Wissen in akademischen Gefilden ein offizielles Zuhause fand, gab es hochintelligente Männer und Frauen, die ihren Interessen privat nachgingen. In den meisten Fällen hatten sie natürlich Geld; manche waren exzentrisch, einige wenige nachweislich verrückt. Doch mit ihrem Geld konnten sie reisen und forschen, was und wo sie wollten, ohne Publikationsdruck und die Notwendigkeit, Kollegen zu übertrumpfen oder Institutsleiter zufriedenzustellen.
Über Elizabeth Finchs finanzielle Lage habe ich nie etwas erfahren. Ich stellte mir vor, dass sie über Geld von ihrer Familie oder eine Erbschaft verfügte. Sie hatte eine Wohnung in West London, die ich nie betreten habe; sie schien sparsam zu leben; ich nehme an, sie organisierte ihre Lehre so, dass ihr noch Zeit für private, unabhängige Forschungen blieb. Sie hatte zwei Bücher veröffentlicht: Explosive Frauen über Londoner Anarchistinnen zwischen 1890 und 1910 und Unsere notwendigen Mythen über Nationalismus, Religion und Familie. Beide waren kurz, und beide waren vergriffen. Manch einem mag eine Privatgelehrte, deren Bücher nicht verfügbar sind, als eine komische Figur erscheinen. Dabei gibt es Dutzende von fest angestellten Trotteln und Langweilern, die besser den Mund gehalten hätten.
Mehrere ihrer Studenten haben sich später einen Namen gemacht. Sie wird in den Danksagungen von Büchern über mittelalterliche Geschichte und weibliches Denken gewürdigt. Aber wer sie nicht kannte, für den war sie unbekannt. Das klingt, als würde es sich von selbst verstehen. Doch in der digitalen Welt von heute haben die Begriffe »Freund« und »Follower« eine andere, verwässerte Bedeutung angenommen. Viele Leute kennen sich, ohne sich im Geringsten zu kennen. Und sind mit dieser Oberflächlichkeit zufrieden.
Sie mögen mich für altmodisch halten (aber um mich geht es hier nicht). Sie mögen Elizabeth Finch für ebenso altmodisch, wenn nicht noch altmodischer halten. Doch wenn sie das war, dann nicht auf die normale Art, als Verkörperung einer früheren Generation, deren Wahrheiten sich inzwischen als fahl und welk erwiesen haben. Wie soll ich es ausdrücken? Ihr Metier waren nicht die Wahrheiten früherer Generationen, sondern früherer Epochen, Wahrheiten, die sie am Leben hielt, die andere jedoch hinter sich gelassen hatten. Und damit meine ich nicht so etwas wie »sie war eine altmodische Konservative/Liberale/Sozialistin«. Sie stand in vielerlei Hinsicht außerhalb ihrer Zeit. »Lassen Sie sich nicht von der Zeit täuschen«, sagte sie einmal, »und zu dem Glauben verleiten, die Geschichte – und insbesondere die Geistesgeschichte – verlaufe linear.« Sie war ein hochgesinnter, autonomer, europäischer Mensch. Und während ich diese Wörter hinschreibe, halte ich inne, weil mir eine Lehre durch den Kopf geht, die sie uns einmal im Seminar erteilte. »Und merken Sie sich, wenn Sie in einem Roman oder gar einer Biografie oder einem Geschichtsbuch eine Figur auf drei Adjektive reduziert und zurechtgestutzt sehen, muss diese Beschreibung Sie misstrauisch machen.« Eine Faustregel, an die ich mich nach Kräften gehalten habe.
Im Seminar bildeten sich bald Grüppchen und Cliquen heraus, wie üblich durch eine Mischung aus Zufall und Absicht. Das beruhte zum Teil darauf, was man nach dem Seminar am liebsten trank: Bier, Wein, Bier und/oder Wein und/oder irgendwas anderes aus einer Flasche, Fruchtsaft, gar nichts. Meine Gruppe, die sich zwanglos zwischen Bier und Wein bewegte, bestand aus Neil (d.h. mir), Anna (aus Holland, daher bisweilen empört über englische Leichtfertigkeiten), Geoff (Provokateur), Linda (emotional labil, was das Studium wie das eigentliche Leben anging) und Stevie (Stadtplaner mit einem Streben nach Höherem). Uns verband unter anderem – paradoxerweise –, dass wir uns kaum jemals einig waren, abgesehen davon, dass die jeweils amtierende Regierung unfähig war, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott gab, dass man das Leben genießen sollte, solange es ging, und dass man nie genug Knabberzeug aus knisternden Tüten futtern konnte. Es war die Zeit vor Laptops im Seminar und Social Media außerhalb, als man sich Nachrichten aus Zeitungen holte und Wissen aus Büchern. War diese Zeit einfacher oder langweiliger? Beides zugleich oder keins von beidem?
»Monotheismus«, sagte Elizabeth Finch. »Monomanie. Monogamie. Monotonie. Was so anfängt, kann nichts Gutes sein.« Sie machte eine kurze Pause. »Monogramm – ein Zeichen von Eitelkeit. Dito Monokel. Monokultur – Wegbereiter des Sterbens des ländlichen Europa. Ich bin bereit, die Nützlichkeit von Monografien einzuräumen. Es gibt viele neutrale wissenschaftliche Termini, die ich ebenfalls bereit bin, gelten zu lassen. Doch wenn sich das Präfix auf menschliche Angelegenheiten bezieht … monoglott, das Kennzeichen eines Landes, das sich abschottet und sich selbst betrügt. Der Monokini, komische Etymologie und komisches Kleidungsstück. Monopole – und ich meine Monopole, nicht Monopoly – immer eine Katastrophe, wenn man lange genug wartet. Monorchie: ein bemitleidenswerter, aber kein erstrebenswerter Zustand. Gibt es dazu Fragen?«
Linda, die anscheinend oft an etwas litt, was sie mit dem kuriosen Namen »Herzbeschwernis« bezeichnete, fragte beklommen: »Was haben Sie gegen Monogamie? Ist es nicht so, dass die meisten Menschen so leben wollen? Dass die meisten Menschen davon träumen?«
»Vor Träumen sollte man sich hüten«, erwiderte Elizabeth Finch. »In aller Regel sollte man sich auch vor dem hüten, wonach die meisten Menschen streben.« Sie überlegte kurz, bedachte Linda mit einem angedeuteten Lächeln und sprach dann das ganze Seminar an. »Erzwungene Monogamie heißt so viel wie erzwungenes Glück, was, wie wir wissen, nicht möglich ist. Nicht erzwungene Monogamie könnte möglich erscheinen. Romantische Monogamie könnte erstrebenswert erscheinen. Doch Erstere fällt normalerweise in eine Version von erzwungener Monogamie zurück, und Letztere wird nur allzu leicht zwanghaft und hysterisch. Und ist damit nicht weit von der Monomanie entfernt. Wir sollten immer zwischen beiderseitiger Leidenschaft und gemeinsamer Monomanie unterscheiden.«
Wir versanken alle in Schweigen, um das zu verdauen. Die meisten von uns hatten so viele sexuelle und amouröse Erfahrungen hinter sich wie der Durchschnitt unserer Generation: also nach Ansicht der vorigen Generation viel zu viel und in den Augen der nächsten, herandrängenden Generation erbärmlich wenig. Wir fragten uns auch, wie viel von dem, was sie gesagt hatte, auf persönlicher Erfahrung beruhte, aber das wagte niemand zu fragen.
Linda ließ es, was ich ihr hoch anrechne, nicht dabei bewenden. »Wollen Sie damit sagen, es sei alles hoffnungslos?«
»Wie hat Stephen Sondheim es so launig ausgedrückt?« Und Elizabeth Finch stimmte tatsächlich einen Singsang an: »›One’s impossible / Two is dreary / Three is company, safe and cheery.‹ So kann man das natürlich auch sehen.«
»Aber stimmen Sie dem zu, oder wollen Sie einfach der Frage ausweichen?«
»Nein, ich zeige Ihnen nur die Alternativen auf.«
»Das heißt also, es war falsch, dass Aetherius nach Köln gegangen ist?« Linda nahm, wie wir jetzt erfuhren, die Seminare sehr persönlich, selbst die über mittelalterliche Religion.
»Nein, falsch nicht. Wir wollen alle das vermeintlich Beste für uns erreichen, selbst wenn es uns ins Verderben führt. Manchmal gerade dann. Und wenn wir es erreicht haben, oder eben nicht erreicht haben, ist es meist sowieso zu spät.«
»Das hilft mir nicht viel weiter«, sagte Linda mit einer Art weinerlichen Heftigkeit.
»Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zu helfen«, erwiderte Elizabeth Finch bestimmt, aber ohne Vorwurf. »Ich bin hier, um Ihnen zur Seite zu stehen, wenn Sie sich im Denken und Argumentieren üben und eine eigene Meinung entwickeln.« Sie hielt inne. »Doch da Sie nach Aetherius fragen, betrachten wir einmal seinen Fall. Als Ursulas Verlobter hatte er ihre Bedingungen akzeptiert: dass er, während sie ihre Wallfahrt nach Rom unternahm, die christlichen Schriften lesen, sich von deren Wahrheiten überzeugen und sich taufen lassen würde. Wie sehr das seinen Vater, den König von Anglia und allbekannten Heiden, erzürnt haben muss, erfahren wir nicht. Auf jeden Fall aber erschien Aetherius ein Engel des Herrn und befahl ihm, Ursula nach Köln entgegenzureisen, wo sie gemeinsam eine glorreiche Märtyrerschaft erleiden würden.
Wie sollen wir das verstehen? Auf emotionaler Ebene könnten wir das als ein extremes, ja fanatisches Beispiel romantischer Liebe ansehen. Womöglich hat das auch einen wagnerianischen Aspekt. Auf theologischer Ebene könnte dieses Verhalten als dreiste Vordrängelei betrachtet werden. Wir müssen zudem die Wirkung erzwungener Keuschheit auf ein junges männliches Wesen bedenken – und auf ein junges weibliches Wesen auch. Das kann sich in allerlei morbiden Verhaltensweisen manifestieren. Wurde Ursula und Aetherius, nunmehr drei Jahre einander verlobt, eine Hochzeitsnacht gewährt, bevor sie den Hals teutonischen Schwertern anheimgaben und die Brust Lanzen und Pfeilen darboten? Das müssen wir eher bezweifeln, denn die eheliche Erregung hätte sie durchaus zu einem Sinneswandel bewegen können.«
Danach gingen einige von uns in der Studentenbar gleich zu Hochprozentigem über.
Ich habe eine Schauspielschule besucht, so habe ich meine erste Frau kennengelernt, Joanna. Wir hatten beide den gleichen unausgegorenen und doch unerschütterlichen Optimismus, wenigstens in den ersten Jahren. Ich bekam kleine Rollen im Fernsehen und machte Voiceovers; gemeinsam schrieben wir Drehbücher und schickten sie in alle vier Winde. Unser Repertoire umfasste auch Zweipersonenshows auf Kreuzfahrtschiffen: Comedy, verbales Geplänkel, ein bisschen Singen und Tanzen. Meine beständigste Einnahmequelle war eine Rolle als leicht unheimlicher Barkeeper in einer TV-Dauerserie (nein, keiner berühmten). Manchmal sprachen mich noch Jahre später Leute an mit, »Sie sehen aber genauso aus wie Freddy der Barkeeper in, wie hieß das noch gleich – NW 12?« Ich korrigierte das nie zu SE 15, ich lächelte nur und erwiderte: »Komisch, nicht wahr, das habe ich schon öfter gehört.«
Als die Engagements ausblieben, habe ich in Restaurants gearbeitet. Das heißt, ich war Kellner. Aber ich hatte eine gewisse Präsenz oder konnte eine solche vortäuschen, darum wurde ich zum Empfangschef befördert. Und nach und nach war ich kein Schauspieler mit Engagement und dann überhaupt kein Schauspieler mehr. Ich kannte ein paar Lebensmittellieferanten, Joanna und ich beschlossen, aufs Land zu ziehen. Ich züchtete Champignons, und später baute ich Tomaten in Hydrokultur an. Unsere Tochter Hannah sagte nicht mehr mit kindlichem Stolz »Mein Papa ist im Fernsehen« und versuchte tapfer, dieselbe Begeisterung in den Spruch »Mein Papa züchtet Champignons« zu legen. Joanna, die als Schauspielerin erfolgreicher war als ich, meinte, es wäre besser für ihre Karriere, wenn sie in London wohnte. Und ich nicht. Das war’s dann eigentlich. Ja, Sie können sie immer noch im Fernsehen sehen, sie ist oft in … ach, scheiß drauf.
Als ich Elizabeth Finch erzählte, dass ich früher Schauspieler war, lächelte sie. »Ah, die Schauspielerei«, sagte sie, »das perfekte Beispiel dafür, wie Künstlichkeit Authentizität erzeugt.« Das hat mich ziemlich gefreut, ja ich fühlte mich wertgeschätzt.
EF, wie wir sie jetzt unter uns nannten, stand vor uns, die Handtasche wie üblich auf dem Pult, und sagte: »Begnügen Sie sich annäherungsweise mit annäherndem Glück. Das Einzige auf Erden, was klar ist und außer jedem Zweifel steht, ist das Unglück.« Und dann wartete sie. Wir waren auf uns allein gestellt. Wer würde es wagen, sich als Erster zu Wort zu melden?
Sie werden bemerken, dass uns für das Zitat keine Quelle genannt wurde. Das machte sie mit Absicht, ein nützlicher Trick, um uns zu eigenständigem Denken zu bewegen. Hätte sie die Quelle genannt, dann hätten wir sofort überlegt, was wir über Leben und Werk des betreffenden Menschen wussten und wie die gängige Meinung darüber lautete. Entsprechend hätten wir uns in Ehrfurcht verneigt oder das Gegenteil getan.
Und so hatten wir eine lebhafte Diskussion, stellten einen noch jugendlichen Optimismus einer reifen Skepsis gegenüber – zumindest sahen wir das so –, bis sie endlich ihre Quelle offenlegte und fortfuhr:
»Goethe, der ein so erfülltes und interessantes Leben hatte, wie es sich nur wenige von uns erhoffen können, erklärte im hohen Alter – er war damals fünfundsiebzig Jahre alt –, er sei in seinem ganzen Leben nur vier Wochen lang glücklich gewesen.« Sie zog nicht wirklich die Augenbrauen hoch – das war nicht ihre Art –, aber sie zog metaphorisch oder gar moralisch die Augenbrauen hoch. Und so machten wir uns als Seminar unsere Gedanken darüber und begannen zu debattieren, ob man als großer – oder auch kleiner – Denker zum Unglück verdammt sei und ob Menschen im hohen Alter solche Bemerkungen machten (was uns völlig unglaubhaft erschien), weil ihr Gedächtnis nachließ oder weil sie den Tod leichter annehmen konnten, wenn sie einen derart wichtigen Aspekt ihres Lebens herunterspielten. Und da meinte Linda, die sich nie scheute, Sachen zu sagen, die wir anderen naiv oder gar peinlich fanden:
»Vielleicht hat Goethe einfach nie die richtige Frau gefunden.«
Bei einem anderen Dozenten hätten wir vielleicht ungeniert gekichert. Doch EF war zwar im eigenen Denken rigoros, setzte sich aber nie verächtlich über unsere Ideen und Beiträge hinweg, auch wenn sie noch so dürftig, gefühlsduselig oder abgrundtief autobiografisch waren. Stattdessen verwandelte sie unsere armseligen Gedankenschnipsel in etwas von größerem Interesse.
»Wir müssen allerdings nicht nur in diesem Seminar, sondern auch außerhalb, in unserem eigenen turbulenten und hektischen Leben, das Element des Zufalls einbeziehen. Die Anzahl der Menschen, die wir zuinnerst kennenlernen, ist merkwürdig klein. Die Leidenschaft kann uns furios in die Irre führen. Die Vernunft kann uns ebenso sehr in die Irre führen. Unser genetisches Erbe kann uns lähmen. Ebenso frühere Ereignisse in unserem Leben. Nicht nur ein Soldat im Feld leidet später unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Oft ist das die unausweichliche Folge eines scheinbar normalen Lebens auf dieser Erde.«
Worauf Linda es sich nicht verkneifen konnte, eine leicht selbstgefällige Miene aufzusetzen.
Natürlich kann ich nicht versprechen, dass das EFs genaue Worte waren. Aber ich habe ein gutes Ohr für Stimmen, und wenn ich ihre Sprechweise rekonstruiere, darf ich hoffen, sie nicht zu karikieren. Wahrscheinlich habe ich bei ihr mehr darauf geachtet, was sie sagte und wie sie sprach, als bei irgendjemandem sonst in meinem Leben, vorher oder nachher. Vielleicht am Anfang meiner beiden Ehen; aber, wie EF gerade zu bedenken gab, »die Leidenschaft kann uns furios in die Irre führen«.
Die Ungezwungenheit, mit der sie über Herzensangelegenheiten sprach und das wie selbstverständlich in ein Seminar über »Kultur und Zivilisation« integrierte, machte sie in den ersten Semesterwochen zu einer Zielscheibe der Satire. Wie Jungs – und dreißigjährige Männer – nun einmal sind, gab es Gemunkel und Gelächter.
»Stell dir vor – ihre Handtasche ist aufgegangen, und da war ein James-Bond-Roman drin.«
»Letzte Woche hab ich gesehen, wie sie mit einem Jaguar E-Type abgeholt wurde. Und am Steuer saß eine Frau!«
»Hab gestern Abend die alte Liz ausgeführt, und wir haben so richtig auf den Putz gehauen. Ein, zwei Drinks, ein Häppchen auf die Schnelle, dann in einen Klub, sie tanzt wie der Teufel, dann zurück zu ihr, sie hat was gebunkert, dreht uns ein paar Joints, und dann« – worauf bisweilen ein affektiertes Lächeln über das Gesicht des Jungen beziehungsweise Mannes zog –, »und dann, nein, tut mir leid, ein Gentleman genießt und schweigt.« Wie man sich vorstellen kann, gab es auch andere, reicher ausgeschmückte Versionen, in denen ein Gentleman dann doch nicht schwieg.
Solche Reaktionen kamen von denen, die nicht recht wussten, wie sie mit Elizabeth Finchs Selbstsicherheit umgehen sollten, und von ihrer Autorität verunsichert waren. Diese Fantasien waren sicher fehlgeleitet, aber Elizabeth Finch hatte tatsächlich etwas Feuriges an sich. Wenn nicht greifbar und präsent, so doch potenziell. Und wenn ich selbst meine Gedanken schweifen lasse, dann könnten sie mir ein Bild von EF etwa in einem Schlafwagenabteil erster Klasse vorzaubern, in einem Zug, der durch eine dunkle Landschaft fährt; sie steht in einem seidenen Pyjama am Fenster und drückt eine letzte Zigarette aus, während ein mysteriöser und jetzt nicht mehr identifizierbarer Begleiter aus dem oberen Bett einen leisen nasalen Pfiff ausstößt. Draußen wäre unter einem Dreiviertelmond der Hang eines französischen Weinbergs zu erkennen oder der matte Glanz eines italienischen Sees.
Natürlich sagen solche Fantasien mehr über den Fantasierer aus als über sein Objekt. Sie unterstellten entweder eine glamouröse Vergangenheit oder eine imaginäre Gegenwart, in der EF Kompensation für ihr tatsächliches Leben suchte; und sie unterstellten weiter, dass sie, wie alle anderen auch, auf irgendeine Weise bedürftig und unbefriedigt war. Dem war aber nicht so. Die Elizabeth Finch, die vor uns stand, war das fertige Produkt, die Summe dessen, was sie selbst zustande gebracht hatte, was sie mithilfe anderer zustande gebracht hatte und was die Welt ihr geboten hatte. Die Welt nicht nur in ihren gegenwärtigen Erscheinungsformen, sondern auch in ihrer langen Geschichte. Nach und nach verstanden wir das und verwarfen unsere plumpen Gedankenspiele als erste, müßige Reaktionen auf ihre Einzigartigkeit. Und ohne erkennbare Mühe gelang es ihr, uns alle zu bändigen. Nein, das ist nicht ganz richtig: Es ging tiefer. Vielmehr nötigte sie uns – einfach durch ihr Beispiel –, in unserem Inneren ein Zentrum der Ernsthaftigkeit zu suchen und zu finden.
Linda kam zu mir und suchte meinen Rat. Das passiert mir nicht oft: Ich bin offenbar nicht so der Ratgebertyp. Und wie sich herausstellte, wollte sie mich um Rat fragen, ob sie EF um deren Rat fragen sollte. Ich stellte ihr bewusst keine näheren Fragen, weil es bei Linda unweigerlich um irgendein emotionales Drama ging. Außerdem hielt ich es für keine gute Idee, dass sie sich an EF wenden wollte. Die mochte zwar bereit sein, im Seminar über Goethes Liebesleben zu diskutieren, aber das hieß noch lange nicht, dass sie bereit oder in der Lage war oder auch nur die Erlaubnis der Hochschule hatte, einem Studenten oder einer Studentin außerhalb des Hörsaals Ratschläge zu erteilen. Mir wurde aber bald klar, dass Linda eigentlich gar nicht meine Meinung hören wollte; besser gesagt, sie wollte meine Meinung hören, solange sie mit dem übereinstimmte, was sie selbst bereits beschlossen hatte. Manche Leute sind so, vielleicht die meisten. Um ihr einen Gefallen zu tun, rückte ich daher von meinem Standpunkt ab und bestärkte sie in ihrer Absicht.
Ein, zwei Tage später saß ich allein in der Studentenbar, als sie auftauchte und sich an meinen Tisch setzte.
»EF war wunderbar«, begann Linda, schon mit Wasser in den Augen. »Ich habe ihr von meiner Herzbeschwernis erzählt, und sie hat sehr viel Verständnis gezeigt. Sie hat die Hand ausgestreckt und sie so neben mich gelegt.« Das tat Linda jetzt auch, sie legte ihre Hand mit der Handfläche nach unten auf den Tisch. »Und sie hat gesagt, dass die Liebe alles ist. Sie ist das Einzige, was zählt.« Und dann brach sie – also Linda – in Tränen aus.
Mit solchen Situationen kann ich nicht sehr gut umgehen, darum sagte ich: »Ich hole uns noch was zu trinken.«
Als ich von der Theke zurückkam, war Linda weg. Es war nur ein feuchter Handabdruck in der Mitte des Tischs von ihr geblieben, wo sie ihre Hand hingelegt hatte, um Elizabeth Finch nachzuahmen. Ich saß da und dachte, wahrscheinlich zum ersten Mal, über Linda nach. Und da EF auch ihre krudesten Ansichten nie herablassend behandelte, dachte ich auch ernsthafter über sie nach. Es lag etwas Flehendes in Lindas Blick, wenn sie einen ansah. Flehend – um was? Oder ganz allgemein flehend? Doch während der Abdruck ihrer Hand verschwand, verschwanden auch meine Gedanken an sie.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: