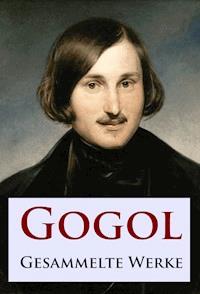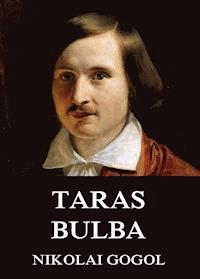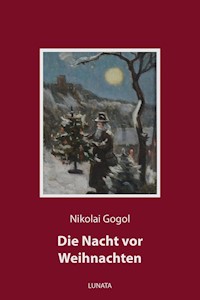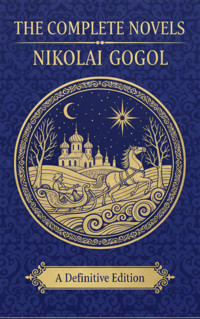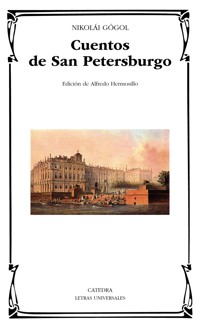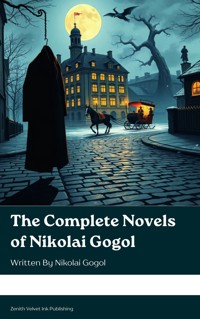Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die tragisch-komische Geschichte des Akakij Akakijewitsch, der ein trostloses und einsames Leben als Kopist führt, von Kollegen verspottet oder überhaupt nicht wahrgenommen, bis er eines Tages einen Mantel erwirbt. Von da an ändert sich sein Leben. Er beginnt, die Welt um sich her mit anderen Augen wahrzunehmen, ihm wird Ehre und Respekt zuteil. Dann aber wird Akakij auf dem Heimweg überfallen und sein Mantel gestohlen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Der Mantel
Eine Novelle
Nikolai Gogol
Der Mantel
© 1842 by Nikolai Wassiljewitsch Gogol
Originaltitel Šinel'
Aus dem Russischen von Alexander Eliasberg
Umschlagbild: Hans von Marées
Selbstbildnis im japanischen Mantel
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Der Mantel
Über den Autor
In einer Amtskanzlei des Ministeriums für . . . ach nein, verschweigen wir das Ministerium lieber! Nichts ist so leicht gekränkt wie unsere Zivil- und Militärbehörden, kurz, die Beamten jeder Art. Und heutzutage fühlt ja schon der einfache Privatmann in seiner eigenen Person gleich immer »die Gesellschaft« angegriffen. Vor kurzem soll – ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es war – ein Ordnungsrichter seiner vorgesetzten Stelle eine Beschwerde unterbreitet haben, in der er klipp und klar bewies, daß man die staatlichen Verfügungen für gar nichts achte und daß selbst sein heiliger Name unnütz geführt werde; als Material lag der Beschwerde ein riesendicker Wälzer von Roman bei, in dem beinah auf jeder zehnten Seite ein Ordnungsrichter in Erscheinung trat, und noch dazu des öfteren mit einem Bombenrausch behaftet. Um alle diese Schwierigkeiten zu vermeiden, bezeichnen wir das Amt, das hier in Frage kommt, ganz einfach als »ein« Amt. Also: in »einem« Amte diente einstmals »ein« Beamter. Es läßt sich nicht behaupten, daß der würdige Beamte durch irgendwas bemerkenswert gewesen wäre. Er war von niedriger Statur und etwas pockennarbig, hatte ziemlich rote Haare und, wenn der Schein nicht trog, recht schwache Augen, des ferneren eine mittelgroße Glatze, verrunzelte und eingefallne Wangen und die Gesichtsfarbe der Leute, die an Hämorrhoiden leiden. Das ist nun einmal nicht zu ändern! Das Petersburger Klima trägt die Schuld. Was nun den Rang betrifft – denn danach fragt man ja bei uns zuerst –, so war er, was man einen »ewigen« Titularrat nennt. Diese Beamtenklasse ist im übrigen genügend oft und witzig von gar manchen unsrer Schriftsteller verspottet worden, die die verständliche und edelmütige Gewohnheit haben, sich über Leute herzumachen, die ihnen nicht so leicht die Zähne weisen können. Der Zuname des Beamten war Baschmatschkin. Schon aus diesem Zunamen ergibt sich die Herkunft von dem Wort »Baschmak«; doch wann, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise der Name aus dem Worte Baschmak entstanden ist, darüber ist nichts bekannt. Sowohl der Vater als auch der Großvater und sogar auch ein Schwager und alle echten Baschmatschkins gingen in Stiefeln und erneuerten nur dreimal im Jahre die Sohlen. Sein Vorname lautete Akakij Akakijewitsch. Nun, dieser Vor- und Vatersname mag dem lieben Leser wohl ein wenig seltsam und gesucht erscheinen, doch darf er ruhig glauben, daß von Suchen dabei keine Rede war und daß das Schicksal selber es so fügte – man konnte ihm ganz einfach keinen andern Namen geben. Wie das sich zutrug, will ich gleich erzählen. Akakij Akakijewitsch wurde, wenn mir recht ist, in der Nacht zum Dreiundzwanzigsten des Monats März geboren. Seine Mutter, habe Gott sie selig, eine Beamtenwitwe und kreuzbrave Frau, tat ungesäumt nach gutem altem Brauch das Nötige zur Taufe ihres Sohnes. Die Mutter lag im Wochenbett, der Tür gegenüber; zu ihrer Rechten stand der Pate, Herr Jeroschkin, Kanzleivorsteher im Senat und überhaupt ein Mann von Ansehn und Bedeutung, und neben ihm die Patin, Arina Semjonowna Belobrjuschkowa, Gemahlin eines Leutnants von der Polizei, aufs vorteilhafteste bekannt für ihre exemplarisch reinen Sitten. Der Mutter wurden nun zunächst drei Namen vorgelegt, damit sie selber ihre Auswahl treffe: Mokkij, Sossij sowie der Name des Märtyrers Chosdasat. ›Nein‹, dachte die Mama, Gott hab sie selig – ›nein, das sind doch gar so sonderbare Namen.‹ Ihr zu Gefallen wurde der Kalender noch an einer andern Stelle aufgeschlagen, und die drei Namen, die da standen, lauteten: Trifilij, Dula, Warachassij. »Das ist ja eine Strafe Gottes!« rief die Wöchnerin. »Was das für Namen sind! Die hab ich ja in meinem Leben nicht gehört. Wenn es noch Warach oder Waradat gewesen wäre, aber Trifilij, Dula, Warachassij . . .!« Man blätterte noch einmal um, und da stand: Pawsikachij und Wachtissij. »Nein, nein, ich seh schon«, rief die gute Frau, »das Schicksal will es nicht. So mag er lieber noch nach seinem Vater heißen. Sein Vater hieß Akakij; wollen wir den Sohn in Gottes Namen auch Akakij nennen.« Auf die Art kam unser Held zu seinem Namen: Akakij Akakijewitsch. Beim Taufakt weinte er und zog ein so bekümmertes Gesicht, als sähe er sich schon als künftigen Titularrat. Das war der Hergang der Geschichte. Und wir haben das so eingehend berichtet, damit der Leser selber sieht, daß alles kommen mußte, wie es kam, und daß ein andrer Name völlig ausgeschlossen schien. Seit wann Akakij Akakijewitsch seines Amtes waltete und wer ihm diesen Posten zugewiesen hatte, wußte niemand mehr. So viele Vorsteher und Direktoren auch gekommen und gegangen waren – sie alle hatten ihn am gleichen Platze sitzen sehen, in ewig gleicher Haltung, an der gleichen Arbeit: beim Abschreiben von amtlichen Papieren. Drum glaubte man beinah, er wäre einst schon fix und fertig, wie er dasaß, auf die Welt gekommen, in der Beamtenuniform und mit der Glatze. Respekt bezeigte ihm kein Mensch im ganzen Amt. Nicht nur, daß der Portier gleichgültig sitzen blieb, wenn er zur Tür hereintrat – er schien ihn überhaupt nicht zu bemerken und tat, als surre dort bloß eine Fliege durch das Vestibül. Die Vorgesetzten zeigten ihm die kälteste Despotenmiene. Irgendein Direktionsvertreter warf nachlässig einen Akt auf seinen Schreibtisch und sagte dazu nicht einmal: »Ach, schreiben Sie das ab« oder: »Das ist ein netter, interessanter kleiner Schriftsatz« oder sonst etwas Verbindliches, wie's unter wohlerzogenen Beamten Brauch und Sitte ist. Akakij nahm die Arbeit still entgegen, sah nur auf das Papier und nahm sich nicht einmal die Mühe, festzustellen, wer es ihm zugeschoben hätte und ob denn der Betreffende auch überhaupt ein Recht dazu besäße; er nahm die Arbeit still entgegen und ging sofort ans Abschreiben. Die jüngeren Beamten trieben ihren Spott mit ihm und machten ihn zum Opfer ihres Witzes, soweit von Witz in solchen Amtskanzleien überhaupt gesprochen werden kann. Sie liebten es, in seiner Gegenwart erfundene »Schwänke aus Akakijs Leben« zu erzählen, behaupteten zum Beispiel, daß ihn seine Zimmerwirtin, eine alte Frau von siebzig Jahren, jeden Tag verprügele, erkundigten sich, wann die beiden Hochzeit machen würden, und schütteten auch etwa mit dem Ruf: »Es schneit!« Papierschnitzel auf seinen würdigen Glatzkopf. Akakij aber sagte zu alldem kein Wort – es war, als ob er seine Gegner überhaupt nicht sehe und bemerke. Nicht einmal im Kopieren störte ihn das alles, trotz dieser ewigen Neckereien verschrieb er sich kein einziges Mal. Nur wenn die Späße gar zu unerträglich wurden, wenn man ihn an den Ellenbogen stieß, so daß er seine Arbeit unterbrechen mußte, dann sagte er zum Schluß: »Ach, lassen Sie mich doch! Was quälen Sie mich denn?« Und etwas Sonderbares lag in diesen Worten und in seinem Tonfall – es klang da etwas durch, was unwillkürlich Mitleid weckte. Das mußte beispielsweise einst ein junger Mann erleben, der erst seit kurzem in dem Amte angestellt war. Auch er trieb seine Possen mit Akakij, wie er es von den andern sah. Da trafen jene leisen Worte ihn ins Herz, und er hielt mit Beschämung inne. Von dieser Stunde an erschien ihm alles wie verwandelt und in neuem Licht. Ein dunkler Widerwille stieß ihn fortan von den Kollegen ab, die er, da er sie kennenlernte, doch für ehrenwerte, wohlerzogene junge Leute angesehen hatte. Noch viele Jahre später trat, und oft sogar in seinen frohesten Minuten, plötzlich das Bild des kleinen Subalternbeamten mit der Glatze vor sein inneres Auge, der so beweglich hatte sagen können: »Ach, lassen Sie mich doch! Was quälen Sie mich denn?« Und dabei klangen wie ein starker Unterton noch andere Worte mit – die schlichte Frage: »Bin ich nicht dein Bruder?« Dann schlug der arme junge Mann die Hände vors Gesicht; gar manches Mal in seinem Leben faßte ihn seit jenem Augenblick ein Zittern, wenn es ihm wieder einmal aufstieß, wieviel Unmenschlichkeit im Menschenherzen lebt, wieviel gemeine Rohheit sich hinter abgeschliffener Weitläufigkeit verbirgt – du lieber Gott, und das sogar bei Leuten, die jedermann für tadellose Ehrenmänner hält . . .