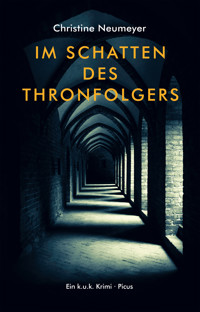Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Schlosskrimi – süffig, spannend und mit einer Prise Romantik Wir schreiben das Jahr 1898: Schloss Hof liegt alt und vergessen im österreichischen Marchfeld. Während in Wien das fünfzigjährige Regierungsjubiläum Franz Josephs I. gefeiert wird, obwohl im Umland die Rebellion rumort, ist das Leben hier noch ruhig und urtümlich. Als der Kaiser beschließt, das Jagdschloss ans Militär zu verpachten, wird das Leben von Dienstmädchen Irmi ordentlich aufgewirbelt. Denn außer einer Gruppe fescher Offiziere kündigt auch Kaiserin Sisi ihren Besuch an. Grund genug für ein rauschendes Fest. Doch am nächsten Morgen wird die Leiche eines der Offiziere gefunden. Der geheime Polizeiagent Johann Pospischil wird aus Wien entsandt, um zu ermitteln – und kommt einem Skandal auf die Spur, der bis in die vornehmsten Adelshäuser reicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Neumeyer
Der Offizier der Kaiserin
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Frantisek Czanner (Schloss), Svetlana Ryazantseva (Reiterin), Andriy Solovyov (Pferdekopf)
Lektorat: Nadine Buranaseda, Bonn
eBook-Produktion: CPI books GmbH, Leck
Christine Neumeyer übersiedelte nach Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung von Niederösterreich nach Wien und arbeitet nach zehn Jahren im Direktionssekretariat des Schlosses Belvedere in der Verwaltung der Universität Wien. Als Leiterin der Regionalgruppe Österreich der Mörderischen Schwestern
Prolog
Im August 1898
»Auf in den Kampf!«, rief der Ungar Sándor Kiss. Hinter ihm stampften die Stiefel der Kameraden auf den Boden. »Nieder mit Habsburg! Nieder mit dem Kaiser! Freiheit für unsere Völker!«
Unerschrocken rissen die Männer die Fäuste hoch. Erst als Hufschlag erklang, hielten sie inne. Der Geruch von warmen Tierkörpern hing in der Luft. Staub wirbelte auf. Das Gold der Knöpfe auf den Gendarmerieuniformen blitzte in der sich senkenden Nachmittagssonne.
»Was sucht ihr hier an der Brücke?«, fragte der Uniformierte, während sein Schimmel schnaubte.
»Unsere Freiheit!«, brüllte Sándor aus tiefster Kehle.
»Verschwindet!« Die Augen des Reiters verengten sich, sein Blick richtete sich auf die Schlagstöcke, Äxte und Messer hinter den Rücken der Männer. »Rebellengesindel!«
Eine Peitsche knallte, ein Schuss fiel, Pferdehufe trafen auf Stein. Jemand schrie: »Freiheit für unser Volk!«
Mann für Mann sank nieder.
Nachdem Sándor Kiss wieder zu sich gekommen war, brannte sein Schädel an jener Stelle, wo die Rute ihn getroffen hatte. Seinen jungen Freund hatte es schlimmer erwischt. Die Peitsche hatte sein Gesicht getroffen, ein roter Strich zog sich von der Stirn quer bis zum Hals. Der Junge wimmerte vor Schmerz.
»Wo sind die anderen?«, fragte Sándor.
Der Junge öffnete den Mund, Blut tropfte über seine Lippe. Ein Schneidezahn war ausgeschlagen. »Geflohen«, nuschelte er.
»Das ist noch lange nicht das Ende«, raunte Sándor. »Das nächste Mal rücken wir wie die Soldaten des Kaisers hoch zu Ross an und peitschen die dreckigen Uniformen nieder.«
Sein kroatischer Freund nickte mit verzerrter Miene. Humpelnd kehrten sie um und bewegten sich auf das im Schilf versteckte Boot zu.
»Mein Sohn in Wien wird uns helfen«, sagte Sándor nach einer Weile.
»Immer redest du von deinem Sohn«, erwiderte der Kroate. »Niemand von uns hat ihn je zu Gesicht bekommen. Vielleicht gibt es ihn gar nicht und alle warten auf ein Wunder, das nie geschieht.«
»Ihr werdet ihn sehen, sobald er nach unserem Sieg zu seinem Vater zurückgekehrt ist.«
»Und wenn er versagt, dein feiner Herr Sohn?«
»Ihre Majestät, Kaiserin Elisabeth, vertraut ihm, du Dummkopf!« Sándor reckte wütend die Faust.
Der Kroate duckte sich. »Um die Königin von Ungarn tut es mir leid«, gab er kleinlaut zurück.
1
Der Außenanstrich bröckelte, Spinnweben hingen an den Fenstern, Unkraut und wildes Gras wucherten im Park und der heiße, trockene August des Jahres 1898 trieb zu allem Übel auch noch die Ratten in den ehemaligen Landsitz von Prinz Eugen und Kaiserin Maria Theresia.
Brahm seufzte. Fünf Offiziere des niederösterreichischen Dragonerregiments würden für eine unbestimmte Zeit auf Schloss Hof Quartier beziehen. Die Stallungen sollten ebenso rasch instand gesetzt werden wie die Wohnräume des Ostflügels. Der Verwalter hasste es, mit Aufträgen bedrängt zu werden. Grimmig blickte er durch das Fenster zum Hügel in Richtung Osten, zur Grenzlinie nach Ungarn, die sich entlang der March in den Graben schnitt. Kaiserin Maria Theresia hatte in der Blütezeit der Schlösser eine Brücke über den Fluss errichten lassen. Heerscharen von Reitern und Kutschern passierten diese einst bedeutende Verbindung nach Pressburg und Budapest. Heute nutzten kaum mehr Gefährte den Steg.
Brahm runzelte die Stirn. Der erste Nebel zog an diesem Vormittag über die Felder. Langsam verdichtete sich der leuchtende Sommer zu einer unergründlichen Düsternis. Kräftig würden bald die Nordstürme um die Gemäuer in ungeschützter Lage fegen und die dünnen Stämme der Föhren neigen. Beim Gedanken an die tote Zeit des Winters war der Niedergang der Marchfeldschlösser für Brahm ein Vorbote für das drohende Ende der Doppelmonarchie. Dem kleineren Schloss in Niederweiden, etwa sechs Kilometer südwärts im flachen Land, erging es ähnlich. Dass der Kaiser die Verwalterstelle bisher nicht gestrichten hatte, beruhigte Brahm keineswegs. Nach den verlorenen Kriegen wurde allerorts gespart und da im Marchfeld wohl nie wieder Hof gehalten werden würde, war es nur eine Frage der Zeit, dass er ebenfalls seiner ehrenvollen Aufgabe enthoben werden würde.
Der Besuch des Dragonerregiments konnte allerdings das Zeichen für eine positive Wendung sein. Brahm dachte an seine Dienstwohnung im herabgewirtschafteten Meierhof, die er trotz der bescheidenen Ausstattung allzu gerne bis ans Ende seiner Tage behalten würde, als ihn ein kratzendes Geräusch herumfahren ließ.
Mit dem spitzen Gesicht voran, den dünnen Schwanz nachziehend, huschte eine Ratte die bunte Wand empor. Kein Kronleuchter, kein Dachstuhl schien dem Vieh zu hoch. Das Tier fraß sich durchs Mobiliar, ob Damast, Seide, Papier oder Holz. Angewidert verzog der Verwalter das Gesicht. Die Rattenbisskrankheit konnte selbst einem kräftigen Mann wochenlanges Fieber bescheren, im schlimmsten Fall den Tod. Wenn er auch manchmal angesichts der Verwahrlosung in Trübsinn versank, sterben wollte er nicht. Rasch musste er etwas unternehmen gegen die Plagegeister. Er sah es als seine Pflicht, auf das Eigentum des Kaisers zu achten, selbst wenn es bei Seiner Gnaden längst in Vergessenheit geraten war. Brahm deutete eine französische Verbeugung an. Nur Arsen, Thallium- oder Kumarinpräparate vermochten die Nager zu bremsen – oder ein loderndes Feuer. Den Flammen erlag jedes Leben, sei es noch so zäh, bedauerlicherweise ebenso jedes Inventar, besonders jene scheußliche Chinesentapete im Ostflügel.
Entschlossen schulterte er sein Gewehr, lud durch, zielte und drückte ab. Rot färbte sich das helle Fell. Dumpf glitt der tote Körper die Wand hinunter auf den staubigen Teppich. Das Knistern war verstummt. Rudolf Brahm hatte die Rattenplage im Griff. Sein Kinn reckte sich, die Wirbelsäule richtete sich auf im Angesicht des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn auf dem Ölgemälde vor ihm. Da mussten andere Kaliber heranrücken, um ihn von seiner Aufgabe abzuhalten. Es galt, Haltung zu bewahren, in jeder Situation. Brahm griff zum Flachmann in seiner Jacke, öffnete den Schraubverschluss und nahm einen kräftigen Schluck von dem gebrannten Wasser.
Im Wirtshaus zur Suppenkuchl in Groißenbrunn hing dicke Luft. Weniger lag es an dem Qualm aus den offenen Töpfen oder an den billigen Zigaretten, denen sich die Männer hinter dem Windfang aus Weichholz hingaben, vielmehr lag es an der schlechten Laune des Gastwirts.
»Geh, Weib«, schalt er, »bring dem Herrn Hofmarschall den guaten Wein aus dem Keller, weißt schon, den Roten, den uns der Herr Baron letztes Weihnachten gschenkt hat.«
»Was, den guten Wein willst aufmachen?«
»Ja, der Hofmarschall hat Geburtstag heut«, raunte er. »Wenn man ihr net alles anschafft, tut sie gar nichts, des Weibsbild, des ausgschamte.«
»Na geh«, beschwichtigte Brahm, »sei nicht so streng mit der Eva und ein für alle Mal: Für den Titel eines Hofmarschalls bräuchte es eine bessere Adelsprobe. Haha. Leider keine Chance bei dem winzigen Tropfen böhmisch blauen Blutes in mir. Haha. Keine Chance, bedaure.« Wenn er es auch nicht zugeben wollte, so aalte er sich gerne im warmen Schein der herrschaftlichen Anrede. Deshalb kam er so gerne in die Suppenkuchl.
Der Wirt wandte sich grunzend ab und widmete sich eine Weile dem Ausschank vorne an der Bierzapfsäule, bevor er zu seinem Gast im hinteren Teil der Stube zurückschlurfte.
»Dauernd ist das Weib beim Kaplan putzen«, schimpfte er. »Ich würd des Geld net brauchen, aber sie und die Tochter, die haben so gerne was Schönes zum Dekorieren.«
»Ja, die Weiberleut«, pflichtete der Verwalter bei. »Die machen aus uns Männern Bettler. Haha.«
Der Wirt stieß einen zustimmenden Rülpser aus, als seine Frau mit dem Wein aus dem Keller zurückkehrte und Rudolf Brahm einschenkte. Gluckernd füllte sich das Glas. »Herzlichen Glückwunsch. Darf ich dem Herrn sonst noch etwas bringen?«
»Ja gerne.« Er grinste. »Eure köstliche Rindsuppe mit den Schöberln bitte schön.« Seine Nasenflügel weiteten sich. »Der Duft eurer Suppen ist einfach unwiderstehlich.«
»Die Kaiser-Schöberl-Suppe also«, wiederholte die Wirtin mit einem Lächeln. »Die ist guat, gell, Herr von Brahm?«
»Die beste im ganzen Reich.«
»Was gibt’s Neues im Schloss?«, fragte sie mit schmeichelnder Stimme. »Oder wissen S’ vor lauter Langeweile nichts anzufangen mit Ihrer Zeit, Herr Hofmarschall?« Sie lachte schallend.
Die rauchenden Männer auf den Hockern vor dem Windfang reckten neugierig die Köpfe. Der Wirt hob die Brauen.
»Langeweile? Pah! Von wegen«, erwiderte Brahm, von der Keckheit der Wirtin aufgestachelt. »Erst gestern habe ich ein Apostolat erhalten, vom Kaiser, jawohl, von Seiner Gnaden höchstpersönlich.«
»Ein Apostolat? Vom Kaiser?« Die Wirtin zeigte sich beeindruckt.
Das Fräulein Tochter stand mit geröteten Wangen in der offenen Tür. »Wirklich vom Kaiser? Besucht Seine Hoheit unser Marchfeld? So reden S’ doch, Herr von Brahm!«
»Geh, deppert’s Mensch«, schimpfte die Mutter. »Der Kaiser kommt längst nicht mehr raus in die windige Einöde. Seine Gnaden mögen die Berge mehr, Seine Gnaden gehen lieber im Wienerwald jagen, dort sind die Rehlein feiner als bei uns, und die Kaiserin weilt eh meistens auf Korfu oder neuerdings in Budapest bei ihrem feschen Grafen Andrássy.« Sie senkte den Kopf. »Wer könnt es ihr verdenken, ein Rendezvous mit einem Aufständischen ist gewiss spannender, als beim alten Kaiser zu hocken, der außer der Pflicht nichts kennt.«
»Na, der Kaiser kommt nicht. Aber seine Vorhut.« Brahm fixierte den dicken Busen am Fräulein Tochter. Das hellgelbe Korsett vermochte ihr junges Fleisch kaum zu bändigen. »Sehr bald, die nächsten Tage bereits. Aus Kostengründen und wegen der Zeitnot werd i wohl oder übel Personal aus Pressburg in Dienst nehmen müssen. Der Ostflügel soll gsäubert werden und das Gras vor dem Schloss ist mannshoch, das ghört gschnitten. In so einer Unordnung lässt man keinen vorfahren, schon gar keinen kaiserlichen Stoßtrupp. Wir haben viel zu wenig Leut in der Meierei dafür.«
Die hellen Augen der Wirtstochter weiteten sich. »Die Vorhut des Kaisers? Für ein Fest auf dem Schloss? Zum Jubiläum Seiner Hoheit, ist es wahr?« Ihre Stimme überschlug sich, unruhig strichen ihre Hände über die entblößten Unterarme. »Ein richtiger Hofstaat auf Schloss Hof, wie seinerzeit bei der rühmlichen Kaiserin Maria Theresia?«
»Richtig!« Er dehnte den Rücken im Glanz der Aufmerksamkeit, die ihm Rosi viel zu selten schenkte. »Ein Fest.« Er erinnerte sich an den Kern der Nachricht aus der Kasernenkanzlei. Fünf berittene Dragoner wurden angekündigt, ein Offizier, vier Unteroffiziere. Er solle sich um die Unterkunft und die Versorgung von Soldat und Pferd kümmern, den Grund für den Besuch hatte er jedoch, sosehr er sich anstrengte, tatsächlich vergessen. »Ja, ein Fest wird es geben«, wiederholte er bestimmter, weil sich die junge Rosi so zu freuen schien. Und wenn sich das Mädel wegen ihm freute, wurde ihm warm ums Herz. So hübsch sah es heute aus in dem gelben Stoff, das blonde Haar zu zwei Zöpfen geflochten, die dicken Waden in weißgezwirnten Strümpfen und die kleinen Füße mit den winzigen Zehen in den schwarzen Lederhalbschuhen versteckt.
»Mein Gott!«, rief Rosi und faltete die Hände vor der Brust. »Das muss ich sofort der Irmi erzählen. Die wird schauen.« Lachend hätte sie ihn beinahe umarmt, wenn nicht die Mutter sie weggezerrt hätte.
»Schamst dich net, Madl? Unsere Gäste zu belästigen mit deinem Überschwang.«
»Aber, Gnädigste«, raunte Brahm, »lassen Sie das Mädel doch.« Seine Hand erwischte gerade noch die Hüfte, bevor die Wirtstochter am Windfang vorbei in den goldenen Glanz der Augustsonne entschwand.
»So ein närrisches Ding.« Der Wirt schüttelte den Kopf. »Die alberne Schwärmerei für den Kaiser und seinen Hof hat sie nicht von mir. Auch nicht die seltsame Freude an Büchern. Dauernd hat sie den Kopf zwischen zwei verstaubten Buchdeckeln, anstatt sich um die Gäst zu kümmern.«
Brahm lachte. »Sie ist halt ein kluges Dirndl, eure Rosi. Einer von euch beiden muss ihr das Hirnschmalz ja vererbt haben. Haha.«
Über das Gesicht der Wirtin huschte ein verkniffener Ausdruck. Mit zitternder Hand schenkte sie ihm an seinem Ehrentag das zweite Glas voll mit dem teuren Wein von dem gnädigen Baron, während ihr Gatte die dampfende Kaiser-Schöberl-Suppe servierte.
Schließlich kehrte wieder Ruhe ein in die Suppenkuchl von Groißenbrunn. Seit die beiden in der Nachbarschaft gelegenen Marchfeld-Schlösser Hof und Niederweiden nicht mehr vom Kaiser und von seinem Gefolge genutzt wurden, war es das einzige Wirtshaus weit und breit, das nicht mangels zahlungskräftiger Kundschaft hatte zusperren müssen. Vermutlich lag es an dem legendären Rindsuppenangebot. Das Fleisch bezog der Wirt billigst aus den angrenzenden Kronländern, angesichts der unverschämten Preise der Rinder in den österreichischen Alpentälern.
Wenig später saß Rosi neben ihrer Freundin Irmi am Holztisch der schlicht ausgestatteten Stube im Haus des Gärtners. Am Fenster klapperte die Nähmaschine. Der Mutter pressierte der Auftrag einer feinen Dame aus dem Landadel. Die Gnädigste bräuchte für ein Souper morgen beim Grafen Hardegg im Weinviertel einen Hut, einen ganz besonderen mit Straußenfedern und Stoffblumen am Band. Die Frau Grünanger sei der Gnädigsten wärmstens empfohlen worden. Allerdings müsste der Hut bereits am Abend fertig sein, hatte der Bote die Dringlichkeit untermauert.
»Ich hab’s gwusst, ich hab’s gspürt.« Irmis schmale Schultern hoben und senkten sich. Sie atmete schwer. »Nicht nur die Wiener kommen in den Genuss eines Fests zu Ehren der Kaiserlichen Hoheit, auch Schloss Hof wird sich an der Festlichkeit für unseren Monarchen beteiligen. Erst heute Nacht hat es mir geträumt. Unzählige Blumen, ein Meer an Farben, feine Roben, gepuderte Haare, Fächer aus chinesischem Papier sowie feinstes Porzellan, schwarze Schwäne und bunte Vögel aus Arabien, Springbrunnen mit riesigen Fontänen und, nicht zu vergessen, Perlen und Gold. Ich hab’s deutlich gsehn.«
»Personal braucht der Herr Verwalter zum Putzen und zum Gärtnern. Wäre das nicht was für deinen Herrn Vater, Irmi?« Rosi ereiferte sich. »Ihr habts doch den Garten gepflegt damals in den besseren Zeiten.«
»Hast ghört?« Irmi fuhr hoch und klopfte der nähenden Mutter am Fenster auf die Schulter. »Es gibt Arbeit für den Papa. Der Herr von Brahm weiß von einem Fest auf Schloss Hof so wie damals bei der Kaiserin Maria Theresia.«
Elsa Grünanger nahm den Fuß vom Pedal und löste die Hand vom Schwungrad. Die dunkle Seide ergoss sich mit einem leisen Rauschen über ihre Knie. Sie hob den müden Blick und runzelte die Stirn. »Ich will euch nicht die Hoffnung nehmen, Mädchen, aber an ein Fest wie bei der seligen Maria Theresia glaube ich nie und nimmer. Der Herr Verwalter hat sicher wieder zu tief ins Weinglas gschaut.«
»Doch, Frau Grünanger!«, protestierte Rosi. »Ich habe es eben mit meinen eigenen Ohren gehört. Die Vorhut ist auf dem Weg nach Schloss Hof.«
Irmi warf die Hände hoch. »Wir werden die Kaiserin Sisi sehen. Oh, wie herrlich. Ihre Eleganz, ihre Schönheit von ganz nah!«
»Unsere Landesmutter, liebe Irmi«, die Mutter spitzte die Lippen, »ist eine verhärmte Frau, die nur mehr Schwarz trägt und uns einfachen Leuten niemals ihr altes Gesicht zeigen wird. Meine Großmutter hat die glanzvolle Zeit von Schloss Hof erleben dürfen. Was uns bleibt, ist die Erinnerung an ihre Geschichten. Wir haben dem Herrgott dankbar zu sein für den Frieden. Maria Theresia hat andauernd Krieg geführt. Sehr ungewöhnlich für eine Frau. Wo das weibliche Naturell sonst so friedfertig ist. Andererseits …«
Irmi schenkte den Ausschweifungen der Mutter wenig Beachtung. Lachend stellte sie sich die kostbaren Kleider und den noch kostbareren Schmuck der eleganten Damen vor, die hohen, mit Perlen und Kämmen verzierten Frisuren, die schwarzen Anzüge der Herren, ihre Gamaschen und weißen Krägen, die Zylinder im schimmernden Lack, die Stöcke, Bärte, Uniformen, Abzeichen, Säbel. Kurzum, alles Schöne und Wertvolle, das die Monarchie zu bieten wusste.
Mit einem Seufzer dachte Irmi an ihre Ahnin, die legendäre Schneiderin Eleonore, die ihr Leben der Garderobe der Kaiserin gewidmet und dafür die Ehelosigkeit in Kauf genommen hatte. Dass ihr im recht reifen Alter dennoch ein Sohn geboren worden war, betrachtete die Familie heute mit etwas gutem Willen als göttliches Geschenk. Bis in die Gegenwart hielt sich die Legende der Beihilfe durch einen ungarischen Gesandten am österreichischen Hof. Das Geheimnis um den Vater ihres Kindes hatte die Urgroßmutter mit ins Grab genommen.
»Komm mit, Irmi.« Rosis Wangen glühten. »Der Verwalter sitzt bestimmt bis spät in die Nacht in unserer Wirtsstubn und sauft, wo er heute seinen Geburtstag feiert.«
»Mama, darf ich mit der Rosi in die Suppenkuchl?« Irmi zappelte mit den Beinen. »Ich hab das Geschirr abgewaschen und mit dem Staubwischen bin ich auch fertig.«
Ihre Mutter unterbrach die Näharbeit und sah besorgt hoch. »Irmi, der Vater sieht es nicht gerne, wenn du dich bei den Männern herumtreibst.«
»Meine Eltern passen auf.« Rosi verzog den Mund. »Uns geschieht nichts.«
»Aber spätestens um sechs Uhr bist zurück, hörst du, Irmi?«, mahnte die Mutter. »Der Vater wird vom Holzsammeln rechtzeitig vor dem Abendbrot retour sein. Und du weißt ja, wie er reagiert, wenn …«
Hand in Hand liefen die beiden Mädchen in den Nachmittag hinaus.
»Warum sich deine Mama immer so viele Sorgen macht?« Rosi schüttelte den Kopf. »Wir sind beinah erwachsen.«
»Wenn ich Geschwister hätte, wäre vieles einfacher. Seit vor einem Jahr mein Bruder kurz nach der Geburt gestorben ist«, Irmi holte tief Atem, »ist wohl nichts mehr zwischen Mama und Papa, du weißt schon, was ich meine.« Ihre Wangen röteten sich. »Wenn man das einzige Kind ist … na ja.«
»Ich weiß, was du meinst. Daran ist der Marchfelder Fluch schuld.«
»Was für ein Fluch?« Irmi spürte ein Frösteln.
»Wenn ein männlicher Säugling zur Welt kommt, überlebt er nicht das erste Jahr. Sieh dich um, in anderen Dörfern gibt es viele Söhne, bei uns nur Töchter.«
Irmi schüttelte den Kopf. »Groißenbrunn ist ein kleiner Ort mit wenigen Menschen, da kann es vorkommen, dass mehr Mädchen als …«
»Die Ursache liegt in der Vergangenheit«, insistierte Rosi. »Rudolf von Habsburg hat im 13. Jahrhundert gegen Ottokar in der überaus grausamen Schlacht am Marchfeld gekämpft. Damals sind sechzigtausend Ritter aufeinander losgegangen. Viel Blut ist geflossen. Und seither gibt es kaum überlebende männliche Säuglinge in der Gegend. Das habe ich kürzlich in einer Chronik gelesen. Es ist wahr. Und, dass im Marchfeld die Hexen in den Föhren hausen. Die Kaiserin Maria Theresia hat viele solche Bäume als Windschutz pflanzen lassen und da tanzen in den dunklen Nächten die bösen Geister drauf herum. Allerdings nur in den Föhren, wegen der langen Nadeln, die aussehen wie Hexenhaare. Manchmal kann man sie singen hören. Grauslich, lauter krächzende Stimmen, sag ich dir.«
Irmi riss die Augen auf. Die Rosi wird recht haben mit dem Fluch, dachte sie. Die Sache mit den Hexen in den Föhren hat der Maxi auch schon mal erwähnt. Sie nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen und während einer der nächsten Mondnächte draußen in die Baumkronen zu lauschen.
Im Wirtshaus herrschte am Nachmittag reges Treiben. Der blonde Bäckerjunge Max aus Marchegg saß hinter dem Windfang und rauchte mit den Männern eine Zigarette. Mit sichtlichem Stolz schaute er auf die beiden Mädchen und grüßte wie ein nobler Herr mit einem koketten Nicken. Mit Irmi war er so gut wie verlobt, zumindest versprochen.
Irmi schubste ihre Freundin. »Du, der kommt sich heute aber gut vor, weil ihm die Männer so einen Stinkestängel spendiert haben.«
Rosi zuckte mit den Schultern und schob sie weiter bis zum Tisch des Stammgastes im rückwärtigen Teil der Stubn. »Grüß Gott, Herr Hofmarschall.« Sie baute sich vor Rudolf Brahm auf. »Die Irmi interessiert sich für die Vorhut und das bevorstehende Fest am Schloss Hof und fragt für ihre Mama und für ihren Papa, wann hätten der Herr Verwalter denn Arbeit für einen Gärtner und eine Schneiderin im Schloss?«
Brahm glotzte und kratzte sich am Kopf. »Soso. Arbeit wollts ihr von mir?« Sein Blick glitt die schmalen Hüften hoch bis zu den Wölbungen der kleinen Brüste. »Da ließe sich was machen. Kommts halt morgen bei mir vorbei, du und deine Eltern. Nur recht früh, weil ich nachher mit der Kutschen nach Pressburg rübermuss.«
Irmi, die seine gierigen Augen wie heißes Wasser über ihren Körper gleiten spürte, errötete. »Vergelt’s Gott, Herr Hofmarschall.«
»Na, net so förmlich«, raunte Brahm und zog Irmi zu sich heran. Schon saß sie auf seinem Schoß. Als der scharfe Weinatem ihre Nase streifte, wandte sie sich ab. Just in dem Augenblick griff der Verwalter in Irmis Haarknoten, sodass ihr Nacken versteifte, und drückte einen feuchten Kuss auf ihre Wange. »Bis morgen, Schönheit.«
Erschrocken sprang Irmi hoch und obwohl der Übergriff höchstens fünf Sekunden gedauert haben konnte, war er dem Max drüben am Windfang offenbar nicht entgangen.
Mit wütendem Blick stemmte der dürre Bäckerjunge seine Fäuste in die Hüften. »Ich möchte den Herrn bitten, das zu unterlassen. Die Irmi ist mein Mädchen.«
Ein Moment der Stille erfüllte den verrauchten Raum, alle Köpfe wandten sich dem Tisch des Verwalters zu, der Wirt stand ebenso erstarrt wie seine Gäste, bis Brahm mit beiden Händen auf seine Schenkel klopfend schallend loslachte.
»Dein Mädchen? Hä? Depperter Bua, weißt nicht, wen’st vor dir hast, hä, depperter Bua?« Da niemand in sein Lachen einstimmte, verzog er das Gesicht und ein zorniges Glühen schoss in seine dunklen Augen.
So schnell hatte Irmi ihren Maxi noch nie an der Hand gepackt und nach draußen gezerrt. »Geh jetzt bitte«, flehte sie. »Meine Eltern brauchen die Arbeit im Schloss. Verdirb es nicht.«
»Aber der hat dich gepackt und abgschmust«, protestierte Maxi.
»Gar nichts ist geschehen und jetzt geh nach Hause. Wenn du magst, kannst mich ja morgen im Schloss besuchen und nach dem Rechten sehen.«
»Sicher?«
»Ganz sicher. Lass es gut sein, Maxi.« Irmi drückte einen Schmatzer auf seinen Mund, da schien er endlich versöhnt und ging.
In der Suppenkuchl hatte sich rasch die Aufregung gelegt, nachdem der Wirt zum Ehrentage des Verwalters allen Gästen Freibier spendiert hatte. Wenig später trat der Herr Kaplan in die Stube. Hochwürden warf ein knappes »Grüß Gott« hin und ging geradewegs nach hinten in die Kuchl. Als er die beiden Mädchen am Tisch plaudern sah, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Kurz hielt er inne, dann steuerte er grußlos auf die Wirtin zu, die sich gerade über den Topf am Feuer beugte. »Auf ein Wort.«
Die Frau zuckte unter seiner Stimme zusammen, drehte sich um und beorderte die Mädchen mit einem hektischen Winken nach draußen.
»Der sieht mich immer so finster an«, raunte Rosi im Gehen ihrer Freundin zu. »Ich fürchte mich vor dem Herrn Kaplan. Schon immer hat er mir Angst gemacht. Meinst, des is a Sünd?«
Irmi kicherte. »Hast leicht was angestellt?«
»Aber woher!« Rosi runzelte die Stirn. »Ich frage mich, was der Kaplan in unserer Kuchl mit der Mutter zu bereden hat.«
»Vielleicht braucht er einen frischen Messwein.«
»Den würd er wohl eher vorne beim Papa an der Schank kriegen.« Rosi drehte sich zu ihrem Vater um. Der schaute wie üblich mürrisch drein und wie es schien unschlüssig. Doch dann durfte er sich zu einer Entscheidung durchgerungen haben, denn plötzlich stapfte er auf die Küchentür zu, trat sie mit heftigem Gepolter auf und verschwand. Nach einem kurzen Wortgefecht tauchte der Herr Kaplan auf, eilte wortlos an den Mädchen vorbei und warf der Rosi, und zwar nur der Rosi, einen gefährlich drohenden Blick zu.
Irmi lief ein Kälteschauer über den Rücken. »Was ist denn heute los bei euch?«
Rosi presste die Lippen aufeinander. Man hörte die beiden Wirtsleute hinter der verschlossenen Tür heftig zanken.
»Ich gehe besser vor zur Schank und lenke die Gäst ab«, flüsterte Rosi mit bleichem Gesicht. »Nicht dass sich die Männer aus dem Dorf noch das Maul zerreißen, weil in unserer Suppenkuchl ein hochwürdiger Herr Kaplan hinauskomplimentiert wird wie ein räudiger Dieb.«
»Wird bei euch öfter so arg gestritten?«, insistierte Irmi.
Rosis wasserblaue Augen schimmerten feucht. »Ich glaub, dem Papa gefällt nicht, dass die Mama in der Kirchn für Geld sauber macht. Ich glaub, es geniert ihn.«
»Nein, das bildest dir ein, sicher geht es nur um den Messwein. Meine Mama verdient ein Zubrot mit der Schneiderei und für den Papa ist das in Ordnung.« Irmi küsste der Wirtstochter tröstend beide Wangen und machte sich rasch auf den Weg nach Hause. Schließlich würde sie ebenfalls Schelte erwarten, wenn sie in der hereinbrechenden Dämmerung länger fortblieb, als es der Jungfrauenehre zukam.
2
Gegen sieben Uhr abends hantierte Irmi in der Küche, da hörte sie unerwarteten Besuch mit schweren Schritten in die Stube eintreten. Erschrocken fuhr sie herum. Ein breiter Uniformrücken nahm Irmi die Sicht. Ihr Blick glitt über den Säbel an der Hüfte und den Streifen an der dunklen Hose. Erschrocken zuckte sie zusammen, als sich ihr Vater mit ungewohnt brüchiger Stimme den beiden Gendarmen zu erklären versuchte, während die Mutter immerzu murmelte: »Holz hat er gesucht im Wald für die kalte Zeit, Holz hat er gesucht. Weiter nichts.«
»Karl Grünanger«, setzte der Soldat an, »es gibt Zeugen, die gehört haben, wie du am Hauptplatz vor der Kirchn dem Kaiser den Tod gewünscht hast.«
»Blödsinn! Da hat sich wer verhört. Alles Gute wünsche ich unserem Kaiser, nur das Allerbeste zu seinem Jubiläum. Hoch soll er leben, der Kaiser! Hoch! Hoch!« Der Vater salutierte. Seine Hand zitterte.
»Es ist Vorschrift, Grünanger. Wir müssen dich mitnehmen und ein Protokoll schreiben.«
Sichtlich unangenehm war den beiden Uniformierten ihre Amtshandlung, kannten sie den Vater doch seit Langem und wussten gewiss, dass sie es nicht mit einem Staatsfeind zu tun hatten, höchstens mit einem Unzufriedenen, wie es viele gab in diesen schweren Zeiten.
Die Mutter schlug jammernd die Hände zusammen. »O mein Gott, o mein Gott!«
Als Irmi kurze Zeit später mit der weinenden Mutter in der Stube das Abendbrot einnahm, versuchte sie, den Ernst der Lage zu begreifen. Ausgerechnet heute, in der Hoffnung auf eine glückliche Wendung, musste Schande über ihre Familie kommen. Irmi verstand nicht, was den Herrn Papa bewogen hatte, gegen den Kaiser zu sprechen. Eine Gruppe habe er formiert mit einigen Männern, die auch ohne Arbeit seien, erklärte die Mutter und wischte sich mit einem Taschentuch die Tränen fort. Der Krieg habe alles kaputt gemacht. In einem großen deutschen Reich hätte der Vater Arbeit gefunden, glaubte die Mutter. Irmi interessierten weder die Machtgelüste der Deutschen noch die der Österreicher. Ihre Wangen röteten sich vor Wut. Kein Gesetzesbrecher würde je das Schloss eines Kaisers betreten dürfen. Nur wenig Schlaf fand sie in der Nacht.
Früh am nächsten Morgen brachten die Gendarmen den Vater zurück. Rein äußerlich war er unversehrt, seiner schlaffen Miene merkte Irmi allerdings an, dass er all die Stunden kein Auge zugetan hatte. Die Mutter kochte ihm einen Tee und brachte ihn zu Bett. Irmi zog die Schnüre ihres Mieders eng und streifte ihr hübschestes Kleid darüber. Sie polierte ihre schwarzen Halbschuhe, obwohl der Staub der Straße den Glanz nach wenigen Schritten wieder überdecken würde, drückte ihren Lieblingshut, den mit den gelben Stoffblumen, auf ihren Haarknoten und schlich unbemerkt aus dem Haus. Vielleicht, so hoffte sie, wusste der Herr von Brahm noch nichts von der Schmach. Vielleicht hatte sie Glück. Nur ein einziges Mal im Leben wollte sie Glück haben.
»Erst einmal müssen wir die Ratten loswerden«, eröffnete Brahm Irmi eine Stunde später das Ausmaß ihrer Aufgaben, ohne nach den Eltern zu fragen. »Ich gebe dir Säckchen, die legst du hinter die Möbel. Aber gib acht, es ist Gift, wasche dir danach gründlich die Hände.« Der Verwalter drückte ihr einen Korb voller scharf riechender Stoffpäckchen in die Hand. »Und danach wirst du im Ostflügel überall den Staub und den Schmutz entfernen. Du holst dir aus der Besenkammer im Keller einen Kübel mit Schmierseife, schöpfst Wasser hinein und putzt alles blitzblank. Ich komme, sobald ich kann, und werde prüfen, wie du gearbeitet hast. Wenn es passt, kannst du bleiben. Am Ende zähle ich deine Arbeitstage und gebe dir für jeden Tag zwei Kronen. Um acht Uhr beginnst du und um sechs Uhr am Abend hörst du auf. Mittags darfst du eine halbe Stunde Pause machen. Kannst dir aus der Küche etwas Brot, Käse und Wein holen. Die vom Meierhof werden dir alles zeigen. Merkst du dir das?« Herr von Brahm legte die Hand auf ihre Schulter.
Irmi nickte. Vor Freude war sie sprachlos.
Brahm nahm seinen Beutel und ging. Einen Moment lang dachte Irmi an ihre Eltern, die sich bestimmt große Sorgen bis zum Abend hin machten, wischte dann die Bedenken mit einem Handstreich fort und begann, das Gift zu verteilen.
Nachher beim Saubermachen, wobei sie die meiste Zeit, das geblümte Kleid bis zur Hüfte hochgerafft, auf den Knien über den Boden rutschte, sah sie ab und an eine tote Ratte unter einem Schrank oder hinter einem Bett mit steifen Gliedern liegen. Mutig packte sie die Kadaver an den Schwänzen und warf sie kurzerhand zum offenen Fenster hinaus. Mittags labte sie sich in der Küche, jedoch keine Minute länger als die vorgeschriebene halbe Stunde. Am Nachmittag schrubbte sie weiter den Ostflügel sauber. Dabei wurde sie zu kurzen Pausen gezwungen, da sie von schubweisen Schwindelanfällen heimgesucht wurde. Später ließ sich der Bäckerjunge Max im Schloss sehen. Doch Irmi ließ sich nicht von der Arbeit abhalten, versicherte ihm kurz angebunden, dass alles bestens sei, und schickte ihn fort. War er tatsächlich gekommen, um sie zu kontrollieren? Irmi stieg die Schamesröte in die Wangen. Wenn bloß der Verwalter nichts mitbekam.
Als der kurz vor sechs mit einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk voller Slowaken zur Inspektion erschien, stand sie zwar mit wunden Knien, einem schief hängenden Hut und vom Geruch des Rattengifts benommen vor ihm, aber als er ihr anerkennend den Rücken bis hinab zum Gesäß tätschelte, war sie mächtig stolz auf ihre Leistung.
Zu Hause wurde sie von der Mutter überschwänglich umarmt, die Nachricht von den zwei Kronen pro Tag glichen den Kummer aus. Der Papa lag noch immer oder schon wieder in der Kammer und ließ sich nicht blicken. Obwohl sich Irmi nach dem Abendessen würgend übergeben musste, blieb sie froh gelaunt und ging früh zu Bett, um für den nächsten Tag Kraft für die Arbeit im Schloss zu sammeln. Selbst als ihre Freundin Rosi an ihren Schultern rüttelte, vermochte sie dies nicht aus ihrer Rattengiftbenommenheit zu wecken, aus der sie erst kurz vor sechs Uhr früh mit leichter Übelkeit erwachte.
Gegen Mittag des übernächsten Tages war es dann so weit. Der Ostflügel, von den toten Ratten befreit, gereinigt und gelüftet, war parat für die Aufnahme der militärischen Delegation. Die Slowakenarbeiter, das Meierhof-Gesinde, Herr Brahm und Irmi standen Spalier für die fünf berittenen Dragoner, die sich auf ihren weißen Pferden dem eisernen Tor näherten. Als die Gesichter der Offiziere unter den Helmen erkennbar wurden, war Irmi anfangs enttäuscht von den recht derben Zügen, bis ihr Blick auf den Mann rechts außen fiel. Drei Sterne trug er am Kragen, die ihn ebenso wie der hohe, mit schwarzem Rosshaar besetzte Helm als den Anführer der Gruppe klassifizierten. Die Opulenz der militärischen Montur im lichtblauen Waffenrock, mit den gelben Knöpfen und den roten Stiefelhosen, brachte ihren Puls zum Rasen. Vor allem die Augen des Offiziers waren von einer besonderen Ausdruckskraft und die kräftig geschwungene Oberlippe, die seinem Mund eine Herzform verlieh, entzückte sie. Während die Pferde schnaubend zum Stillstand kamen, war es wie das Erwachen aus einem Traum. Dumpf vernahm sie die sanfte, vielleicht um eine Nuance zu leise und zu traurige Stimme des Offiziers.
»Gott zum Gruß. Rittmeister Andic meldet die Ankunft der Reiter des fünfzehnten Dragonerregiments Seiner Kaiserlichen Hoheit.« Der militärische Gesichtsausdruck wich einem angedeuteten Lächeln. »Ich hoffe, der temporäre Aufenthalt auf Schloss Hof bereitet dem Herrn Verwalter nicht allzu große Umstände. Es sind die besonderen Aufgaben, die uns veranlassen, für ein paar Tage aus der Kaserne hierher zu wechseln.«
»Ihr gehorsamer Diener, Herr Offizier! Es ist mir eine Ehre.« Brahm löste sich aus der strammen Haltung und verbeugte sich tief. »Die Räumlichkeiten im ersten Stock sind hergerichtet und ein bescheidenes Mahl, exakt nach Anordnung, kann jederzeit im Salon der Beletage serviert werden. Zusätzlich verfügen wir über klares Brunnenwasser, Milch, Wein und alles, was unser Meierhof im späten Sommer zu bieten hat. Die Offiziere mögen sich hemmungslos an den reifen rotbackigen Äpfeln, den letzten Heidelbeeren und den ersten grünen Trauben bedienen.«
»Der Herr Verwalter haben sich viel Mühe gegeben. Ich danke recht schön. Erst einmal würden wir uns gerne etwas frisch machen. Der Staub der Straßen klebt an unserer Haut wie an unseren Stiefeln.«
»Bitte sehr, bitte gleich. Die Dienerschaft füllt unverzüglich die Tröge mit warmem Wasser für die Herrschaften. Die Waschgelegenheiten befinden sich neben der Küche. Wenn der Herr Rittmeister gestatten, führe ich die Gruppe persönlich dorthin.«
Die fünf Männer saßen ab und der Stallmeister, ein kräftiger Bursche aus Pressburg, nahm die Pferde in Empfang.
Irmi war wie versteinert. Die Spalier stehende Belegschaft war den Berittenen des Kaisers wohl kaum eines Blickes würdig gewesen und dennoch konnte sie sich des Gefühls nicht erwehren, für einen kurzen Moment von dem edlen Rittmeister wahrgenommen worden zu sein. Würde sie sonst eine derart erregende Wärme in sich spüren? Nein, dieses prickelnde Gefühl, das ihr vom Scheitel bis in die Zehenspitzen fuhr, konnte nur durch die Offiziersaufmerksamkeit verursacht worden sein. Irmi glühte vor Stolz und nahm sich vor, Rosi noch am Abend von der aufregenden Begegnung mit dem schönen Rittmeister zu berichten. Doch zunächst musste sie den anderen an den Waschtrögen zur Hand gehen. In ihrem Glückstaumel gab es nichts, das sie lieber getan hätte. Eifrig schöpfte sie heißes Wasser aus den schweren Kesseln in die zinnernen Wannen. Allein die Vorstellung, der edle Körper würde in Kürze in dem von ihrer Hand berührten Wasser baden, drohte ihr den Atem zu rauben.
Geraume Zeit später, die Slowaken hatten den Waschraum nach getaner Arbeit unverzüglich verlassen, schickte Irmi neben den dampfenden Trögen ein Stoßgebet zum Himmel. Sie dankte dem lieben Gott für die Gnade, die ihr in diesen Tagen widerfuhr. Sie war ein Teil des kaiserlichen Hofs geworden. Eine Berührung an ihrem Gesäß schreckte sie aus den Gedanken.
»Kleines Fräulein«, hörte sie die säuselnde Stimme des Verwalters dicht an ihrem Ohr. Unvermittelt roch sie den Schnaps, den er wohl kurz zuvor getrunken haben musste. »Bist ein fleißiges Mädel, das ist schön, das freut mich.« Er befingerte nicht nur ihre Brüste, überall fühlte sie sich entsetzlich von ihm bedrängt. Vor Schreck verschlug es ihr die Sprache.
Sein mächtiger Körper drückte ihren Unterleib gegen den Trog, sein Keuchen wurde immer ungestümer, ebenso seine Bewegungen mit der Hüfte. Irmi krümmte sich und wäre beinahe mit dem Kopf voran ins Wasser gefallen, da fand sie endlich ihre Stimme wieder und wollte laut um Hilfe schreien, aus ihrer Kehle drang jedoch bloß ein kümmerliches Röcheln.
»Was tun Sie da?«
War es Traum oder Wirklichkeit, dass sie den Herrn Rittmeister reden hörte? Irmi fuhr herum, der Griff um ihre Brust löste sich. Höchstens zwei Schritte entfernt stand er ohne den hellblauen Rock und den Helm nur in Hemd und Hosen. »Ich muss doch sehr bitten, Herr Verwalter.«
»V-verzeiht, verzeiht«, stammelte Brahm. »Ich habe mich vergessen. Bitte untertänigst um Vergebung.«
»Bitten S’ nicht mich, sondern die junge Dame um Vergebung.«
»Verzeih, Irmi, verzeih.« Zerknirscht streckte der Verwalter die Hand aus und Irmi griff in ihrer Verwirrung zu.
»Ist in Ordnung, Herr Brahm«, murmelte sie. »Ich hätte mit den anderen gehen sollen, bin eh selber schuld.« Irmi wagte kaum, den Blick zu heben, und sah von den vier Männern hinter dem Rittmeister bloß Beine und Füße. Die Schamesröte schoss in ihre Wangen.
»Wir würden jetzt gerne unser Bad nehmen.«
»Selbstverständlich, die Herren Offiziere werden nicht mehr gestört.« Brahm räusperte sich und schob Irmi vor sich her dem Ausgang zu.
»Bringen S’ uns eine Flasche von dem roten Wein und fünf Gläser. Und lassen S’ die Finger von dem Fräulein!«
»Selbstverständlich, Herr Offizier.«
Draußen verschwand Brahm ohne ein weiteres Wort. Irmi blieb zitternd zurück, unfähig, klar zu denken. Sicher war es unverzeihlich, dass sie sich nicht gebührend beim Rittmeister für die Rettung ihrer Ehre bedankt hatte. Wie dumm von ihr, dass sie wie ein Kind vor lauter Angst und Scham den Mund nicht hatte aufbringen können. Gewiss redet er jetzt mit seinen Unteroffizieren über mich, dachte Irmi, da vernahm sie schon schallendes Gelächter durch die geschlossene Tür. In ihrem Magen krampfte es. Niemand sollte je von ihrer Schmach erfahren. Der Verwalter würde schweigen, sie würde ebenfalls keine Silbe über den unglücklichen Vorfall verlieren. Selbst Rosi gegenüber nicht.
Es war Sonntag und die Gläubigen hatten nach einer strengen und ermahnenden Predigt die Kirche verlassen, bis auf die Gattin des Wirts und den Herrn Kaplan.
»Ich wünsche mir nichts sehnlicher als einen Sohn«, klagte die Wirtsfrau auf Knien. »Mein Gemahl ist, wie Hochwürden bekannt sein dürfte, mit einer Krankheit bestraft, die es ihm unmöglich macht, mir diesen Wunsch zu erfüllen.« Sie hob die gefalteten Hände in bittender Geste. »Wer soll die Wirtschaft weiterführen, wenn wir nicht mehr sind? So helft mir aus, in Gottes Namen, Herr Kaplan.«
Hochwürden wandte sich ab. Der Anblick des Weibs in Unterwäsche drohte ihm den Verstand zu vernebeln. Dann trug die Verführerin auch noch den schönen Namen Eva. »Geh nach Hause und bete für deine Seele. Ich will dir in dieser Sache nicht mehr helfen.«
»So sagt mir doch, warum mir der Herr keinen Sohn schenken mag.«
»Versündige dich nicht, Weib.« Der Kaplan nahm schützend seine Hände vor die Augen, um die viele nackte Haut nicht zu sehen. Stark wollte er bleiben. Nie wieder durfte er sich am Fleische versündigen.
»Sagt mir bitte, Hochwürden, wie ich den Fluch besiegen kann. Soll ich eine unserer Gänse abstechen? Würde ein Blutopfer die Dämonen vertreiben?«
»Ich kann es nicht mehr hören!« Der Kaplan fuhr hoch. »Der heidnische Aberglaube zerfrisst eure christlichen Seelen! Wie oft habe ich in der Sonntagspredigt davor gewarnt? Wann begreift ihr es endlich? Alles ist Gottes Wille. Danke dem Herrn für die gesunde Tochter, die er dir geschenkt hat, und geh nach Haus zu deinem Ehemann.«
»Eine Tochter kann unsere Gastwirtschaft nicht weiterführen.« Die Wirtin erhob sich von ihren Knien, griff zornig nach ihrem Kleid und zog es über. »Die unsere schon gar net. Von einer Heirat will sie nichts wissen, ihre ganze Leidenschaft gilt den Büchern.«
»Schluss damit«, donnerte der Kaplan.
»Dann werde ich eben woanders um Hilfe bitten«, erwiderte die Wirtin trotzig und wandte sich ab.
Die Herren Unteroffiziere suchten nach der heiligen Messe notgedrungen die Suppenkuchl auf, da es weit und breit kein anderes Wirtshaus gab und am Sonntag nicht im Schloss gekocht wurde. Zu ihrer Überraschung wurden ein schön herbes Biergebräu und eine ausgezeichnete Suppe serviert, die sich »Königinsuppe« nannte und in der neben Speck und Wurzelwerk so Schmackhaftes wie Fleisch und Leber vom Kalb schwammen. Anschließend trug der dickleibige Wirt einen Tafelspitz mit Kren und in Schmalz gerösteten Erdäpfeln auf. Die Männer blieben nach dem Mahl sitzen und tranken weiter, nur der Herr Rittmeister löste sich aus der Gesellschaft seiner Truppe und kehrte unverzüglich ins Schloss zurück, um die Inspektionsarbeiten fortzuführen.
Mit zerwühlten Haaren saß er in der verlassenen Küche im Erdgeschoss und studierte am roh gezimmerten Tisch die Pläne der kilometerlangen Wasserleitungen, die einst Prinz Eugen für den Betrieb der Fontänen und Kaskaden von den besten Ingenieuren seiner Zeit hatte errichten lassen. Viele davon waren beschädigt und seit Jahren unbrauchbar. Andic wollte keineswegs die hübschen Brunnen der sieben Terrassen wieder zum Sprudeln bringen. Er dachte an die Pferde, die künftig auf dem Gelände versorgt werden mussten, mehr noch dachte er an die Zucht der weißen Araber und an die Erweiterung der Stallungen zu diesem Zweck. Die bestehenden Holzleitungen zur Brauchwasserversorgung durch die drei Teiche bei Groißenbrunn reichten dafür bei Weitem nicht aus. Die Zuflüsse mussten repariert und neue Brunnen mussten gegraben werden. Andic wollte die besten Handwerker der Gegenwart dafür nach Schloss Hof holen und überlegte, über welchen adeligen Mäzen er das nötige Geld aus den mageren Staatsbudgettöpfen kriegen könnte.
Wie nun Irmi im Rahmen der besonders gründlichen Sonntagssäuberung, die eine penible Überprüfung der aktuellen Rattenpopulation beinhaltete, in der Annahme den Raum betrat, die hohen Gäste wären ausnahmslos drüben in Groißenbrunn, zuckte sie erschrocken zurück, als sie den Rittmeister in Gedanken versunken am Fenster sitzen sah. Doch dann beschloss sie, die ihr gebotene Möglichkeit am Schopf zu packen, und machte sich räuspernd bemerkbar.
Rittmeister von Andic hob fragend den Blick.
»Verzeihung, Herr Rittmeister, ich wollt mich entschuldigen.«
»Wofür denn, mein Fräulein?«
»Na ja, dafür, dass mir der Herr Rittmeister kürzlich die Ehre gerettet haben. Der Herr Verwalter hat sich … hat sich nicht anständig benommen gestern.«
»Ach ja, der Zwischenfall in den Waschräumen.«
»Der Herr erinnern sich.«
»Wie heißt denn das Fräulein?« Er musterte sie von Kopf bis Fuß.
»Irmi Grünanger, Herr Offizier.« Sie knickste mit gesenktem Haupt.
»Komm näher. Lass dich anschauen, Irmi.«
Mit klopfendem Herzen und winzigen Schritten trippelte sie auf ihn zu. »Wenn es erlaubt ist, möchte ich anmerken, dass wir in Groißenbrunn alle sehr, sehr glücklich über das Eintreffen der Herren Offiziere sind.«
»Was ist denn am Eintreffen von Militär so erfreulich, wenn ich fragen darf?« Rittmeister Andic zog die Brauen hoch.
»Weil seit ewig nichts mehr los ist bei uns und wir uns schrecklich langweilen auf dem Land, weil es vielen schlecht geht, weil es zu wenig Arbeit und nichts zu verdienen gibt, jetzt ist jedoch alles gut, jetzt geht es bergauf und wir alle freuen uns auf das bevorstehende …« Irmi schlug sich mit der flachen Hand auf den Mund. »Was plappere ich daher, ich störe den Herrn Offizier bei der Arbeit. Ich bitte um Vergebung.«
Sie schickte sich an, auf der Stelle umzukehren, aber der Rittmeister hob beschwichtigend die Hand und sein Blick hielt sie gefangen, sodass sie gar nicht in der Lage gewesen wäre, sich umzudrehen oder nur einen Deut abzuwenden.
»So lass doch die umständliche Anrede sein.« Ein Lächeln erhellte seine Miene. »Wenn wir unter uns sind, Fräulein Irmi, darfst mich mit ›Herr Andic‹ anreden oder noch besser mit ›Herr Tomas‹. Das klingt melodischer und ich komme mir nicht so furchtbar alt dabei vor. Wir zwei sind höchstens ein paar Jährchen auseinander, also bitte nicht so förmlich, Fräulein.«
Verlegen verbarg Irmi ihre Hände hinter dem Rücken. Ungemein genierte sie sich für den albernen Staubwedel in ihrer Hand. »Ja, ist es denn einem einfachen Mädel wie mir gestattet, einen Herrn Offizier aus feinem Hause mit ›Du‹ anzureden?«
»Meine Eltern hinterließen mir zwar etwas Grundbesitz in der Steiermark …« Der Rittmeister schien gedanklich abzuschweifen, hielt inne und fuhr erst nach einigen Sekunden mit belegter Stimme fort. »Die Geburt ist vielleicht ein Glück, ein Verdienst ist sie niemals, Fräulein. Wir sind zu bewerten nach unserem Handeln, nicht nach dem Erbe unserer Eltern.«
»Ich bin die Tochter des Gärtners von Groißenbrunn«, erwiderte Irmi, durch seine vertrauliche Rede ermuntert, von sich zu erzählen. »Meine Urgroßmutter war am Hof der Kaiserin Maria Theresia als Schneiderin im Dienst. Zweihundert Bedienstete soll es damals am Schloss gegeben haben.«
»Donnerwetter, Schneiderin bei der Kaiserin Maria Theresia!«
Die Aufmerksamkeit des Rittmeisters schien geweckt. Irmi strahlte und rückte ihren verrutschten Hut zurecht.
»Da entstammt das Fräulein also einer berühmten Handwerksdynastie. Kann es denn auch fein schneidern wie die Urgroßmutter?«
Irmi schüttelte den Kopf. »Na, i net, Herr Rittmeister Andic, aber meine Mama, die kann wunderschöne Sachen nähen.« Sie lüftete mit der freien Hand den Saum ihres Kleids. »Alles, was ich anhab, hat sie geschneidert. Na ja, bis auf die Strümpfe und das Mieder.«
Der Rittmeister lachte. »Selbst den Hut?«
»Hüte kann meine Mama am besten nähen.«