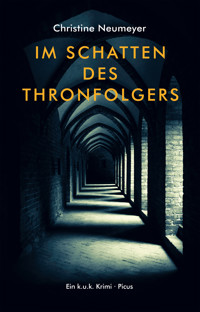
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Schloss Artstetten haben sich Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie einen schönen Landsitz mit großzügigen Gärten geschaffen. Auch eine Familiengruft soll gebaut werden – doch im Zuge dieser Bauarbeiten kommt es zu einem grausigen Fund. Polizeiagent Pospischil und sein Assistent Frisch werden aus Wien zum Tatort gerufen, und bald schon wird klar, dass Kammermeister Baron von Wald eigenmächtig Gartenjagden für Adelige veranstaltet: Die Gejagten sind Bauernmädchen aus der Umgebung und die adeligen Herren werden vom Baron in Folge mit eindeutigen Fotos erpresst. Als dann auch noch die Leiche eines Mädchens gefunden wird, das seine Teilnahme an der Jagd verweigert hat, erhält der ursprüngliche Mordfall noch weitere Dimensionen, und Pospischil bringt die aparte Pfarrersköchin gewaltig in Versuchung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christine Neumeyer
Im Schatten des Thronfolgers
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Lord Runar/iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2143-3
eISBN 978-3-7117-5508-7
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
Christine Neumeyer
Im Schatten des Thronfolgers
Ein k. u. k. Krimi
Picus Verlag Wien
Inhalt
Kapitel 1: Montag, 26. April 1909, Wien
Kapitel 2: Dienstag, 27. April 1909, Artstetten
Kapitel 3: Freitag, 30. April 1909, Artstetten
Kapitel 4: Freitag, 14. Mai 1909, im Garten von Schloss Artstetten
Kapitel 5: Freitag, 28. Mai 1909, Artstetten
Kapitel 6: Freitag, 28. Mai 1909, Wien
Kapitel 7: Freitag, 28. Mai 1909, Pöggstall und Artstetten
Kapitel 8: Samstag, 29. Mai 1909, Wien
Kapitel 9: Samstag, 29. Mai 1909, Artstetten
Kapitel 10: Sonntag, 30. Mai 1909, Marchfeld und Wien
Kapitel 11: Montag, 31. Mai 1909, Wien
Kapitel 12: Montag, 31. Mai 1909, Artstetten
Kapitel 13: Dienstag, 1. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 14: Dienstag, 1. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 15: Mittwoch, 2. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 16: Mittwoch, 2. Juni 1909, Maria Taferl
Kapitel 17: Mittwoch, 2. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 18: Mittwoch, 2. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 19: Donnerstag, 3. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 20: Donnerstag, 3. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 21: Donnerstag, 3. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 22: Donnerstag, 3. Juni 1909, Wien
Kapitel 23: Donnerstag, 3. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 24: Donnerstag, 3. Juni 1909, Wien
Kapitel 25: Donnerstag, 3. Juni, Artstetten
Kapitel 26: Freitag, 4. Juni, Artstetten
Kapitel 27: Freitag, 4. Juni 1909, Artstetten
Kapitel 28: Sonntag, 6. Juni, Artstetten
Kapitel 29: Samstag, 12. Juni 1909, Marchfeld bei Engelhartstetten
Danksagung
Kapitel1
Montag, 26. April 1909, Wien
Baron Adolf von Wald nahm den weiten Weg mit der Eisenbahn aus Pöchlarn nahe Artstetten auf sich, weil sich die Geschäfte in der Regel lohnten, die er in der Reichshauptstadt anzubahnen pflegte. Außerdem gab es nur in Wien die Sorte seiner heiß geliebten Havanna-Zigarren, ohne die er es, ähnlich wie der Kaiser Höchstselbst, keinen Tag lang aushalten konnte. Nachdenklich blickte er über die im hellen Sonnenschein vorbeifliegenden Wiesen und Äcker. Seit Jahren diente er auf dem Sommerschloss im Nibelungengau als Kammermeister Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Zuvor war sein Vater bei Erzherzog Karl Ludwig im Dienst gestanden. Er selbst war dessen Sohn mittlerweile recht nahegekommen, vor allem, weil er sich für die äußerst ehrenhafte Wartung seiner Jagdwaffen zuständig fühlte. Von Wald seufzte. Längst wäre es an der Zeit, eine Sprosse in der gesellschaftlichen Hierarchie emporzusteigen. Er dachte an den Titel eines Grafen. Heutzutage wurde jeder Beamte des höheren Dienstes, hatte er nur lange genug in den Amtsstuben gebuckelt, in wenigen formalen Schritten zu einem edlen Herrn von und zu. Eine simple schriftliche Beantragung genügte und der Prozess der Nobilitierung setzte sich in Gange. »Ha! Ha!« Adolf von Wald lachte höhnisch. Den abschätzigen Blick des ihm gegenübersitzenden Herrn ignorierte er vornehm. Bald würde es in der Monarchie mehr Adelige als Bürgerliche geben. Die Zivilisten in den Ministerien ersaßen sich die Adelung mit runden Rücken, die Offiziere der k. u. k. Armee erkämpften sie sich wenigstens stehend von Manöver zu Manöver. Er sah sich irgendwo dazwischen. Als Kammermeister kümmerte er sich immerhin um das Wohlergehen des künftigen Kaisers. Wie man munkelte, würde das Schloss Artstetten nach dem Tod des Onkels eine bedeutende Rolle im Zentrum der Macht übernehmen. Neben Wien natürlich. Darin sah er seine Chance. Trotz alledem musste er immer öfter Demütigungen durch den Gutsverwalter Franz Hahn ertragen. Unglaublich, wie der Mann aus einfachen Verhältnissen zu einer derartigen Position gekommen war! Sämtliche seiner Ausgaben wollte der unverschämte Kerl prüfen. Es fehlte noch, und der Kaiser beförderte auch ihn zu einem edlen Herrn von und zu. Die Monarchie hatte bei Gott bessere Leute verdient! Was blieb ihm übrig, als seine persönliche Weiterentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Hätte Erzherzog Franz Ferdinand die besonderen Fähigkeiten seines Kammermeisters nicht derart träge zur Kenntnis genommen, als wäre alles eine Selbstverständlichkeit, wäre er nicht zu außergewöhnlichen Maßnahmen gezwungen gewesen. Kurz vor der Stadtgrenze nahm von Wald einen tiefen Zug von der Havanna und blies ihn seinem Gegenüber ins Gesicht.
Nachdem er am Wiener Westbahnhof in eine Droschke gestiegen war, ging er im Geiste die wöchentlich erscheinende Liste in der Österreichischen Zeitschrift für Verwaltung durch. Die Namen der geadelten Offiziere interessierten ihn wenig. Die vom Militär waren zu misstrauisch und würden nur Ärger bereiten. Allein auf die dienenden Beamten der Verwaltung hatte er es abgesehen. Das ob der mangelnden Bewegung in frischer Luft geschwächte Hirn machte weich und anfällig für Schmeicheleien. In dieser Woche war sein Auserwählter ein gewisser Herr Stanislaus Freudenthal aus Schlesien. Bis vor Kurzem war der Herr Rechtsanwalt im k. k. Handelsministerium für die Kooperation der Geschäfte zwischen den einzelnen Kronländern zuständig gewesen. Eine durchaus wichtige Aufgabe für einen Bürgerlichen, musste der Baron sich eingestehen. Seine Majestät von Gottes Gnaden hatte dem braven Staatsdiener den Antrag zur Verleihung des Titels eines Edlen von und zu umgehend nach der Pensionierung genehmigt. Na, das wird den Herrn Stanislaus eine saftige Gebühr für die Stempelmarken gekostet haben, amüsierte sich von Wald. Der Edle kostet was extra. Brieflich hatte er sich bereits vor Tagen in der Wickenburggasse in der Josefstadt nahe dem Gerichtsgebäude zu einem Gespräch angeboten und war sogleich von Freudenthal eingeladen worden. Von Wald grinste. Durch seine breit gestreuten Beziehungen war es ein Leichtes, die Adressen seiner künftigen Geschäftspartner auszukundschaften. Er schnippte den Zigarrenstummel mit Schwung aus dem halb geöffneten Fenster. Der Geruch nach Pferdemist stieg unangenehm scharf in seine Nase. Mit dem Ellenbogen schob er lässig das Fenster hinauf, lehnte sich zurück und brachte sich die eingeholten Informationen für das in Kürze stattfindende Gespräch in Erinnerung. Hofrat und Rechtsanwalt Stanislaus Edler von Freudenthal war seit Jahren verwitwet und Vater eines erwachsenen Sohnes mit krankhafter Spielleidenschaft. Einen besseren Kandidaten konnte es nicht geben. Der Mann hatte wenig zu verlieren, abgesehen von seiner Ehre, und noch weniger zu vererben. Das gesamte Familienvermögen floss dank seines einzigen Nachkommens in die Spielhöhlen der Kronländer. Da war die Adelung, die den Kaiser nebenbei nichts kostete, zur rechten Zeit gekommen. Mit der Nobilitierung öffneten sich Türen, die einem Bürgerlichen, selbst mit bester Bildung, verschlossen blieben. Diese neuen Zugänge versprachen Geld. Auf einmal stieg bei den Bankinstituten die Kreditwürdigkeit, auf einmal wurde man in Häuser eingeladen, die nur dem Adel offenstanden, die Kontakte zur besseren Gesellschaft eröffneten neue Geldquellen und so weiter und so fort. Von Wald hob das Kinn und blickte aus dem Wagen über die Josefstädter Straße zu einem Fenster, dessen Läden sich gerade öffneten. Eine Frau mit dunklen offenen Haaren beugte sich vor und blickte hinaus auf die Straße, wo vier Männer in Mantel und Hut auf die nächste Elektrische warteten. Das gleichmäßige Klappern der Pferdehufe über das Kopfsteinpflaster ermüdete ihn. Gähnend lehnte er sich zurück. Der Herr Hofrat in Ruhe wäre ein Narr, sein Angebot nicht anzunehmen, sinnierte er. Eine offizielle Einladung der Jagdgäste nach Artstetten versendete er allerdings erst nach genauer Prüfung der Kandidaten. Zu heikel war die Angelegenheit. Schließlich bewegte er sich dabei am Rande der Legalität. Selbst für einen Adeligen nicht ungefährlich. Er grinste in sich hinein, stieg an der Wickenburggasse Nummer zehn aus der Droschke, bezahlte, betrat das Haus, nahm die breite Steintreppe und betätigte im ersten Stock den Türklopfer.
Der Herr Rechtsanwalt öffnete persönlich in schlichten Hosen und Hemd, als hätte er hinter der Tür auf ihn gewartet. Herr von Wald machte sich beim Eintreten innerhalb von Sekunden ein Bild von den Verhältnissen. Mächtige Räume mit hohen Fenstern, an manchen Stellen blätterte die gelbe Wandfarbe von den Wänden, Ölgemälde mit höflichen Landschaften unbestimmter Herkunft, gewiss von geringem Wert, Kristallluster, Vorhänge aus edlem Brokatstoff. Mit einem gefälligen Lächeln ließ er sich in den Wohnsalon führen.
»Ich freu mich sehr über Ihren Besuch. Bittschön, kommen S’ weiter. Entschuldigen Sie die Unordnung, mein Dienstmädchen hat ihren freien Tag.«
»Bitte keine Umstände«, raunte von Wald und sah sich weiter um. Der beinahe bis zum Plafond reichende Kachelofen hatte Klasse, die Qualität der Möbel zeugte von einem soliden bürgerlichen Wohlstand, das Silber in der Vitrine ein dezenter Hinweis auf ein reiches Erbe. Seinem geschulten Auge entgingen jedoch weder die vergilbten ungewaschenen Gardinen noch das verstaubte Holz. Das Dienstmädchen musste mehr als einen freien Tag haben, dachte er, vermutlich gab es gar keines.
An einem runden Tischchen mit Spitzendecke setzten sich die Männer. Herr von Freudenthal bot seinem Gast Kaffee und Whiskey an. Beides stand auf einem Tablett bereit. Herr von Wald griff dankend zu. Das gerahmte Diplom zur Verleihung des Adelsstandes mit dem Zusatz des Edlen von hing prominent über dem Sofa, stellte Herr von Wald amüsiert fest. Eine stark ausgeprägte Eitelkeit konnte er gut für seine Zwecke gebrauchen. Das rote Wachs mit der Signatur des Kaisers von Österreich-Ungarn leuchtete wie ein Blutfleck von dem hellen Pergament. Er wusste über das Prozedere Bescheid. Das Diplom wurde in Massen vorgedruckt. Einzig die Namen wurden mit Tinte in den vorgegebenen Text eingefügt. Der Kaiser signierte blanko, vermutlich ohne Interesse an dem jeweiligen Adressaten.
»Respekt und herzliche Gratulation. Jetzt sind Sie einer von uns.« Herr von Wald hob grinsend das Whiskeyglas. »Chapeau, edler Herr von Freudenthal.«
»Zu viel der Ehre. Ich danke Ihnen.« Der Hofrat neigte den Kopf. »Sie schrieben mir von einer Einladung nach Artstetten. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich nun auch persönlich in dieser Sache aufsuchen, doch darf ich fragen, wie Sie auf mich gekommen sind, verehrter Herr von Wald? Ich bin wenig geübt im Schießen und ein miserabler Reiter.«
»Oh, das ist wohl ein Missverständnis. Verzeihen Sie mir, lieber Herr von Freudenthal. Das Schreiben war wohl zu knapp formuliert. Bei unserer Jagd handelt es sich um eine Maskerade im Rahmen eines kleinen Gartenfestes. Zweifelsohne ein besonderes Vergnügen, aber es wird weder geschossen noch geritten.«
»So, so. Also keine Jagd. Eine Maskerade.« Freudenthal runzelte die Stirn.
»Das Anwesen des Schlosses in Artstetten verfügt über einen beachtlichen Baumbestand und seltene exotische Pflanzen, vieles vom Thronfolger auf seinen Reisen gesammelt. Dort werden Sie die einmalige Gelegenheit haben, ausgewählte liebreizende Jungfern in fröhlicher Kostümierung durch den Garten zu jagen, bevor Sie sich an den Köstlichkeiten der Region laben werden.« Von Wald grinste. »Vor allem jedoch werden Sie die Umgebung des künftigen Kaisers von Österreich kennenlernen.«
»Sie laden mich ein, Jungfern zu jagen?« Die Augen von Freudenthal wurden schmal. »Ich dachte, ich würde den Erzherzog auf seinem Sommerschloss treffen, um eine spätere Zusammenarbeit zu besprechen.«
Von Wald tat, als überhörte er den Ton der Enttäuschung in der Stimme seines Gegenübers. »Sie schießen zu schnell, lieber Herr von Freudenthal.« Er beugte sich lächelnd vor. »Sehen Sie es als ersten Schritt, um in den Kreis des Beraterstabs des baldigen Kaisers von Österreich aufgenommen zu werden. Es kostet Sie die Kleinigkeit einer Kanzleigebühr von fünfzig Kronen für die Bewirtung und, wenn Sie möchten, extra fünfzig Kronen für eine Übernachtung nach dem Fest in einem Gasthof in der Nähe des Schlosses.«
»Eine Gebühr von einhundert Kronen? Da habe ich wirklich einiges missverstanden!« Der Herr Hofrat verzog das Gesicht.
»Nun. Sie müssen sich den Aufwand für das benötigte Personal vorstellen.« Von Wald hüstelte. Der Hofrat zeigte sich schwerfälliger als erhofft. »Bedenken Sie, lieber Herr von Freudenthal, die sich eröffnenden Möglichkeiten, die eine solche Kontaktaufnahme für Sie bieten könnte. Ihre Chancen, wenn der Thronfolger erst einmal Kaiser geworden ist.«
»Eine Investition in die Zukunft soll es sein, Jungfern durch einen Park zu jagen?«
»Verstehen Sie keinen Spaß, lieber Herr von Freudenthal? Pflicht und Genuss müssen einander nicht widersprechen. Neue Zeiten brechen an. Neue Sitten, wenn Sie so wollen. Der künftige Kaiser sieht die Welt bunter als sein greiser Onkel in Schönbrunn, glauben Sie mir.«
Von Freudenthal hob den Kopf. In seinen Augen blitzte ein verräterisches Funkeln. Zufrieden drückte der Kammermeister den Rücken gegen die Sessellehne und trank den Kaffee in wenigen Zügen. Er hatte ihn an der Angel.
»Wenn das so ist«, fuhr Freudenthal nach einer Gedankenpause fort. »Wann soll dieses … nun, diese Jagd denn stattfinden, Herr Baron?«
»Mitte Mai, mein Lieber. Ich sende Ihnen eine offizielle Notiz mit allen Details.« Er rieb sich die Hände. »Wenn ich mir erlauben dürfte, um die kleine Kanzleigebühr für den Verwaltungsaufwand im Voraus zu bitten.«
»Nun, es wird mir eine Ehre sein, im Garten des Schlosses unseres Thronfolgers zu lustwandeln.« Freudenthal stand auf, ging steif zu einer Kommode, kramte und entnahm einen Geldschein. »Hier sind die fünfzig Kronen. Um eine Übernachtung, sollte sie notwendig sein, werde ich mich selbst kümmern.«
»Wie Sie wünschen, Herr von Freudenthal.« Der Kammermeister nahm den Geldschein entgegen. »Ich freue mich, Sie bald in Artstetten begrüßen zu dürfen. Werden Sie mit dem Schiff oder mit der Bahn anreisen? Es könnte Sie jemand vom Bahnhof Pöchlarn abholen.«
»Ich denke, ich werde mit der Bahn reisen und werde Sie über die geplante Ankunft unterrichten.«
»Eine gute Wahl. Ich freue mich.«
»Ich freue mich auch, verehrter Herr von Wald.« Freudenthal hob das Whiskeyglas. »Auf neue, auf bessere Zeiten.«
Er tat es ihm gleich. »Trinken wir auf die Zukunft, die bald kommen wird, mein Freund. Vertrauen Sie mir.«
Kapitel2
Dienstag, 27. April 1909, Artstetten
»Bitte beeilen Sie sich. Mei Frau liegt in den Wehen mit unserem vierten Kind und sie leidet große Schmerzen.«
Das Gesicht des Mannes glänzte im fahlen Morgenlicht schweißnass. Franziska kannte ihn. Der Weinbauer und seine Frau lebten mit drei Kindern im Nachbarort Pöbring. Nun machte also das vierte Kind Probleme.
»Warten Sie, Herr Winter, wir ziehen uns schnell etwas an.«
»Franziska! Was ist denn los?«, rief die Mutter aus der Schlafkammer.
»Eine Geburt in Pöbring, bei den Winters.«
»Ich bin gleich so weit.«
Der Weinbauer war mit einem schwarzen Fahrrad gekommen. Auch die Hebamme und ihre Tochter besaßen welche. Franziska klemmte die große Tasche mit dem Werkzeug auf dem Gepäckträger fest, straffte den Rocksaum zwischen die Beine und schwang sich auf den ledernen Sattel. Mutter bildete das Schlusslicht des Trios auf der im Morgengrauen menschenleeren Landstraße. Bis auf den Gesang der Vögel war es still. Mit kräftigen Tritten radelten die drei gegen den leichten Wind. Nach der Brücke über den Mühlbach dauerte es noch zehn Minuten bis nach Pöbring. Ein süßer Duft nach Gras und Kräutern hing in der Luft. Franziska mochte die Morgenstunden, wenn die Nebel aus den hügeligen Wiesen stiegen. Das einfache Bauernhaus lag am Rande des Dorfes unweit der Kirche und des Friedhofs. Ein Hahn krähte, als sie keuchend von den Rädern stiegen und hineineilten.
Zwei kleine Mädchen und ein Bub saßen zu einem Bündel zusammengekauert auf einer Bank in der Küche. Kerzenflammen loderten und rußten. Zuckende Schatten huschten über die Gesichter. Keinen Ton gaben die sichtlich verängstigten Kinder von sich. Jeder Schritt über die Holzdielen knarrte.
»Kommen Sie!« Der Bauer führte die beiden Frauen weiter in ein Nebenzimmer. Dort lag die Frau auf einem hellen Laken und stöhnte. Es roch nach Blut. Die Morgensonne warf ein warmes Rot über die dunklen Möbel und weißen Wände.
»Haben Sie heißes Wasser und Seife?«, fragte die Mutter. Er zeigte durch die offene Tür auf einen Topf auf dem Herd. Mutter und Tochter reinigten sich rasch die Hände. Danach tastete die Mutter über den Bauch der Frau. »Jetzt du, Franzi.«
Sie schloss die Augen und fühlte. »Die Lage des Ungeborenen ist nicht günstig. Der Kopf liegt oben.«
»Richtig. Da muss gedreht werden«, diagnostizierte die Mutter. »Wie lange hat Ihre Frau schon Wehen, Herr Winter?«
»Nicht lange. Ich bin gleich losgefahren, als die Schmerzen begannen.«
»Gut. Dann haben wir noch Zeit. Wir brauchen einen Arzt.«
»Wir können uns keinen Mediziner leisten«, jammerte der Ehemann. »Die letzte Ernte war miserabel und mein alter Gaul lahmt.« Er senkte den Blick.
»Der Herr Doktor Koch aus Emmersdorf an der Donau arbeitet in Notfällen kostenlos.« Sie stand auf und ging zu dem Bauern, der kreidebleich geworden war. »Holen Sie ihn«, sprach sie leise. »Er wohnt neben der Kirche, das erste Haus im Ort. Sie können es nicht verfehlen, es hat einen hellen Anstrich und ein rotes Dach. Nennen Sie ihm meinen Namen, dann kommt er.« Mit ihrem rechten Arm machte sie eine Bewegung, als wollte sie Hühner aufscheuchen. »Beeilen Sie sich!«
Der Mann warf einen angsterfüllten Blick zu seiner Frau. Als sie in diesem Moment im Schmerz aufstöhnte, fuhr er herum und stolperte in die Küche, wo er seine Kinder umarmte, bevor er sich losriss und verschwand. Die beiden kleinen Mädchen begannen leise zu weinen. Der Bub starrte stumm zu Boden.
»Seid beruhigt. Wir kümmern uns um eure Mutter.« Franziska streichelte den drei verschreckten Kindern über die Köpfe in der Hoffnung, dass der Vater die Strecke bis Emmersdorf und zurück rechtzeitig schaffte. Die Mutter quälten die gleichen Gedanken. Franziska las es in ihren Augen. Viel hatte sie von ihr gelernt. Uraltes Wissen. Bald war sie bereit für das Hebammen-Examen, und sobald sie bestand, würde sie alleine arbeiten dürfen. Im Moment fürchtete sie sich davor, obwohl eine so dramatische Geburt wie heute äußerst selten war. Mein Gott, diese Frau musste leben. Was täte der Mann ohne sein Weib, ohne die Mutter seiner Kinder? Franziska blickte voll Mitleid auf die Kleinen in der Stube. Zitternd hielten sie sich an den Händen. Große Augen starrten ihr entgegen. Im Stillen betete sie ein Vaterunser, während das Stöhnen der Frau in der Kammer immer kräftiger und beängstigender wurde. »Seid jetzt brav und still. Wir werden eurer Mama helfen«, sagte Franziska und schloss die Tür zur Küche. Was jetzt geschah, war nichts für Kinderaugen.
»Alles wird gut. Atmen Sie. Atmen Sie. Hilfe ist unterwegs.« Während Franziska die Gebärende beruhigte, entnahm die Mutter der Hebammentasche die Leibschüssel und schob sie unter das Gesäß der Frau. Dann griff sie nach dem Tupfer und der Flasche mit der Desinfektionsflüssigkeit und reinigte den Unterleib zur Vorbereitung der hoffentlich bald einsetzenden Geburt. Das Wichtigste war Sauberkeit, um Infektionen zu vermeiden. Zu viele Frauen starben im Wochenbett. Vier Hände strichen in Kreisen über den Bauch der Frau, um einerseits die Krämpfe zu mildern, andererseits um vielleicht doch noch eine Drehung des Kindes zu bewirken.
Nach eineinhalb Stunden, der Bauer musste mit dem Rad durch die Landschaft gerast sein, kehrte er schweißüberströmt zurück. »Der Doktor war nicht da«, stieß er atemlos hervor. »Er ist bei einem anderen Notfall, nur seine Frau war zu Hause.«
»Es ist ein Skandal«, schimpfte die Mutter, »wir brauchen mehr Landärzte.«
»Machen Sie die Wendung. Ich bitte Sie!«
»Guter Mann, wir Hebammen haben uns an Vorschriften zu halten. Wenn etwas passiert, droht uns der Verlust der Zulassung.«
»Ich flehe Sie an.« Der Mann sank auf die Knie. »Lassen Sie meine Frau nicht sterben.«
Franziska wechselte einen Blick mit der Mutter. Die Herztöne des Kindes waren schwächer geworden, die Frau verlor zusehends an Kraft. Für einen Transport in ein Spital war es zu spät.
»Also gut, Herr Winter, wenn Sie mir versprechen, niemandem davon zu erzählen, was immer auch geschieht.«
»Ich schwöre es Ihnen.« Seiner erschöpften Frau drückte er einen Kuss auf die feuchte Stirn. »Alles wird gut, Liebes.«
»Gehen Sie zu Ihren Kindern. Beruhigen Sie sie«, scheuchte die Mutter ihn fort. Dann kniete sie sich ans Ende des Bettes. Für eine Wendung im Mutterleib musste man spezielle Handgriffe beherrschen, das wusste Franziska. Noch nie hatte sie eine Wendung miterlebt, nur in der Hebammenzeitschrift darüber gelesen. Am besten begann man damit früh, nicht erst im Laufe der Geburt. Es war aber nun einmal nicht mehr zu ändern. Die Mutter sagte, was sie brauchte, und Franziska eilte in die Küche, um ein Stück Holz, eine Schere, Tücher und das abgekochte, ausgekühlte Wasser zu holen. Das Stück Holz klemmte sie zwischen die Zähne der Frau, die Schere wurde desinfiziert.
»Eine Wendung ist wie ein Tanz zu dritt«, sagte die Mutter und fuhr mit beiden Händen in den geöffneten Muttermund. »Eigentlich ist es nicht schwer, man muss es nur wagen.« Die Frau presste die Zähne in das Holz. Keine fünf Minuten dauerte es, bis der Kopf des Kindes, kurz darauf die Schultern und mit einem Flutsch auch der Rest des kleinen Körpers zum Vorschein kamen. Die Mutter gab dem Knaben einen Klaps auf den Po, worauf er ein leises Jauchzen von sich gab. Das Kind atmete! Gott sei Dank! Franziska schossen Tränen der Erleichterung in die Augen. Zum Glück war es keine Totgeburt. Wie hätten sie es den Behörden erklärt? Mit flinken Fingern trennten sie die Nabelschnur und kümmerten sich um die Entfernung der Plazenta, bevor der Vater mit den Kindern die Kammer betreten durfte.
»Vergelt’s Gott«, murmelte die Frau und ihr Ehemann drückte der Mutter mit feuchten Augen fünf Kronen in die Hand. »Das ist alles, was ich Ihnen geben kann.«
»Es reicht«, murmelte die Mutter und steckte das Geld in die Tasche. Franziska wusste, dass sie normalerweise mindestens zehn Kronen für Geburten verlangte, aber der Bauer hatte es nicht leicht mit vier Kindern, einem winzigen Pachtgrund und einem lahmenden Pferd.
Auf dem Nachhauseweg wärmten die Strahlen der aufgehenden Sonne im Rücken und ein heftig aufbrausender Wind schob die Räder. Sie brauchten kaum zu treten. Nach der Aufregung fühlte sich Franziska leicht wie ein Vogel.
»Ich weiß nicht, Mutter, ob ich mich jemals trauen würde, eine Wendung selbst durchzuführen.« Franziska nahm einen tiefen Atemzug von der frischen, vom Geruch der nahen Nadelwälder erfüllten Luft.
»Das solltest du auch nicht, Kind. Halte dich immer an die Vorschriften.«
»Aber dann wären vielleicht beide gestorben.«
»Trotzdem. Wir müssen uns der Ärzteschaft fügen, sonst verbietet man uns eines Tages das Handwerk.«
»Mutter, du sagst doch immer, dass es nicht genug Ärzte für die vielen Geburten gibt.«
»Genau das ist das Problem der Herren Mediziner, liebe Tochter. Nur deshalb lässt man uns in Ruhe arbeiten.«
Am Nachmittag kam überraschender Besuch aus dem Dorf, Hermine, die einzige Tochter des Tagelöhners Franz Mayer. Er und seine beiden Söhne bearbeiteten seit Jahren die Äcker des Grafen von Wolkenstein am Rande der Wälder. Franziska kannte Hermine seit der Kindheit, zu richtigen Freundinnen waren sie aber nie geworden und seit sie die Schule verlassen hatten, redeten sie selten miteinander, wenn man von den kurzen Begegnungen während einer Sonntagsmesse absah.
»Hast du Zeit, Franzi? Ich möcht dich was fragen.«
»Grüß dich.« Sie trat einen Schritt zurück. »Komm herein«, sagte sie zaghaft. Als Kind hatte sie sich nicht selten vor der Riesin mit der lauten Stimme gefürchtet. Selbst jetzt hatte sie ein Gefühl des Unwohlseins in ihrer Gegenwart. Forschend betrachtete sie den kecken Strohhut auf ihrem strohblonden Haar. Ein wollenes Tuch aus nachtblauem Garn bedeckte die kräftigen Schultern. Das einfallende Licht zauberte ein Funkeln in die hellen Augen. Für einen kurzen Moment war sie recht lieb anzuschauen und Franziska schämte sich für ihre intuitive Abneigung gegen die einstige Schulkameradin. Schuldbewusst setzte sie ein Lächeln auf. »Ich freue mich, dass du mich besuchen kommst nach so langer Zeit.«
Hermine schob sich leise kichernd an ihr vorbei. »Ich war grad in der Nähe, da dachte ich, schaust bei der Franzi vorbei. Ist es nicht a Schand, dass wir zwei gar nicht mehr zusammenkommen?«
»Ja, da hast du recht, Hermine. Wir Mädeln sollten zusammenhalten.« Sie lächelte. »Es ist so viel zu tun, weißt, ich muss fleißig für mein Examen als Hebamme lernen. Magst vielleicht was trinken?«
Mit einem Seufzer sank die junge Frau auf einen der Sessel in der Wohnstube nieder. »Na, danke. I brauch nix.«
Franziska setzte sich zu ihr. Hermine überragte sie auch im Sitzen um eine Kopfeslänge, und als sie sich zu ihr beugte, drängten die fleischigen und rosigen Brüste aus dem Kleiderausschnitt in ihr Blickfeld. Franziska wandte sich ab.
»Hast g’hört, der Kammermeister von Wald is wieder unterwegs wegen der heurigen Gartenjagd«, fing sie an.
»Ach ja. Ist es wieder so weit. Wie die Zeit vergeht.« Franziska seufzte leise.
»Hat er di a scho g’fragt, ob du ein Paradiesvogel sein magst?«
Franziska schüttelte den Kopf. »Mich fragt er nicht mehr, weil er weiß, dass ich Nein sag, meine Mutter ist ganz auf meiner Seite.« Sie neigte den Kopf. »Weißt, beim Servieren für die Gäste des Thronfolgers und seiner Familie helfe ich gerne, schrubbe auch die Fliesen im Badezimmer für die Hoheiten blitzblank, aber mit nackerte Wadeln für fremde Männer durchs Gebüsch kriechen.« Sie schüttelte sich. »Das ist nichts für mich.«
Ein kräftiger Schuss von Feindseligkeit schlug ihr aus Hermines Augen entgegen. »Aber wenn du daran Spaß hast, ist das in Ordnung«, setzte sie erschrocken nach.
Hermine zog die Mundwinkel nach oben, ihr Blick hingegen blieb eisig. »Der Herr Baron zahlt zwanzig Kronen. Es ist eine große Ehre, durch den herrlichen Park von Seiner Hoheit, dem künftigen Kaiser, zu spazieren.« Sie hob das Kinn und schaute von oben herab. »Nicht zu kriechen.« Das letzte Wort zog sie überdeutlich in die Länge. »Ich versteh dich nicht, Franzi. Kannst du das Körberlgeld vom Baron nicht auch gebrauchen?«
»Eine Ehre soll es sein?« Franziska schluckte. Vielleicht war sie wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Hermine und die anderen. Allzu arglos kamen sie ihr vor. »Hast du denn nichts von den Gerüchten gehört? Diese Herren kommen ohne Damenbegleitung nach Artstetten«, sie zog die Brauen hoch, »weil sie sich Abwechslung mit unseren feschen Madln erhoffen. Nicht selten soll es den Jungfern dabei an die Wäsche gehen.«
»An die Wäsche gehen?« Hermine zog einen Schmollmund. »Des is nur dummes Gerede. Des darfst net glauben.«
»Der Schlosswart hat es mir erzählt, und der sieht viel.«
Hermine kicherte. »Geh Franzi, der Herr Walter sieht Gespenster, des weiß doch jeder. Der ist nicht ganz richtig im Kopf.« Hermine tippte mit dem Zeigefinger an ihre Schläfe. »Meine Eltern und meine Brüder sind stolz auf mich, weil der Herr Baron von Wald mich dieses Jahr g’fragt hat.« Hermine reckte das Kinn noch ein Quäntchen höher. »Letztens hab ich die Dorli aus Pöchlarn zufällig beim Einkaufen am Marktplatz getroffen. Die war letztes Jahr ein Paradiesvogel. Und die hat g’sagt, wir sollen nicht hören auf den Neid von de Madln, die niemals g’fragt werden.« Sie kicherte. »Glaubst wirklich, Franzi, im feinen Garten eines Hochwohlgeborenen passiert etwas Unschickliches, etwas Unrechtes?« Sie schüttelte den Kopf. »Alles Lügen. Wir tanzen in prächtigen Kleidern herum, verstecken uns und warten, bis einer der feinen Herren unsere Feder erbeutet und dann gibt’s was zu essen und zu trinken. Die Tische sollen sich biegen vor lauter Köstlichkeiten, die wir sonst nie am Tisch haben, das alles hat mir die Dorli g’sagt, und die muss es wissen, weil sie schon mal dabei gewesen ist. Zum Abschluss macht der Herr Baron ein Bild von allen mit seinem speziellen viereckigen Apparat. Diese Fotografie zeigt er später dem Thronfolger und vielleicht hängen sie im Schloss sogar irgendwo an der Wand. Vielleicht in seinem Schlafgemach?« Hermine holte tief Atem, bevor sie mit der Schwärmerei fortfuhr. »Franzi, allein der Gedanke, dass dich der künftige Kaiser anschaut in dem schönen Kleid. Ist das nicht aufregend?« Ihre Augen glitzerten und funkelten im einfallenden Sonnenlicht. »Du versäumst etwas, glaube mir.«
»Wenn du meinst, Hermine.« Franziska senkte den Kopf. Während ihrer Dienste im Schloss hatte sie vieles an den Wänden gesehen, Hirschgeweihe von erstaunlicher Größe, Ölgemälde von den Ahnen der Habsburger, liebliche Landschaften, aber bestimmt keine Fotografien von den Paradiesvögeln.
»Ja, das meine ich, Franzi.« Hermine reckte ihren Busen.
»Meine Mama schneidert schon an dem Kleid. Ich hab mir einen knallroten Stoff aussuchen dürfen und eine Augenmaske für die Kostümierung in Rot näht mir die Mama auch.« Lachend zeigte sie zwei Reihen kleiner weißer Zähne. »Die schmal g’schnittenen Kleider aus der Truhe des Kammermeisters passen mir nicht.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich kann’s nicht ändern.«
»Erzählst mir halt nachher, wie es gewesen ist«, erwiderte Franzi tonlos.
Hermine neigte den Kopf. »Du, ist eh alles in Ordnung? Schaust a bisserl müd und traurig aus.«
Franziska gähnte hinter vorgehaltener Hand. »Es gab eine schwere Geburt zeitig in der Früh in Pöbring drüben.«
»Ah, sonst is nix los?«
»Na. Warum fragst?«
»Die Leute im Ort zerreißen sich die Mäuler über den spaßigen Diener vom Grafen Wolkenstein. In letzter Zeit soll er oft vor eurem Haus rumg’schnüffelt haben.« Hermine fixierte sie aus schmalen Augen. »Was will denn der Diener des feinen Grafen bei euch?«
Franziska spürte, wie eine heiße Röte ihre Wangen überzog. Nichts blieb verborgen. Überall waren Augen und Ohren. Nie war man unbeobachtet. Dabei hatte sie gedacht, überaus vorsichtig gewesen zu sein. Nun ja, der Diener in seiner lächerlichen Livree war wirklich recht auffallend. »Der wird jemanden gesucht haben in der Schlossstraß’n«, gab sie schnippisch zurück und konnte das Aufsteigen der Wangenröte bis in die Haarspitzen nicht unterdrücken. »Ständig rennt der herum wie a aufgeschrecktes Hendl.«
»Man erzählt sich, dass der Graf vielleicht ein unerwünschtes ungeborenes Kind loswerden wollt. Ein Kind der Schand, verstehst?« Hermine sprach flüsternd, doch Franziska zuckte zurück, als wäre sie angeschrien worden.
»So was machen wir nicht. Das ist verboten!«
Hermine hob die Brauen. »Ja, es ist eine Todsünde, ein Kind zu töten.«
»Hermine, ein für alle Mal. Meine Mutter und ich halten uns an die Vorschriften. Ohne Ausnahme.«
Hermine zog die Stirn kraus. »Unsere liebe, hochanständige und tadellose Franzi«, säuselte sie, »die schöne und unnahbare Elfe, unverändert, wie damals in der Schul.«
Franziska schüttelte den Kopf. »Geh, hör auf. Elfe hat mich noch nie jemand genannt.« Immer unangenehmer wurde ihr die Anwesenheit von Hermine. Franziska bohrte in ihren Gedanken nach Ausflüchten, um sie schnell loszuwerden, da ertönte ein schrilles Geschrei durch das geöffnete Fenster. »Hilfe! Hilfe!«
Franziska schoss auf. Von draußen hörte sie die Stimme der Mutter. »Beruhigen Sie sich, Frau Bürgermeister, und sagen Sie mir, was passiert ist.« Franziska stürzte zum Fenster und spähte nach draußen in den Vorgarten. Die Frau Bürgermeister stand kreidebleich am Gartenzaun und zerrte an den Schultern der Mutter. »Es ist alles voller Blut. Bitte kommen Sie.«
»Warum holen Sie denn keinen Arzt, Frau Bürgermeister?«
Die Antwort konnte Franziska nicht verstehen, weil die Frau Bürgermeister flüsterte und danach in Tränen ausbrach.
»Mutter, kann ich dir helfen?«, rief sie zum Fenster hinaus.
Doch die winkte ab, nahm die Verzweifelte in den Arm und drückte sie an die Brust. »Ich muss kurz mal fort«, rief sie zum Fenster, »ich komme bald zurück. Mach dir keine Sorgen.«
Als die Mutter etwa eine Stunde später heimkam, wirkte sie betrübt und wollte nicht darüber reden, was passiert war. Stattdessen fragte sie, was Hermine, die Tochter vom Mayer Franz, gewollt hätte. Franziska konnte keine stimmige Antwort geben. War sie nur wegen der Paradiesvogeljagd gekommen? Vermutlich eher, um sie über den Grafen Wolkenstein auszufragen, die falsche Schlange.
Erst spätabends, als der Schrei des Nachtkauzes durch die Wälder hallte, erfuhr Franziska vom Ableben der Bürgermeistertochter. Cäcilia hatte versucht, mit Nadeln eine unerwünschte Schwangerschaft zu beenden, und war daran verblutet. Die Mutter hatte nicht mehr helfen können und fühlte sich schuldig, nicht stärker auf die Konsultation eines Arztes bestanden zu haben. Der Bürgermeister und seine Gattin hatten von der Sünde der Tochter nichts geahnt. Niemand dürfe die Wahrheit erfahren. Der nach dem Ableben herbeigerufene Mediziner, ein Freund des Bürgermeisters, trug auf dem Totenschein die Diagnose tragische und plötzlich aufgetretene Leberblutung aus unbekannter Ursache ein.
Kapitel3
Freitag, 30. April 1909, Artstetten
Der Herr Bürgermeister war zu bedauern. Da hatte er eine brave, fleißige und ansehnliche Tochter großgezogen, die Hochzeit mit einem Weinbauernsohn aus gutem Hause war beschlossene Sache, und dann starb ihm das Mäderl wegen einer entzündeten Leber lang vor der Zeit. Herr von Wald schüttelte den Kopf. Einen Tag nur war sie darniedergelegen, in der darauffolgenden Nacht hatten sich ihre Augen für immer geschlossen. Dabei hatte er den Bürgermeister und Feuerwehrhauptmann von Artstetten noch diese Woche fragen wollen, ob seine Tochter bei der diesjährigen Gartenjagd beim Schloss mitmachen tät. Wenn so ein Mäderl erst einmal unter der Haube war, war sie für ihn verloren. Überhaupt wusste er bald nicht mehr, wen er fragen könnte. Potenzielle Kandidatinnen für einen Paradiesvogel wurden immer rarer. Jedes Jahr suchte er nach vier Jungfern für vier frisch geadelte Herren. Die Adeligen vermehrten sich, die Jungfern nicht. Noch lohnte sich das Geschäft. Aber wie lange noch? Bald musste er sich etwas Neues ausdenken. Seufzend ließ er den Blick schweifen. Die Tochter der Hebamme, Franziska Buls, die würde ihm gefallen. An eine Heirat schien sie nicht zu denken. Da kein Vater mehr da war, musste er sich an die Witwe halten. Leider hatte die ihm schon zweimal eine schroffe Abfuhr erteilt. Da lebten die zwei Weiber allein in einem recht passablen Haus und trugen die Nasen höher als die ehrbare Fürstin Sophie, immerhin die Gattin des Thronfolgers. Von Wald schnaubte verächtlich, während er die zierliche Gestalt der Hebammentochter in dem schwarzen Kleid abschätzend betrachtete. Zart war die Wölbung ihres Busens über der geschnürten Taille, kräftig der Schwung ihrer Hüften. Das Schönste an ihr waren jedoch das prachtvolle, seidig glänzende Haar, fast so schwarz wie das Federkleid eines Raben, und erst der kleine rote Kirschmund. Lüstern strich seine Zunge über die Unterlippe. Widerspenstigkeit reizte ihn. Die Eroberung war der Lohn des Jägers. Leise brummte er vor sich hin und ließ den Blick weiterwandern. Alle waren sie aus ihren Häusern gekrochen, um dem Bürgermeister von Artstetten und seiner Gattin das Beileid zum Tod des einzigen Kindes auszusprechen. Der Pfarrer sprach von der reinen Liebe im Paradies. Ob die Cäcilia die andere, die sinnliche Liebe, in ihrem kurzen Leben kennengelernt hatte? Er unterdrückte ein Grinsen beim Gedanken an den zarten, bis vor wenigen Tagen lebendigen und mit Gewissheit wohlduftenden Körper der Bürgermeistertochter. Erschauernd starrte er auf den ins dunkle Erdloch sinkenden Holzsarg. Gleich würden sich die Würmer über das junge Fleisch freuen. Von Wald sah auf. Viele der Frauen hatten Tränen in den Augen. Der Verlust eines Kindes war eine Katastrophe. Bei den Edlen genauso wie bei den einfachen Leuten. Er konnte sich den Schmerz vorstellen, selbst wenn er niemals Nachkommen haben würde. Unverwandt dachte er an seine Mutter, die immer schwächer wurde. Das Haus verließ sie kaum mehr. Ohne ihn wäre sie verloren. »Mein herzlichstes Beileid, Herr Bürgermeister.« Die Hand des Vaters legte sich schlaff in die seine. »Mein herzlichstes Beileid, Frau Bürgermeister.« Er strich über die kalten und knochigen Finger der Gattin. Sie schluchzte auf.
»Der Herr gibt. Der Herr nimmt.« Er verbeugte sich.
»Danke, Herr von Wald. Gott mit Ihnen. Kommen S’ anschließend mit ins Wirtshaus? Wir haben Schnitzerl mit Erdäpfelsalat herrichten lassen. Es wär uns a Ehr«, flüsterte der Bürgermeister.
»Schnitzerl mit Erdäpfelsalat. Mei Leibspeis. Trotzdem, bedaure, verehrter Herr Bürgermeister. Die Geschäfte rufen mich auch heute zur Pflicht. In zwei Stunden werden Seine Kaiserliche Hoheit, der Thronfolger mit hochrangigen Gästen im Schloss erwartet.«
»Der Herr Kammermeister ist ein tüchtiger und viel beschäftigter Mann. Wir danken, dass Sie sich dennoch die Zeit genommen haben.« Der Bürgermeister neigte den Kopf. Die Gattin schloss die zuckenden Lider. Baron von Wald hatte es eilig.
Zwei Stunden später öffnete sich vor der Einfahrt vor dem Schloss die Tür des schwarz glänzenden Wagens. Im Gegensatz zu seinem Onkel, dem Kaiser von Österreich-Ungarn, ließ sich der Neffe lieber mit einem Verbrennungsmotor chauffieren als mit Pferdestärken. Schneidig stieg er aus, drehte sich um und half seiner Gattin, Fürstin Sophie, galant beim Aussteigen. Wendig sprangen die drei Kinder, Sophie, Maximilian und Ernst, aus dem Gefährt.
Dahinter hielt der Wagen des Militäradjutanten Major Alexander Brosch, Edler von Aarenau. Jö! Seine überaus liebreizende Gattin Nathalie hatte er mitgebracht. Was sie wieder für einen hübschen Hut auf dem gelockten Haar trug. Kein Wunder, dass der Major um seine schöne Frau herumschwänzelte wie ein Jungverliebter. Na geh, der Franz Hahn stand auch schon da in seinen lächerlichen Lederhosen und der Feder auf dem Hut. Wichtigtuerisch wie immer, mit hinter dem Rücken verschränkten Armen und vorgerecktem Kinn. »Na wart, dich werd ich gleich abdrängen«, knurrte der Kammermeister leise, bevor er sich tief nach spanischer Art vor den Ankommenden verbeugte. »Ein herzliches Willkommen, Eure Kaiserliche Hoheit. Stets zu Diensten. Wie immer ist alles nach Euren Wünschen vorbereitet.«
»Eure Kaiserliche Hoheit, Ihr untergebener Diener.« Der Verwalter trat mit angewinkelten Armen vor seinen Kontrahenten, dem er mit geschlossenen Lippen zuzischte: »Gehen S’ auf die Seiten, Baron, ich mach das.« Mit einem Grinsen wandte er sich wieder dem Erzherzog zu, der wie aus dem Ei gepellt in blauer Uniform in der Sonne stand und den Blick mit zufriedener Miene über das Anwesen gleiten ließ. »Sophie. Wir sind zurück im Paradies.«
Die Fürstin seufzte tief. »Ja, Ferdi. Es ist wirklich reizend hier.«
»Die Zimmer sind hergerichtet, Hoheiten. In dreißig Minuten wird im Salon der Mokka serviert.« Franz Hahn drehte seinen Kopf nach hinten und zischelte dem Kammermeister zu. »Nach dem Kaffee geht’s zur Jagd. Dinner pünktlich um sieben Uhr. Bleiben S’ da stehen und warten S’, bis die anderen Gäste eintreffen. Die sollen umgehend in den Salon kommen. Sonst geht sich das mit dem Protokoll net aus. Ich bring die Herrschaften ins Schloss.«
Herr von Wald schnappte nach Luft. Unerhört! Was erlaubte er sich, ihm Befehle zu erteilen! Doch bevor er auf die Impertinenz reagieren konnte, war der Verwalter mit der Hautevolee schon Richtung Schloss verschwunden. Die aus Wien mitgereiste Dienerschaft watschelte hinterher.
Elender Halunke, ärgerte er sich weiter. Gar nicht beruhigen konnte er sich. Seine Aufgabe wäre es, in Artstetten an der Seite des Thronfolgers zu stehen. Lange ertrug er die Demütigungen nicht mehr. Der Hahn musste weg. Ihm musste etwas einfallen. Das Geräusch von schlagenden Hufen ließ ihn herumfahren. Aha, die anderen Gäste sind da! Von Wald schritt auf die Ankommenden zu. Ein Zweispänner mit dunklen Pferden fuhr vor. Zwei Männer in ziviler Kleidung stiegen aus der blau lackierten Kutsche und stellten sich als Architekt Oberbaurat Ludwig Baumann und Baumeister Friedrich Eichberger vor. Den Eichberger kannte er. Der wohnte in Pöchlarn, dem reizvollen Handelsstädtchen am anderen Donauufer. Bald solle es einen umfassenden Umbau am Schloss geben, wurde er von Hahn gestern bei der Vorbesprechung zum heutigen Protokoll in gnädiger Weise unterrichtet. Die zwei Gäste würden nur für eine Stunde bleiben. An der Jagd und am Dinner durften die beiden Bürgerlichen nicht teilnehmen. Er begrüßte die Herren und zeigte ihnen den Weg zum Salon. Wenigstens das war ihm vergönnt. Die Pferde übergab er dem Stallburschen, der in einigem Abstand, so wie es das Protokoll vorschrieb, auf seinen Einsatz wartete.
Zum Abschluss trafen die Gäste des Hochadels ein. Die Damen in eleganten Kleidern mit geschnürten Taillen und Hüten mit hochgesteckten Frisuren und goldenen Gehängen an den Ohrläppchen, die Herren in Frack und Zylinder. Während die Herzöge, Fürsten und Grafen sich der Jagd nach Rebhühnern in den umliegenden Wäldern widmeten, würden die Damen im Salon auf ihre Ehemänner warten und Tee trinken. Manchmal spazierten sie aber auch lieber durch den schönen Garten. Dann musste er ihnen hinterherschleichen und zur Stelle sein, sollte sich eine Frau Herzogin, Fürstin oder Gräfin wegen des ungeeigneten Schuhwerks das feine Knöcherl verstauchen oder wegen der zu engen Schnürung des Korsetts ohnmächtig werden. Alles schon da gewesen. Er half rasch und diskret, hatte neben nach Kräutern duftenden Riechfläschchen auch Verbandsmaterial und kühlende Kompressen dabei. Er scheute nicht, wie der Hahn, den Körperkontakt mit den feinen Gästen. Aber vor dem Thronfolger, da buckelte der Verwalter so heftig, dass sich sein Rückgrat schon krümmte.
Franziska schritt im Festsaal entlang der gedeckten Tafel und prüfte, ob die Dienerschaft die Servietten, das Porzellan, die Gläser, die Kärtchen und das Silberbesteck ordentlich auf dem weißen Tischtuch platziert hatte. Lag ein Messer schief, richtete sie es, glänzte ein goldfarbener Serviettenring nicht ausreichend, polierte sie ihn. Und wehe, auf einem der geschliffenen Gläser spiegelte sich das durch die hohen Fenster einfallende Licht nicht in voller Kraft oder eines der Namenskärtchen stand von dem mit Wiesen- und Blumenmotiven verzierten Porzellanteller zu weit entfernt. Franziska spürte jeden Makel sofort auf. Während sie ein Porzellangefäß für Salz um einen Zentimeter verrückte, strichen ihre Gedanken zurück zum Begräbnis von Cäcilia vor wenigen Stunden. Am offenen Grab hatte Hermine ihr ins Ohr geflüstert, der künftige Bräutigam solle nicht der Verursacher des tödlichen Fehltritts, dessen Folgen als Leberleiden getarnt wurden, gewesen sein. Woher hatte die Hermine das gewusst? Spionierte sie der Bürgermeisterfamilie hinterher? Sie und ihre Mutter hatten bestimmt keinem davon erzählt. Franziska dachte an die Frauen, die hin und wieder an die Tür ihres Hauses klopften und die Mutter anbettelten, die unerwünschte Frucht im Bauch wegzumachen. In den meisten Fällen schickte die Mutter sie mit Ratschlägen fort, an welche Behörden sie das Kind nach der Geburt übergeben konnten. Manchmal wendete sie eine Scheidenspülung mit Zusatz von Carbolsäure an. Leider wussten sie beide, dass diese Methode wenig wirksam war. Es diente vordergründig der Beruhigung. Nur in äußerst prekären Fällen wendete Mutter die härteste aller Methoden an, wenn eine Frau drohte, sich im dunklen Wasser der Donau zu ertränken. Nachts, wenn alle schliefen, konnte nur der Mond am wolkenlosen Himmel den roten Saft zwischen den Beinen der unglücklichen Frauen sehen. Ihr hatte Mutter das Töten eines von Gottes Gnaden heranwachsenden Lebens strengstens verboten. Wurde man erwischt, landete man im Gefängnis. Ein kalter Schauer kroch ihren Rücken hinauf. Mutter war eine Engelmacherin aus Gnade, die ihrer Tochter verbat, es ihr nachzumachen. Franziska wollte sich daran halten und hatte Pläne, wie sie den Frauen Leid ersparen konnte. Mittlerweile gab es bessere Methoden der Empfängnisvermeidung. Wenn nur die Kirche nicht alles verbieten würde. Franziska grübelte, während sie das Tuch über das Besteck gleiten ließ. Kondome aus Gummi gab es mittlerweile und in einem Artikel hatte sie von einer neuen Erfindung, dem Diaphragma, gelesen. Eine Kombination aus mechanischer und chemischer Verhütung. Eine Kappe aus Gummi sollte den Muttermund versperren. Zusätzlich wurde ein spermatötendes Gel angewendet. Franziska schüttelte sich ab. Vorstellen mochte sie sich einen Geschlechtsakt mit derartigen Instrumenten nicht. Aber was blieb den Frauen übrig? Der Coitus interruptus war vermutlich auch keine absolut sichere Methode. Franziska zuckte mit den Schultern. Am besten blieb man keusch. Aber wenn selbst ihr das immer schwerer fiel? Der trübe Fleck auf dem Silber war wegpoliert. Sie ging weiter und glättete beim nächsten Gedeck den verbogenen Zipfel einer Serviette. Nun sah die Tafel perfekt aus.
Zwanzig Kronen zahlte der Kammermeister den Jungfern für die Rolle eines Paradiesvogels. Ihr gab er zehn Kronen für das Herumtragen der mit Essen schwer beladenen Tabletts. Mutter hatte recht, da war etwas nicht im Lot. Warum zahlte der Kammermeister mehr Geld für eine Maskerade im Garten als für echte Arbeit im Schloss? Wieder spürte Franziska eine heiße Röte in ihre Wangen steigen, wie immer, wenn sie sich über etwas ärgerte. Sie wollte an etwas Schönes denken, wie an das gestrige Treffen mit dem Grafen Wolkenstein. Im goldenen Licht des Abends hatte er sie am Waldesrand zum ersten Mal





























