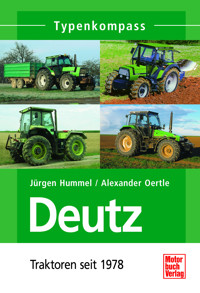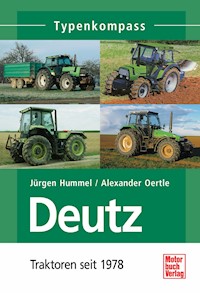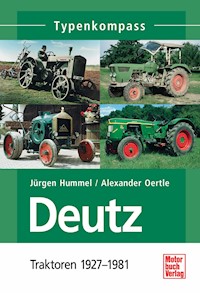Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ganz Pforzheim steht Kopf: Der Papst kommt! Eine willkommene Gelegenheit für das „Trio Klerikale“, die eigene Karriere zu beschleunigen: Adler, der Missionsbeauftragte, will Pforzheim zu einer Musterstadt für die Neuevangelisation machen; Morsch, der Prälat, erhofft sich die Kardinalswürde; und Schönthal, der Kirchenbedarfshändler, freut sich auf tolle Geschäfte. Doch die unvollständige Beichte einer Patientin bringt einiges durcheinander. Privatdetektiv Bruno Hansen ermittelt in der ihm fremden Welt der Katholiken und stößt dabei auf Heilige und Selige, Wunder und Wandlungen, Tod und Teufel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Hummel
Der Papst in Pforzheim
Jürgen Hummel
Der Papst in Pforzheim
Roman
SWB MEDIA PUBLISHING
Die Handlung und die handelnden Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden und bereits verstorbenen Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2016
ISBN 978-3-945769-18-8
© 2016 Südwestbuch Verlag, Gaisburgstraße 4 B, 70182 Stuttgart
Lektorat: Dr. Joachim Worthmann, Stuttgart
Titelgestaltung: Sig Mayhew/www.mayhew-edition.de
Titelfoto: © caamalf_www.shutterstock.com
Satz: Südwestbuch
Druck, Verarbeitung: Rosch-Buch, Scheßlitz
Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.
www.swb-verlag.de
„Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit; such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade.“ (Die Sprüche Salomos 3;5-6)
Anmerkung: Alle Bibelzitate nach den Kapitelüberschriften sind in der Einheitsübersetzung für den liturgischen Gebrauch im römisch-katholischen Gottesdienst verfasst.
Inhalt
Notiz 1
1Schafe
2Besuch
3Wunder
Notiz 2
4Spaltung
5Blut
Notiz 3
6Wahrheit
7Mission
Notiz 4
8Handel
9Salbung
Notiz 5
10Wurf
11Sünde
Notiz 6
12Aufstieg
13Beichte
Notiz 7
14Traum
15Teufel
16Ehre
Notiz 8
17Freunde
18Kraft
19Gift
20Angst
Notiz 9
21Tod
22Bruch
23Brief
Notiz 10
24Rauch
25Lügen
26Schnitt
27Haare
Notiz 11
28Ruine
29Geld
30Kloster
Notiz 12
31Schlaf
32Geburt
33Vertrauen
Notiz 13
34Vergebung
35Grüße
Notiz 14
36Wahn
37Streit
38Reue
39Dank
Notiz 15
40Liebe
41Ende
Notiz 16
Notiz 1
Ich werde Adler nicht umbringen. Das wäre zu einfach, für ihn und auch für seine Vorgesetzten, samt dem Chef mit den roten Schuhen in Rom. Die sind nämlich alle mitschuldig. Denn die haben ihn zu dem gemacht, der er ist.
Es war nicht schwer, Adler zu finden. Einer wie der will ja gesehen und gehört werden.
Jetzt ist er gerade in Pforzheim. Spielt dort den großen Zampano als Missionsbeauftragter. Ausgerechnet er!
Irgendwann und irgendwo werde ich ihm die Maske herunterreißen. Ich habe Zeit, wenn es sein muss, ein ganzes Jahr lang. Vorher soll er keine ruhige Stunde mehr haben. Ich werde ihm das Leben zur Hölle machen, wo immer es geht.
Adler, der Überflieger. So haben sie ihn im Fernsehen genannt. Alle Welt soll sehen, wie er abstürzt und im Dreck liegt und ich dann auf ihn spucke ! Das ist besser, als ihn zum Märtyrer und mich zum Mörder zu machen.
„Niemals wird man mich so schlecht behandeln, wie ich es verdiene.“
Ich werde dafür sorgen, dass ihn dieser perverse Spruch der Heiligen Teresa von Avila ständig begleitet. Die Arme wurde sinnlos Opfer ihrer Kirche. Für Adler macht es Sinn.
1 Schafe
„Amen, amen, das sage ich euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen.“
(Johannes 10, 1-4)
Bruno Hansen war noch nie in Pforzheim gewesen. Das lag unter anderem daran, dass er bis vor kurzem keinen Führerschein mehr besaß und sich seine beruflichen Aktivitäten als Privatdetektiv fast ausschließlich in Stuttgart abspielten. Aber nun war er froh, dass er sich doch noch mit Mitte fünfzig dem „Idiotentest“ gestellt hatte. Es war schon bequemer mit dem Auto zu fahren, das er sich dank seines üppigen Honorars für die Lösung des Falles Paschke leisten konnte. Und wie er sonst zum vereinbarten Treffpunkt Wildpark mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sollte, hätte er erst erforschen müssen.
Pforzheim – diesen Ort verband der Liebhaber klassischer Musik bisher nur mit dem dortigen Kammerorchester. Das Navi führte ihn über Weil der Stadt, weil die Funktion „Autobahn meiden“ eingestellt war. Hansen fuhr lieber gemächlich über Land. Da konnte er besser „sinnieren“, wie es seine Freundin Irene nannte, wenn er seinen Gedanken nachging.
Weil der Stadt, die Geburtsstadt von Johannes Kepler, kannte er. Er war auch schon im Keplermuseum. Daher wusste er, dass der tiefgläubige Astronom ständig Ärger mit der Kirche hatte oder besser, die Kirche mit ihm. Der hatte es nicht in den Kram gepasst, dass sich die Erde um die Sonne drehen sollte. Fast hätten sie seine Mutter als Hexe verbrannt. Nur durch gute Beziehungen hatte das Genie die frommen Eiferer davon abhalten können, die streitbare Frau in die Hölle zu schicken.
Wäre es deshalb nicht angebracht gewesen, den Auftrag des katholischen Priesters abzulehnen, grübelte Hansen. Doch das Telefongespräch mit Pater Dr. Franz Adler gestern hatte seine Neugier geweckt, auch wenn sich der noch nicht darüber ausgelassen hatte, worum es eigentlich ging. Nur dass es eine ganz große Sache sein könnte. Mehr wolle er nicht sagen. Aber er solle sich bitte mit ihm treffen. Es störe ihn überhaupt nicht, dass Hansen Atheist sei – im Gegenteil, das sei in diesem Fall eher von Vorteil. Hansen wollte sich am Telefon nicht auf eine Diskussion einlassen und ließ das „Atheist“ stehen, obwohl er sich nicht als solcher fühlte, nur weil er aus der Kirche ausgetreten war.
Über Hausen, noch zum Kreis Böblingen gehörend, erreichte Hansen den Enzkreis, der nun schon badisch war. Wo sie „Guten Tag“ und nicht mehr „Grüß Gott“ sagen. Durch Tiefenbronn und dann durch den Hagenschieß zum hoch über Pforzheim gelegenen Wildpark – eintrittsfrei, wie Hansen erfreut feststellte. Vielleicht war das der Grund für den Kirchenmann, dass man sich ausgerechnet dort treffen sollte.
Zu den Waschbären solle Hansen kommen, gegenüber von den Mufflons, die seien nicht zu übersehen. Da stehe eine Bank, und er säße dort mit dem Schwarzwälder Boten in der Hand, natürlich in Zivil, nicht im Priestergewand. Wie Hansen denn nur auf diese Idee komme? Er sei ja schließlich auch Mensch, nicht nur Pfarrer. So hatte er sich ausgedrückt, und Hansen fand das etwas seltsam. Er fragte noch, wie er Hansen erkennen könne. Ob Adler schon ein Porträt von Johannes Brahms gesehen habe, fragte Hansen zurück, so sehe er nach Ansicht seiner Freundin aus. Nur fast dreißig Zentimeter größer und ein paar Kilo schwerer. Klar kenne er Brahms, erwiderte Adler, und er liebe sogar sein Deutsches Requiem, obwohl es nicht sehr katholisch sei. „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ – das gehe ihm unter die Haut, sagte der Katholik und brummte mit tiefen Bass die Melodie. Er kannte sich offensichtlich aus, was Hansens Neugier erhöhte.
Dr. Franz Adler….Irgendwo, vielleicht im Fernsehen oder im Radio, hatte er diesen Namen und diese Stimme schon gehört. Vielleicht war es beim ‚Wort zum Tag‘, wenn er für die Nachrichten etwas zu früh eingeschaltet hatte. Er musste ein hohes Tier in der Kirche sein.
Die Waschbären sah Hansen nicht im Gehege. Aber auf der Bank saß ein schlanker großer Mann mittleren Alters mit einer schwarzen Aktentasche und der Zeitung auf den Knien. Das blaugestreifte Hemd unter der braunen Lederjacke sah edel aus, und die modische Brille mit den schmalen Metallrändern passte gut zu seinem ebenmäßigen Gesicht und dem schwarzen Lockenhaar. In einer Soutane konnte sich Hansen diesen eleganten Herrn nur schwer vorstellen, eher in einem der dunkelblauen oder grauen Anzüge, wie sie Geschäftsleute gerne tragen. Oder auch in der Kluft einer Edelsportart wie Golf oder Tennis.
Der Mann stand auf, warf die Zeitung treffsicher in den Abfallkorb neben der Bank und ging mit ausgestreckter Hand auf Hansen zu:
„Tatsächlich, der Bart passt – wie Brahms. Ich bin Franz Adler. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich gehe immer mal wieder in den Wildpark und treffe dort Menschen. Wenn ich also hier gesehen werde, ist das völlig unverdächtig. Wir können uns beim Spazierengehen unterhalten, einverstanden?“
Hansen war das recht. Er ging gerne zu Fuß, auf Rat seiner Freundin Irene sogar ziemlich regelmäßig. Das täte ihm „saugut“ und reduziere seinen „Ranzen“ – so der klare Befund der Schwäbin.
„Sie sind zwar nicht katholisch, wie Sie mir schon gesagt haben, aber Sie wissen sicher, wie die Eucharistie gefeiert wird?“, eröffnete Adler das Gespräch.
„Ich glaube, so ungefähr weiß ich das. Ich war früher mal evangelisch. Da geht es doch ums Abendmahl. Das wird ja bei den Katholiken so ähnlich ablaufen, oder?“
Hansens Frage verwandelte Adler. Der Geistliche blieb unvermittelt stehen, riss die Augen auf und drehte sich zu Hansen, der nun auch innehalten musste. Über Adlers Brauen zogen drei gleichmäßige Falten auf. Er hob den Zeigefinger und sprach mit dröhnender Stimme:
„Wie man’s nimmt, es gibt ganz wesentliche Unterschiede. Bei den Protestanten ist die heilige Kommunion schon sehr verwässert, die haben Probleme mit der Wandlung.“
Nun konnte Hansen sich Adler auf der Kanzel vorstellen. Der Pater ließ den Finger wieder sinken, lief weiter und setzte seine Rede in ruhigerem Tonfall fort:
„Aber für mein Problem tut das zunächst nichts zur Sache. Ich erzähle Ihnen nun etwas. Hören Sie sich das bitte ganz genau an.“
Dann begann Adler von seinen Erlebnissen der letzten Tage zu berichten. Hansen musste zeitweilig stehen bleiben, um sich etwas aufzuschreiben, und er konnte Nachfragen nicht ganz vermeiden. Er war eben nicht firm in der Fachsprache der Theologen. Doch Adler war gnädig und klärte ihn auf.
So erfuhr Hansen beim Halt vor den Fischottern, dass die chemische Zusammensetzung der gereichten Gaben beim Abendmahl – also der Oblaten und des Weins – zwar unverändert bleibe, aber diese durch die Worte des Priesters in der Substanz etwas völlig anderes werden. Die „Transsubstantiation“ sei ein Dogma, und deshalb sei auch kein Zweifel statthaft an der Wesensverwandlung der geweihten Oblate, die spätestens von da an „Hostie“ heiße.
Während das schottische Hochlandrind äste, dozierte Adler über den fundamentalen Unterschied zwischen „Handkommunion“ und „Mundkommunion“. Seine Erregung steigerte sich mit jedem Satz, und beide Arme fuchtelten im Takt seiner Worte:
„Wissen Sie, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Heilige Vater in Freiburg selbst von der Mundkommunion abgegangen ist. Ich finde, damit hat er die Schleusen für eine weitere Verwässerung unseres heiligsten Sakraments geöffnet, fast schon ein Sakrileg! Auch ich muss seit einigen Wochen beim Abendmahl zur Handkommunion übergehen. Der liebe Dekan hat die Eucharistie hier schon ganz schön verlottern lassen. Keine Disziplin, keine wirksame Kontrolle mehr, purer Liberalismus! Sie glauben gar nicht, wie groß der Druck von Laien wird, die sich für ach so fortschrittlich halten, wenn sie sich dabei auch noch auf den Papst berufen können. Da muss selbst ich Kompromisse eingehen. Aber irgendwo gibt es Grenzen. Wenn die so weiter machen, werfen sie den Leib Christi in den Müll und schütten das Blut des Herrn in die Kanalisation, wie es die Lutheraner seit Jahrhunderten praktizieren.“
Adler blieb einen Augenblick schweigend stehen. Er atmete tief durch, um seine Erregung abklingen zu lassen. Hansen sagte auch nichts, blickte ihn nur irritiert an. Der Pater fuhr fort:
„Kommen Sie, wir gehen weiter. Hören Sie bitte einfach nur zu. Ich will keine theologische Diskussion mit Ihnen anfangen. Ich brauche Sie ausschließlich für die Klärung von Sachfragen.“
Adler wies auf eine Bank am Gehege der Elche. Sie setzten sich auf die Bank, gestiftet von der Firma Schönthal, wie ein aufdringliches Messingschild kundtat. Adler entnahm seiner Aktentasche eine Klarsichthülle. In ihr steckte ein chamoisfarbenes Blatt Papier. Er übergab es seinem Sitznachbarn, ohne ihn dabei anzublicken.
„Was sehen Sie?“
Hansen beugte sich über das Blatt und betrachtete es lange.
„Lassen Sie sich nur Zeit, ich gebe Ihnen keine Hilfe, ich will Sie nicht beeinflussen“, sagte Adler und beobachtete die Elche, die sich mit ruhigen Schritten dem Zaun des Geheges näherten.
„Die weiße Kreisfläche könnte die Kopie einer Oblate sein. So eine für das Abendmahl, oder?“
„Das Abbild einer Priesterhostie, schon konsekriert. Aber was sehen Sie auf ihr?“
„Priesterhostie?“
„Ja, die sind größer als die Laienhostien.“
„Und konsekriert, was heißt das?“
„Das ist für Sie jetzt nicht wichtig. Später vielleicht. Ich will erst wissen, was Sie noch darauf entdecken.“
Hansen war etwas befremdet vom harschen Ton des Priesters, der immer noch nur Augen für die Elche hatte, die wohl auf die Fütterung warteten.
„Rotbraune Flecken, sieht aus wie eine Figur, mit Hut vielleicht?“
Adler drehte sich schnell zu Hansen, tippte mehrmals mit dem Finger auf einen der Flecken. Auf seiner Stirn erschienen wieder die drei Falten, und er antwortete gereizt:
„Hut? Das ist ein Nimbus, ganz sicher!“
„Na gut, Hut passt vielleicht doch nicht so. Es könnte auch etwas anderes darstellen. Finden Sie nicht, dass das eher aussieht wie ein Heiligenschein? Ja, Heiligenschein, das passt besser.“
„So ist es, die Gottesmutter mit Heiligenschein, klar erkennbar. Auch für Ungläubige, nicht wahr? Ein Nimbus ist übrigens nichts anderes als ein Heiligenschein.“
Adler erhob sich. Vor einem neugierigen Schwarznasenschaf blieb der Priester stehen und erklärte dem ungläubigen Detektiv, dass es sich bei Wundern im Verständnis der Kirche nicht um Zauberei, Hexerei oder Scharlatanerie handle. Vielmehr seien es Erscheinungen, die von der päpstlichen „Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse“ sorgfältig geprüft würden und strengen Kriterien genügen müssten. Die Transsubstantiation als Dogma sei aber kein derartiges Wunder, sondern ein „Mysterium“. Bei diesem Wort, das er zweimal wiederholte, wandte sich der Seelenhirte von den Schafen ab, legte die Hand auf Hansens Schulter und blickte ihm lange in die Augen. Dann setzten sie ihren Gang schweigend fort. Die Wolken hatten sich verzogen, die Sonne brach hervor, der Park bevölkerte sich.
Bei den Enten und Gänsen waren die beiden Männer fast unter sich. Nur ein paar Kinder versuchten vergeblich, die satten Vögel mit Brotstücken anzulocken. Adler blieb wieder unvermittelt stehen.
„Hier sind wir ungestört, ich komme jetzt zu Ihrer Aufgabe“, sagte Adler und verbat sich noch einmal jegliche Diskussion. Hansen könne zwar unterbrechen, wenn ihm Begriffe oder Sachverhalte unklar seien, aber er solle sich auf die Ermittlung konzentrieren, sich die Vorgehensweise überlegen und diese mit ihm abstimmen. Erst dann sei es sinnvoll, weitere Informationen abzufragen. Hansen wusste immer noch nicht, was er eigentlich ermitteln sollte, und wollte deshalb nachfragen. Er fügte sich widerwillig. Gerne hätte er klargestellt, dass er sich nicht zu den „Ungläubigen“ zähle, und es hätte ihn gereizt, mit dem herrischen Priester über die Gottesmutter und den Heiligenschein zu sprechen. Mit seiner Rolle als Auftragnehmer ließ sich das jedoch nicht vereinbaren und so antwortete er nur:
„Ich mache mir ein paar Notizen, einverstanden?“
„Nichts dagegen, wenn Sie damit so umgehen, wie ich mit dem Beichtgeheimnis.“
„Ich nehme an, der Ermittlungsauftrag hängt mit der Hostie zusammen, die Sie mir gezeigt haben. Also, was erwarten Sie jetzt von mir? Was soll ich konkret unternehmen?“
„Ich will wissen, woher diese Hostie kommt und auf welche Weise die Mutter Gottes darauf sichtbar wurde.“
„Und darf ich fragen, warum? Vermuten Sie denn irgendeine Straftat dahinter?“
„Ich halte nichts von Spekulationen. Für mich zählen Tatsachen. Ich will von Ihnen wissen, wie die Figur auf die Hostie gekommen ist. Wenn Sie eine Erklärung dafür finden, handelt es sich um einen Fall von schwerem Hostienfrevel. Dann muss ich mich damit nach den Regeln unserer Kirche auseinandersetzen. Ob es sich um eine Straftat nach weltlichem Recht handelt, interessiert mich weniger. Und wenn Sie keine Erklärung finden, ist die Marienerscheinung auf der Hostie ein Wunder.“
„Ein Wunder? Wie meinen Sie das?“
„Wie ich es sage: ein Wunder. Ein Zeichen Gottes. Haben Sie vorhin nicht aufgepasst? Noch nie etwas von Wundern gehört?“
„Doch, doch, Wunderheilungen und so. Aber das ist ja…“
Adler wurde lauter:
„Ich erkläre Ihnen nun schon zum dritten Mal, dass ich mit Ihnen nicht diskutieren will. Wenn Sie den Auftrag nicht annehmen wollen, sagen Sie es einfach, dann suche ich mir eben einen Anderen. Ich selbst habe für solche Recherchen einfach keine Zeit und bin auch kein Profi für so etwas. Also, was ist jetzt?“
„Ich brauche viel mehr Informationen. Die Kopie der Hostie zum Beispiel genügt nicht, ich muss das Original haben.“
„Das ist klar, aber Sie bekommen es erst, wenn Sie zugesagt haben. Ohne saubere Vereinbarung gibt es von mir keine vertraulichen Infos!“
„Geben Sie mir etwas Zeit.“
„Na gut, ich bin die nächste Woche sowieso viel unterwegs. Da werde ich keine Minute übrig haben. Übermorgen werden Sie wissen, warum das so ist und wie wichtig die Sache ist. Und zwar nicht nur für uns hier in Pforzheim, nein, für alle Christen in ganz Deutschland. Rufen Sie mich wieder an. Das ist jederzeit möglich – ich habe ein Smartphone. Wir sind nämlich auch in dieser Welt angekommen, schon länger als Sie sich das denken. Unsere Internetpräsenz ist beeindruckend, nicht ganz ohne mein Zutun übrigens. So, ich muss nun gehen. Die Pflicht ruft. Sie melden sich. Wenn Sie zugesagt haben, erhalten Sie von mir einen Termin für ein neues Treffen. Da bekommen Sie dann mehr Informationen.“
Adler reichte Hansen die Klarsichthülle, steckte eine Visitenkarte dazu, verabschiedete sich knapp, ließ den Detektiv bei den Enten und Gänsen zurück und verschwand mit schnellen Schritten Richtung Parkplatz.
Hansen schlenderte noch ein wenig im Wildpark umher. Bei den Ponys war eine Bank frei. Auf die setzte er sich. Er betrachtete die Hostienabbildung. Die bräunlichen Flecken hatten unterschiedliche Größen und Formen und etwas verschwommene Konturen, aber tatsächlich war zu erkennen, dass sie in ihrer Gesamtheit eine menschliche Figur darstellten. Und das Gebilde um den Kopf konnte man wirklich kaum einen Hut nennen, eher einen Heiligenschein, den Adler ‚Nimbus‘ genannt hatte. Insgesamt das Bild einer Mariengestalt, wie in Aquarelltechnik gemalt.
Wieso beunruhigte eine bemalte Oblate den forschen Priester so? Der Glaubensmann machte nun wirklich nicht den Eindruck, dass er leicht zu erschüttern sei. Er glaubte ihm, dass er die Maria nicht selbst auf die Hostie gemalt hatte. Also musste es jemand anderes gewesen sein. Und wenn schon..., dachte Hansen. Adler denkt offensichtlich anders – seltsam....
2 Besuch
„Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen; bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der Friede zu euch zurückkehren. Wenn man euch aber in einem Haus oder in einer Stadt nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen. Amen, das sage ich euch: Dem Gebiet von Sodom und Gomorrha wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt.“
(Matthäus 10,11-15)
Der Oberbürgermeister von Pforzheim hatte sich schon viel von Leuten anhören müssen, die etwas von ihm wollten. Oft stellten seine Gesprächspartner die Dinge übertrieben oder sogar falsch dar, weil sie sich dadurch Gehör schaffen wollten. So wurden aus ein paar Schlaglöchern in einer Nebenstraße lebensgefährliche Abgründe; die Kürzung des Zuschusses für den Kleintierzüchterverein bedeutete den Zusammenbruch des Pforzheimer Vereins- und Kulturlebens; und die Ablehnung einer Höherstufung des stellvertretenden Leiters im Friedhofsamt musste als Beweis für systematische Benachteiligung und Ausbeutung herhalten.
Der OB kannte seine Pappenheimer. Manche Querulanten gaben immerhin Ruhe, wenn sie zu ihm vorgelassen wurden. Denn er ließ sie reden, entlarvte schnell ihre zwar heftigen, meist aber verzeihlichen Übertreibungen und sah ihnen die kleinen taktischen Schwindeleien nach. Er hörte den Vortragenden gelassen und mit freundlicher Aufmerksamkeit zu. Dafür war er bekannt und geachtet. Meistens waren die Leute dann zufrieden. Es genügte ihnen, dem da oben mal in aller Deutlichkeit die Meinung gesagt zu haben.
Doch heute war er überrascht. So hatte er Klaus Hofelich noch nicht erlebt, selbst bei den hitzigsten Debatten im Gemeinderat nicht, wenn er als Fraktionsvorsitzender das große Wort führte. Das Gesicht war rot vor Erregung, und die Stimme schnappte über, obwohl er während seines langen Vortrags fast durchgehend geflüstert hatte. Auf der Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. Er schloss:
„Sie sind der Zweite, mit dem ich darüber rede. Aber das bleibt unter uns.“
„Nur der Zweite“, sagte der OB schmunzelnd, „und was hat denn der Erste dazu gesagt?“
„Der Erste war natürlich der Bischof, und der hat mir gesagt, ich solle das direkt mit Ihnen besprechen, vertraulich. Er wird sich getrennt von mir umhören. Ich soll hier vor Ort einstweilen Vorschläge für Fall A, B, und C durchsprechen.“
Der OB blickte auf, und Hofelich erklärte:
„Fall A: Er kommt tatsächlich. Fall B: Er kommt nicht. Fall C: Er lässt es noch offen, ob er kommt oder nicht kommt. Das heißt – er kommt vielleicht.“
Der Bürgermeister verschränkte die Arme hinter dem Nacken, lehnte sich in seinen gepolsterten Gesundheitssessel weit zurück und blickte so lange zur Decke, bis ihn der ungeduldig hin und her rutschende Hofelich zur Antwort förmlich nötigte:
„Und, was sagen Sie dazu? Wie gedenkt die Stadt damit umzugehen?“
Das Stadtoberhaupt ließ den Sessel zurück wippen, faltete die Hände auf der aufgeräumten Schreibtischplatte und beugte sich zu seinem Gesprächspartner im Besuchersessel:
„Herr Hofelich, wir können uns auf Fall C beschränken. Fall A ist bei aller Wertschätzung eine Nummer zu groß für uns beide. Das ist Sache von Ministerpräsident und Erzbischof, mindestens. Eigentlich sogar Bundessache. Und erst dann, wenn Programm, Termine und Kompetenzen geklärt sind, beschäftigen wir uns damit. Der Papst käme ja nicht nur als oberster Kirchenführer, sondern auch als Staatsoberhaupt. Fall B brauchen wir nicht zu besprechen, deswegen wären Sie auch nicht zu mir gekommen. Also bleibt Fall C. Sie wissen nichts Genaues. Sie haben nur Gerüchte und Vermutungen. Ich will ganz ehrlich sein: Ich glaube nicht, dass der Papst so kurz nach Freiburg noch einmal Deutschland besucht und wenn, dann schon gar nicht Pforzheim. Was sollte er ausgerechnet hier wollen? Wie verlässlich ist denn überhaupt Ihre Quelle?“
Hofelich erhob sich vom Sessel, stützte sich am Schreibtisch ab und antwortete mit erregt zitternder Stimme:
„Herr Oberbürgermeister, glauben Sie denn wirklich, ich, Klaus Hofelich, Rechtsanwalt, langjähriger Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Christlich Demokratischen Union, ehrenamtlicher Vorsitzender des Kirchengemeinderates und vieles mehr – ich belästige Sie und den Bischof mit Gerüchten, wenn sie nicht einen belastbaren Hintergrund hätten? Und glauben Sie wirklich, dieser Bischof, der dazu noch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, würde mich grundlos bitten, mit Ihnen darüber zu reden? Wir dachten, es sei gut, wenn der OB rechtzeitig und zuallererst informiert wird, bevor er irgendwann mal was hintenrum erfährt. Nicht einmal meine eigene Fraktion weiß davon. Aber bitte, vielleicht sehen Sie das anders. Es ist Ihre Sache, wie Sie damit umgehen. Wir jedenfalls tun das Unsrige.“
„Herr Hofelich, bitte nehmen Sie wieder Platz. Sie verstehen sicher, dass ich erst versuchen werde, Näheres zu erfahren. Ich verspreche Ihnen, dass ich das im Vorfeld sehr diskret mache. Aber meine engsten Mitarbeiter muss ich schon einweihen. Richten Sie das dem Erzbischof aus. Er kann mich gerne auch direkt anrufen.“
„Ist das alles, was ich ihm sagen soll?“ fragte Hofelich mit beleidigtem Unterton.
„Sie können ja noch ergänzen, dass Pforzheim sich auf einen – wie auch immer gearteten – Abstecher des Papstes freut und wir zu gegebener Zeit Vorbereitungen treffen werden.“
„Der Heilige Vater macht keine ‚Abstecher‘, Sie können es schon Besuch nennen.“
„Ich wollte das mögliche Ereignis nicht abwerten. Aber ich will unsere schöne Stadt auch nicht überschätzen. Pforzheim hat keinen Dom. Wir werden angemessen reagieren. Ich unterrichte Sie als Ersten von meinen Gesprächen, einverstanden?“
Der Stadtrat sagte nichts mehr. Er war enttäuscht. Klaus Hofelich wusste zwar, dass der OB kein Katholik war und hatte deshalb nicht unbedingt Jubel erwartet. Dennoch – ein bisschen Lokalpatriotismus hätte er als erster Bürger der Goldstadt schon zeigen können. Schließlich ging es um den höchsten Würdenträger der größten Glaubensgemeinschaft der Erde – das Oberhaupt von über einer Milliarde Katholiken. Das wäre gegebenenfalls ein auch für Nichtkatholiken bedeutsameres Ereignis als das Oechsle-Fest oder das internationale Tanzturnier um den Goldstadtpokal, dachte Hofelich. Er nahm sich vor, den CDU-Landesvorsitzenden zu sensibilisieren. Hofelich schätzte den umtriebigen Parteifreund, der das „C“ in seiner Partei noch ernst nahm. Ein Mann mit Einfluss und Tatkraft. Ganz auf seiner Wellenlänge, fand Hofelich.
Gleich am nächsten Morgen rief der Oberbürgermeister den Erzbischof an und erfuhr von ihm etwas mehr über die Hintergründe. Die Quelle des Gerüchtes entsprang wohl einer Wallfahrt nach Rom mit Audienz beim Papst, organisiert von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung e.V..
Die teilnehmende Pilgergruppe der Gemeinde Pforzheim Mitte hatte bei der Audienz direkten Kontakt mit dem Heiligen Vater. Im Laufe des kurzen Gespräches bedauerte der Papst, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, zum 98. deutschen Katholikentag persönlich zu erscheinen. Er äußerte aber, dass sich die nächste Gelegenheit bestimmt in absehbarer Zeit bieten würde. Der Papst sei zwar körperlich in schlechter Verfassung gewesen und habe sehr leise und langsam gesprochen. Er sei aber geistig im Vollbesitz seiner Kräfte, und jedes seiner Worte sei klar und verständlich gewesen. Die Teilnehmer waren überrascht, wie unglaublich gut der Nachfolger Petri über die Besonderheiten im Diözesansekretariat Nordbaden informiert war. Er sprach auch schon vom hundertsten Kirchentag, der in Leipzig vorgesehen sei.
Der Erzbischof kam auch auf Hofelich zu sprechen:
„Bei Hofelich muss man aufpassen. Der neigt nämlich dazu, sich in eine Sache hineinzusteigern. Also: Vorsicht! Andererseits kenne ich schon seit vielen Jahren den Reiseleiter der Pilgerfahrt: Gottlob Schönthal. Nach meinen Erfahrungen ist das ein absolut zuverlässiger, grundsolider Mann. Er ist übrigens ein Onkel unseres Kirchenbedarfslieferanten Gottfried Schönthal. Bei dem habe ich gleich nach dem Anruf von Hofelich sicherheitshalber nachgehakt. Schönthal hat gute Verbindungen zu unserer Kirche. Ein Geschäftsmann eben, der sich überall umhört und das Gras wachsen hört. Jedenfalls ist er ziemlich überzeugt davon, dass die Zeichen für einen neuen Besuch des Papstes in Deutschland auf Grün stehen.
Zugegeben, letztlich weiß niemand genau, wie die Reisepläne der nächsten Jahre aussehen, ich natürlich auch nicht, wahrscheinlich nicht einmal der Heilige Vater selbst. Trotzdem: Ich rate der Stadt dringend, Vorsorge für den Besuchsfall zu treffen. Mal ganz unter uns: So eine gewisse – vielleicht altersbedingte Tendenz – zu eigenwilligen und einsamen Entscheidungen ist nun mal bei unserem Oberhaupt nicht zu leugnen. Jedenfalls leidet das Umfeld sehr unter seiner Unberechenbarkeit. Also Überraschungen sind durchaus möglich.“
Im weiteren Verlauf des Gesprächs empfahl der Erzbischof, den Pforzheimer Dekan Kornmüller zwar zu informieren, aber nicht aktiv in die Vorkehrungen einzubinden. Er sei bei einem derartigen Ereignis wahrscheinlich etwas überfordert.
„Setzten Sie lieber auf Pater Dr. Franz Adler. Der ist der neue Missionsbeauftragte. Kornmüller ist bestimmt ein lieber Mann und wirklich ein guter Seelsorger. Ich mag ihn sehr. Aber Adler ist nun mal ein exzellenter Netzwerker mit Gespür auch für die politischen Dimensionen.“
Am Schluss des Gespräches verriet der Erzbischof noch, dass sich der Papst sehr positiv zur Heiligsprechung des seligen Bernhard II. von Baden geäußert habe. Das sage er nicht ohne Stolz, denn die Initiative zur Heiligsprechung sei von seiner Diözese ausgegangen. Bei der Würdigung dieses auch für die Politik so bedeutsamen Badeners, mahnte er an, sollte sich die Stadt durchaus etwas stärker engagieren.
„In der Besuchssache halten wir uns aber zunächst noch etwas zurück. Wir dürfen erst agieren, wenn uns der Vatikan dazu einen klaren Auftrag gibt. Wir sind an kurzer Leine, da haben Sie mehr Freiheit“, sagte der Erzbischof abschließend.
3 Wunder
„Was soll ich dir tun? Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott.“
(Lukas 18, 41-43)
„Du hast diesem Pater wirklich zugesagt? Ich glaube es nicht, das ist nicht dein Ernst! Du lässt dich zum Affen machen!“, schimpfte Irene Maurer und hielt die Klarsichthülle mit der Hostienkopie ans Licht.
„Was, das soll die Jungfrau Maria sein? Die braunen Kleckse da? Sieht doch eher aus wie ein Teufel mit Hörnern. Hat dich der komische Pater schon infiziert? Überhaupt, absolut lächerlich, auf was du dich da eingelassen hast. Wie kannst du nur einen so blödsinnigen Auftrag annehmen und wegen ein paar Flecken auf einer Oblate nach Pforzheim fahren. Zahlt dir der wundergläubige Wanderprediger wenigstens den Sprit?“
Irene war wütend, weil Bruno Hansen ihr gerade erklärt hatte, weshalb er sie am nächsten Mittwoch nicht zum Konzert der Stuttgarter Philharmoniker begleiten könne. Bruno setzte zur Antwort an, kam aber überhaupt nicht zu Wort. Irene fuchtelte mit dem Programmheft vor seiner Nase herum und wetterte weiter:
„Da verrätst du einfach deinen protestantischen Landsmann Mendelssohn, du anonymer Katho-holiker. Wahrscheinlich hat dich der Kerl schon so stark verfrömmelt, dass du die Reformations-Sinfonie nicht mehr ertragen kannst. Ausgerechnet die wird nämlich gespielt!“
So war sie. Sie konnte heftig und sehr kreativ schimpfen. Unter ihren Schülern und Kollegen machten so manche ihrer Wortschöpfungen die Runde. Wegen der Titulierung eines für die Statistik zuständigen Schulrates als „durchgeknallter Trockenerbsenzähler“ erhielt sie sogar eine offizielle Rüge, was sie aber nicht davon abhielt, kurz danach einen anderen Statistiker als „Ameiseneierklassifizierer“ zu bezeichnen. Der nahm es allerdings mit Humor. Das rettete die Wiederholungstäterin vor schärferen Disziplinarmaßnahmen. Hansen wusste, dass er einfach warten musste, bis sie sich ganz entladen hatte.
„Verzichte doch auf den Judaslohn. So wie es aussieht, bekommst du den von dieser scheinheiligen Klingelbeutelratte sowieso nie! Schmeiß’ den Bettel einfach hin, sag’, dass du Besseres zu tun hast, als bei dem absurden Theaterzauber Statist zu spielen. Bestimmt hängt das mit dem Papstbesuch zusammen. Keiner weiß was Genaues, aber alle spinnen. Hast du das in der Zeitung gelesen? Im Radio kam es heute Morgen auch schon. Wissen nichts, aber kommentieren und spekulieren schon um die Wette.“
Jetzt atmete sie durch, und Bruno kam zu Wort:
„Ich glaube, du tust dem Mann Unrecht. So übel ist Adler nicht. Ich habe es im Gefühl – irgendetwas Größeres steckt dahinter. Das will, das muss ich herausfinden. Deshalb gehe ich nächste Woche zum Pforzheimer Dekan. Kornmüller heißt er. Es war schwierig genug, bei ihm einen Termin zu bekommen. Es passte nur der Mittwoch. Du glaubst ja gar nicht, was bei dem seit dem Gerücht über den Papstbesuch los ist. Die ganze Stadt dreht durch, besonders natürlich die Amtsträger der Katholiken.“
Irenes Zornesfalten verschwanden. Sie setzte sich zu Bruno auf das Sofa, zupfte ihn am Vollbart und sagte freundlich:
„Gut, dann zieh’ zu deinen Schwarzwälder Katholiken, alter Abraham. Ich lasse mich währenddessen von der Musik in den Himmel heben. Weißt du übrigens, dass Felix Mendelssohn diese Sinfonie als Zwanzigjähriger zur Feier des dreihundertsten Reformationstages geschrieben hat? Und dass er von diesem Werk später gar nicht mehr überzeugt war? Ich les’ dir noch vor, was Mendelssohns Vater – übrigens ein Banker – seiner Tochter Fanny geschrieben hat. Steht im Programmheft:
„Ob Gott ist? Was Gott sei? Ob ein Theil unserer Selbst ewig sei und, nachdem der andere Theil vergangen, fortlebe? und wo? und wie? – Alles das weiss ich nicht und habe Dich deswegen nie etwas darüber gelehrt. Allein ich weiss, dass es in mir und in Dir und in allen Menschen einen ewigen Hang zu allem Guten, Wahren und Rechten und ein Gewissen gibt, welches uns mahnt und leitet, wenn wir uns davon entfernen. Ich weiss es, ich glaube daran, lebe in diesem Glauben und er ist meine Religion.“
Irene klappte das Programmheft zu und sagte: „Nicht dumm, was? Und sehr optimistisch. So gewappnet kannst du getrost zu den Besserwissern im Glauben ziehen. Sag’ diesem Erbsündenlehrer einen schönen Gruß von mir und von Felix, dem Glücklichen.“
Mit einem Ruck stemmte sie sich vom Sofa, setzte sich an den Computer und schaltete ihn ein.
„Komm, wir recherchieren. Du wirst ja nicht unvorbereitet zum Pforzheimer Oberpriester gehen. Du musst mehr über die Wunder wissen, damit du nachempfinden kannst, wie so ein Gottesmann tickt. Ich kenne mich in Glaubensdingen etwas besser aus. Gelobt sei das Marienhospital mit seinen Vinzentinerinnen! Weißt du noch?“
Bruno wusste noch, und sie hatte wohl recht.
Es war bereits über fünf Jahre her, als sie sich im Marienhospital Stuttgart kennengelernt hatten – sie kurz zuvor geschieden, er schon länger. Ihr musste die linke Brust entfernt und ihm der Darm um zehn Zentimeter verkürzt werden. Sein Geschwür war gutartig, ihres nicht. Deshalb musste sie regelmäßig zur Beobachtung ins Krankenhaus und oft lange warten. Aber passives Warten war nicht Sache dieser temperamentvollen Frau.
Dr. Irene Maurer, die als Oberstudienrätin Deutsch und Geschichte unterrichtete, wusste immer etwas mit sich anzufangen. So beschäftigte sie sich zwischen Röntgenterminen, Computertomografien, Ultraschalluntersuchungen und Blutabnahmen mit der Geschichte des Marienhospitals und der dort tätigen „Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul“.
„Ich weiß noch, dass eine der Schwestern – Edelgard oder Edeltraud hieß sie – sogar regelmäßig zu den Wirkungsstätten von Seligen und Heiligen gepilgert ist. Dort hat sie im Gebet mit ihnen gesprochen und mir dann mit verklärten Augen von den Wundern erzählt. Dass meine Operation so gut verlaufen ist, sei ein großes Wunder, fand sie, und wollte das unbedingt auf die Wirkung von Vinzenz von Paul zurückführen. Er sei schließlich der Patron der Waisen, Gefangenen, Findelkinder und der Krankenhäuser. Eigenartige Zusammenstellung, oder? Ich fand das ja auch alles wunderbar. Wie die frommen Schwestern mich damals im Marienhospital umsorgt haben, so richtig liebevoll und aufmerksam.... Komm, wir machen weiter!“
So saßen die Beiden nun gemeinsam in Hansens kleiner Zweizimmerwohnung am Bihlplatz in Stuttgart-Heslach und starrten ungläubig auf die Internetseiten der organisierten Gläubigen. Sie klickten die Homepages der bekannten Wallfahrtsorte Lourdes, Assisi, Fatima, Santiago de Compostela, Oberammergau und Altötting an und wunderten sich über die Vielzahl weiterer Orte, von denen sie bisher noch nie etwas gehört hatten.
Sie hatten nicht gewusst, dass allein im Lande Baden-Württemberg siebenunddreißig Wallfahrtsorte um Pilger buhlen. Sie wussten auch nicht, dass der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahre 2009 in Engerazhofen eine neue Niederlassung der „Gemeinschaft der Missionare Unserer Lieben Frau von La Salette“ errichtet hatte und diese jetzt aus drei polnischen Salettinern besteht.
Sie waren überrascht vom Umfang der Liste der Seligen und Heiligen und von der Vielfalt ihrer Wundertaten, über die sie sich im kirchenoffiziellen „Martyrologium Romanum“ kundig machten. Über sechstausend Heilige und Selige und über siebentausend Märtyrer waren auf 844 Seiten in lateinischer Sprache aufgelistet – von A wie Aaron von Caerleon, einem Märtyrer, bis Z wie Zosimus, einem Papst. Erscheinungen von Aposteln, Engeln, Maria, Christus und auch der gesamten Heiligen Familie waren dokumentiert. Über wundersame Heilungen aller Arten von Krankheiten und Gebrechen, Erweckungen, Erlösungen, Erleuchtungen, Läuterungen und dramatische Rettungen wurde berichtet.
Die beiden Wunderforscher verloren sich fast in den vielen aufregenden und berührenden Geschichten um die besonders verdienten Diener Gottes. Bruno Hansen erinnerte an den Zweck seiner Recherche und riss die Herrschaft über die Computer-Maus an sich. Er informierte sich nun gezielt über Wunder im Zusammenhang mit Hostien.
Es bot sich eine große Auswahl an. Seitenweise Geschichten über höchst seltsame Ereignisse mit besonders frommen Menschen. Hostien, von denen Blut tropfte, Hostien, die sich in faseriges Fleisch verwandelten, Hostien, die ohne Zutun des Priesters auf die Zunge des Abendmahlempfängers schwebten.
Irene Maurer und Bruno Hansen waren erschlagen. Mehr Wunder konnten sie nicht aufnehmen. Hansen war überzeugt, dass Adlers Marienbild-Hostie sich bruchlos in das Martyrologium der Weltkirche einfügen ließ. Dieses Wunder, wenn es denn eines wäre, würde nicht aus der Reihe tanzen.
Notiz 2
Ich war im Gemeinderat auf der Zuschauertribüne. Adler hat über den Stand des Verfahrens zur Heiligsprechung von Markgraf Bernhard berichten dürfen. „Ein furchtloser Kämpfer für den wahren Glauben“, brüllt Adler, und alle klatschen. Alle, die Linken und die Rechten.
Widerlich, besonders die jungen Weiber. Wie sie ihn anhimmeln. Wenn er gesungen hätte, hätten sie gekreischt und ihre Schlüpfer auf die Bühne geworfen. Die merken nicht, wie er sie verachtet.
Ich habe ihn dabei fotografiert. Das Bild kann ich groß zoomen, und dann müsste jeder, der noch einen Funken gesunden Menschenverstand hat, den spöttischen Glanz in Adlers Augen sehen. Bildunterschrift :
Der Schein trügt, Adler lügt!
4 Spaltung
„Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.“
(Matthäus 10,34-38)
Der Oberbürgermeister, erfahren im politischen Geschäft, hatte es geahnt. Es ließ sich nicht mehr geheim halten. Zwei Tage nach seinem Gespräch mit dem Stadtdekan stand es in der Zeitung. Er musste handeln. Wer nicht selbst schnell agiert, wird ein Spielball der Medien und Lobbyisten.
Der OB richtete eine Arbeitsgruppe ein. Etwas flapsig taufte er die neue AG „PIP“, Papst in Pforzheim. Die Gruppe sollte sich mit „vorläufigen Vorbereitungen“ beschäftigen. Die Sache solle man trotz Presse auf keinen Fall zu hoch hängen, ließ der OB verlautbaren. Deshalb wurde die AG PIP nicht von ihm selbst oder einem seiner Dezernatsleiter geführt. Für die Leitung habe er Sven Kufler vorgesehen, einen jungen, dynamischen Mitarbeiter der Messegesellschaft. Stadtrat Klaus Hofelich hatte sich freiwillig angeboten, ein Auge auf die Arbeit der PIP-Runde zu werfen.
Vergeblich hatten sich der OB und der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz darum bemüht, aus dem Umfeld des Stellvertreters Christi Klarheit zu erhalten. Tagelang zog sich das hin. „Kommt er oder kommt er nicht?“, raunten sich Gemeinderäte, Kirchgänger und Stammtischbesucher zu. In einer ersten Stellungnahme vermeldete der Vatikan, dass die Reisepläne des Heiligen Vaters in der Regel nicht mehr als achtzehn Monate im Voraus bekannt gegeben würden. Dies hatten Fans, die nicht nur in kirchlichen Kreisen zu finden waren, sofort als glückliches Zeichen aufgefasst. Schließlich bedeutete es kein Dementi.
Nach Rücksprache mit dem Pforzheimer OB und dem Ministerpräsidenten Baden-Württembergs war der Erzbischof der Diözese sogar nach Rom gereist. Er versuchte, mit dem Papst persönlich zu sprechen. Das Treffen kam leider nicht zustande, aber immerhin drang er bis zum Kardinalstaatssekretär vor. Das war einem Bundesbruder des Erzbischofs aus der Tübinger Guestfalia zu verdanken – Lothar Morsch, einem Landsmann, der kürzlich als Mitglied des neu gebildeten „Päpstlichen Rates zur Neuevangelisierung“ zum Weihbischof ernannt worden war. Der Heilige Vater habe zwar noch keine konkreten Reisepläne, aber selbstverständlich schließe er einen nochmaligen Besuch in Deutschland nicht aus. Der Papst behalte sich in letzter Zeit auch sehr spontane Reisen vor, denn er wisse sehr wohl, dass der Allmächtige ihn jederzeit zu sich nehmen könne. Eines müsse auf jeden Fall klargestellt werden: der Pontifex Maximus werde sich auf keinen Fall dem Druck der Straße oder Presse beugen. Wen er wann, wo und wie besuche, sei allein seine eigene Entscheidung.
So blieb alles im Ungewissen. Die Spekulation „Kommt er oder kommt er nicht?“ mutierte schnell zur Frage „Willkommen oder nicht willkommen?“, und die Antwort war selten allein von Glaubensüberzeugungen oder Sachargumenten bestimmt. Für den OB konnte es nur einen Schluss geben, und der wurde von den Gemeinderäten mit großer Mehrheit geteilt: Ein Besuch des Papstes dürfe die Goldstadt nicht unvorbereitet treffen. „Sparsamste Vorausplanungen im Vorfeld unter Einbeziehung von kirchlichen Ressourcen und Sponsoren aus der Wirtschaft“ seien unabdingbar, formulierte man für eine Pressemitteilung. Blamieren wolle man sich nicht, aber andererseits dürfe man auch nicht auf Verdacht Steuergelder verpulvern und Energien der Verwaltung unnötig binden.
Der Oberbürgermeister musste sich vorwerfen lassen, ohne Absicht mit der griffigen Abkürzung PIP selbst zur Zuspitzung beigetragen zu haben. Sie wurde schnell zum Selbstläufer und hatte damit das „PIP-Fieber“ gesteigert. Der OB hätte die PIP-Gruppe nun auch nicht mehr umbenennen können. Das wäre ihm als Verschleierung ausgelegt worden. Und immer wieder zu betonen, dass PIP keine Bewegung sei, sondern nur eine ressortübergreifende, temporäre Arbeitsgruppe innerhalb der Stadtverwaltung, hätte nicht geholfen, im Gegenteil. Der OB wusste: Je geringer er ihren Stellenwert einstufen würde, desto misstrauischer und aufmerksamer würde ihre Arbeit von der Presse beobachtet werden. Hilflos musste er zusehen, wie eine Massenbewegung mit geradezu hysterischen Zügen entstand.
Es dauerte nicht lange, bis sich eine Protestgruppe bildete. Sie modifizierte das Kürzel PIP und nannte sich POP: Pforzheim ohne Papst. Begriffe wie Popkultur, Popkonzerte und Popstar wurden von der „freien Bürgerbewegung“ – so nannte sie sich selbst – vereinnahmt und mit neuer Bedeutung aufgeladen. Vor den öffentlichen Einrichtungen, sogar vor dem Reuchlinhaus, in dem sich das berühmte Schmuckmuseum befand, verteilten Papstgegner „POPKorn“, kleine Maisriegel mit der Aufschrift „Pforzheim ohne Papst!“ Die Widerständler nannten sich selbst Popper.
Sie folgten im Kielwasser des auf den Wogen der Begeisterung segelnden PIP-Schiffes und setzten zum Überholen an. Viele Gruppen sprangen auf und bildeten eine eigenartige Crew mit höchst unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Ansichten. Die Protestierenden hielt nur ein Ziel zusammen: einen Besuch des Papstes in Pforzheim zu verhindern. Gegner der Kirchensteuer und des Zölibats, Atheisten, Humanisten, Kommunisten, Freimaurer, Juden, Missbrauchsopfer, Frauenrechtlerinnen, Lesben- und Schwulenverbände und viele Einzelpersonen schlossen sich an und bewaffneten sich mit Bekenntnis-Buttons nach dem Vorbild der Stuttgart-21-Gegner: Eine rot durchgestrichene Mitra signalisierte, dass der Papst in ihrer Stadt eine unerwünschte Person sei. Manch einer drückte seine Ablehnung sogar auf Lateinisch aus. Aufkleber mit „Papa – persona non grata!“ zierten das Heck von Autos.
Es vergingen nur wenige Tage, bis die Popper auf Pforzheimer Bürger mit etwas größeren Gegenbuttons stießen, auf denen ein freundliches Konterfei des Papstes zu sehen war. Selbst Kinder schwenkten Fähnchen. „Herzlich willkommen“ hieß die fröhliche Botschaft. Der Adressat ihrer Sympathiebekundung blieb allerdings ungenannt, und so konnte man die Fähnchen gegebenenfalls für andere Jubelfeiern aufheben.
Sogar die Priesterbruderschaft St. Pius X., der die Abgrenzung des obersten Glaubenshüters von anderen Religionen eigentlich als viel zu lasch erschien, reihte sich in die Jubelschar ein. Sie wollte ihre seit einiger Zeit gestiegene Wertschätzung im Vatikan nicht verspielen.
Pforzheim war gespalten. Dabei hatten sich Oberbürgermeister und Stadtverwaltung die größte Mühe gegeben, die Wogen zu glätten. Schon wurden Rufe nach einem Schlichter laut, der zwischen PIP und POP vermitteln sollte. In einer Glosse hatte das Pforzheimer Tagblatt den Imam der Moschee vorgeschlagen, und der hatte das sogar ernst genommen. Vielleicht war dem Hüter der Muslime die Gelegenheit willkommen, dem Konkurrenten um die Alleinseligmachung das eigene Angebot entgegenzusetzen. Immerhin stand der Imam einer der bedeutendsten Moscheen Deutschlands vor. Die Muslime machten schließlich einen großen Bevölkerungsanteil der „Pforte zum Schwarzwald“ aus, wie sich die Stadt mitunter bezeichnete. Jedenfalls ließ der Imam verlauten, dass er sich gerne einer solchen Aufgabe stellen würde, und erinnerte freundlich an den Beitrag der christlichen Kirchen zur Eröffnung der Fatih-Moschee mit ihrem dreiundzwanzig Meter hohen Minarett. Der gespendete Kronleuchter erleuchte auch heute noch den Raum, in dem zu Allah gebetet werde. Dies sei ein schönes Beispiel für den interreligiösen Dialog, den es fortzusetzen gelte, zitierte ihn die Lokalzeitung. Überhaupt gebe es doch viele Gemeinsamkeiten zwischen Juden, Christen und Muslimen. Sie alle stammten aus Urvater Abrahams Schoß, mit dem Glauben an einen Gott. Im Koran – Sure 19 – sei sogar die jungfräuliche Geburt von Isa bin Maryan dokumentiert. So heiße Jesus dort.
Die katholische Kirche selbst konnte nichts zur Befriedung beitragen, im Gegenteil – ihre Entspannungsbemühungen wurden vom POP-Lager als Tarnmanöver abgetan. Selbst der Ministerpräsident des Landes konnte nichts ausrichten. Man hielt den gläubigen Katholiken für befangen, zumal er gleich nach seinem Amtsantritt beim Papst in Freiburg eine Audienz bekommen hatte.
Die evangelische Kirche wiederum hielt sich aus dem Streit heraus, konnte oder wollte sich aber nicht dagegen wehren, dass sie von den POP-Aktivisten vereinnahmt wurde. Regelmäßig musste sie dementieren, an Aktionen von POP direkt beteiligt gewesen zu sein, und beteuern, dass sie nichts gegen einen Besuch des Oberhauptes der Katholiken habe. Klammheimlich aber hofften die Protestanten, dass an ihnen der Kelch vorübergehen möge. Sie wollten das Feld nicht kurz vor dem fünfhundertsten Jubiläum des Lutherschen Thesenanschlags demjenigen überlassen, der ihnen noch deutlicher als sein Vorgänger das Recht auf eine ebenbürtige Kirche absprach.
Ähnliche Schwierigkeiten hatten die Zeugen Jehovas. Sie diskutierten die Lage zunächst getrennt in ihren Versammlungen Pforzheim-Süd und Pforzheim-West, kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen und mussten sich Weisung von ihrer Zentrale in BerlinKöpenick holen. Die „Leitende Körperschaft“ erinnerte die nordbadischen Zeugen an das Gebot, sich in politischen Fragen neutral zu verhalten, denn der mögliche Besuch des Papstes als Staatsoberhaupt von Vatikanstadt sei eindeutig eine weltliche Angelegenheit. Außerdem mögen die Brüder und Schwestern beachten, dass ihre Gemeinschaft in Baden-Württemberg im Gegensatz zu denen in fast allen anderen Bundesländern noch nicht als Körperschaft des Öffentlichen Rechts anerkannt sei. Also sei Vorsicht geboten, und es seien keine unbedachten Äußerungen zu machen. Aber es sei nichts dagegen einzuwenden, ja sogar zu empfehlen, die Missionstätigkeit in diesen Tagen der erhöhten Empfänglichkeit für religiöse Fragen zu verstärken.
Das wurde auch prompt umgesetzt, und so standen vor dem Schmuckmuseum, dem Rathaus und den Ämtern ernste Männer und ungeschminkte Frauen, die den „Der Wachtturm“ vor sich hielten und Sonderdrucke eines Traktates verteilten: „Sollte man an die Dreieinigkeit glauben?“ mit dem Untertitel „Ist Jesus Christus Gott, der Allmächtige?“ auf der Vorderseite, „Ewiges Leben im Paradies auf Erden“ auf der Rückseite mit einem lachenden Kinderpaar, das Hand in Hand durch eine Blumenwiese hüpft.
5 Blut
„Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.“
(Johannes 6, 54-56)
Wieder musste Hansen in den Nordschwarzwald fahren. Sein klerikaler Auftraggeber hatte ihn nach Tiefenbronn bestellt, dem größten Ort der „Seelsorgeeinheit Biet“ des Dekanats Pforzheim. Gleich gegenüber der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena in der Franz-Joseph-Gall-Straße gebe es das Café „Ambiente“. Dort solle er auf ihn warten, alles Weitere könne man vor Ort in der Kirche besprechen.
Das Café befand sich in der Ortsmitte neben einem prächtigen Fachwerkhaus, in der eine Bäckerei schon in der dritten Generation geführt wurde, die für ihre köstlichen Kuchen und Pralinen weit über die Gemeinde hinaus bekannt war. Adler saß bereits an einem Zweiertisch mit Blick zum Eingang, vor sich ein Kännchen Kaffee und die gepriesene Torte.
„Vielen Dank auch, dass Sie zugesagt haben. Sie spüren sicher, dass Ihre Mission jetzt angesichts des Papstbesuches noch viel, viel wichtiger geworden ist. Wir trinken aber erst mal einen Kaffee. Und dabei bitte kein Wort zu unserem Thema! Die haben hier eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte. Dann geht’s zum ernsten Teil über. Das machen wir in der Kirche. Dort kann uns keiner belauschen; sie ist um diese Zeit geschlossen.“
So, so, ‚Mission‘ nannte Adler das. Die Besprechung auch noch in der Kirche – ohne zu fragen, ob ihm dies so passen würde. Hansen ärgerte sich über seinen Auftragsgeber. Partnerschaft sieht anders aus. Was hätte der wohl gesagt, wenn Hansen ihn gedrängt hätte, nach Stuttgart zu fahren? Inzwischen war Hansen eigentlich kein demütiger Befehlsempfänger seiner Auftraggeber mehr. Selbst schuld, er hatte es wieder mal verpasst, sich bequemere Bedingungen auszuhandeln.
„Sie können den Kuchen jetzt bringen und den Kaffee auch gleich!“ rief Adler der Bedienung zu.
„Nein, bitte keinen Kaffee, ich bin Teetrinker!“, wehrte sich Hansen.
„Der Kaffee hier ist spitze, kann ich nur empfehlen“, warf Adler ein, „aber was soll’s, bringen Sie meinem Gast einen First-Flush-Darjeeling.“
Die junge Dame war kurz irritiert, nahm die Kaffeekanne vom schon bereitgestellten Tablett und sagte mit Ehrfurcht in der Stimme: „Gerne, Herr Doktor, ich bringe den Tee gleich. Soll ich die Torte…?“
„Den Kuchen können Sie schon mal dalassen“, sagte Adler und deutete auf Hansens Platz.
„Lassen Sie sich’s schmecken. Wussten Sie übrigens, dass Franz Joseph Gall hier in Tiefenbronn geboren ist?“
„Ich weiß nicht einmal, wer dieser Herr Gall war. Ein wundertätiger Priester etwa?“
„Gott bewahre, wie kommen Sie denn darauf. Nein, eher das Gegenteil. Ein Schädelforscher, so am Ende des achtzehnten Jahrhunderts herum mit wissenschaftlich widerlegten Thesen – ein Blender, ein Scharlatan. Unsere Kirche hat seine Schriften damals auf den Index gesetzt.“
Hansen erinnerte sich. Bei seinem letzten Fall spielte der Name Gall auch eine Rolle. Das hätte er eigentlich noch wissen müssen.
„Ist das der Gall, der auf etwas obskure Weise dafür gesorgt hat, dass Joseph Haydns Schädel in seine Sammlung kam?“
„Davon weiß ich nichts, aber zuzutrauen wäre ihm ein solcher Frevel. Auf jeden Fall war er kein guter Christ. Sein eigener Schädel kam übrigens in ein Pariser Museum. Dafür sorgte ein befreundeter Phrenologe – ekelhaft, so was, nicht wahr?“
„Phrenologe?“
„Hirnforscher würde man wohl heute sagen. Einer, der Dumme und Kluge, Gute und Böse an der Form des Schädels identifizieren wollte. Wissenschaftlich verbrämter Aberglaube, meines Erachtens Teufelswerk. Gall bekam einen Schlaganfall, kurz nach dem Tod seiner Frau, die er jahrelang betrogen hatte. Er starb ohne Sakramente, und eine kirchliche Bestattung hatte er sich noch auf dem Sterbebett selbst verbeten. Trotzdem, hier widmen sie ihm sogar die Hauptstraße. Das führt uns fast schon zum Thema. Essen Sie auf, wir gehen gleich rüber. Ich zahle, Sie sind eingeladen.“
Sie überquerten die Straße mit dem Namen des Unheiligen und standen nach ein paar Schritten vor der äußerlich eher unscheinbaren gotischen Pfarrkirche der Heiligen Maria Magdalena.
„Sie haben einen Schlüssel?“
„Ja, ich halte hier hin und wieder Gottesdienste ab und will nicht jedes Mal auf den Messner angewiesen sein. Das habe ich mir ausbedungen. Für mich sehr praktisch, ich habe für die Dauer meines Auftrags im Dekanat ein Zimmer im Nachbarort. Außerdem ist die Kirche hier im Biet absolut die Schönste. Innere Werte hat die, da werden Sie gleich staunen.“
Das tat Bruno Hansen, als er ein paar Stufen hinunter stieg und in die von Licht erfüllte Basilika gelangte. Wundervolle Glasfenster, herrliche Wandgemälde, Statuen der Stifter, eine Fülle von Heiligenbildern und im Chorschluss ein fast zehn Meter hoher Hochaltar des Ulmer Meisters Hans Schüchlin, der mit seinen verschwenderisch vergoldeten Plastiken glänzte. An der Ostwand, weniger spektakulär – aber, wie ihn Adler belehrte, kunsthistorisch noch bedeutsamer – stand ein weiteres Werk, der Magdalenenaltar aus dem 15. Jahrhundert, gestaltet von Lukas Moser.
Hansen wehrte sich gegen das aufkommende Gefühl. Vergeblich, er war ergriffen. Ja, so musste er es wohl nennen. Ähnlich, wie er es bei seinen Konzertbesuchen hin und wieder erlebte. Er drehte sich noch einmal nach allen Seiten und staunte. Ziemlich abgegriffene Wörter kamen ihm in den Sinn und verloren hier ihre Verflachung: erhaben, edel, feierlich, würdevoll, – fast hätte er noch heilig dazugesetzt. Er konnte sich gut vorstellen, wie Adler mit seiner Donnerstimme in diesem einzigartigen Rahmen Gottesfurcht und Bußfertigkeit herbeipredigen konnte.
„Wirklich prächtig“, flüsterte Hansen.
„Kommen Sie“, sagte Adler, schloss die Portaltür von innen ab und führte Hansen zu einer niedrigen Tür im Altarraum, „gehen wir in das Beichtzimmer. Da können wir miteinander reden, völlig ungestört.“
Sie saßen sich an einem einfachen Holztisch gegenüber. Der Priester begann mit der Erklärung, dass Hansen doch etwas mehr über die Hintergründe seines Auftrags wissen müsse. Hansen solle ungeniert fragen.
Unvermittelt beugte sich Adler vor, tippte mit dem Finger der rechten Hand auf seine offene linke Handfläche und sagte:
„Bei der letzten Kommunion – das war in der Barfüßerkirche in Pforzheim – ist es passiert: Plötzlich Blut auf meiner Hand, nicht viel, aber klar erkennbar. Das habe ich unmittelbar nach der Konsumption bemerkt, als ich zum letzten Teil der Feier, der Oration, kam. Und ich bin mir ganz sicher, dass beim Agnus dei vor der Darreichung der eucharistischen Gaben noch kein Blut an meiner Hand war.“
„Kann es nicht sein, dass ein paar Tropfen Messwein auf Ihre Hand gelangt sind? Beim Ausgießen aus der Kanne?“
Diese Frage hätte Hansen nicht stellen dürfen. Adler wurde lauter:
„Quatsch, so was hätte ich ja sofort gesehen. Außerdem, mein lieber Herr Detektiv, müssten Sie eigentlich inzwischen wissen, dass wir mit Weißwein arbeiten. Der verwandelt sich auch nicht in Rotwein. Da müssten Sie das mit der Wandlung falsch verstanden haben. Aber lassen wir die Theologie aus dem Spiel. Es muss wohl so gelaufen sein: Als ich die Hostie bei der Handkommunion ausgegeben habe, hat mich einer der Abendmahlsempfänger mit beiden Händen umfasst. Nur kurz und genau in dem Moment, in dem ich die Hostie auf seine linke Handfläche gelegt habe. Ich habe da zwar nichts gespürt, auch hinterher nichts. Aber möglich ist schon, dass er irgendwas Spitzes in der Hand hatte. Bei der Ausgabe des Leibes Christi bin ich so konzentriert im stillen Gebet versunken, da könnte man mir allerlei antun. Ich würde es gar nicht merken. Vielleicht ist das sogar vergleichbar mit Hypnose und mit den indischen Fakiren, die auf Nagelbrettern sitzen können oder über glühende Kohlen laufen. Das hat aber nichts mit Wundern zu tun. Das ist ein weltlicher, ein psychologischer Effekt. So etwas haben Sie sicher auch schon selbst erlebt, oder?“
„War es sicher ein Mann, der Ihnen bei der Kommunion die Hand umklammert hat?“