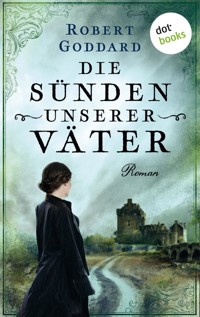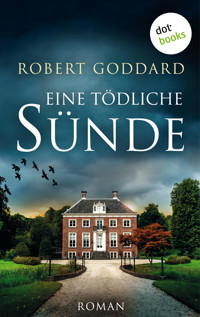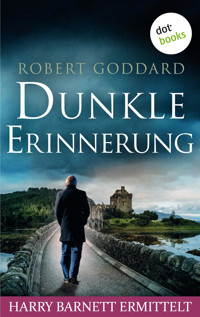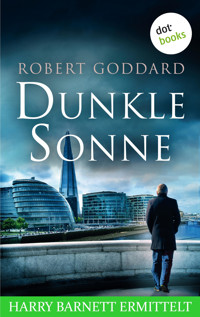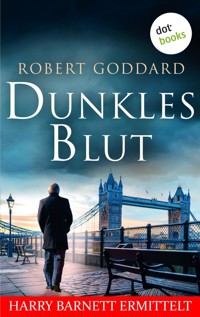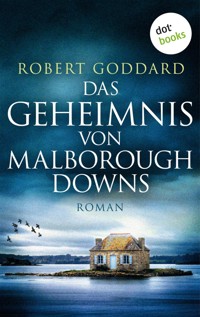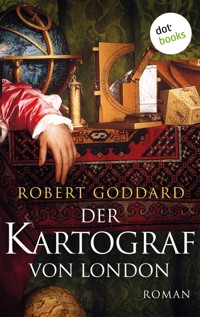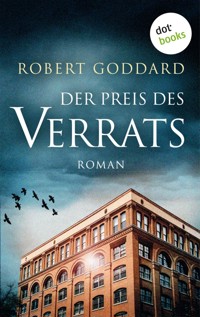
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geister der Vergangenheit ruhen nie: Der mitreißende Kriminalroman »Der Preis des Verrats« von Robert Goddard jetzt als eBook bei dotbooks. Lance Bradley möchte eigentlich nicht mehr vom Leben als morgens ein Schinkensandwich und abends ein Bier im Pub von Somerset. Als sein Freund Rupert Adler vermisst wird, begibt er sich nur widerwillig auf die Suche nach ihm. Was Lance dabei herausfindet, kann unmöglich stimmen: Ruperts ehemaliger Arbeitsgeber will den stets korrekten Buchhalter wegen schweren Betrugs verklagen und ein japanischer Geschäftsmann behauptet, er habe ihm ein Dokument gestohlen, von dem Leben und Tod abhängen. Als Lance von einem Unbekannten bedroht wird, entscheidet er, dass ihm die Sache entschieden zu heiß ist – doch kann er seinen Hals überhaupt noch aus der Schlinge ziehen? »Robert Goddard ist der absolute Meister des Spannungsromans!« Daily Mirror Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Kriminalroman »Der Preis des Verrats« von Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Lance Bradley möchte eigentlich nicht mehr vom Leben als morgens ein Schinkensandwich und abends ein Bier im Pub von Somerset. Als sein Freund Rupert Adler vermisst wird, begibt er sich nur widerwillig auf die Suche nach ihm. Was Lance dabei herausfindet, kann unmöglich stimmen: Ruperts ehemaliger Arbeitsgeber will den stets korrekten Buchhalter wegen schweren Betrugs verklagen und ein japanischer Geschäftsmann behauptet, er habe ihm ein Dokument gestohlen, von dem Leben und Tod abhängen. Als Lance von einem Unbekannten bedroht wird, entscheidet er, dass ihm die Sache entschieden zu heiß ist – doch kann er seinen Hals überhaupt noch aus der Schlinge ziehen?
»Robert Goddard ist der absolute Meister des Spannungsromans!« Daily Mirror
Über den Autor
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die folgenden Kriminalromane: »Im Netz der Lügen«, »Der Preis des Verrats«, »Eine tödliche Sünde«, »Ein dunkler Schatten«, »Denn ewig währt die Schuld«, »Das Geheimnis von Trennor Manor«, »Und Friede den Toten«, »Das Geheimnis der Lady Paxton« und »Das Haus der dunklen Träume«.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane: »Die Sünden unserer Väter«, »Die Schatten der Toten«, »Jäger und Gejagte«, »Die Klage der Toten« und »Der Kartograf von London«
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett: »Dunkles Blut«, »Dunkles Sonne« und »Dunkle Erinnerung«
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Januar 2020
Dieses Buch erschien bereits 2002 unter dem Titel »Der verborgene Schlüssel« bei Goldmann
Copyright © der englischen Originalausgabe 2001 by Robert and Vaunda Goddard
Die englische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Dying to Tell« bei Transworld Publishers.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München.
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Emeraldfoto
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-016-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Robert Goddard« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Der Preis des Verrats
Roman
Aus dem Englischen von Peter Pfaffinger
dotbooks.
SOMERSET
Kapitel 1
Dieser Tag begann wie jeder andere: spät und langsam.
Die Vorhänge zog ich nur ein Stück zurück. Es sah nach zu viel Sonne aus, als dass ich mich ihr vor dem Duschen und einer großen Kanne starken Kaffees hätte stellen können. Sie hatte kein Recht, Ende Oktober so hell zu strahlen! Außerdem wären bei trüberem Wetter die auf dem Fußabstreifer liegenden Rechnungen nicht so aufgefallen. Ebenso wie die Schatten unter meinen Augen, die ich beim Rasieren unwillkürlich begutachtete.
Nur wenige Wochen vor meinem siebenunddreißigsten Geburtstag sah ich gar nicht mal so schlecht aus – für einen Fünfundvierzigjährigen. Es war wirklich höchste Zeit, dass ich mich in den Griff bekam, oder jemanden fand, der das für mich übernahm. Beides schien nicht allzu wahrscheinlich. Wenn schon der Wechsel ins neue Jahrtausend bei mir keine Wende zum Besseren hatte herbeizaubern können, was dann?
Das Problem mit mir ist seit jeher, dass es nicht viel braucht, damit ich mich besser fühle. Ein Specksandwich und ein sauberes T-Shirt genügten, um mich an diesem Morgen in eine halbwegs gute Stimmung zu versetzen. Ich verließ die Wohnung und ging um die Ecke in die Magdalene Street, um mir eine Zeitung zu kaufen. Das Abbey-Parkhaus war bereits voll belegt. Schon Herbstferien? Jedenfalls trieben sich jede Menge Kinder herum. Ein Junge schaffte es, genau in dem Moment, in dem er auf seinen Rollerblades an mir vorbeisauste, einem Kumpel etwas derart gellend zuzurufen, dass ich vor Schreck zusammenfuhr, was ihn ungemein amüsierte.
Ein Segen immerhin, dass die Gaststube des Wheatsheaf wenige Minuten vor Mittag eine kinderfreie Zone war. Und dunkel obendrein! Ich ließ mich auf meinen Stammplatz unter der Fotocollage von der letzten Verkleidungsnacht im Pub sinken, nippte an einem heilsamen Carlsberg Special und widmete mich dem Kreuzworträtsel als Aufwärmübung für meinen Versuch, aus den Nachmittagsrennen in Chepstow und Redcar einen Sieger auszuwählen.
Les, der Wirt, versuchte behutsam, mit ein bisschen Herumpolieren an den Zapfhähnen und der Überprüfung der Optik des Tresens richtig wach zu werden. Die einzigen anderen Gäste außer mir waren zwei ältere Stammkunden namens Red und Syd, die mit Gesprächen nicht viel am Hut hatten. Die Kneipe war ruhig, wohltuend und sicher. Alles war vollkommen normal und bestimmt nicht irgendwie bemerkenswert.
Und doch erinnere ich mich daran bis in jedes Detail. Denn es sollte das letzte Mal sein, dass mein Leben ruhig, angenehm und sicher war. Im nächsten Augenblick sollte die Kneipentür aufgehen und alle Normalität durch das Fenster entweichen.
Das wusste ich natürlich nicht. Ich ahnte nichts davon. Es geschah einfach, und nach Verhängnis, Schicksal oder irgendetwas Bedeutsamem sah es nicht aus. Doch das war es. O ja, das war es ganz gewiss.
Ich erkannte sie nicht auf den ersten Blick. Winifred Alder musste inzwischen auf die sechzig zugehen und hatte sich für ihr Alter auch nicht besser gehalten als ich mich für meines. Sie war hager und hohlwangig, ihr stahlgraues Haar kurz und ausgefranst, als hätte sie es selbst mit einer Schere geschnitten, die einen Schliff nötig gehabt hätte. Von Make-up fehlte jede Spur. Die roten Flecken auf der Haut, die sich über vorstehende Wangenknochen spannte, stammten von Wind und Wetter, nicht von Rouge. Abgesehen davon hätte Make-up kaum zu ihrer Kleidung gepasst – grober grauer Pullover, schienbeinlanger brauner Rock und schlammbespritzter Regenmantel. Es waren eigentlich die Schuhe, an denen ich sie erkannte. Clarks zweiter Wahl, keine gängige Farbe (ursprüngliches Lila, das zu einem trüben Mauve verblasst war), etwa zwanzig Jahre alt. Sie waren es, die meinem Gedächtnis auf die Sprünge halfen. Das musste Winifred sein. Oder ihre Schwester. Mildred glich Winifred wie ein Ei dem anderen. Sie war etwa zwei Jahre jünger, was freilich in ihrem Alter kaum einen sichtbaren Unterschied ausmachte. Aber während ich noch zwischen den zwei Möglichkeiten schwankte, nahm mir Winifreds unverwandter strenger Blick die Entscheidung ab. Mildred hatte anderen nie wirklich in die Augen schauen können.
»Haste ’nen Schauer abgekriegt, Süße?«, fragte Les und grinste sie über die im Sonnenlicht glänzenden Zapfhähne hinweg an.
»Hast du mich gesucht, Win?«, schaltete ich mich ein. (Eine andere Erklärung für ihr Kommen sah ich nicht. Dass sie auf ein Glas Portwein mit Zitrone hereingeschneit war, hielt ich für unwahrscheinlich.)
»Die Kellnerin in dem Café, über dem du wohnst, hat gemeint, ich würde dich hier finden.« Winifred trat vorsichtig zwei Schritte näher.
»Ein Zufallstreffer.«
»Aber durchaus eine sichere Bank«, brummte Les.
»Möchtest du was trinken?«, fragte ich.
»Was ich möchte, ist mit dir reden.«
»Reden ist hier erlaubt«, ließ sich Les vernehmen. »Aber eine Tanzlizenz habe ich nicht. Das solltet ihr wissen.«
»Unter vier Augen.«
»Keine Sorge«, sagte Les. »Ich bin für meine Verschwiegenheit bekannt. Und Reg und Syd haben ihre Hörgeräte abgestellt.«
Wins Blick wurde um keinen Deut weicher. Ja, er war noch viel beredter als ihre Worte.
»Wir könnten in den Garten gehen«, schlug ich vor. »Wenn er geöffnet ist.«
»Er ist schon geöffnet«, antwortete Les. »Soll ich euch die Drinks rausbringen?«
»Was für Drinks?«
»Na ja, du wirst bald Nachschub brauchen. Und für die Dame …?«
Win musterte ihn, dann wanderte ihr Blick über die Flaschen auf dem Tresen. Modische Sachen wie Nitrokegs und Alcopops waren ihr eindeutig ein Rätsel. »Einen kleinen Cider«, verkündete sie schließlich. »Nicht sprudelnd.«
Der Garten war insofern geöffnet, als die Tür, die ins Freie führte, nicht verschlossen war. Im Grunde war er nichts als ein vollgestellter Hinterhof mit Platz für zwei verrostete Tische, den in der Mitte eine Wäscheleine teilte, die von dem Gewicht eines halben Dutzend, zum Trocknen aufgehängter Deckchen durchhing.
»Könnte schlimmer sein«, kommentierte ich. »Wenigstens hat Les nicht ausgerechnet heute seine Unterhosen gewaschen.«
Win sah mich an, als spräche ich eine fremde Sprache, und machte keinerlei Anstalten, sich zu setzen. »Hast du was von Rupert gehört?«, fragte sie mich unvermittelt.
»Rupe? Nein, ich.« Rupert war ihr jüngster Bruder, ein Nachzügler – mehr als zwanzig Jahre lagen zwischen ihnen. Er war sogar ein paar Monate jünger als ich. In der Schule, an der Universität und während der Zeit, als wir beide in London gearbeitet hatten, waren wir Freunde gewesen. Aber in den letzten Jahren hatte ich ihn kaum noch gesehen. Unterschiedliche Karrieren sollten gute Freunde nicht trennen, und in manchen Fällen kommt es vielleicht wirklich nicht dazu. Bei uns war das aber der Fall. Während er immer weiter aufstieg, war es mit mir in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Und wie zum Beweis dafür stand ich nun zwischen Leergut in Les’ sogenanntem Biergarten, wohingegen Rupe… Hm, na ja, was war mit Rupe? »Ich hab schon lang nichts mehr von ihm gehört, Win.«
»Wie lange?«
»Könnten … zwei Jahre sein. Du weißt ja, wie …«
»Die Zeit vergeht im Flug, wenn man Spaß hat.« Les’ Letzte-Bestellungen-bevor-wir-schließen-Bariton dröhnte über den Hof und hallte von den Mauern wider.
»Danke, Les.«
»Soll ich diese Decken da abnehmen?«
»Nein.«
»Macht mir aber wirklich keine Mühe.«
»Nein!«
»Von mir aus. Wie es euch gefällt.« Er stolzierte theatralisch davon.
Ich setzte mich und schob einen Stuhl zu Win hinüber. Langsam ließ sie sich darauf nieder, oder zumindest auf der Kante, auf der sie unbequem sitzen blieb. Zwischen die Knie hatte sie ein Einkaufsnetz geklemmt, das ich bis dahin nicht bemerkt hatte. »Ich hatte gehofft, du wüsstest vielleicht was von ihm«, begann sie zögernd.
»Du etwa nicht?«
»Nein. Nicht mal indirekt.«
Was sie mit »indirekt« meinte, war mir nicht klar. Rupes Familie führte ein zurückgezogenes Leben und blieb stets für sich. Seine Mutter hatte noch gelebt, als ich sie kennengelernt hatte, sein Vater war schon lange tot. Penfrith, ihr baufälliges Zuhause in der Hopper Lane, am Fuß des Ivy-thorn Hill, am Rand des Ortes Street war einmal eine Farm gewesen, ehe sie der Tod des alten Alder zum Verkauf ihres Viehbestands – also ihrer Kühe – und der meisten Felder gezwungen hatte. Irgendwie sah es immer noch nach einer Farm aus; oder zumindest war es mir bei meinem letzten Besuch so vorgekommen. Rupe hatte sich damals schon längst aus dem Staub gemacht. Soweit ich das beurteilen konnte, war er zum letzten Mal 1995 bei der Beerdigung seiner Mutter in Street gewesen. Seitdem lebten Winifred, Mildred und ihr anderer Bruder, der arme alte, minder bemittelte Howard, allein auf Penfrith, ohne Arbeit und Bindungen zu irgendjemandem außerhalb der Familie, und hatten nicht einmal die Möglichkeit, mittels eines Telefons Kontakt zur Welt aufzunehmen. Die Wahrheit war, ich hatte keine Ahnung, wie Rupe mit ihnen in Verbindung blieb, doch das war allem Anschein nach der Fall. Es mussten wohl Briefe sein, aus London oder sonst woher, wohin ihn seine Karriere gerade verschlagen hatte.
»Das hätten wir aber eigentlich müssen, verstehst du. Wir hätten von ihm hören müssen.«
»Wie lange ist es her, dass … er sich zuletzt gemeldet hat?«
»Mehr als zwei Monate.«
»Habt ihr ihm geschrieben?«
»O ja, wir haben geschrieben. Allerdings ohne eine Antwort zu kriegen.«
»Telefon?« (Schließlich gab es so etwas wie Telefonzellen.)
»Dasselbe. Nichts. Außer Sein … du weißt schon, wie das heißt.«
»Anrufbeantworter.«
»Ja, so heißen die Dinger wohl.« Sie hielt inne, um Cider zu trinken, von dem sie etwa das halbe Glas hinunterkippte, um sich dann mit dem Handrücken den Mund abzuwischen. »Na ja, so kann es doch nicht weitergehen, findest du nicht auch?«
»Ich nehme an, dass er im Ausland ist. Ihr werdet sicher bald von ihm hören.«
»Irgendwas stimmt da nicht.«
»Das glaube ich nicht.«
»Jemand muss nach London fahren und es herausfinden.«
Jemand. Langsam erwies sich, dass Winifreds Marsch nach Glastonbury durchaus einen Sinn gehabt hatte, allerdings keinen, der mir gefiel. Ich versuchte, sie davon abzulenken. »Wann möchtest du denn hinfahren?«
»Ich? Nach London? Dort bin ich im ganzen Leben noch nie gewesen.«
»Noch nie?« Dumme Frage, wirklich. Glaubte ich im Ernst, Winifred Alder hätte jemals das große Smogloch besucht? Ein Ausflug der Sonntagsschule nach Weston-super-Mare war bestimmt der am weitesten entfernte Ort, zu dem sie bei ihren Reisen gekommen war. »Hm, das wird eine ganz neue Erfahrung für dich sein.«
»Wir möchten, dass du hinfährst.«
»Ach, komm schon, Win, ich kann doch nicht einfach …«
»Hier alles stehen und liegen lassen?«
»Er ist dein Bruder.«
»Er ist dein Freund.«
»Trotzdem.«
»Du willst nicht hinfahren?«
Ich zuckte die Schultern. »Ich sehe keinen zwingenden Grund. Es ist doch nicht so, als ob.«
»Es gibt einen zwingenden Grund.«
»Hör zu. Warum … wartest du nicht einfach noch ein bisschen?«
»Wir haben lange genug gewartet.«
»Ich sehe wirklich keinen Anlass zur Sorge.«
»Woher nimmst du deine Sicherheit?«
»Woher nimmst du deine?«
Win starrte mich finster an. Nach einem weiteren Schluck Cider stieß sie hervor: »Er hat dir das Leben gerettet.«
»Ja, das hat er.« Es stimmte. Andererseits hätte man mit der gleichen Berechtigung sagen können, dass er es auch in Gefahr gebracht hatte. Dennoch ließ sich an den Tatsachen nicht rütteln. Wäre Rupert Alder nicht gewesen, hätte ich meinen gegenwärtigen Beitrag zum erhabenen Kampf der Menschheit nicht leisten können. »Aber sein Leben ist doch nicht in Gefahr.«
»Vielleicht doch.«
»Es besteht kein Grund, so etwas anzunehmen.«
»Lancelot.«
Es macht mir nichts aus, zuzugeben, dass es mich aus dem Konzept brachte, meinen vollen Namen zu hören. Jeder kannte mich als Lance. Und so ziemlich jeder ging davon aus, dass das auch mein Taufname war. Ich wünschte nur, sie hätten recht gehabt. Doch Winifred Alder wusste es natürlich besser, nur hielt sie eben nichts von Kurzformen. Zugegeben, ihre Schwester nannte sie Mil. Aber Mil war ein Sonderfall. Rupe hieß immer Rupert und ich offenbar immer Lancelot.
Sie beugte sich vor. »Er schickt uns Geld«, flüsterte sie. »Nur so halten wir uns über Wasser.«
»Bekommt ihr keine. Sozialhilfe?« Nein, wie ich ihrer leicht verächtlichen Miene entnahm, war das wohl nicht der Fall. Sie hätten das Almosen genannt. Und sie wollten nichts mit der Welt zu tun haben, nicht einmal mit ihrer Fürsorge.
Trotzdem mussten sie irgendwie leben. »Du musst nicht darüber reden, Win.«
»Damit hat er aufgehört.«
»Aufgehört?«
»Seit Ende August ist nichts mehr gekommen.«
»Ich verstehe.«
»Das würde er uns nie antun.«
»Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen.«
»Fährst du hin?« Sie sah mich mit, wie ich glaube, flehenden Augen an. »Ich würde das als einen großen Freundschaftsdienst auffassen, Lancelot.«
»Hast du schon mit den Leuten gesprochen, für die er arbeitet?«
»Sie sagen, dass er gegangen ist. ›Hat die Firma verlassen‹. Mehr war nicht aus ihnen herauszubekommen. Und es hat mich eine ganze Hand voll Münzen gekostet, bis ich das bisschen erfahren habe. Bei meinen meisten Anrufen haben sie mir einfach … Musik vorgespielt.«
Auf einmal bekam ich Mitleid mit ihr. Ich sah sie förmlich vor mir, wie sie in einer Telefonzelle in der Handtasche nach Münzen wühlte und gleichzeitig versuchte, aus der computergesteuerten Anlage, an die sie geraten war, schlau zu werden. »Ich rufe dort an«, versprach ich. »Mal sehen, was ich herausfinden kann.«
»Du wirst persönlich mit ihnen sprechen müssen. Anders geht es nicht.«
»Ich rufe an, Win. Gleich heute Nachmittag. Abspeisen lasse ich mich von denen nicht, das garantiere ich dir. Und wenn das nicht klappt.«
»Fährst du hin?«
»Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird.«
»Doch. Etwas stimmt nicht, das weiß ich.«
»Warten wir’s ab.«
»Heute Nachmittag, sagst du?«
»Ganz bestimmt.«
»Wenn du nicht zu viel von diesem … Lager … trinkst und dann alles vergisst.«
»Das werde ich nicht.« Ich grinste sie verlegen an. »Es vergessen, meine ich.«
»Ich musste wegen deiner Anschrift zu deinen Eltern gehen.« Diese Bemerkung bedeutete einen Übergang zu beinahe leichter Konversation. »Es scheint ihnen gut zu gehen.«
»Ach, Mum und Dad halten sich recht fit.«
»Dein Vater hat mich gebeten, dir Grüße auszurichten.«
»Wirklich?«
»Das kam mir merkwürdig vor. Ich meine, du musst sie doch häufig sehen, da du ja in der Nähe wohnst.«
»Das ist nur sein Sinn für Humor.« Ich zwang mich zu einem Grinsen. »Von ihm hab ich den meinen geerbt.«
Der Tag ließ sich eindeutig nicht so an, wie ich es erwartet hatte. Und er sollte eine weitere unwillkommene Wendung nehmen.
Ich begleitete Win noch zur Bushaltestelle. Nach dem Abschied kehrte ich schnurstracks ins Wheatsheaf zurück, wo mich ein hämisches Funkeln in Les’ Augen schon vor neuem Ungemach warnte.
»Lancelot, hm?«
»Was?«
»Lance als Kurzform von Lancelot. Darauf wäre ich nie gekommen.«
Ich holte tief Luft. »Wir sind zu einem vertraulichen Gespräch in den Garten gegangen.«
»Ich wollte gerade im Damenklo die Seife überprüfen. Nur für den Fall, dass deine Bekannte sich die Nase pudern möchte. Und weil das Fenster zufällig offen stand.«
»Wie lange hat das Überprüfen der Seife denn gedauert?«
»Ich habe gründlich gearbeitet.«
»Selbstverständlich.«
»Na ja, wie du gesagt hast, dein Vater hat Sinn für Humor. Lancelot ist der schlagende Beweis, würde ich sagen.«
»Ach ja?«
»Wer ist eigentlich dieser Rupe?« Für den klassischen Kneipenwirt fehlte es Les an der Leibesfülle eines Falstaff, dafür stürzte er sich umso lieber in den anderen Teil seiner Rolle, den des fürsorglichen Beichtvaters. »Ich hab dich nie von ihm reden hören.«
»Ein Freund von mir. Ich habe nämlich welche, weißt du.«
»Schade, dass du sie nicht mitbringst. Wie ist er denn mit der Frau im Regenmantel verwandt?«
»Bruder. Er und ich sind in Street zusammen zur Schule gegangen.«
»In die Millfield, richtig?«
»Wir sind in Street geboren und aufgewachsen, Les. Wie alle anderen sind wir in die Crispin gegangen.«
»Wie kommt es, dass er dir das Leben gerettet hat?«
»Das war ein Unfall während einer Höhlenwanderung.«
»Du machst Höhlenwanderungen?«
»Es ist lange her.«
»Was ist geschehen?«
»Ist das so wichtig?«
»Hintergrundwissen zu meinen Stammgästen ist immer wertvoll.«
»Das sehe ich nicht so.« Gleichwohl war mir bereits klar, dass er keine Ruhe geben würde, bis er mir die ganze Geschichte aus der Nase gezogen hatte.
Im Sommer 1985 hatte Rupe mich dazu überredet, ihn bei einer Höhlenexkursion in den Mendips zu begleiten. Er war Mitglied eines Höhlengängerclubs, allerdings ohne große Lust auf Gruppenwanderungen. Viel lieber zog er allein los, was, wie er mir versicherte, bei weitem nicht so gefährlich war, wie es klang. Um ein Vielfaches riskanter erschien es mir dagegen, sobald wir uns unter Tage befanden. Und als ich dann auch noch zwei Siphons bewältigen musste – kurze überflutete Strecken, wo die Luft zwischen der Wasseroberfläche und der Decke zum Atmen reichte –, war ich in heller Panik, lange bevor Rupe die Anzeichen für ein Ansteigen des Wassers bemerkte, das vermutlich durch starke Regenfälle draußen im Freien ausgelöst worden war. Erst jetzt verriet er mir, dass im Wetterbericht von der »Möglichkeit« heftiger Schauer die Rede gewesen war. Wir kehrten sofort um, obwohl Rupe meinte, es wäre wahrscheinlich sicherer, auf einer höher gelegenen Stelle einfach abzuwarten, bis sich die Flut zurückzog. Natürlich gefiel mir das ganz und gar nicht; vielmehr zog es mich mit aller Macht unter den freien Himmel. So hasteten wir zurück, wobei es mir nicht schnell genug gehen konnte.
Das war mein Verhängnis. Rupe hatte die ganze Ausrüstung – Seile, Geschirr, Lampen, Karabiner – und wusste damit umzugehen. Hätte ich seine Anweisungen befolgt, wäre nie etwas passiert. Aber ich war unterkühlt, durchnässt und verängstigt – vor allem verängstigt. Ich wollte nichts wie raus. Und raus bedeutete einen mehr oder weniger senkrechten Abhang mit Hilfe einer Strickleiter hinaufzuklettern. Rupe ging voran. Er hatte das Seil, mit dem er mich sichern wollte, noch nicht ganz herabgelassen, als ich mich schon an den Aufstieg machte. Auf halbem Weg rutschte ich aus.
»Und dann?« Les’ Nachfragen wiederholten sich bei diesem Abschnitt meiner Geschichte immer öfter.
»Ich bin gestürzt.«
»Wie tief?«
»Tief genug. Weil ich es nicht hatte erwarten können, bot das Seil überreichlich Spielraum, und ich bin auf den Felsboden gekracht.« Les schnappte nach Luft. »Hab mir einen Knöchel gebrochen, und mehrere Rippen. Nicht zu empfehlen.«
»Schmerzen?«
»Schlimmer als ein Kater von deinem roten Hauswein.«
Les ignorierte meine Spöttelei. Offenbar war er zu gespannt, um sie überhaupt zu bemerken. »Hat Rupe Hilfe geholt?«
Ich grinste. »Nicht sofort.«
»Warum nicht, zum Henker?«
»Die Überschwemmung. Ihm war klar, dass ich dort, wo ich lag, längst ertrunken wäre, ehe er mich mit einem Bergungstrupp erreicht hätte.«
»Was hat er also gemacht?«
»Mich zu einer höher gelegenen Stelle hochgezogen.«
»Das war bestimmt nicht leicht.«
»Nein, aber er hat es getan. Die meiste Zeit war ich nicht mehr als ein totes Gewicht, aber wir haben es geschafft. Oben hat er mich in einen Biwaksack gesteckt und gewartet, bis das Wasser nicht mehr stieg; dann hat er noch ein bisschen länger gewartet, bis es wieder etwas gesunken war, ehe er Hilfe holen gegangen ist. Die Siphons waren da natürlich immer noch überflutet, und zwar bis zur Decke und jeweils über ziemlich lange Strecken. Da konnte man beim Durchtauchen schon Angst kriegen. Die Rettungsmannschaft hatte Sauerstoffgeräte dabei, als sie mich bergen kamen. Rupe hatte sich auf nichts als sein Urteilsvermögen verlassen. Zu meinem Glück hatte er einen guten Riecher.«
»Du hättest allerdings genauso gut Pech haben können.«
»Stimmt vollkommen. Das ist der Grund, warum ich seitdem nie wieder unter der Erde gewesen bin. Nicht einmal mit der U-Bahn fahre ich.«
»Du machst Witze!«
»Nein. Als ich in London lebte, war der Bus immer gerade gut genug für mich. Selbst in deinem Keller würde ich mich unbehaglich fühlen.«
»Kein Grund zur Sorge.« Les hatte plötzlich ein ernstes Gesicht aufgesetzt. »Da lasse ich dich nie runter.«
Les bedrängte mich, für den Anruf bei Rupes Arbeitgeber sein Telefon zu benutzen. Mittlerweile brannte er noch mehr darauf als ich, zu erfahren, was los war. Ich erklärte (was zufällig sogar stimmte), dass ich die Nummern, die ich brauchte, nicht dabei hatte. So kehrte ich in meine Wohnung zurück, um sie hervorzukramen, und beschloss, mich kurz aufs Ohr zu legen, woraus ein fester Schlummer von über einer Stunde wurde. Unerwartete Heimsuchungen und traumatische Erinnerungen können einem ganz schön zusetzen. Schließlich, so gegen halb fünf, erledigte ich die Anrufe.
Ich bekam dasselbe zu hören wie Win: den Anrufbeantworter bei Rupes Nummer und höflich formuliertes, doch in keinster Weise hilfreiches Blabla von der Personalabteilung der Eurybia Shipping Company. »Mr Alder ist nicht mehr für uns tätig.« Wie lange denn schon? »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.« Wo arbeitete er jetzt? »Das wurde uns leider nicht mitgeteilt.« Wie konnten wir ihn finden? »Das weiß ich leider nicht.« Danke für nichts. »Gern geschehen. Danke für Ihren Anruf.«
Fehlanzeige. Doch im Gegensatz zu Win hatte ich Quellen, die ich anzapfen konnte. (Sonst wäre die Lage wirklich verzweifelt gewesen.) Simon Yardley war zusammen mit Rupe und mir in Durham gewesen und war jetzt eine große Nummer – oder zumindest eine gut bezahlte – in einer Handelsbank. Zu dritt waren wir später gelegentlich in London auf einen Drink gegangen, als wir alle dort Arbeit gefunden hatten. Darum war ich mir ziemlich sicher, dass Rupe und er ihre Kneipenbummel auch dann noch fortgesetzt hatten, als ich von der Bildfläche verschwunden war. Da ich immer noch Simons Telefonnummer hatte, rief ich bei ihm an. Freilich war es zu früh, um einen Handelsbanker zu Hause anzutreffen, doch sein Anrufbeantworter regte an, es mit seiner Handynummer zu versuchen. Anders als Rupe wollte Simon nicht schwer zu erreichen sein. Und er war es tatsächlich nicht.
»Hi.«
»Simon, ich bin’s, Lance Bradley.«
»Wer?«
»Lance Bradley.«
»Ach, Lance. Das ist aber … Wie geht’s dir?«
»Gut. Und dir?«
»Noch nie so gut wie jetzt. Hatte aber auch noch nie so viel Stress. Hör mal, könnten wir vielleicht ein andermal miteinander sprechen? Ich bin wirklich …«
»Es ist wegen Rupe, Simon. Rupert Alder. Irgendwie kann ich ihn einfach nicht erreichen.«
»Hast du denn seine Nummer nicht?«
»Er geht nie ran.«
»Versuch’s mit seinem Büro. Bei der Eurybia Shipping.«
»Dort ist er nicht mehr.«
»Wirklich?«
»Hast du eine Handynummer von ihm?«
»Ich glaube, nein. Er hat bei Eurybia gekündigt, sagst du? Dabei hat er nie angedeutet, dass er weg will.«
»Hast du ihn denn in letzter Zeit gesehen?«
»Eigentlich nein. Nichts, was erwähnenswert wäre. Tut mir Leid, Lance, aber ich habe keinen blassen Schimmer.
Und jetzt muss ich springen – das heißt, nur im metaphorischen Sinn. Melde dich bei mir, wenn du das nächste Mal in der Stadt bist. Ciao.«
Ciao? Das war ein Neuzugang in Simons Vokabular und ging mir nicht unbedingt leicht ins Ohr. Merkwürdig, wie selbstverständlich er davon ausgegangen war, dass ich nicht in London war. Natürlich hatte er recht, dieser Scheißkerl. Aber vielleicht bald nicht mehr. Win würde nicht damit aufhören, mein Gewissen zu piesacken, bis ich mehr vorweisen konnte als nur ein paar vergebliche Telefonate.
Aber mussten sie denn vergeblich bleiben? Ich wählte noch einmal Rupes Nummer und hinterließ eine Nachricht mit der Bitte, wegen einer dringenden Angelegenheit zurückzurufen. Ich gab ihm sogar die Nummer des Wheat-sheaf, damit er es zur Not dort versuchen konnte. Meine Überlegungen gingen dahin, dass es ihm vielleicht aus irgendeinem wichtigen Grund widerstrebte, mit seiner Familie zu sprechen. Womöglich war ihm bei Eurybia gekündigt worden. Damit wäre erklärt, warum die Zahlungen versiegt waren. Aber mit mir würde er doch ohne Probleme reden können. Mir schuldete er ja nichts. Wenn ich mich nicht täuschte, würde er sich bald melden.
Er meldete sich nicht.
Kapitel 2
Hinsichtlich des Zufalls bin ich mir noch nie allzu sicher gewesen. Im besten Fall ist er eine schlüpfrige Angelegenheit. Aus diesem Grund setze ich auf Pferde, nicht auf die Lotterie. Mir gefällt die Vorstellung, dass ich dank meines Verstands zu einem Vermögen kommen kann. Was man durch reinen Zufall gewinnen kann, kann man genauso leicht verlieren.
Ein Beispiel dafür ist mein stressfreies, aber weit von Wohlstand entferntes Dasein in Glastonbury. Nachdem ich in der Rezession der frühen neunziger Jahre einen guten Job, eine wunderbare Frau und ein hoffnungslos mit Hypotheken belastetes Haus verloren hatte, zog ich als Notlösung wieder bei meinen Eltern in Street ein. Dann lernte ich Ria kennen, und statt meine Fühler erneut nach London auszustrecken, lebte ich plötzlich mit ihr in einer Wohnung in der High Street von Glastonbury und half ihr, im Secret Valley, ihrem New-Age-Laden, Räucherstäbchen und keltische Amulette zu verkaufen. Dann verließ Ria den Laden und mich und verzog sich mit einem keltischen Magier der menschlichen Art namens Dermot nach Irland, aus dem Secret Valley wurde das Tiffin Café, und ich … blieb, wo ich war.
Angesichts einer solchen Fülle von Indizien entging meinem analytischen Verstand natürlich keineswegs, dass ein kurzer Abstecher nach London auf der Suche nach einem verschollenen Freund sich zu einem Geflecht von Komplikationen entwickeln konnte. Für wahrscheinlich hielt ich das zwar nicht, aber ich war mir dieser Möglichkeit durchaus bewusst. Und ich kann nicht leugnen, dass sie einen gewissen Reiz ausübte. Die Frage war nur: Wollte ich eine Veränderung so sehr, wie ich sie eigentlich nötig hatte?
Die Antwort war mir immer noch völlig unklar, als ich am folgenden Nachmittag den Bus nach Street nahm, um Win zu melden, dass ich nichts ausgerichtet hatte. (Die Eigentümerschaft eines Wagens war mit noch weniger Zeremoniell aus meinem Leben geglitten als kurz davor Ria.)
Glastonbury ist mit Jahrhunderte alter Geschichte und Legenden erfüllt. Das weiß hier jeder und keiner besser als ich, was ich einem Vater verdanke, der derart von den König-Arthur-Mythen durchdrungen war, dass er darauf bestanden hatte, mir die Namen Arthur und Gawain aufzubürden, die ich jetzt bis ins Grab mitschleppen muss. (Meine Mutter hatte den Namen meiner Schwester aussuchen dürfen, die das Glück hatte, mit einem schlichten Diane Patricia davonzukommen.) Die kurze Busfahrt führte mich vorbei am Wearyall Hill, wo Joseph von Arimathea gelandet sein soll (der größte Teil von Somerset lag damals unter Wasser), und über die Pomparles Bridge, an deren Stelle einst die ursprüngliche Pons Perilis stand, auf der der sterbende Arthur laut der Sage Bedivere befohlen hat, sein Excalibur in den See zu schleudern. (Ich selbst habe mich immer auf Bediveres Seite geschlagen. Angesichts der düsteren Schatten des Dunklen Zeitalters und des bevorstehenden Zusammenbruchs der Eisenhütten ergab es allerdings überhaupt keinen Sinn, ein solch prächtiges Meisterwerk der Schwertschmiedekunst wie Excalibur einfach wegzuwerfen.)
Im Gegensatz dazu herrscht in Street ein deutlicher Mangel an Legenden. Als strenge Quäker kümmerten sich die Clarks um praktischere Dinge. Und Schuhe sind so ziemlich das Praktischste, womit man sich befassen kann. Zumindest sind das die Clarks-Schuhe seit jeher gewesen. Mein Vater hat beinahe fünfzig Jahre lang für Clarks gearbeitet. Und mit ihm die meisten Männer seiner Generation sowie die Hälfte der weiblichen Bevölkerung. All das änderte sich um die Zeit, in der ich aus London zurückkam, als die Produktion nach Portugal verlagert und die Fabrik durch ein Einkaufszentrum für »berühmte Marken zu Herstellerpreisen« ersetzt wurde. Dort entstanden natürlich auch Arbeitsplätze, aber nicht für Leute wie Winifred und Mildred Alder oder deren geistig zurückgebliebenen Bruder Howard. Ich hatte angenommen, sie hätten seitdem von staatlicher Fürsorge gelebt. Doch jetzt sah es ganz so aus, als hätte Rupe sie über Wasser gehalten, was ihm freilich nicht immer leicht gefallen sein kann, wie bescheiden sie auch leben mochten.
Wie sie eigentlich lebten, sollte ich bald erfahren. Aber vorher musste ich mir einen Weg durch einen Wust von banalen Fragmenten aus meiner eigenen Vergangenheit bahnen. Gegenüber dem Möbelgeschäft Living Home, dessen Mauern mir vertrauter gewesen waren, als sie noch die Grundschule von Street beherbergt hatten, bog ich von der High Street in südlicher Richtung ab. Bald erreichte ich die Ivythorn Road, in der ich 1963 in einem Hinterhof in der Gaston Close 8 das Licht der Welt erblickt hatte. Damals hatten im Westen der Stadt größtenteils Gärten und Felder gelegen, und Penfrith war Ackerland gewesen. Mittlerweile war die Stadt darüber hinweggekrochen. Meine Eltern waren in den siebziger Jahren in einem dieser Neubauviertel in einen Bungalow gezogen. Doch die Alders hatten der Zeit getrotzt. Sie waren geblieben, wo sie immer gewesen waren, während sich die Welt um sie herum veränderte.
Die Hopper Lane glich immer noch einem Feldweg. In dem Teil, der in die Somerton Road mündete, standen moderne Häuser, aber weiter unten wurden sie von verwilderten Obstgärten, mit Unkraut überwachsenen Grundstücken und verfallenen Häuschen gesäumt. Der Nachmittag schien immer feuchter und trüber zu werden, je weiter ich vordrang, und in der Luft mischten sich die Gerüche faulender Äpfel, vermodernden Laubs und herantreibender Rauchschwaden von Kartoffelfeuern. Penfrith selbst sah zunächst gar nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch das lag daran, dass das Haus hinter einem wild wuchernden Rhododendronwald so gut wie nicht auszumachen war. Logischerweise mussten das dieselben Pflanzen sein, die ich noch als junge Büsche in Erinnerung hatte, und es fiel mir schwer, diese Tatsache nicht aus den Augen zu verlieren.
Wäre Penfrith in seinem gegenwärtigen Zustand zum Verkauf angeboten worden, hätte ich vorgeschlagen, es ohne Foto zu inserieren. Ansonsten hätte man JEDES ANGEBOT WIRD ANGENOMMEN darunter schreiben müssen. Vom Dach fehlten genügend Schindeln, um es bei Regen in ein Sieb zu verwandeln, und der First hing bedenklich durch. Die Fensterrahmen wiesen mehr nacktes Holz als Farbe auf, und einige Scheiben hatten Sprünge. Dahinter hingen verloren und schlaff ausgebleichte Lumpen, die vor langer Zeit einmal Vorhänge gewesen sein mochten.
Vor der Haustür musste ich einem Rhododendronzweig ausweichen, dann drückte ich versuchsweise auf die Klingel. Sie funktionierte nicht – wirklich kein Wunder –, sodass ich stattdessen mehrmals kräftig den Klopfer betätigte. Das brachte mir eine vom Rost rote Handfläche ein, die erst mal abgewischt werden musste. In der nun wieder einsetzenden Stille vergingen mehrere Sekunden. Eigentlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass niemand zu Hause war. Gerade wollte ich wieder zum Klopfer greifen, als mich das klamme Gefühl beschlich, beobachtet zu werden. Ich drehte mich nach rechts und machte vor Schreck einen Satz nach hinten. Durch das Erkerfenster starrte mich stumm Howard Alder an.
»Verfluchte Scheiße, Howard!«, rief ich. »Musst du mich derart erschrecken?« Er schien mich nicht zu hören, und es war klar zu erkennen, dass sein Begriffsvermögen sich nicht gebessert hatte, seit ich ihn zuletzt gesehen hatte. Wie Win gereichten Howard die Jahre – in seinem Fall ungefähr fünfzig – nicht unbedingt zum Vorteil. Er war unrasiert, die Haare, die er noch hatte, fielen ihm grau und strähnig auf die Schultern. Bekleidet war er mit einer verfilzten grauen
Strickjacke über einem schmutzigen Sweatshirt mit der Aufschrift Durham University (wohl ein Geschenk von Rupe) und einer, soweit ich das über das Fensterbrett hinweg beurteilen konnte, abgetragenen rosa und weiß gestreiften Schlafanzughose. Die neue Herbstmode für Herren war das eindeutig nicht. »Willst du mich nicht reinlassen?«
Howard beschrieb mit der Hand eine Kreisbewegung, die eine Bedeutung haben musste. Die Tür war nicht verriegelt. Ich drehte am Knauf, zeigte Howard meinen nach oben gereckten Daumen und trat ein.
Mein erster Eindruck war, dass sich an dem Haus, so wie ich es in Erinnerung hatte, nichts verändert hatte. Ein schmaler Flur führte zur Treppe. An einer Wand hing ein riesiges uraltes Barometer, gegenüber stellte ein antikes Möbelstück Spiegel, Kleiderhaken und Schirmständer dar. Der Teppich und die Tapete waren sicher noch dieselben wie damals. Erst jetzt stieg mir der modrige Geruch in die Nase. Tatsächlich: Nichts hatte sich geändert, sieht man einmal davon ab, dass Verfall Veränderung bedeutet. Und genau das fand auf Penfrith statt: ein sich allmählich beschleunigender Verfall.
Ich ging ins Wohnzimmer und traf auf noch mehr, was unverändert geblieben war: der Läufer vor dem Kamin; die dreiteilige Sitzgarnitur; der Schreibtisch; die Uhr auf dem Kaminsims; der schief in seinem Rahmen hängende Abdruck eines Gemäldes von Constable; der museumsreife Fernseher in der Ecke, dessen Gehäuse weitaus tiefer war als der Bildschirm breit – all das vergammelte an dem ihm zugewiesenen Platz. Und Staub hatte sich darauf gelegt, höllisch viel Staub. Mrs Alder hatte vielleicht kein neues, aber doch ein sauberes Haus geführt; ihre Kinder dagegen waren sichtlich anderer Meinung. Unwillkürlich fragte ich mich, ob Howards Haar vielleicht grauer war, als es sein müsste.
Über seinen abgewetzten karierten Hausschuhen mit Löchern an den Zehen trug er tatsächlich eine Schlafanzughose. Noch immer stand er vor dem Erkerfenster und versuchte zu lächeln, auch wenn man sich bei Howard diesbezüglich nie sicher sein konnte. Neben ihm lag auf einem Tisch, der früher als Ständer für eine Aspidistra gedient hatte (und die immerhin war verschwunden), ein Stoß Zeitschriften. Beim Näherkommen erkannte ich, dass sie seinen treuesten und so ziemlich einzigen Lesestoff darstellten: Railway World. Natürlich keine neue Auflage, sondern abgegriffene Ausgaben aus Howards Tagen als Fan von Lokomotiven in den sechziger Jahren, bevor Beeching die Somerset-Dorset-Linie stillgelegt hatte. Laut Rupe (der es von seinen Schwestern gehört haben musste) war Howard über das Ende der S & D – den Abriss der Gleise, die Verschrottung der Lokomotiven, den Raub der geliebten Eisenbahn aus seinem Leben – nie hinweggekommen. So wie es aussah, versuchte er noch immer, jene verlorene Welt der Zwei-Sechs-Zwei und der Null-Sechs-Null, die damals durch das Sumpfgebiet um Glastonbury zum Meer gestampft waren, zurückzuholen. Ob er heute auch nur ein Wort seiner Jugendlektüre verstand, war freilich mehr als fraglich. Denn Howard gab meines Wissens seit Ewigkeiten nichts mehr von sich – das soll heißen, Wörter, die sich deutlich von irgendwelchen Lauten unterschieden –, und zwar seit August 1977.
Das war der Sommer gewesen, in dem ihn die völlige geistige Umnachtung ereilt hatte. Damals hatte er noch so etwas wie einen Job bei Clarks. Rupe und ich radelten als Dreizehnjährige eifrig durch die Moore zu Angelexpeditionen, während Howard auf seinem Moped weitere Fahrten unternahm. Und in seiner Vorstellung … Na gut, wer weiß schon, wie er auf die Schnapsidee gekommen war (vielleicht durch einen Leserbrief in der Railway World?), dass es im Verzeichnis der in den Sechzigern verschrotteten Dampflokomotiven eine geheimnisvolle Lücke gebe und dass die Regierung für den Fall einer Ölknappheit oder sonstigen Katastrophe eine strategische Reserve angelegt habe. (Laut Rupe wies das Verzeichnis tatsächlich eine Lücke auf; schon als Dreizehnjähriger hatte er eine Schwäche für Verschwörungstheorien.) Wie auch immer, unter den Eisenbahnliebhabern ging das Gerücht, dass diese verschollenen Loks in einer riesigen Höhle unter dem Box Hill in Wiltshire verborgen würden, wo die Bristol-London-Verbindung nahe an einem Luftwaffenstützpunkt vorbeiführt. Von da an unternahm Howard jede Nacht auf der Suche nach Hinweisen weite Touren. Die Spinnerei eines Verrückten, könnte man sagen. Vielleicht habe ich sogar genau solche Äußerungen von mir gegeben, doch das Scherzen verging uns, als Howard nach einem Sturz in einen Entlüftungsschacht schwer verwundet in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dass ihn das nicht das Leben gekostet hatte, war pures Glück, sofern man einen dauerhaften Hirnschaden als Glück bezeichnen kann. Wie er in diesen Schacht geraten ist, werden wir nie erfahren. Selbst wenn er sich hätte erinnern können, was unwahrscheinlich ist, wäre er nicht in der Lage gewesen, mit jemandem darüber zu reden. Seine Lippen waren versiegelt. (Offenbar war er in dieser Nacht außerdem von einem Hund gebissen worden – darauf wies eine hässliche Wunde hin, die sich deutlich von seinen vielen anderen Verletzungen unterschied. Ein Wachhund, wie Rupert vermutete. Aber es war ja klar, dass er auf so etwas kommen musste. Ich selbst neigte eher zu der Annahme, dass Howard zu den Zeitgenossen gehörte, von denen jeder Hund, der auf seine Würde hielt, ein Stückchen erbeutete.)
»Howard, ich bin’s, Lance«, sagte ich und lächelte ihn an. »Erinnerst du dich?«
Er nickte heftig und gab ein saugendes Geräusch von sich. Ich glaube, er erkannte mich wirklich.
»Wo sind deine Schwestern?«
Er nickte noch heftiger und deutete zum hinteren Teil des Hauses, ahmte Schaufelbewegungen nach und stieß, begleitet von jeder Menge Speichel, ein Lachen aus.
»Im Garten? Danke. Ich werd’s mal dort versuchen.«
Ich überließ ihn der Railway World, durchquerte den Flur und strebte zur Küche. Keine glückliche Wahl der Route, wenn man eine empfindliche Nase besaß. In ungewaschenen Pfannen und verschmierten Schränken schienen alle möglichen Dinge zu verfaulen. Sorgfältig einen Blick auf die Spüle vermeidend, hastete ich zur Vorratskammer und durch die Hintertür ins Freie.
Der Küchengarten war nicht so verwahrlost wie das Grün vor dem Haus. Zwar wucherten die Hecken, die ihn begrenzten, wild drauflos, und das Gras unter den Obstbäumen stand hüfthoch, doch die Gemüsebeete selbst wurden durchaus gehegt und gepflegt. Und dort war auch Mildred Alder und riss voller Energie Möhren und Kartoffeln aus der Erde. Sie war ihrer Schwester auffallend ähnlich, nur hatte sie nicht deren gerade Haltung. Als sie mich bemerkte, nahmen ihre Augen einen panischen Ausdruck an, den es bei Win nie gegeben hätte, und sie hörte sofort auf zu graben. Mil trug einen von Lehm verdreckten, marineblauen Overall und Gummistiefel. Während sie gegen den Stiel ihrer Gabel gelehnt dastand und mich anstarrte, bildete ihr Atem in der kalten Luft Kondenswolken. Auch wenn sie nichts sagte, war ich mir sicher, dass sie mich erkannt hatte. Abgesehen davon konnte mein Besuch wohl kaum völlig überraschend kommen.
Ich trat näher auf sie zu. »Hallo, Mil.«
»Lance«, sagte sie stirnrunzelnd, womit sie mich von der Vorliebe ihrer Schwester für Lancelot verschonte. »Ich hatte gar nicht mit dir gerechnet.«
»Tja, jetzt bin ich da.«
»Was hast du uns zu berichten?«
»Eigentlich nichts. Ich kann Rupe nirgendwo erreichen.«
»Hatte nichts anderes erwartet.«
»Kein Vertrauen zu mir, Mil?«
»So hab ich das nicht gemeint.« Sie wirkte etwas durcheinander. Vielleicht war ihr wettergegerbtes Gesicht sogar rot angelaufen. »Schau, da kommt Win.«
Von den Obstbäumen näherte sich ihre Schwester mit einem Eimer voller Äpfel. Wie Mil trug sie Gummistiefel und darüber den Rock und den Pullover, in denen ich sie am Tag zuvor gesehen hatte. (Kleiderschränke gehörten auf Penfrith nicht unbedingt zu den wichtigsten Möbelstücken.) »Was hast du ausgerichtet?«, rief sie, noch während sie um das Kartoffelfeld herum auf uns zulief.
»Nichts«, brummte ich. »Ich hab eine Niete gezogen.«
»Das dachte ich mir schon.«
»Ich weiß, ich weiß. Das hast du mir ja gesagt.«
Win blieb neben ihrer Schwester stehen und knallte den Eimer auf die Erde. Dann fixierte sie mich mit ihrem durchdringenden Blick. »Schön, dass du gekommen bist, um es uns zu sagen, Lancelot.«
»Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
»Und mehr hast du nicht vor?«
»Doch. Ich denke, ich fahre nach London und schaue selbst nach, was los ist – wenn was los ist.«
»Es ist was los.«
»Na ja, ich werde es rausfinden. Morgen breche ich auf.«
»Das ist nett von dir. Wir sind dir dankbar, nicht wahr, Mil?«
»O ja«, nickte Mil. »Das ist furchtbar nett von dir, Lance.«
»Er ist doch nicht umgezogen, oder? Die Adresse, die er mir gegeben hat, ist in der Hardrada Road.« (Bei meinem letzten Besuch hatte er in einer Wohnung im Londoner Stadtteil Swiss Cottage gelebt. Danach hatte er sich südlich der Themse niedergelassen.)
»Hardrada Road zwölf«, bestätigte Win. »Stimmt.«
»Und wann genau habt ihr zuletzt von ihm gehört?«
»Kommt darauf an, was du darunter verstehst.«
»Na ja, ein Brief, zum Beispiel.«
»Wir bekommen keine Briefe«, erklärte Mil.
»Nicht von Rupert«, ergänzte Win. »Er schreibt nie. Von ihm kommt nur immer … Geld.«
»Und wie schickt er es?«
»Direkt auf die Bank. Aber das kommt jetzt auch nicht mehr … seit Ende August.«
»Hm. Und wann habt ihr zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Gesprochen?«
»Ja, Win. Geredet.«
»Als Mutter gestorben ist«, murmelte Mil. »Seitdem nicht mehr.«
In diesem Moment wechselten die Schwestern einen Blick. Aber weil sich ihre Konversation im Laufe der Jahre auf eine eigene Kurzform eingeschliffen hatte, hegte ich erst gar nicht die Hoffnung, daraus schlau zu werden. Abgesehen davon gab es jetzt andere Dinge, die ich irgendwie klären musste. Seit dem Tod seiner Mutter hatte Rupe vor oder nach einem Besuch auf Penfrith zwei-, dreimal bei mir vorbeigeschaut. Zumindest hatte ich angenommen, dass er vor allem wegen seiner Geschwister in die Gegend gekommen war. Vielleicht hatte er sich sogar dahingehend geäußert, auch wenn ich das nicht beschwören konnte. Wenn nicht aus diesem Grund, warum war er dann gekommen? Sicher nicht, um mit mir ein paar Drinks zu kippen, das stand schon mal fest. Dieser Gedanke führte zu einem anderen: Was immer jetzt los war, wann hatte es damit angefangen?
»Rupert hat immer bis zum Hals in Arbeit gesteckt«, sagte Win, die anscheinend (und zu Recht) spürte, dass so etwas wie eine Erklärung angebracht war. Aber was sie mir anbot, half nicht weiter. »Wir erwarten ja gar nicht, ihn oft zu sehen.«
Doch das Geld, das er ihnen schickte, erwarteten sie sehr wohl. Ging es ihnen nur darum? Geld für den Unterhalt ihres mehr als bescheidenen Lebens? Ein bisschen Fleisch zu den Möhren und Kartoffeln?
»Wir machen uns Sorgen um ihn, Lancelot. Wirklich, wir sind sehr beunruhigt.«
»Hoffen wir, dass dazu kein Anlass besteht.«
»Gestern bist du dir noch ganz sicher gewesen, dass es nichts ist.«
»Und morgen werde ich mein Bestes geben, um es herauszufinden.« Ich sah von einer zur anderen. »Okay?«
Von Penfrith zum Haus meiner Eltern war es zu Fuß nicht mehr als eine Viertelstunde. Aber in anderer Hinsicht waren es mehr als hundert Jahre. Die Alders hausten in einem vergessenen Reservat aus dem neunzehnten Jahrhundert. Sie lebten nicht nur in einer anderen Zeit, sondern auch völlig abgekapselt. Mum und Dad dagegen wohnten im Schmucke-Häuschen-mit-Panoramafenster-Land des ausgehenden Zwanzigsten Jahrhunderts, wo der Rasen gepflegt, das Auto gewaschen, der Zaun gestrichen und der Anschein gewahrt wurde. Mein Vater las gern über die Vergangenheit, doch er hatte keinen Wunsch, in ihr zu leben.
»Deine Mutter ist nicht da«, lauteten seine ersten Worte beim Öffnen der Tür, womit er durchklingen ließ, ich sei nur ihretwegen gekommen. »Scrabble.«
»Das macht sie immer noch?«
»O ja, jeden Mittwochnachmittag.« Er stapfte in die Küche, und ich folgte ihm. Mir fiel auf, dass sein Rücken immer krummer wurde. All die Jahre, in denen er sich bei Clarks über Rechnungsbücher gebeugt hatte, verlangten ihren Tribut. »Ich wollte gerade Tee machen. Möchtest du eine Tasse?«
»Warum nicht?«
»Weil du ja vielleicht gerade keine willst.«
»Schön, zu hören, dass du immer noch alles wörtlich nimmst.«
»Wie sollte ich es denn sonst nehmen?«
»Ich hätte gern eine Tasse Tee, Dad, danke.«
»Solange du dir sicher bist.« Er legte den Schalter am elektrischen Wasserkessel um, und das Wasser begann sofort zu kochen. Offenbar war es schon heiß gewesen, und mein Vater hatte den Kessel ausgeschaltet, weil es geklingelt hatte. »Häng bitte noch einen Beutel in die Kanne. Die Dose ist hinter dir.«
»Ach, Teebeutel?« (Ich hatte diese elenden Dinger seit jeher gehasst. Um ehrlich zu sein, lag das allerdings mehr an der Gewohnheit meiner Mutter, sie nach Gebrauch als Dünger um ihre Blumen herum auszulegen, und nicht so sehr am Geschmack des Tees selbst.)
»Verstehst du jetzt, was ich gemeint habe?« Dad runzelte die Stirn. »Ich wusste gleich, dass es zwischen uns wieder losgehen würde.«
»Vergiss es. Ich nehme es, wie es kommt.« Ich zog einen Beutel aus der Dose und warf ihn in die Kanne.
Während Dad das Wasser darüber goss, musterte er mich durch den Dampf hindurch mit zusammengekniffenen Augen. »Diane hat gestern Abend angerufen.«
»Ach ja?«
»Brian ist befördert worden.«
»Das ist eine gute Nachricht.« (Und obendrein eine furchtbar vorhersehbare. Brian gehörte zu der Art von Musterschwiegersohn, die flach verpackt aus dem Versandgeschäft geliefert wurde.)
»Nicht wahr?«
»Habe ich das denn nicht gesagt?« (Himmel, wie erbärmlich diese Geplänkel waren, über die wir einfach nie hinauskamen!)
»Hast du denn welche? Gute Nachrichten, meine ich.«
»Eigentlich nicht. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten.«
»Was für einen?«
»Ich muss einen möglichst frühen Zug nach London nehmen.«
»Und jetzt soll dich jemand hinfahren.«
Ich grinste. »Genau.«
»Hast du zufällig ein Vorstellungsgespräch?«
»Nein.«
»Dachte ich’s mir doch. Ich meine, fürs Haareschneiden wäre es jetzt zu spät gewesen.«
»Stimmt. Gut beobachtet, Dad.«
»Wie früh?«
»Einfach nur früh. Ich habe mir gedacht, du kannst sicher ein paar Abfahrtszeiten im Internet rausfinden.«
»Schon möglich, dass ich das kann.« Er grinste über die Ironie, die er in seiner Antwort entdeckte. »Genau, das mache ich, während du den Tisch deckst. Ich esse zwei Kekse dazu.« Er ging in sein Büro.
Unterdessen kramte ich die Tassen und die Milch hervor und riss auf der Suche nach der Keksdose sechs Hängeschränke auf, ehe ich sie im siebten fand.
Zu guter Letzt trug ich alles ins Wohnzimmer. Dort lag auf dem Beistelltisch der Daily Telegraph, das Kreuzworträtsel war aufgeschlagen. Dad hatte es beinahe ganz gelöst, aber es sah so aus, als würden ihn die wenigen übrig gebliebenen Lücken ärgern. Ich hatte mich gerade darüber gebeugt, als er hereinkam. »Um zehn vor acht kommt ein Zug aus Castle Cary. Damit bist du um halb zehn in Paddington. Ist das früh genug?«
»Klingt gut.«
»Dann hole ich dich um Viertel nach sieben ab.«
»Danke.«
»Tja, der Wagen braucht mal wieder Auslauf. Und zurzeit wache ich ohnehin in aller Früh auf. Darum …« Er setzte sich und trank ein paar Schlucke Tee. »Das ist nicht wegen einer Arbeit, sagst du?«
»Nein.«
»Schade.«
»Ich tue jemandem einen Gefallen. Den Alders. Erinnerst du dich noch?«
»Wie könnte ich sie vergessen?«
»Sie sorgen sich um Rupe. Sie können ihn nicht erreichen. Er scheint … na ja, wie vom Erdboden verschluckt zu sein.«
»Und du willst ihn finden?«
»Das habe ich vor.«
»Wirklich?« Seiner skeptischen Miene nach zu urteilen bezweifelte Dad meine Befähigung dazu. »Hast du schon die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Rupert schlichtweg nichts mehr mit seiner Familie zu tun haben will? Übel nehmen könnte man ihm das wirklich nicht. Sie sind ein erbärmlicher Haufen. Noch erbärmlicher sogar, wenn man sich ihren Stammbaum vor Augen hält.«
»Was für ein Stammbaum ist das?«
»Ach, alles andere als ein guter. Aber immerhin haben sie auf Penfrith bereits im siebzehnten Jahrhundert Ackerbau betrieben.«
»Du hast bei den Alders Ahnenforschung angestellt?«
»Natürlich nicht.« Dads Miene verriet mir bereits, für wie grenzenlos dumm er diese Frage hielt. »Sie sind in einer historischen Quelle aufgetaucht, die ich letzthin studiert habe. Am Anfang des Bürgerkriegs hat es auf der anderen Seite des Ivory Hill ein Scharmützel gegeben. Wurde als das Gefecht von Marshall’s Elm bekannt. Dabei wurde ein Trupp des Parlaments von königstreuen Dragonern aufgerieben. Unter den Toten befand sich ein gewisser Josiah Alder aus Penfrith. Rein historisch stellt dieser Vorfall eine Kuriosität dar, weil als Beginn des Bürgerkriegs der zweiundzwanzigste August 1642 belegt ist, als der König seine Standarte in Nottingham aufzog. Doch das Gefecht von Marshall’s Elm war fast drei Wochen früher, nämlich am …« Er verstummte jäh und sah mich scharf an. »Hörst du überhaupt zu?«
»Doch, doch, Dad, ich bin ganz Ohr. Auf Penfrith haben schon 1642 Alders gelebt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es 2042 auch noch welche geben wird.«
»Wenn es so kommt, wird es daran liegen, dass sie damit aufgehört haben, auf dem Land, auf dem sie geboren wurden, Ackerbau zu betreiben. Wenn sie eine Berufung hatten, dann dazu. Und sie haben es aufgegeben.«
»Die Umstände waren eben dagegen.«
»Dass George Alder gestorben ist, ohne einen Sohn zu hinterlassen, der alt oder reif genug war, um den Hof zu übernehmen, meinst du?«
»Ja. Persönlich hast du ihn nie kennengelernt, oder?«
»Bestimmt nicht. Wir hätten mit keinem von ihnen Kontakt gehabt, wenn du dich nicht mit Rupert angefreundet hättest.«
»George Alder ist ertrunken, richtig?«
»Ich glaube, ja. In einem der Entwässerungskanäle. Richtig, im Sedgemoor Drain. Kann nicht lange nach Ruperts Geburt gewesen sein.«
»Davor, hat Rupe immer gesagt.«
»Du hast recht.« Dad knabberte nachdenklich an seinem Keks. »Es war tatsächlich davor gewesen, Sommer oder Herbst ’63. Komisch, dass ich das alles vergessen hatte.«
»Was alles?«
»Ach, um diese Zeit herum hat es noch mehr Todesfälle auf Bauernhöfen gegeben. Unfälle. Selbstmorde. Sachen dieser Art. Die Leute begannen schon davon zu reden, dass das Land verhext sei. Die Gazette war voll davon. Eine Weile zumindest.«
Wenn die Central Somerset Gazette von etwas voll war, hieß das noch lange nicht, dass es sich um weltbewegende Nachrichten handelte. Trotzdem war ich mehr als nur ein bisschen überrascht, dass ich bis dahin nie von einem Hexenbann über die Farmen von Street im Jahr ’63 gehört hatte. »Wie viele Todesfälle?«
»Ich weiß nicht mehr. Zwei oder drei vielleicht. Hm. Vielleicht lese ich das alles nächstes Mal in der Bibliothek nach. Ein interessantes Thema.«
»Könntest du es mich wissen lassen, wenn du was erfährst?«
»Klar.« Dad kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Ich dachte, die örtliche Geschichte würde dich zu Tode langweilen.«
»Das tut sie auch. Normalerweise.«
»Aber in diesem Fall nicht?«
»Das wird von deinen Ergebnissen abhängen.« Ich war weit neugieriger, als ich ihm zeigen wollte. Warum hatte Rupe mir gegenüber nie etwas davon erwähnt? Er liebte Geheimnisse, große und kleine. Und dieses schien sich um seinen eigenen Vater zu drehen. Nun, vielleicht wusste er darüber selbst nicht Bescheid. Aber dann wurde das Ganze nur noch rätselhafter. Ich würde eine Menge Fragen an Rupe haben, sobald ich ihn aufgetrieben hatte.
»Hexenzauber auf dem Land«, sinnierte Dad und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Oder ein Fluch.« Seine Augen nahmen einen abwesenden Ausdruck an, den ich von früher gut kannte. »Das hat Arthur’sche Dimensionen, findest du nicht auch?«
»Wenn du mich so fragst, nein.« (Für mich jedenfalls nicht. Das heißt, mit Arthur hatte ich nichts am Hut. Aber Dimensionen? Das ja. Ich hätte zugeben sollen, dass diese Sache jede Menge Dimensionen hatte.)
»Du wirst morgen doch nicht verschlafen, Junge?«
»Nein, Dad, bestimmt nicht.«
Und ich verschlief auch nicht.
LONDON
Kapitel 3
Der Zug fuhr mit halbstündiger Verspätung in Paddington ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund war, warum ich mich so niedergeschlagen fühlte, als ich durch den Bahnhof in einen Morgen hinausstapfte, der für den Herbst viel zu warm war, aber schon jede Menge Grautöne bot. Der frühe Aufbruch von Glastonbury hatte bestimmt nicht geholfen. Hinzu kam, dass ich noch nie ein Anhänger unserer nicht so schönen Hauptstadt gewesen bin. Der alte Spitzname der S & D-Linie von Somerset nach Dorset – schlampig und dreckig – trifft bis ins Letzte auch für London zu. Vor allem im Untergrund.
Nicht dass ich die Absicht gehabt hätte, in die Gedärme der U-Bahnlinie nach Bakerloo hinabzusteigen. Für mich kam nur der Bus in Frage: in diesem Fall die Linie 36. Das vierzigminütige Gerumpel führte mich vorbei am Hyde Park und am Buck Pal, vor dem es wie immer von Touristen wimmelte, dann über die Vauxhall Bridge zum The Oval am anderen Themse-Ufer. Wieso Rupe, ein eingefleischter Feind jedes Mannschaftssports, ausgerechnet in die Nähe eines großen Cricketstadions gezogen war, überstieg mein Vorstellungsvermögen. Laut dem A-to-Z-Plan war die Hardrada Road nur einen Katzensprung von den Kassenhäuschen entfernt. Nun, vielleicht hatte es ihm einfach Spaß gemacht, diesen Ort mit Nichtbeachtung zu strafen.
Die Hardrada Road 12 gehörte zu einem Ensemble dreistöckiger viktorianischer Ziegelhäuser. Elegant und doch bescheiden, könnte man sagen. Allerdings eine Katastrophe, was Parkplätze betraf. Nummer 12 sah nicht so aus, als hätte ihr Bewohner das Weite gesucht. Die Fenster im dritten Stock standen weit offen. Ich klingelte, weil ich das für angebracht hielt, ehe ich es bei den Nachbarn versuchte. Wie erwartet, rührte sich niemand. Nun, selbst wenn Rupe noch dort lebte und sich nur weigerte, Briefe und Anrufe anzunehmen, wäre er jetzt, an einem Donnerstagvormittag um elf Uhr, natürlich in der Arbeit. Aber da ich keine Ahnung hatte, wo er nach der Kündigung bei Eurybia Shipping sein Brot verdiente, führte mich dieser Gedanke auch nicht weiter.
Eine gestresste, aber hilfsbereite Mutter von zwei Kindern (mindestens), die mir in Nummer 10 öffnete, hatte Rupe seit Monaten nicht mehr gesehen. »Nicht dass wir ihn davor allzu oft zu Gesicht bekommen hätten. Ich nehme an, dass er im Ausland arbeitet. Hat er mir nicht sogar so was gesagt? Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Fragen Sie doch Echo. Sie wird schon wissen, wann er zurückkommt.«
»Wen?«
»Echo Bateman. Seine Untermieterin. Sie kommt normalerweise gegen Mittag nach Hause.«
Eine Untermieterin! Plötzlich sah es so aus, als würde es viel leichter als befürchtet sein, Rupes habhaft zu werden. Die kleine Miss Echo konnte sicher alles für mich klären. Um mein Glück zu feiern, schlenderte ich zu einem Pub, an dem ich auf dem Weg vom The Oval vorbeigekommen war. Ich musste noch eine Stunde warten und brauchte dringend etwas, um die Kopfschmerzen los zu werden, die ich zu viel Kaffee und zu wenig Essen in der Früh verdankte.
Mit seinem vielen rohen, nackten Holz war das Pole Star ein typischer Vertreter des Chics der neunziger Jahre. Vielleicht etwas nachgedunkelt und an den Kanten abgewetzt, aber die Hand voll Kunden, die hier so kurz nach der Öffnung herumsaß, liebte das Pub so, wie es eben war, und darum waren keine Klagen zu hören. Keine jedenfalls, die nicht vom Dröhnen eines Staubsaugers im Speisebereich übertönt wurden. Zum Glück war das Wegsaugen der Pizzareste von gestern Nacht eine Lappalie. Ich hatte meinen Drink erst zur Hälfte geleert, als bereits wieder Ruhe einkehrte. So beschloss ich, den Barkeeper auszufragen.
»Kennst du Rupe Alder? Er lebt hier um die Ecke.«
»Rupe Alder? Yeh.« (Das gute alte »Yes« schien bei der jüngeren Generation, zu der auch ich mich noch zählte, auszusterben.) »War aber schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Biste’n Freund von ihm?«
»Von früher. Von sehr viel früher, um ehrlich zu sein. Und das ist mein Problem. Wir haben uns aus den Augen verloren und ich weiß nicht, wo er jetzt ist.«
»Da kann ich dir auch nicht helfen, Kumpel. Aber am Abend arbeitet hier ein Typ, der ihn gut kennt. Wenigstens hat er ihn gut gekannt. Vielleicht kann dir Carl mehr über Rupe Alder sagen.«
»Und wird Carl heute Abend hier sein?«
»Yeh – wenn er rechtzeitig aufwacht.«
Das sah ja immer besser aus. So geht es mir jedes Mal, wenn meine ziellosen Streifzüge durch das Leben die flüchtige Würde eines Plans annehmen. Ich verließ das Pole Star mit dem Vorsatz, im Zeitschriftenladen nebenan eine Schachtel extrastarke Pfefferminzbonbons zu kaufen, mir auf dem Rückweg in die Hardrada Road gleich eines in den Mund zu stecken (für den Fall, dass Echo etwas gegen Alkohol am Mittag hatte), mir anzuhören, was Echo zu sagen hatte, mich nach einem billigen Zimmer für die Nacht umzusehen, vielleicht irgendwo ins Kino zu gehen und schließlich wieder in den Sog des Pole Star zu geraten, wo dann hoffentlich besagter Carl Schicht hatte.
Was mich betrifft, steht L. G., wie wir wissen, für Lancelot Gawain. Aber manchmal denke ich, es könnte auch Lance der Glückspilz heißen. Nicht oft, aber bisweilen. Das war mal wieder so ein Anlass. Gerade sperrte eine junge Frau die Haustür auf, als ich erneut vor der Nummer 12 einlief. Sie war hoch gewachsen und kräftig gebaut, hatte kurzes schwarzes Igelhaar, große Augen und trug eine Postbotenuniform. Erst stieß sie einen unüberhörbaren Seufzer aus, ehe sie mich bemerkte – ein Hinweis darauf, dass sie heute schon viele lange Stunden über die Bürgersteige von Südlondon gelatscht war.
»Echo?«
»Himmel, hast du mich erschreckt!« (Das hatte ich allerdings. Kein Wunder – bei den weichen Sohlen meiner Clarks.) Sie drehte sich zu mir um und musterte mich mit sich verengenden Kulleraugen.
»Deine Nachbarin hat mir deinen Namen genannt. Ich bin ein Freund von Rupe. Lance Bradley.«
»Kennen wir uns?«
»Nein, aber …«
»Trotzdem … irgendwie kommt mir dein Gesicht vertraut vor.«
»Ich verspreche dir, dass ich es nicht werde.«
»Was?«
»Zu vertraulich.« Ich fabrizierte ein Grinsen. »Wenn du mich reinlässt.«
»Soll das ein Scherz sein?«
»Na ja, eigentlich schon. Lass es mich noch mal versuchen. Ich komme aus der hintersten Provinz. Vielleicht ist das der Grund, warum der Witz nicht zündet. Also, ich suche Rupe. Seine Familie macht sich um ihn Sorgen.«
»Seine was?«
»Familie. Die meisten von uns haben eine, ob es uns passt oder nicht.«
»Das ist das erste Mal, dass ich von Rupes Verwandten höre. Wie auch immer, du wirst ihn hier nicht finden. Aber …« Sie musterte mich von oben bis unten. »Na gut, komm rein. Jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Du bist wirklich ein Freund von Rupe.«
»Hab ich doch gesagt.«
»Die Leute sagen alles Mögliche.« Sie stieß die Tür weit auf, trat ein und bedeutete mir, ihr zu folgen.
Als Erstes stach mir ein großes Ölgemälde in grellen Farben ins Auge, das ungerahmt gleich neben der Tür an der Wand hing. Das Nächste, was mir auffiel, war ein ähnliches Bild hinter der Treppe. Keine Frage, beide stammten vom selben Maler; darauf hätte ich mein Geld verwettet. Was die Absicht des Künstlers betraf – mit all den hingeknallten Linien und grellen Farben –, hätte ich allerdings nicht mal zu raten gewagt.
»Die sind von mir«, kommentierte Echo, als sie die Tür zuschlug und bemerkte, in welche Richtung ich starrte. »Du brauchst dich nicht verpflichtet zu fühlen, einen Kommentar abzugeben.«
»Gut.«
»Komm mit in die Küche. Möchtest du Tee?«
»Warum nicht?« (Es war höchste Zeit, dass ich mir bei Einladungen zu einem Getränk einen besseren Spruch einfallen ließ.)
Vorbei an zwei Gemälden mit so etwas wie einem Vulkanausbruch und zwei geschlossenen Türen, gingen wir weiter in die Küche. »Das bist doch du, oder?«, fragte Echo und deutete auf ein (gerahmtes) Bild links neben der Tür.