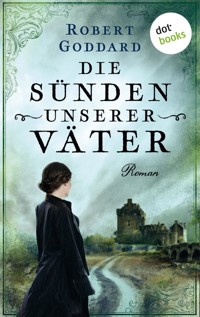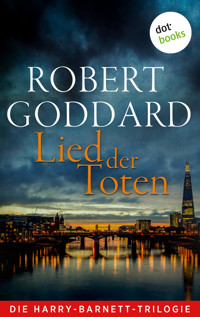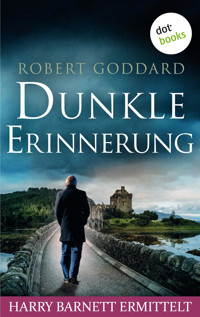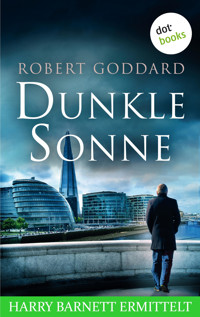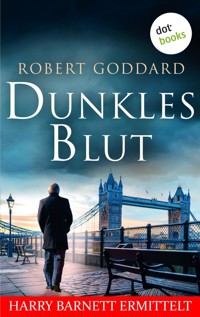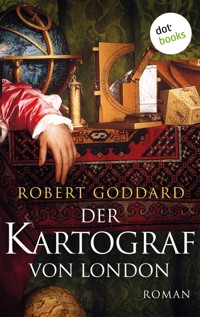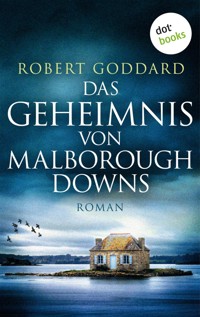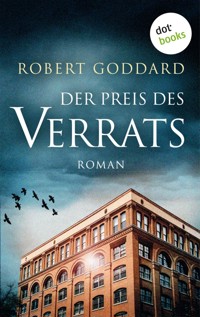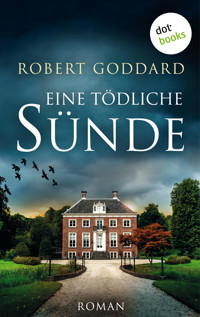
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein Blut klebt an all unseren Händen: Der fesselnde Kriminalroman »Eine tödliche Sünde« von Robert Goddard jetzt als eBook bei dotbooks. Vor vielen Jahren hat Chris Napier mit seiner Familie und seinem alten Leben gebrochen. Nun ist er völlig geschockt, als er seinen besten Freund aus Jugendtagen wiedertrifft: Nicky Lanyon ist verwahrlost und redet wie im Wahn über eine fürchterliche Bluttat, die vor fast 40 Jahren ihre beiden Familien erschüttert hat. Damals wurde Nickys Vater hingerichtet, vorgeblich für den Mord an Chris' reichem Onkel. Doch jetzt besteht Nicky auf seines Vaters Unschuld – und erhängt sich am nächsten Tag … Chris Napier weiß, dass sein Gewissen nur Ruhe findet, wenn er den letzten Wunsch seines toten Freundes erfüllen kann: Er muss herausfinden, was damals wirklich geschah! Aber schon bald werden seine Nachforschungen von mysteriösen Zwischenfällen unterbrochen – und aus der Suche nach der Wahrheit wird ein Spiel um Leben und Tod … »Robert Goddard ist so clever wie fesselnd!« Stephen King Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Kriminalroman »Eine tödliche Sünde« von Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vor vielen Jahren hat Chris Napier mit seiner Familie und seinem alten Leben gebrochen. Nun ist er völlig geschockt, als er seinen besten Freund aus Jugendtagen wiedertrifft: Nicky Lanyon ist verwahrlost und redet wie im Wahn über eine fürchterliche Bluttat, die vor fast 40 Jahren ihre beiden Familien erschüttert hat. Damals wurde Nickys Vater hingerichtet, vorgeblich für den Mord an Chris' reichem Onkel. Doch jetzt besteht Nicky auf seines Vaters Unschuld – und erhängt sich am nächsten Tag … Chris Napier weiß, dass sein Gewissen nur Ruhe findet, wenn er den letzten Wunsch seines toten Freundes erfüllen kann: Er muss herausfinden, was damals wirklich geschah! Aber schon bald werden seine Nachforschungen von mysteriösen Zwischenfällen unterbrochen – und aus der Suche nach der Wahrheit wird ein Spiel um Leben und Tod …
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die folgenden Kriminalromane:»Im Netz der Lügen«»Der Preis des Verrats«»Ein dunkler Schatten«»Denn ewig währt die Schuld«»Das Geheimnis von Trennor Manor«»Und Friede den Toten«»Das Geheimnis der Lady Paxton«»Das Haus der dunklen Träume«
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane:»Die Sünden unserer Väter«»Die Schatten der Toten«»Jäger und Gejagte«»Die Klage der Toten«»Der Kartograf von London«
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett:»Dunkles Blut«»Dunkle Sonne«»Dunkle Erinnerung«
***
eBook-Neuausgabe September 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Beyond Recall« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Dunkle Spiegel« im C. Bertelsmann Verlag, München
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Robert Goddard
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Erik Laan
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-895-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eine tödliche Sünde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Eine tödliche Sünde
Roman
Aus dem Englischen von Elke vom Scheidt
dotbooks.
In liebevoller Erinnerung an Terry Green – Freund, Kollege und guter Kumpel, der viel zu früh abberufen wurde.
HEUTE
Die Luft ist hier anders, irgendwie reiner. Das Licht ist heller, die Ränder der Blätter und die Umrisse der Gebäude zeichnen sich so deutlich ab wie die Erinnerungen, die mir in den Sinn kommen, ausgelöst durch die unveränderte Heiligkeit dieses Ortes, den ich Heimat nenne. Ich schiebe das Fenster hoch und schaue in den Abend hinaus. Die Luft ist kühl und durch den Regen am späten Nachmittag wunderbar klar. Ich berühre das Holz und prüfe mit dem Daumen den Anstrich. Ich beobachte ein Kaninchen, das ich durch das Quietschen des Fensterrahmens gestört, aber nicht erschreckt habe; es hoppelt gemächlich in die Deckung der Bäume. Sein geruhsamer Rückzug lenkt meinen Blick nach St. Clement's Hill, wo ich die Dächer der Truro School und gleich nördlich davon die weißen Punkte ausmachen kann, die Schafe auf einer Weide sein könnten, wenn ihre Abstände nicht so regelmäßig wären, Schafe, die behütet grasen, und nicht Grabsteine von Toten, die für immer auf einem vertrauten Hügel ruhen.
Ich habe kein Zimmer verlangt, das nach Osten hinausgeht. Ich habe meine Verbindung mit Tredower House nicht erwähnt, als ich mich angemeldet habe. Ich habe nicht einmal meinen Namen preisgegeben. Die Dame am Empfang war ohnehin zu jung, um sich zu erinnern, vermutlich auch zu jung, um sich überhaupt dafür zu interessieren. Reiner Zufall hat mich also in dieses spezielle Zimmer geführt, wo mein Großonkel seinen riesigen alten Diwan, sein Durcheinander von Prüfgeräten und seine angeschlagenen Ledertruhen und Schrankkoffer stehen hatte, als warteten sie auf eine Reise. Vielleicht hat er hier geruht, hat dem Gurren der Tauben gelauscht und die Sommerluft eingeatmet, bevor er vor fünfzig Jahren zum letztenmal aufbrach. Genau hier oben, höchstens sechs Kilometer entfernt, sind seine Knochen jetzt Staub unter einer Platte aus komischem Granit. Noch vor ein paar Stunden stand ich vor dieser Grabplatte und wartete auf ein Treffen; ich wartete, und ich war bereit, mich zu Erinnerungen zwingen zu lassen. Ich las die Inschrift, kursorisch und zurückhaltend, die nur soviel verriet, wie der Anstand gebot, und dachte daran, wie sorgfältig meine Großmutter die Worte ausgewählt haben mußte. »Knapp und schicklich«, hörte ich sie im Geist zu dem Steinmetz sagen. »Sein Name.« Joshua George Carnoweth. »Seine Daten.« 1873-1947. »Die üblichen Initialen.« RIP. »Ich denke, das sollte genügen.«
Und du mußt gedacht haben, es würde genügen, nicht wahr, Großmutter? Du mußt dir deiner Sache sehr sicher gewesen sein, sogar noch, als fünfundzwanzig Jahre später dein eigenes Leben zur Neige ging. Für dich natürlich kein kaltes Grab auf einem windigen Hügelkamm, sondern hygienische Verbrennung. Nun ja, manche Dinge kann man nicht verbrennen, nicht einmal begraben. Du mußt geglaubt haben, man könne es doch. Aber du hast dich geirrt. Nur bist du nicht mehr da, um dieser Tatsache ins Auge zu blicken, nicht wahr? Aber ich bin da.
Ich kam zu früh zu meiner Verabredung auf dem Friedhof. Nicht viel, aber früh genug, um nach dem Aufstieg wieder zu Atem zu kommen und mich von der Umgebung etwas beruhigen zu lassen. Es war windig, was den Regen ankündigte, der noch nicht gefallen war. Die rasch dahinziehenden Wolken lenkten die Sonnenstrahlen über die Stadt unter mir, ließen ihren Schein zuerst auf die einzelne kupferne Turmspitze der Kathedrale, dann auf den höheren Mittelturm, dann auf die lange, helle Linie des Viadukts und die tiefgrünen Weiden dahinter fallen; und endlich, in größerer Nähe, auf einen Vogelschwarm über der Kapelle des Friedhofs, der im Wind herumwirbelte wie eine Handvoll Kies an einem sturmgepeitschten Strand, angestrahlt und sichtbar und dann schnell wieder verschwunden.
Seit Onkel Joshua begraben wurde, sind die Häuser an den Hängen rings um den Friedhof hinaufgekrochen wie irgendein feindlicher Belagerer bei Nacht, unbemerkt, bis man ihn plötzlich wahrnimmt. Dieser Gedanke kam mir genau in dem Moment, als ich sie den Weg heraufkommen sah, schnellen und entschlossenen Schrittes, unauffällig gekleidet, dünner, verhärmter und älter als bei unserer letzten Begegnung.
In einiger Entfernung blieb sie stehen und starrte mich an, regelmäßig atmend. Die Feindseligkeit, sofern vorhanden, war gut getarnt. Aber was hatte ich anderes erwartet? Sie hatte immer eine Maske getragen. Ich hatte das nur nicht gewußt.
»Sie sind gut gealtert«, sagte sie sachlich. »Noch immer trocken?«
»Ja, in der Tat.«
»Dann muß es daran liegen. Es sei denn, es sind die Auswirkungen von Ehe und Vaterschaft.«
»Wie haben Sie das herausgefunden?«
»Ich habe mich auf dem laufenden gehalten. Wo sind sie – Ihre Frau und Ihr Sohn?«
»Schweiz.«
»Praktisch wegen der Banken, stelle ich mir vor.«
»Ist es das, worum es geht – Geld?«
»Was sonst? Ich bin knapp dran.«
»Hat man Ihnen für Ihre phantasievollen Memoiren nicht genug bezahlt?«
»Nicht genug, um unbegrenzt so weiterleben zu können, wie ich es gewohnt bin.«
»Sie meinen, Sie haben alles verbraucht?«
»So ungefähr.«
»Nun, das ist Pech. Von mir werden Sie nichts bekommen.«
»Von irgend jemandem werde ich soviel bekommen, wie ich brauche. Von Ihnen – oder von dem, der am meisten bietet. Und ich denke, die Gebote für die Geschichte, die ich zu erzählen habe, werden ziemlich hoch sein. Meinen Sie nicht?«
»Vielleicht.«
»Wenn die Wahrheit herauskommt, werden eine Menge Leute sehr dumm dastehen.«
»Schlimmer als dumm, in Ihrem Fall.«
»Deswegen bin ich ja bereit, den Mund zu halten. Für einen Preis.«
»Welchen Preis?«
»Die Hälfte von dem, was ich letztes Mal hätte bekommen sollen. Sie können es sich leisten. Bloß die Hälfte. Ist das nicht fair?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Ich gebe Ihnen vierundzwanzig Stunden, um darüber nachzudenken. Kommen Sie morgen um die gleiche Zeit mit Ihrer Antwort hierher.«
»Warum hierher?«
»Weil dies das einzige Grab ist, von dem ich genau weiß, wo es liegt.« Dabei hätte sie fast gelächelt. Ein Lächeln wäre das Eingeständnis gewesen, daß hier etwas jenseits von Habgier und Neid am Werk war, aber dazu reichte es nicht ganz.
»Ich glaube nicht, daß Sie den Mut haben, jetzt alles ans Licht zu zerren.«
»Das hat mit Mut nichts zu tun, das ist ein Mangel an Alternativen. In letzter Zeit mußte ich mich sehr einschränken und ein tödlich langweiliges Leben führen; dabei hatte ich mir geschworen, es dazu nie kommen zu lassen. Nun, ich habe genug davon, und dies ist die einzige Möglichkeit, ihm zu entfliehen.«
»Ist das nicht immer noch besser als ein Gefängnis?«
»Oh, ich habe nicht die Absicht, dorthin zurückzugehen. Mit dem, was die Zeitungen mir für die Wahrheit bezahlen werden, kann ich das Land verlassen und ein anderer Mensch werden. Sie wissen, wie gut ich darin bin.«
»Ja, das weiß ich.«
»Aber für Sie käme das nicht in Frage, nicht? Sie sind jetzt ein hingebungsvoller Familienvater. Denken Sie darüber nach. Wir haben schon einmal ein Geschäft gemacht. Wir können wieder eins machen. Es ist ganz einfach.«
»Wenn Sie wirklich glauben ...«
»Ich glaube, daß Sie alles, was Sie jetzt sagen, später ziemlich töricht finden könnten, wenn Sie erst Gelegenheit hatten, sich die Alternativen zu überlegen. Ich wäge sie schon seit langem ab.«
»Und ich bekomme vierundzwanzig Stunden, um dasselbe zu tun?«
»Genau. Unter den gegebenen Umständen ist das großzügig.« Sie sah mich einen Augenblick unverwandt an. Ob sie dieselbe eigenartige Komplizenschaft mit mir empfand, die ich ihr gegenüber fühlte, konnte ich nicht feststellen, und ich hätte nie gewagt, danach zu fragen, aus Angst vor der Antwort. Wir hatten uns vor Jahren selbst in diese Lage gebracht, indem wir uns darauf geeinigt hatten – wie widerstrebend auch immer –, die Wahrheit, die wir beide kannten, geheimzuhalten. Was ist ein Geheimnis ohne Vertrauen anderes als ein Vertrag, der nur darauf wartet, gebrochen zu werden? »Bis morgen?« fügte sie hinzu.
Ich nickte. »Bis morgen.«
Da ist sie also, die Bedrohung, mit der ich seit unserem Handel immer gelebt habe. Das Dilemma, von dem ich gern so tue, als hätte ich es nicht erwartet. Nun gut, wenn es passieren muß, dann soll es eben passieren. Hier und jetzt. Es gibt keinen passenderen Ort und keinen passenderen Zeitpunkt. Und ich habe bis morgen Zeit, um zu einer Entscheidung zu kommen. Wer braucht mehr als das?
Ich schaue aus dem Fenster auf die am Hang abfallenden Rasenflächen und höre das Dröhnen des Verkehrs, das hügelaufwärts lauter wird. Ich erinnere mich an eine Zeit, als der Verkehr so gering war, daß man ein einzelnes Auto die Boscawen-Brücke überqueren und sich die Straße zum Isolation Hospital hinaufquälen hören konnte. Genauso, wie ich mich an eine Zeit erinnere, als ich noch nichts von der Wahrheit über Onkel Joshuas Tod wußte, bis auf das Wenige, das dem durchschnittlichen Zeitungsleser im Omnibus nach Clapham bekannt war. Mehr als dreißig Jahre habe ich als Kind und als Mann in diesem glücklichen Zustand gelebt. Dann, an einem frühen Sonntagmorgen im September 1981, auf dem Weg dort unten in der Nähe der Rhododendren, den ich jetzt betrachte, erhaschte ich den ersten, von Unterholz teilweise verdeckten Blick auf das, was diese Phase meines Lebens abrupt und erschreckend beendete. Und die nächste Phase in Gang setzte. Die sich auf den heutigen Tag zubewegte. Und auf morgen.
Ich lasse das Fenster herunter und schließe den Lärm aus. Aber nicht die Erinnerungen. Sie stürmen auf mich ein und ergreifen Besitz von mir, als ich langsam durch das Zimmer gehe, mich aufs Bett lege und die Augen schließe, um mich ihnen zu stellen. Ich werde nirgends hingehen. Ich laufe nicht weg. Ich habe bis morgen Zeit, um sie alle noch einmal zu durchleben. Was ich anscheinend tun muß, bevor ich mich entscheide.
GESTERN
Kapitel 1
Im September 1981 war der Mord an meinem Großonkel Joshua Carnoweth längst kein schockierender und vielbeklagter Schlag gegen Truros friedliches Selbstbild mehr. Vierunddreißig Jahre hatten ihn zu einer kuriosen Fußnote der Stadtgeschichte werden lassen. Die meisten der vielen Dinge, die seinerzeit darüber gesagt worden waren, waren vergessen, und alle Leidenschaften, die er geweckt hatte, waren vergangen. Es war nicht so, als würde sich keiner erinnern, nur waren die Dinge niemandem wichtig genug, um daran zurückzudenken. Nach drei Jahrzehnten Wohlstandsgesellschaft waren die rationierten Freuden und reichlich vorhandenen Sorgen von 1947 relativ antiquiert, und mit ihnen auch die Erinnerungen an jene, die das Jahr nicht überlebt hatten.
Selbst innerhalb der Familie, von der Joshua sich teilweise gelöst hatte, wurde sein Name selten erwähnt. Einige von uns wohnten in seinem Haus. Und uns allen ging es dank des Vermögens, das meine Großmutter von ihm geerbt hatte, gut – in unterschiedlichem Maß. Aber die meisten von uns hatten gelernt, so zu tun, als habe er keine wirkliche Rolle dabei gespielt, die Napiers von bescheidenen Ladenbesitzern zu Firmendirektoren und Hoteliers zu machen. Das war schließlich nicht seine Absicht gewesen. Er hatte uns nicht mit seinem Reichtum überschütten wollen. Vermutlich wäre er empört gewesen, daß seine Ermordung solche Folgen hatte. Insoweit war es wohl gerechtfertigt, daß wir sowenig an ihn dachten. Vielleicht wäre alles, was über kollektive Gleichgültigkeit hinausging, so gewesen, als würden wir auf seinem Grab tanzen. Ich gehörte damals zu denjenigen, denen seine Wohltaten am wenigsten bewußt waren. Ich glaubte, die ganze Geschichte zu kennen, aber ich kannte sie nicht einmal zur Hälfte. Ich dachte, ich würde mich genauso daran erinnern, wie sie gewesen war, aber das, was ich im Gedächtnis hatte, war eine Fiktion, die sich gefährlich abgenutzt hatte, ohne daß es jemand merkte. Und im September 1981 begann sie sich endgültig aufzulösen.
Samstag, der fünfte September, war der Tag, an dem meine Nichte, Tabitha Rutherford, Dominic Beale heiraten sollte, einen gutaussehenden und sehr begehrten jungen Bankkaufmann. Durch einen glücklichen Zufall war es auch der Tag, an dem meine Eltern ihre goldene Hochzeit feierten. Deshalb wurde ein großes Familienfest arrangiert. Die Eheschließung sollte in der St. Mary Clement Methodist Church im Zentrum Truros stattfinden, gefolgt von einem Empfang in Tredower House.
Nach dem Tod meiner Großmutter war das Heim der Familie in Cornwalls führendes Hotel- und Konferenzzentrum umgewandelt worden (so hieß es im Prospekt), geführt von meinem Schwager, Trevor Rutherford. So hatte mein Vater das Problem gelöst, was man mit Trevor machen sollte, nachdem Dad die Kette von sechs Napier-Kaufhäusern verkauft hatte, die er in den fünfziger Jahren mit Hilfe dessen, was Großmutter von Onkel Joshua erbte, hatte erwerben können. Er hatte das fast sofort nach ihrem Tod getan, als sie kein Veto mehr gegen einen derart konservativen Schritt einlegen konnte, und hatte sich mit meiner Mutter nach Jersey zurückgezogen. Ein paar Jahre später, als ihnen klarwurde, daß sie eigentlich doch sehr an Cornwall hingen, waren sie wieder zurückgekommen zu dem, was noch immer der begehrenswerteste Wohnsitz an der Mündung bei Helford sein muß. Das Tredower-House-Hotel entsprach mittlerweile seinem Ruf, was mehr dem Organisationstalent meiner Schwester Pam zu verdanken war als irgendwelchen herausragenden Fähigkeiten Trevors in seiner Eigenschaft als Manager.
Das Hotel war übers Wochenende geschlossen, so daß die große Versammlung von Freunden, Verwandten und Geschäftsfreunden sich ungestört unserer Gastfreundschaft erfreuen konnte. Und am Samstag morgen fuhr ich, widerstrebend Pams Befehlen gehorchend, von Pangbourne herunter, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Ich hatte den Stag für die Fahrt fertig gemacht und schaffte es in genau vier Stunden, was damals beinahe ein Rekord war. Pam hatte gewollt, daß ich am Freitag käme, aber ich hatte behauptet, eine Fahrt gegen die Uhr mit offenem Verdeck sei genau das, was ich bräuchte, um einen klaren Kopf zu bekommen.
Das war natürlich ein Vorwand, und ich bin sicher, daß sie das erkannt hat. Ich, konnte ein Ereignis dieser Größenordnung nicht boykottieren, aber ich konnte meine Teilnahme daran auf ein Minimum beschränken. Ankunft in letzter Minute, rascher Aufbruch am folgenden Nachmittag: Ich hatte alles geplant. Ich würde da sein, aber mit etwas Glück würde ich mich fühlen, als sei ich nicht da.
Zwischen mir und Dad bestand ein klassischer Zwist. Er reichte zwanzig Jahre zurück; damals war ich zur Managerausbildung in das Geschäft in Plymouth gegangen und hatte als Belohnung dafür, daß ich ein gehorsamer Sohn war, einen großzügigen Zuschuß erhalten. Jetzt verdiente ich meinen Lebensunterhalt selbst, und zwar gar nicht schlecht, aber es hatte Zeiten gegeben, in denen das nicht der Fall gewesen war, und sie waren zu zahlreich gewesen, um sich dabei wohl zu fühlen. Bei keinem dieser Anlässe hatte ich um Hilfe gebeten, und Dad hatte mir auch keine angeboten. Auf beiden Seiten stand der Stolz im Weg. Er wollte, daß ich meine Fehler zugab, ohne einzuräumen, daß er selbst auch welche gemacht hatte, und vermutlich dachte er, ich wolle das gleiche von ihm. Was dabei herauskam, war ein Waffenstillstand. So hatte ich in der jüngeren Generation meiner Familie eine einzigartige Stellung, indem ich es selbst zu etwas gebracht hatte. Genauer ausgedrückt, indem ich es wieder zu etwas gebracht hatte, denn Ende der sechziger Jahre hatte ich längere Zeit versucht, mich zu Tode zu trinken. Doch das Ergebnis war dasselbe. Ich war nicht drinnen und auch nicht draußen. Ich war einer von ihnen, aber es sah nicht so aus – weder für sie noch für mich.
Eine ähnliche Ambivalenz kennzeichnete meine Beziehung zu meiner Geburtsstadt. Truro ist alles, was man von einer Domstadt an der feuchten, entlegenen Spitze der Südwesthalbinsel erwartet, und ist es gleichzeitig auch nicht. Es ist eine Stadt langer, steiler, geschwungener Hügel, helles Licht scheint auf vom Regen gewaschene Steine; georgianische Eleganz neben schmutzigen Lagerhäusern und schlammigen Kais, Armut und Verelendung neben wimmelndem Tourismus, keltischer Romantik und dem seltsamen, hartnäckigen Gefühl, bedeutend zu sein. Keines von Truros Merkmalen, die ich auf Anhieb beschreiben kann – die überdimensionale Kathedrale, das Viadukt hoch über Victoria Park, meine alte Schule, die hoch auf dem Hügel im Süden liegt, das Haus in der Crescent Road, in dem ich geboren wurde, Tredower House selbst –, war damals viel älter als hundert Jahre. Doch das, was ich von Truro mit mir herumtrage und weder abtun noch mir genau vorstellen kann, wirkt zugleich älter und kraftvoller. Wir Napiers sind teilweise zugewandert. Eine der anziehendsten Eigenschaften meines Großvaters Napier war für meine Großmutter die Tatsache, daß er nicht aus Cornwall stammte. Die Carnoweths hingegen sind so komisch wie Safrankuchen. Ihre Truroer Wurzeln reichen tief, und manche davon haben auch mich im Griff, egal, wie weit entfernt oder lange ich fort bin.
All dies machte jeden meiner Besuche in Tredower House zu einem Abenteuer in bekannten Gewässern, die aber dennoch turbulent waren. Es stand, von Bäumen umgeben, nahe beim Hügelkamm in der St. Austell Road, ein gotisches Herrenhaus, das nackt und häßlich ausgesehen haben muß, als es um 1870 für Sir Reginald Pencavel, den Porzellanerde-Magnaten, erbaut wurde. Aber im Laufe der Jahre wuchsen die Bäume, und der Sandstein alterte, so daß das Haus etwas verwandtschaftlich Vertrautes bekam, wie ein alter Bekannter, von dem man plötzlich merkt, daß er ein Freund geworden ist.
Der letzte der Pencavels fiel an der Somme. Als seine Witwe 192o wieder heiratete, schrieb sie das Haus zum Verkauf aus. Der Käufer war ein heimkehrender verlorener Sohn der Stadt, mein Großonkel Joshua Carnoweth, der gerade aus dem langen, selbstauferlegten Exil von den Goldfeldern in Nordamerika zurückgekehrt war, nachdem er ein größeres Vermögen erworben hatte, das ihm keiner zugetraut hatte. Der Kauf von Tredower House war eine Zurechtweisung der Zeitgenossen, die an ihm gezweifelt hatten, und sollte gleichzeitig allen verkünden, daß seine Wanderjahre nun zu Ende waren. Er war siebenundvierzig; zu jung, würde ich sagen, um sich als Landjunker in Cornwall niederzulassen. Doch er hatte Gründe genug dafür und konnte nicht wissen, daß sich diese eines Tages gegen ihn verbünden und ihn vernichten würden.
In gewisser Weise war ich froh, daß das Haus belebter und auffälliger geworden war, seit ich nicht mehr dort wohnte. Ein moderner Konferenzsaal auf der Rückseite, ein Parkplatz, wo sich der Obstgarten befunden hatte, und zahlreiche Wegweiser und Sicherheitsscheinwerfer kündeten in einer Weise von seiner kommerziellen Identität, die persönliche Erinnerungen überlagerte, ohne sie indessen ganz auszulöschen. Selbst das Ausrichten von Hochzeiten gehörte regelmäßig zum Geschäft, wenn auch keiner der Empfänge für Kunden wohl je ein größeres Festzelt mit rosafarbenen Drapierungen und goldenen Bändern erfordert hatte als das, das ich zwischen den Bäumen erspähte, als ich an diesem Morgen auf dem Weg zur Kirche in meinem Stag am Grundstück vorbeifuhr.
Die Trauung verlief reibungslos und ohne den geringsten Patzer. Danach erfolgte ein Massentransport zu Tredower House. Da sich so viele Leute darum rissen, der Braut und ihren Großeitern zu gratulieren, Pam von ihren Pflichten als Gastgeberin in Anspruch genommen war und Trevor dieses eine Mal eine gute Entschuldigung hatte, mich zu ignorieren, geriet ich ohne großen Widerstand an den Rand der Ereignisse. Mindestens eine Stunde war noch mit Champagner und Kanapees zuzubringen. Für einen trockenen Alkoholiker, der mit seinen Verwandten nicht auf allzu gutem Fuß stand, versprach diese Stunde qualvoll zu werden. Also verzog ich mich so diskret wie möglich in eine schattige Ecke des Rasens, lehnte mich an die Krocketbank, die man unter einer Buche in Sicherheit gebracht hatte, und beobachtete die Party. Gelächter mischte sich mit den trägen Melodien der Jazzband in der stillen Sommerluft. Bunte Kleider bewegten sich wie in einem langsam gedrehten Kaleidoskop im dunstigen Sonnenschein. Das Licht funkelte in den Champagnerkelchen. Freude, Vergnügen und Zufriedenheit allenthalben. Ich versuchte, mich nicht wie am Katzentisch zu fühlen, und brachte mit Orangensaft einen Toast auf die ganze Versammlung aus.
Meine Eltern, zusammen mit Braut und Bräutigam, waren im Festzelt und daher nicht zu sehen. Sie hatten sicher noch damit zu tun, die Gäste zu begrüßen, und ich wußte, daß sie das mit unerschöpflichem Aplomb erledigen würden. Großmutter hatte meinen Vater gut für die gesellschaftlichen Verpflichtungen trainiert, die mit der Stellung verbunden waren, die sie für ihn vorgesehen hatte. Sie hatte ihm beigebracht, eine glatte, gewandte Fassade vor sich herzutragen, die seinen Weg in die Welt des Big Business und der Lokalpolitik ebnete. Das Alter schien dieses Image nur noch zu verstärken. Man mußte ihm sehr nahe gestanden haben, um in ihm einen ganz anderen Menschen zu erkennen.
Und meine Mutter stand ihm seit fünfzig Jahren näher als alle anderen, und ich wußte, daß ihre Zuneigung nicht gespielt war; ich schätze daher, daß an ihm mehr echt gewesen sein muß, als ich zuzugeben bereit war. Ich argwöhnte, daß Großmutter ihn zu dieser Ehe gedrängt hatte. Die Auswahl einer Ehefrau für ihren Sohn und einer Mutter für ihre Enkel war etwas, das sie nicht dem Zufall überlassen hätte, soviel steht fest. Doch wenn es so war, dann war ihr Manöver erfolgreich gewesen, wie üblich. Ich hatte nie Grund, daran zu zweifeln, daß meine Eltern sich liebten. Die einzige Frage, die mir im Kopf herumging, war, ob sie auch mich liebten.
Pam hätte einen solchen Gedanken als dummes Zeug abgetan, und das mit gutem Grund. Ihre Erziehung hatte sie zu einer praktischen und liebevollen Frau mit einer Tochter gemacht, die für ihre guten Eigenschaften sprach. Tabitha besaß den gleichen Scharfsinn und die gleiche Klarsicht wie ihre Mutter und auch deren fein gemeißelte Züge und anmutige Bewegungen.
In diesem Augenblick sah ich den Vater der Braut, der sich gewandt durch die Menge bewegte. Die mittleren Jahre hatten Trevor gewinnen lassen und das Linkische und Unsichere geglättet, das mir aufgefallen war, als Pam uns miteinander bekannt gemacht hatte. Die Public-Relations-Seite des Hotelmanagements war etwas, das er ausgezeichnet beherrschte. Solche Dinge lagen ihm eindeutig. Er war ein schwerer Trinker, dem man nichts anmerkte, was mich natürlich sehr ärgerte; insgeheim hielt ich ihn für einen Dummkopf, und er mich vermutlich auch. Wir hätten beide allerhand zur Untermauerung unserer Behauptung anführen können.
Ich glaube nicht, daß ich irgend etwas hörte, was mich veranlaßte, mich in diesem Moment umzudrehen. Vielleicht spürte ich, daß ich nicht der einzige war, der die Szene beobachtete, daß eine Veränderung eingetreten, ein Faden aus dem Gewebe des Tages gezogen worden war. Ich bin nicht sicher. Und es spielt auch keine Rolle. Tatsache ist, daß ich mich umdrehte und einen Mann unter den ausladenden Ästen der alten Roßkastanie stehen sah, die die Nordwestecke des Gartens beherrschte. Er war ungefähr so groß wie ich, aber dünner, und hatte verfilztes, grau werdendes Haar und einen Bart. Seine Kleider waren zerlumpt und staubig, zerschlissene Jeans und ein kariertes Hemd mit offenem Kragen unter einem alten Regenmantel. Dieser bewirkte, daß ich ihn für einen Landstreicher hielt. Wer sonst würde an einem so sonnigen Tag einen Regenmantel tragen? Der Mann zitterte, aber gewiß nicht vor Kälte. Sein Gesicht befand sich im Schatten, aber ich hatte den Eindruck, daß er mich anstarrte und nicht die Hochzeitsparty auf dem Rasen.
Ich richtete mich auf und ging um die Bank herum. Während ich das tat, trat er einen Schritt auf mich zu und kam ins Sonnenlicht. Zum erstenmal sah ich sein Gesicht deutlich. Wenn er ein Landstreicher war, dann noch nicht lange. Seine Augen waren nicht trübe, seine Haut nicht rauh genug. Instinktiv hatte ich das Gefühl, ihn zu kennen, aber ich traute diesem Instinkt nicht. Sein Mund zuckte. Ein Lächeln oder eine Grimasse, das war schwer zu unterscheiden. Er murmelte etwas. Auch ohne den Lärm der Party wäre er schwer zu verstehen gewesen. Aber ich verstand ihn trotzdem. »Chris.« Mein Name. Gesprochen von jemandem, den ich nicht länger für einen Fremden halten konnte.
»Kennen wir uns?« fragte ich stirnrunzelnd.
Da lächelte er, schief und vertraut. Er schaute zu dem dicken Ast der Roßkastanie über seinem Kopf empor, hob langsam die Arme und bewegte sie vor und zurück wie jemand, der eine am Ast hängende Schaukel in Schwung bringen will. Ich spürte, wie ich den Mund aufsperrte, und erinnerte mich, daß ich als Kind genau an diesem Ast geschaukelt hatte, daß mein Freund aus Kindertagen, Nicky Lanyon, und ich ...
»Nicky?« Ich hätte es gleich wissen müssen. Von unserem siebten bis elften Lebensjahr haben wir wohl mehr Zeit miteinander verbracht als mit irgendeinem anderen Menschen. Wir waren unzertrennlich in diesen vier Jahren um das Ende des Krieges herum. Chris und Nicky. Nicky und Chris. Doch im Sommer 1947 hatte all das geendet. All das und noch viel mehr. »Bist du's?«
Ich hatte ihn vierunddreißig Jahre nicht gesehen. Ich hatte mein Bestes getan, um ihn zu vergessen. Aber die Vergeßlichkeit, das wurde mir klar, als ich ihn ansah, war nur Verstellung. Ich erinnerte mich an ihn, als sei das schäbige mittlere Alter nur eine Verkleidung, die er jeden Moment abwerfen würde, als könne der elfjährige Junge, der er einst gewesen war, plötzlich sichtbar werden, mit kurzgeschorenen Haaren, funkelnden Augen, vom komischen Sommer gebräuntem Gesicht, von irgendwelchen Waldabenteuern zerrissenem Hemd, grasfleckigen Hosen, schmutzigen Knien, heruntergerutschten Socken, verschrammten Schuhen; als könnten sich alle Bruchstücke einer verlorenen Freundschaft auf wunderbare Weise wieder einfinden und zusammensetzen. Es gab einen Moment – einen flüchtigen Augenblick –, da war ich glücklich, sehr glücklich, ihn zu sehen. Dann durchströmten mich Schuldgefühle und Mißtrauen und etwas wie Verachtung, um meine Rolle bei seiner Ächtung zu rechtfertigen. Ich spürte, wie ich mich versteifte und zurückwich. Ich sah ihn zusammenzucken, als habe auch er bemerkt, wie das Fallgitter zwischen uns herunterfiel.
»Was machst du hier?« Mein Ton hatte sich geändert, ohne daß ich es wollte. Ich muß mich kalt, steif und ablehnend angehört haben.
»Ich wollte ...« Er sprach langsam und schleppend; sein Blick ruhte mit seltsamer, milder Neugierde auf mir. »Ich wollte ... dich sehen.«
»Mich?«
»Habe ... über das hier gelesen.« Er zog etwas, was wie ein Zeitungsausschnitt aussah, aus der Tasche seines Regenmantels und hielt es hoch. Ich dachte, der Ausschnitt stamme aus der Lokalzeitung, und nahm an, daß Trevor vielleicht eine Hochzeitsanzeige hatte drucken lassen. Aber wieso interessierte Nicky sich dafür? Er lebte nicht einmal in der hiesigen Gegend. Oder doch? »Wußte ... daß du hier sein würdest.«
»Du hast ... auf mich gewartet?«
»Mum ist tot.«
»Deine Mutter? Das tut mir leid. Ich ...«
»Meine Schwester auch.«
Nickys jüngere Schwester, Freda, war während des Krieges an Keuchhusten gestorben. Daß er ihren Tod erwähnte, obwohl er wußte, daß er mir bekannt war, schien sinnlos, wenn nicht pervers, aber ich nahm an, daß es irgendeine Bedeutung hatte, die nur er verstehen konnte. »Was willst du, Nicky?«
»Mum und Dad ... zusammen.«
»Vielleicht sind sie jetzt zusammen.«
»Nicht mit mir.«
»Wann ist deine Mutter gestorben?«
»Vor ... sechs Monaten.« Er stopfte den Zeitungsausschnitt wieder in die Tasche. »Krebs.«
»Tut mir leid, das zu hören.«
Sein Blick wurde hart. »Wieso denn das?«
»Weil ich sie gern hatte.«
»Lügner.«
»Es ist wahr.«
»Lügner!« Diesmal schrie er das Wort, und sein Gesicht wurde rot vor Zorn. »Lügner!«
»Beruhige dich doch, um Gottes willen.«
»Warum ... sollte ich?«
»Das ist der Hochzeitstag meiner Nichte. Wir wollen keine ... Unannehmlichkeiten.« Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, bedauerte ich sie. Sein eigenes Leben hatte mehr als genug Unannehmlichkeiten enthalten, und gewiß wollte auch er keine weiteren. »Was ... machst du denn so?«
»Suchen.«
»Was?«
»Die Antwort.«
»Auf was?«
»Das weißt du.«
»Nein. Das weiß ich nicht.«
»Aber du ... kennst die Antwort? Kennst du sie, Chris?«
»Die Antwort auf was?«
»Wer hat meinen Vater getötet?« Die Frage war so bizarr, aber so offensichtlich ehrlich, daß ich ihn daraufhin nur anstarrte und versuchte, an seinem verzweifelten Blick abzulesen, wie schwer sein Weg seit dem Sommer 1947 gewesen war. »Wer hat es getan?«
»Was zum Teufel ist da los?« Trevors Stimme, laut und herrisch, unterbrach unser privates Gespräch. Ich drehte mich um und sah ihn auf uns zukommen, das Gesicht von Alkohol und Mißbilligung gerötet. »Was soll das Geschrei?«
»Nichts. Alles in Ordnung. Du brauchst nicht ...«
»Wer ist das?« Trevor schaute an mir vorbei auf Nicky. »Sieht aus wie irgendein verdammter Penner.«
»Nichts dergleichen. Ich kann ...«
»Dies ist eine private Party«, fiel Trevor mir ins Wort. »Verschwinden Sie von hier.«
»Moment, Trevor. Du verstehst nicht.«
Doch Unverständnis hatte meinen Schwager noch nie von etwas abgehalten. Er marschierte auf Nicky zu, mit einem Arm in Richtung Straße weisend. Nicky stolperte rückwärts, hob die Hände und senkte unterwürfig den Kopf. Kummer – und Schuldgefühle – durchzuckten mich bei dieser Zurschaustellung von Schwäche. Ich rief seinen Namen, aber es war zu spät. Er drehte sich um und begann zu laufen, duckte sich unter den Ästen und rannte auf den Teil der Mauer zu, den wir als Jungen so oft zusammen überklettert hatten, während Trevor tat, als verfolge er ihn. Es war kein Wettbewerb. Nicky flüchtete wie ein Fuchs vor den Hunden und verschwand im tieferen Schatten der Bäume. Vor meinem geistigen Auge sah ich ihn über die Mauer klettern, erinnerte mich, wo unsere Füße Halt gefunden hatten, sah ihn auf der anderen Seite herunterspringen, auf der Böschung bis zum tiefer liegenden Bürgersteig rutschen und dann auf der Straße davonlaufen.
»Der Bastard ist weg«, keuchte Trevor, als er wieder zu meiner Bank kam. »Davongelaufen.«
»Ich hab's gesehen.«
»Du hättest ihn selbst verjagen sollen. Säufer und Penner. Man kann es sich nicht leisten, sie zu ermutigen.«
»Er war genauso nüchtern wie ich und kein Penner.«
»Du redest, als wäre er ein Freund von dir von den Anonymen Alkoholikern.«
»Ein Freund? Ja. Na ja, das ist er tatsächlich.« Ich seufzte. »Oder vielmehr, er war es.«
»Ein Freund von dir? Kenne ich ihn vielleicht?«
»In gewissem Sinne, ja.«
»Wirklich? Wie heißt er?«
»Nicky Lanyon.«
»Lanyon?«
»Ja. Der Sohn von Michael Lanyon.«
»Was? Von dem Mann, der ...«
»Richtig. Von dem Mann, den sie für den Mord an Onkel Joshua gehängt haben.«
Von dem Mann, den sie für den Mord an Onkel Joshua gehängt haben. Der Satz ging mir nicht aus dem Kopf und war mit Erinnerungen assoziiert, die an ihm hafteten wie Spinnweben an einem modrigen alten Wegweiser. Trevor hatte uns 1947 nicht gekannt, hatte nicht einmal in Cornwall gelebt. Für ihn waren die Lanyons nur ein unwichtiges Stückchen Geschichte aus zweiter Hand. Trotzdem wollte er nicht, daß ihr Name an einem Tag erwähnt wurde, an dem unsere Familie sich feierte. Ihm war bewußt, daß die Lanyons keine schwerwiegende Bedrohung darstellten, aber sie waren doch etwas leicht Irritierendes. Daß Nicky in Truro war, machte ihm keine Sorgen, aber er hätte es lieber gesehen, wenn er anderswo gewesen wäre. Überall, nur nicht hier.
»Wir sollten das für uns behalten, Chris, meinst du nicht?« sagte er, als wir über den Rasen zurückgingen. »Es ist das letzte, was Melvyn und Una an ihrem Hochzeitstag hören sollten.« Die Anspielung auf meine Eltern war ein direkter Appell an meinen Familiensinn und mein Verantwortungsgefühl. Aber ich hatte ihn im Verdacht, daß Mum und Dad gar nicht die Menschen waren, um die er sich Sorgen machte, was er auch gleich darauf indirekt eingestand. »Und ich will nicht, daß Tabs der Tag verdorben wird.«
»Würde sie denn den Namen überhaupt erkennen?«
»Wahrscheinlich nicht. Aber dabei möchte ich es gern belassen.«
»Was ist mit Dominic? Weiß er, wie wir dieses Anwesen geerbt haben?«
Trevor blieb abrupt stehen. Ich hielt auch inne und wandte mich ihm zu. Sein Gesichtsausdruck verriet, daß er sich große Mühe gab, sich nicht zu ärgern. »In ein paar Stunden werden meine Tochter und mein Schwiegersohn auf Hochzeitsreise nach Mauritius sein. Ist es zuviel verlangt, wenn ich dich bitte, ihnen die Abreise nicht zu verderben?«
»Nein, ist es nicht.« Ich lächelte ihn an, von Mann zu Mann. »Vergessen wir Nicky. Ich schätze, wir werden ihn nicht wiedersehen.«
Ich machte meine Sache ganz gut, wenn ich das selbst sagen darf. Ich entdeckte das Geheimnis, wie ich Dominics Mutter unterhalten konnte, verkaufte seinem Vater beinahe den Bentley Continental, der damals in meinem Ausstellungsraum in Pangbourne den Ehrenplatz einnahm, hielt eine improvisierte Rede, in der ich geistreich die Rollen des dankbaren Sohnes und des zufriedenen Onkels vermischte, und nahm ganz allgemein begeistert an den Feierlichkeiten teil. Ich sah, daß Mum und Dad mindestens einen Blick angenehmer Überraschung über meine Mitwirkung tauschten, und war froh, daß sie nicht die leiseste Ahnung hatten, was dahinterstand. Ich versuchte nach Kräften, die Schuld und Scham abzuschütteln, die Nickys plötzliches Auftauchen in mir hinterlassen hatte. Und zwar, bevor ich zuviel Zeit hatte, mich zu fragen, warum ich sie überhaupt empfand.
Am späten Abend war mir das mehr oder weniger gelungen. Tabitha und Dominic waren nach Mauritius abgereist, und die Disco, die für ihre Freunde veranstaltet wurde, verlor allmählich den Schwung. Meine Mutter wurde müde, aber mein Vater schien sich noch zu amüsieren, also schlug ich eine Partie Snooker vor, da ich wußte, wie er es genoß, einen jüngeren Gegner zu schlagen. Er stellte sich der Herausforderung, und wir gingen ins Billardzimmer, das sich in gnädiger Entfernung vom Lärm der Band befand.
Der Raum wurde für Gäste instandgehalten, aber er sah mit dem großen Tisch, den alten Ledersesseln und den verblichenen Jagdgemälden an den Wänden noch weitgehend so aus wie früher. Die Umgebung erinnerte mich an Onkel Joshua, trotz seiner Verachtung für alle sportlichen Aktivitäten. Doch die nostalgischen Bemerkungen meines Vaters, während er um den Tisch herumging und eine Serie vorbereitete, unterminierten meinen Widerstand gegen Erinnerungen an Nicky Lanyon – und dessen Vater.
»Es war ein fabelhafter Tag. Wirklich. Deiner Mutter hat es sehr gefallen. Und mir auch. Kein Vergleich mit unserer Hochzeit, das kann ich dir sagen. O ja. Die war ganz anders.«
»Inwiefern?«
»Na ja, es war mitten in der Depression, nicht? Wir wohnten in der Carclew Street. In die Crescent Road sind wir erst nach Pams Geburt gezogen. Und das Geschäft ging schlecht. Für eine Hochzeitsreise ans andere Ende der Welt hatten wir kein Geld. Deine Mutter und ich verbrachten drei Tage in Penzance. Drei Tage. Kannst du dir das vorstellen?«
Ich kicherte. »Ich denke schon.«
»Und der Empfang fand in einem Mehrzwecksaal im Royal statt. Kein Festzelt hier oben auf dem Rasen für uns.«
»Aber Onkel Joshua war bei der Hochzeit. Ich habe ihn auf den Fotos gesehen.«
»O ja, er war da und hat mich und deine Mutter sehr von oben herab behandelt.«
»Er war nie der Typ, der ...«
»Was weißt du denn schon?« Mein Vater richtete sich auf, nachdem er mit zusammengekniffenen Augen an seinem Billardqueue entlanggeschaut hatte, und sah mich an. »Du hast die harte Seite seiner Natur nie erlebt. Er hätte ein bißchen mehr für uns tun können, als nur zu unserer Hochzeit erscheinen, nicht? Er besaß Geld und ein großes Haus, in dem man hätte feiern können. Aber hat er vielleicht angeboten, uns zu helfen? Den Teufel hat er getan.«
»Aber am Ende hat er uns doch geholfen, nicht? Unabsichtlich, meine ich. Er ließ sich von dem Mann ermorden, der alles hätte erben sollen. Das Geld und das Haus.«
»Ja.« Die Augen meines Vaters schienen in die weite Ferne zu schauen. »Das hat er.«
»Michael Lanyon.«
»Ich kenne seinen Namen, Junge. Ich kenne ihn gut.«
»Komisch, nicht?« Warum war mir das nicht früher eingefallen? Daran mußte Nicky gedacht haben, als er die vornehmen und reichen Leute beobachtete, die sich auf dem Rasen gegenseitig bewunderten. Daß sie seine Freunde hätten sein können, die eine Party in seinem Haus besuchten, seine Speisen aßen, seinen Champagner tranken. Wenn sein Vater nicht wegen des Mordes an Joshua Carnoweth verurteilt worden wäre. Weil das Gesetz nicht zuläßt, daß ein Mörder von seinem Verbrechen profitiert, indem er das Vermögen seines Opfers erbt. Aber es läßt zu, daß sein Sohn von dem verwiesen wird, was andernfalls sein Eigentum gewesen wäre – ohne Gewissensbisse.
»Was ist so komisch?«
»Wie Dinge manchmal ausgehen.«
Danach war Dad nicht mehr so recht bei der Sache, aber mir ging es genauso, also gewann er trotzdem mit sicherem Vorsprung. Wir gingen zurück in die Halle, wo Mum mittlerweile eingeschlafen war und Trevor sich rasch erbot, sie nach Hause zu fahren. Nachdem meine Eltern fort waren, wollte ich mich eigentlich schleunigst ins Bett verziehen. Aber Pam bestand darauf, daß ich mit ihr noch einen Kaffee trank, und irgendwie war ich sicher, daß sie dabei nicht beabsichtigte, unsere Eindrücke von Tabithas Outfit bei der Abreise auszutauschen.
»Trevor hat mir von Nicky erzählt.«
»Aha.«
»Was macht er in Truro?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Er war dein Freund.«
»Bei dir klingt das wie eine Anklage.«
»Tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint. Ich bin müde und ... Ich möchte nicht, daß irgend etwas den Tag verdirbt.«
»Nichts hat den Tag verdorben.«
»Nein, aber ... Meinst du, daß es Zufall war? Daß er heute nachmittag hier aufgetaucht ist.«
»Ich bin nicht sicher. Er hat gesagt, er hätte von dem Fest gelesen.«
Sie runzelte die Stirn. »Das muß der Artikel letzte Woche im West Briton gewesen sein. Mums und Dads goldene Hochzeit, verbunden mit ein bißchen kostenloser Werbung für die Empfänge, die wir ausrichten. Trevor hielt es für eine gute Idee.«
»Aber du nicht?«
»Na ja, da lag der Tag ja eigentlich noch vor ihnen, oder? Und Tabs und Dominic ... Ich dachte einfach, man hätte es hinterher machen sollen.« Sie seufzte. »Ich halte nichts davon, die Vorsehung herauszufordern.«
»Mach dir keine Sorgen. Sieht so aus, als hätte die Vorsehung der Herausforderung widerstanden.«
»Hoffen wir's.« Mit schwesterlicher Besorgnis sah sie mich an. »War es ein Schock für dich, ihn nach all den Jahren wiederzusehen?«
»Natürlich.«
»Wie sah er aus?«
»Heruntergekommen.«
»Und wie hat er auf dich gewirkt?«
»Verwirrt. Durcheinander. Verzweifelt.«
»Nicht ganz bei sich, meinte Trevor.«
»Kann sein.«
»Wo lebt er jetzt?«
»Das hat er nicht gesagt.«
»Und auch nicht, warum er zurückgekommen ist?«
»Nein«, log ich feierlich. »Kein Wort.«
Ich träumte in dieser Nacht nicht von Nicky, was an sich schon ein Sieg war. Ich schlief tief und fest in dem Zimmer, das ich bewohnt hatte, als wir Anfang 1948 in Tredower House einzogen. Es war eine sentimentale Geste von Pam, mir dieses Zimmer zu geben. Sie konnte nicht wissen, daß mir ein Zimmer mit weniger Erinnerungen an die Vergangenheit lieber gewesen wäre.
Als ich erwachte, früh, und nichts hörte als Vogelgezwitscher und die verkehrslose Stille des Sonntagmorgens, mußte ich an den Tag unseres Umzugs aus der Crescent Road denken. Großmutter hatte ihn geplant wie einen militärischen Feldzug und muß sich gefreut haben, wie glatt er verlief. Natürlich hatte sie lange genug Zeit gehabt, um ihre Pläne auszuarbeiten. Sie hatte gewußt, daß wir dort landen würden, seit Onkel Joshua im August des Vorjahres gestorben war. Und sie hatte angenommen, daß der Mann, dem er das Haus hatte vermachen wollen, wegen des Mordes an ihm verurteilt werden würde, wie es dann ja auch geschah.
Da war es schon fast sechs Monate her, daß ich Nicky zum letztenmal gesehen hatte. Sechs Monate, aus denen vierunddreißig Jahre werden sollten, karg und hart, durch unsere Jugend und Erwachsenenjahre. Schon damals war er für mich verloren. Und ich war froh. Es bedeutete, daß ich das tun konnte, was alle von mir erwarteten: ihn vergessen.
Im Rückblick konnte ich mir mein Verhalten verzeihen. Die Ungeheuerlichkeit des Mordes – und das Kainszeichen der stellvertretenden Rolle meines Freundes dabei – hätte wohl jeden Elfjährigen beeindruckt. Besonders, da meine Familie und halb Truro so glücklich damit schienen, die Schuld auf alle Lanyons auszudehnen, ganz gleich, wie alt sie waren. Doch inzwischen genügte das nicht mehr. Ich war kein Kind mehr. Ich hatte mein ganzes erwachsenes Leben hindurch Zeit gehabt, Nicky aufzuspüren und herauszufinden, ob ich ihm helfen konnte, die Tatsache zu bewältigen, daß sein Vater ein Mörder war. Aber das hatte ich nicht getan. Statt dessen hatte ich mich von ihm aufspüren lassen.
Ich duschte, zog mir etwas an und ging hinaus auf das Gelände, zuversichtlich, daß so früh noch niemand auf sein würde. Das Festzelt stand noch da. Der Rasen war übersät mit Papierservietten, weggeworfenen Cocktailpickern, Zigarettenkippen, Champagnerkorken und Miniaturschneewehen aus Konfetti, die im Laufe der Nacht von der Zufahrt herübergeweht worden waren. Später würden die Leute vom Catering-Service kommen und Ordnung machen, aber im Augenblick war alles still und trostlos, aber seltsam friedvoll.
Ich ertappte mich bei dem Wunsch, Nicky würde jetzt erscheinen, da ich auf ihn vorbereitet war und frei sprechen konnte, denn niemand war anwesend, der sich hätte einmischen können. Ich nahm den langen Weg um den Rasen herum zu der Stelle, an der ich ihn am Nachmittag des Vortags gesehen hatte. Irgendwie hoffte ich, er sei zurückgekommen und warte darauf, mir eine zweite Chance zu geben. Eigentlich war es mehr eine Phantasie als eine Hoffnung. Das Leben ist geizig mit zweiten Chancen. Das wußte ich. Deswegen zuckte ich überrascht zusammen, als ich die Gestalt unter der Roßkastanie erblickte.
Ich hob die Hand, beschleunigte meine Schritte und lächelte unsicher. Aber es erfolgte keine Reaktion, und als ich mich dem Kamm der Anhöhe zwischen uns näherte, erkannte ich den Grund dafür. Mit jedem hastigen Schritt sah ich ihn deutlicher. Da war jemand, der gekleidet war wie Nicky. Er stand nicht, und er schaukelte auch nicht. Er hing an einem einzigen Seil von dem Ast, nach dem ich Nicky die Hände hatte ausstrecken sehen. Er hing da, die Arme schlaff, den Kopf gesenkt, mit baumelnden Füßen.
Kapitel 2
Von meinem Stuhl vor den hohen Fenstern der Halle aus konnte ich die Krone der Roßkastanie sehen, grün und schläfrig im zunehmenden Sonnenschein. Nicht den Ast, den der Strick eingekerbt hatte, nicht das Gehölz darunter, wo sie Nicky in einen Plastiksack mit Reißverschluß gesteckt hatten. Nur das dichte grüne Laub des großen alten Baums, auf den wir in sorglosen Kindertagen geklettert waren, von dem wir Kastanien geworfen und an dem wir geschaukelt hatten. Mein Blick ruhte auf dem Baum, und ich erinnerte mich, während in der Gegenwart Metall auf Metall klirrte, als das rosa und goldene Festzelt langsam abgebaut wurde und Detective Sergeant Collins mühevoll ein weiteres Mal die Fakten durchging.
»Sind Sie sicher, daß es Nicholas Lanyon ist, ja?« Unsere Gewißheit in diesem Punkt, obwohl wir zugaben, mehr als dreißig Jahre keinen Kontakt mit ihm gehabt zu haben, gab ihm eindeutig Rätsel auf. »Mrs. Rutherford?«
»Ja«, sagte Pam. »Ich meine, das heißt, ich habe eigentlich nicht ...«
»Der Tote ist Nicky Lanyon«, warf ich ein. »Sie können sich auf mein Wort verlassen.«
»Für den Augenblick müssen wir das, Sir. Er hatte anscheinend keinerlei Papiere bei sich. Tatsächlich hatte er überhaupt nichts bei sich.«
»Kein Geld?«
»Weniger als zwei Pfund in Kleingeld.«
»Was habe ich gesagt?« bemerkte Trevor düster. »Heruntergekommen. Ich nehme an, da haben Sie Ihr Motiv.«
»Aber warum ist er hergekommen, Sir? Das ist es, was ich nicht verstehe. Sie sagten, seine Familie hätte Truro vor Jahren verlassen.«
»Vor vierunddreißig Jahren«, präzisierte ich leise. »Wenn er vorhatte, sich umzubringen, ist es vollkommen verständlich, daß er dazu hierherkam.«
»Chris«, bat Pam, »müssen wir den Sergeant wirklich mit all dem belästigen?«
»Ich denke, man sollte ihn vorwarnen, daß die Presse sich sehr für diese Geschichte interessieren wird.«
»Ich schätze, das Interesse wird minimal sein, Sir. Selbstmord ist nicht ...«
»Mord, Sergeant. Deswegen wird sie interessiert sein. Nicky Lanyons Vater und ein anderer Mann haben 1947 den Eigentümer dieses Hauses ermordet.«
Collins runzelte die Stirn. »In dem Fall haben Sie vermutlich recht. Wurden sie gehängt?«
»Nickys Vater ja. Das reicht aus, um die Gerichtsreporter die Archive durchforsten zu lassen, meinen Sie nicht?«
»Höchstwahrscheinlich. Wissen Sie irgend etwas über nahe Angehörige?«
»Nicky hat gesagt, seine Mutter sei tot.«
»Irgendwelche Geschwister?«
»Keine lebenden.«
»Irgend jemand in Truro, der vielleicht doch noch mit ihm in Verbindung stand?«
»Nicht daß ich wüßte.«
»Moment«, sagte Pam. »Gab es da nicht eine Tante?«
»Ja«, antwortete ich, einen Augenblick lang erstaunt darüber, wie leicht und vollkommen ich alles vergessen hatte. »Nickys Mutter hatte eine Schwester, die in eine Farmerfamilie unten in Roseland einheiratete – die Jagos. Er verbrachte jeden Sommer eine Woche bei ihnen. Ich ... bin einmal mit ihm dort gewesen.«
»Dann werden Sie wissen, wo wir sie finden können.«
»Ja.« Meine Augen konzentrierten sich wieder auf die Roßkastanie. »Das weiß ich.«
Detective Sergeant Collins sah aus, als sei er 1947 noch nicht geboren gewesen. Kein Wunder, daß der Name Lanyon ihm nichts sagte. Es war so lange her. Aber nicht so lange wie der Beginn der ganzen Geschichte. Dazu mußte man viel weiter zurückgehen. Bis zur Jahrhundertwende und darüber hinaus. In eine Zeit, als die Kathedrale von Truro erst halb fertig war, ein riesiges, von Gerüsten umgebenes Gebäude, das im Herzen der Stadt, die es am Ende überragen würde, langsam Gestalt annahm, ein anglikanischer Kuckuck in einer Hochburg der Methodisten.
In der Hotelbar hing ein gerahmtes Foto von der Westfassade der Kathedrale, das ungefähr von 1900 stammte. Es zeigte die westliche Hälfte des Gebäudes, die noch nicht mehr war als eine leere Hülle; Steinmetze und Aufseher hatten gerade Arbeitspause und schauten von ihren luftigen Plattformen aus auf die Kamera nieder. Mein Urgroßvater, Amos Carnoweth, war nicht unter ihnen. Ich wußte das, obwohl er Steinmetz von Beruf und die Kathedrale sein letzter Arbeitsplatz gewesen war. Ich wußte es, weil er im Frühjahr 1887 auf der anderen Seite der Kathedrale nach einem Sturz vom Gerüst gestorben war. Sein Sohn Joshua war damals vierzehn Jahre alt; seine Tochter Adelaide, meine Großmutter, acht. Sie erzählte mir einmal, ihre Großmutter habe behauptet, die Tragödie sei die Strafe Gottes dafür, daß ein Methodist es gewagt hatte, Hand an anglikanischen Granit zu legen. Das war die alte Zeit.
Urgroßvaters Tod bedeutete den Auszug aus dem Haus der Familie in der Old Bridge Street. Großmutter und Onkel Joshua waren dort aufgewachsen, neben den Ställen des Red-Lion-Hotels, einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt. Die Luft war erfüllt von dem Geruch nach Dung, dem Öl, mit dem die Pferdegeschirre eingerieben wurden, und Granitstaub. Sie fanden eine billigere Unterkunft in der Tabernacle Street nahe dem Lemon Quay, wo es überwiegend nach Schmutz, Fisch und Segeltuch roch.
Die Vergangenheit ist immer näher, als man denkt. Das Red Lion wurde Ende der sechziger Jahre von einem außer Kontrolle geratenen Laster zerstört, und den Fluß, der am Lemon Quay vorbeifloß, hatte man in den zwanziger Jahren überbaut. Ich erinnere mich an die dreieckige Fläche zwischen Lemon und Back Quay nur als Parkplatz, im Norden von der inzwischen fertiggestellten, für die Ewigkeit gebauten Kathedrale überragt. Aber irgendwie scheine ich mich auch an das zu erinnern, was meine Großmutter im Gedächtnis hatte: ein anderes, dunkleres, freundlicheres Truro, mit dem schnellsten Zug von London aus in sechs Stunden zu erreichen, aber in vieler Hinsicht so fern wie Konstantinopel.
Nach dem Tod seines Vaters wurde Onkel Joshua zum Ernährer der Familie. Er arbeitete zwölf Stunden am Tag in einer Zinnmine draußen in Baldhu. Großmutter pflegte ihm zu Mittag frisch gekochte Fleischpastete zu bringen, in Tücher gewickelt, um sie warm zu halten. Drei Meilen hin und drei Meilen zurück. Damals muß eine tiefe Verbundenheit zwischen ihnen bestanden haben, eine vertrauensvolle Zärtlichkeit, und nichts in der Welt deutete darauf hin, daß das nicht ihr ganzes Leben lang so bleiben würde. Die Gesundheit ihrer Mutter ließ nach, geistig und körperlich, aber sie hielten als Familie zusammen.
Großmutter verließ die Schule mit vierzehn Jahren, obwohl sie eine vielversprechende Schülerin war, wie sie später oft klagte. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ihr Vater noch gelebt hätte, aber da ihre Mutter nicht einmal mehr in der Lage war, für andere die Wäsche zu waschen, mußte sie zum Lebensunterhalt beitragen. Sie nahm eine Stelle als Saumnäherin und Hilfsverkäuferin im Gardinengeschäft Webb's in der Boscawen Street an. Eine andere Hilfskraft in ihrem Alter, Cordelia Angwin, wurde ihre Freundin und kam regelmäßig zu Besuch in das Haus in der Tabernacle Street. Cordelia war ein hübsches, lebhaftes Mädchen, das schnell zu einer Schönheit erblühte. Zuerst schenkte Onkel Joshua ihr wenig Beachtung, aber mit der Zeit, als sie älter und ruhiger und immer schöner wurde ...
Onkel Joshua hat mir nie etwas von alldem erzählt, und Großmutter war keine verläßliche Chronistin von Ereignissen, an denen sie selbst beteiligt gewesen war, also konnte ich vieles nur vermuten. Schlußfolgerungen ziehen, sage ich lieber dazu. Als ich Joshua Carnoweth kannte, war er ein schweigsamer und mißtrauischer Mann und scheinbar unfähig zu großen romantischen Gefühlen. Doch damals lagen die Dinge anders, und auch er war anders. Er verliebte sich hoffnungslos in Cordelia Angwin und flehte sie an, ihn zu heiraten. Aber sie wollte warten und lieber einen Mann finden, der in der Lage war, ihr zu gesellschaftlichem Ansehen zu verhelfen, wozu ein einfacher Minenarbeiter kaum fähig war. Das Zerwürfnis zwischen Großmutter und Onkel Joshua geht auf jene Zeit zurück. So wie ich ihren Charakter einschätze, nehme ich an, daß ihr die Werbung des Bruders um ihre Freundin zuerst peinlich war und daß sie dann Zorn auf beide empfand, als ihr klarwurde, wie sehr er sie anbetete. Keiner von beiden benahm sich so, wie sie es wünschte – und das war etwas, das sie nie ertragen konnte.
Im Sommer 1897 spitzten sich die Dinge zu. Cordelia war damals achtzehn und hatte Onkel Joshua klargemacht, daß sie keinesfalls daran denken würde, ihn zu heiraten, ehe sie einundzwanzig war. Ich vermute, unausgesprochen stand dahinter, daß sie dachte, bis dahin würde ihr vielleicht ein besserer Ehemann über den Weg laufen. Onkel Joshua muß angenommen haben, daß er drei Jahre Zeit hatte, um sich in eine Partie zu verwandeln, die man nicht ausschlagen konnte. Im Jahr zuvor hatte sich gerade die Nachricht von einem großen Goldfund am kanadischen Yukon verbreitet. Das Gerücht, das die Arbeiter in den Zinnminen über die Hafenkneipen von Falmouth erreichte, lautete, jemand mit den richtigen Fähigkeiten könne dort ein Vermögen machen. Onkel Joshua wurde eine billige Überfahrt auf einem Frachtdampfer nach Nova Scotia angeboten. Er nahm sie in der Erwartung an, er könne sich mit Wanderarbeit an die Westküste durchschlagen und bis zum Frühjahr den Yukon erreichen. Von Cordelia ließ er sich eine Art Abschiedsversprechen geben, daß sie auf ihn warten würde. Er seinerseits versprach, vor Ablauf von drei Jahren zurückzukehren, die Taschen voller Goldstaub.
Großmutter betrachtete das als unverzeihlichen Verrat, da sie nun ganz allein für die kranke Mutter sorgen mußte. Sie dachte, wenn am Yukon reiche Funde zu machen wären, würde davon nichts mehr übrig sein, bis ihr Bruder dort ankam. Das war eine realistische Einschätzung. Aber Onkel Joshua ging fort, um seinen Traum zu verwirklichen.
Im Verlauf von Winter und Frühjahr erhielten Großmutter und Cordelia ein paar Briefe, in denen er von seinen Fortschritten auf dem Weg durch Kanada berichtete. Dann – nichts mehr. Keine Nachrichten; kein Wort; keinerlei Kontakt. Joshua Carnoweth verschwand von der Bildfläche und endlich, als die Jahre vergingen, auch aus ihren Gedanken. Vielleicht war er tot, vielleicht schämte er sich zu sehr, nach Hause zurückzukehren und seinen Mißerfolg einzugestehen – keiner wußte, wie die Dinge standen. Aber wie auch immer, er kam nicht zurück. Nicht nach drei, nicht nach sechs, nicht nach zwölf und auch nicht nach zwanzig Jahren.
Daheim in Truro begann Großmutter, mit einem jungen Mann namens Cyril Napier auszugehen. Hoffnungslose Verliebtheiten waren ihre Sache nicht. Mein Großvater wurde als genau die Art von ausgeglichenem, aber ehrgeizigem jungen Mann ausgewählt, den sie als Lebensgefährten brauchte. Seine Eltern stammten ursprünglich aus Worcestershire. Sie waren einige Jahre zuvor nach Cornwall gezogen und hatten in der River Street ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Sein Vater kränkelte und hatte gehofft, das mildere Klima von Cornwall werde ihm wohltun. Vielleicht traf dies zu, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Er starb kurz nach der Verlobung von Großmutter und Großvater. Sie setzten den Hochzeitstermin früher an, um das Geschäft als verheiratetes Paar führen zu können, und zogen, um Geld zu sparen, mit beiden Müttern in das Haus der Napiers in der Carclew Street ein. Großvaters Mutter half natürlich im Geschäft, was bedeutete, daß sie niemanden einstellen mußten. Es war harte Arbeit, der Laden hatte an sechs Tagen in der Woche von sieben Uhr morgens bis acht Uhr abends geöffnet, aber er gehörte ihnen, und die Carclew Street lag ein wenig höher den Hügel hinauf, sowohl topographisch als auch sozial. Die Geburt meines Vaters 1905 bedeutete, daß sie mit ihrer Arbeit auch das Los der nächsten Generation verbesserten. Großmutter baute für die Zukunft vor.
In gewissem Sinn tat das auch Cordelia Angwin. Sie verließ Webb's und trat in einem großen Haus in der Falmouth Road in Dienst. Sie wartete auf Onkel Joshua – oder ein besseres Angebot, je nachdem, wie zynisch man sein will –, bis sie einundzwanzig war und noch weit darüber hinaus. Sie und Großmutter verloren sich aus den Augen, obwohl sie sich von Zeit zu Zeit begegnet sein müssen; Truro ist eine zu kleine Stadt, als daß dies zu vermeiden gewesen wäre. Was sie bei solchen Gelegenheiten sagten oder dachten, weiß ich nicht.
Ungefähr zehn Jahre nach Onkel Joshuas Abreise ins unbekannte Kanada heiratete Cordelia. Ihr Mann arbeitete als Hilfskraft im Stadtrat. Sein Name war Archie Lanyon. Sie zogen in ein kleines Haus in der St. Austell Street, wo 1910 ihr erstes und einziges Kind geboren wurde. Sie tauften es auf den Namen Michael.
Im gleichen Jahr wurde die Kathedrale fertiggestellt, und die Steinmetze mußten sich anderswo nach Arbeit umsehen.
Detective Sergeant Collins war längst gegangen und die meisten Angestellten des Catering-Services, die aufgeräumt hatten, ebenfalls. Vom Rasen aus sah ich zu, wie die Männer von der Firma, bei der das Festzelt gemietet worden war, die letzten Teile auf einen Lastwagen verluden, der auf halber Höhe der Zufahrt stand. Der Nachmittag war still und schwül, die Sonne schien warm auf mein Gesicht. Irgendein kleines Tier raschelte im Blattwerk unter den Bäumen jenseits der Blumenbeete. Ohne die Phantasie allzusehr zu bemühen, hätte man die Entdeckung, die ich an diesem Morgen gemacht hatte, ins Reich der Illusion verweisen können. Doch ihre Folgen waren nicht zu ignorieren. Ich sah noch immer Nickys schief herunterhängenden Kopf, sein mit getrocknetem Speichel verkrustetes Kinn, seine geschwollen aus dem Mund ragende Zunge und seine toten, starrenden – mich anstarrenden – Augen.
»Chris!« hörte ich Pam aus dem Haus rufen und drehte mich um. Sie kam mir entgegen, einen Schlüsselbund in der Hand. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja. Ich denke schon.«
»Ich werde runterfahren und Mum und Dad berichten, was passiert ist. Ich dachte, das ist besser als ein Anruf.«
»Gute Idee.«
»Willst du mitkommen?«
»Nein, danke. Ich ... eh ...«
»Mußt du woanders hin?«
Ich lächelte verlegen. »Ja. Ich werde vermutlich ... fahren, wenn du fort bist.«
»Um die Jagos zu besuchen?«
»Anscheinend kannst du Gedanken lesen.«
»Ich dachte, daß du entweder zu ihnen oder geradewegs zurück nach Pangbourne fahren würdest.«
»Nein. Ich ... glaube, ich werde vielleicht ein paar Tage bleiben. Wenn das geht.«
»Kein Problem.«
»Natürlich, wenn du das Zimmer brauchst ...«
»Ich habe gesagt: kein Problem.«
»Ja, hast du. Danke. Ich ...«
»Chris, da ist etwas, das du wissen solltest. Über die Jagos. Sie hatten einen Sohn, nicht?«
»Ja. Tommy. Ein paar Jahre jünger als Nicky und ich.«
»Er ist gestorben. Vor einer Weile. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ein Unfall auf der Farm. Er ist von einem Traktor überrollt worden, glaube ich. Irgend etwas in der Art.«
Ich wandte den Blick ab. »Na, großartig. Das ist einfach großartig.«
»Ich wollte dir davon erzählen, aber bis wir das nächste Mal von dir hörten ... muß ich es vergessen haben.«
»Mach dir nichts draus.« Mit einer flüchtigen Geste brüderlicher Zuneigung legte ich einen Arm um sie. »Sag Mum und Dad, daß es mir wirklich leid tut, falls ihnen das ihren Hochzeitstag verdorben hat.«
»Es ist nicht deine Schuld.« Sie seufzte. »Wenigstens ist es nicht in der Nacht davor passiert.«
»Das wäre unmöglich gewesen.«
Stirnrunzelnd sah sie mich an. »Wieso das?«
»Weil er da noch nicht hier war. Deswegen ist es doch teilweise meine Schuld. Er hat auf mich gewartet. Er wollte, daß ich hier bin, wenn er es tut, er wollte, daß ich sehe, wie er hinterher aussieht.«
»Das kannst du doch gar nicht wissen.«
»Ich glaube doch.«
»Aber warum? Welchen Sinn sollte das haben?«
»Ich bin mir nicht sicher. Aber ich werde versuchen, es herauszufinden.«
»Und du meinst, die Jagos könnten dir helfen?«
»Vielleicht. Irgendwo muß ich ja anfangen.«
»Du mußt überhaupt nicht anfangen. Keiner zwingt dich.«
»Nein? Nun, ich will dir etwas sagen, Pam. Ich fühle mich wirklich so, als wäre ich gezwungen.«
Onkel Joshua sprach niemals offen über seine Jahre in Nordamerika. Die ausführlichste Information, die ich je von ihm bekam, gab er mir, als er mich eines Tages dabei antraf, wie ich eine Landkarte von Alaska und dem Yukon-Gebiet Kanadas betrachtete. Sie befand sich in einem großen alten Atlas in der Bibliothek in Tredower House. Die meisten Bücher hatte er als Partie von Lady Pencavel übernommen, ich nehme an, um die Regale zu füllen, denn keiner hätte ihn als Bücherfreund bezeichnet. Aber Landkarten schien er zu mögen. Vielleicht erinnerten sie ihn an seine Wanderjahre. Diese Jahre müssen irgendeinem Bedürfnis seiner Seele entsprochen haben, sonst hätte er sie nicht so lange ausgedehnt. Und es überraschte mich nicht, daß der Atlas sich immer von selbst an dieser bestimmten Stelle zu öffnen schien.