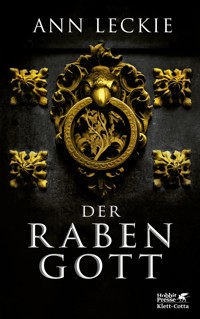
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Englisch
»Es ist ein reines Vergnügen, etwas so Anderes, so Wunderbares zu lesen.« Patrick Rothfuss Seit Jahrhunderten wird das Königreich Iraden von einem Gott beschützt: Er heißt der Rabe und residiert in einem Turm in der mächtigen Hafenstadt Vastai. Von dort wacht er über das Reich. Seinen göttlichen Willen lässt er über einen Rabenvogel an seinen menschlichen »Statthalter« kundtun. Der Vogel des Rabengottes ist tot, und die göttliche Regel schreibt vor, auch der "Statthalter" muss unverzüglich sterben, um Platz für seinen Nachfolger zu machen. Als Mawat, der rechtmäßige Erbe, mit seinem Freund, dem Kämpfer Eolo, in der Hauptstadt eintrifft, sitzt bereits ein Regent auf dem Herrscherstuhl – sein Onkel. Mawats Zorn kennt keine Grenzen und während er versucht, sein Reich zurückzuerobern, entdeckt Eolo, dass der Turm des Raben ein dunkles Geheimnis birgt: In seinem Fundament harrt eine Prophezeiung, die, wenn sie sich erfüllt, Iraden für immer zerstören könnte. Die preisgekrönte Science Fiction-Autorin Ann Leckie legt mit dem Rabengott ihren ersten High Fantasy-Roman vor. »Scharfsinnig, vielschichtig und, wie immer bei Leckie, hochintelligent.« Kirkus Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ann Leckie
Der Rabengott
Aus dem Englischen von Michael Pfingstl
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Raven Tower« im Verlag Orbit, an Imprint of Little Brown Book Group, London
© 2019 by Ann Leckie
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Klett-Cotta
unter Verwendung der Daten des Originalverlags, Abbildung: © Deborah Pendell/Arcangel
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solution, Nördlingen
Illustrationen: VladimirCeresna/shutterstock.com, In Art/shutterstock.com, Potapov Alexander/shutterstock.com, Net Vector/shutterstock.com
Karte: © Tim Paul
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96602-2
E-Book ISBN 978-3-608-12292-3
ES WIRD
EINE
ABRECHNUNG
GEBEN.
Karte von Ard Vusktia und Vastai
Als ich dich das erste Mal sah, kamst du zu Pferde zwischen den Bäumen hervor. Du rittest an den hohen, glupschäugigen Opferpfählen vorbei, die die Grenze des Waldes markierten, dein Pferd ging im Schritt, und neben dir ritt Mawat, den ich bereits kannte: groß und breitschultrig, die langen Haare zu Dutzenden Zöpfen geflochten, die von einem breiten, mit ziselierten Federn verzierten Goldreif zusammengehalten wurden. Sein dunkelgrauer Mantel war mit blauer Seide gesäumt, und seine Unterarme waren mit weiterem Goldschmuck behangen. Er lächelte vage und sagte etwas zu dir, doch seine Augen waren auf die kleine Halbinsel vor euch gerichtet, auf die Festung von Vastai, eine von einer blassgelben Kalksteinmauer eingefasste Ansammlung zwei- und dreistöckiger Gebäude mit einem runden Turm am Meeressaum, die immer noch etwa zwölf Meilen entfernt war. Vor der Festung, durch eine Böschung und einen Graben abgegrenzt, erstreckte sich eine kleine Stadt. Über den wenigen Schiffen im Hafen von Vastai kreisten Möwen, wie auch über dem grauen, vom Wind weiß gefleckten Meer, auf dem hier und da ein Segel zu sehen war. Auf der anderen Seite der Meerenge konntest du die weißen Steinbauten von Ard Vusktia und die weit zahlreicheren Schiffe in dessen Hafen erkennen.
Mawat – und Vastai – kannte ich, aber dich hatte ich noch nie gesehen, also schaute ich genauer. Du warst kleiner und schlanker als Mawat. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn nicht, denn die Festungsbewohner von Vastai essen so viel besser und regelmäßiger als die Bauern, von denen du wahrscheinlich abstammst. Du trugst dein Haar kurz geschnitten, ein Armreif und der Griff des Messers an deinem Gürtel waren das einzige Gold an dir. Deine Hose, dein Hemd, deine Stiefel und dein Mantel waren einfach, aber solide, alles in matten Grün- und Brauntönen. Der Griff deines Schwertes bestand aus mit Leder umwickeltem Holz, ohne Verzierungen, und obwohl dein Pferd nur im Schritt ging, saßest du steif im Sattel, was daran gelegen haben mochte, dass du früh geweckt worden und nun seit drei Tagen unterbrochen unterwegs warst – Pausen hattet ihr nur gemacht, wenn die Pferde sie brauchten. Zudem hattest du wahrscheinlich nur wenig Erfahrung im Reiten gesammelt, bevor du Soldat geworden warst.
Mawat sagte: »Wie es scheint, sind wir gut vorangekommen, und das Instrument weilt noch unter uns. Andernfalls wäre der Turm schwarz beflaggt, und auf dem Hof würde jetzt reges Treiben herrschen. Aber selbst wenn es so wäre, hätten wir keinen Grund zur Eile. Es wäre leichter für dich – und die Pferde –, wenn wir weiter im Schritt reiten, denke ich.« Und dann, wegen des Ausdrucks auf deinem Gesicht: »Was ist?«
»Ich …«
Du holtest tief Luft. Es war klar, dass du ihm weit mehr vertrautest als vielen anderen auf dieser Welt, denn sonst wärst du gar nicht erst an seiner Seite geritten, wie ich stark vermute. Du schienst außerdem zu dem Schluss gekommen zu sein, dass er dir ebenfalls vertraute, auch wenn sein Vertrauen in dich weit gelassener gewesen sein dürfte als deines in ihn, wo er doch so viel Macht über dich hatte und du keine über ihn.
»Mein Lord, normalerweise … redet man nicht über diese Dinge.«
Nein, das tat man nicht, nicht einmal in Vastai. Der Statthalter des Raben allerdings schon, sein Erbe und der engste Familienkreis ebenfalls. Und die Dienerschaft natürlich; die Dienerschaft wird allzu oft vergessen.
»Ich habe nichts verraten, was niemand wissen darf«, erwiderte Mawat. »Oder etwas Unziemliches gesagt.«
War es seltsam für dich, ihn so unbekümmert reden zu hören, wo der Tod seines Vaters so kurz bevorstand? Denn der Tod des Statthalters von Iraden ist die notwendige Konsequenz, wenn das Instrument stirbt …
Und als Erbe würde Mawat den Platz seines Vaters einnehmen und sich verpflichten, mit dem nächsten Instrument ebenfalls zu sterben.
Das gemeine Volk hatte weniger unter der Amtszeit von Mawats Vater zu leiden gehabt, als es hätte sein können. Das heißt nicht, dass er großzügig gewesen wäre oder die Bauern unter seiner Herrschaft glücklicher gewesen wären als sonst. Aber es hätte schlimmer kommen können, und da ein neuer Statthalter stets eine unbekannte Größe ist, wünschten die Iradeni Mawats Vater, wenn sie denn von ihm sprachen, vor allem lang anhaltende Gesundheit. Und für jemanden, der so jung ist wie du, bedeutet das: schon ein ganzes Leben lang.
Ihr beide rittet eine Weile schweigend dahin, Schafe sprenkelten die Wiesen links und rechts der Straße, hoch über euren Köpfen jagten zwei Raben wie schwarze Erscheinungen über den blauen Himmel.
Mawats Stirn lag in Falten, als er sagte: »Eolo.«
Du sahst ihn an, auf der Hut. »Mein Lord.«
»Ich weiß, ich habe versprochen, meine Nase nicht in Dinge zu stecken, die mich nichts angehen, aber wenn ich einmal Statthalter sein werde, kann ich um Dinge bitten. Ich meine, das kann jeder, aber die Frage ist, ob der Rabe auch zuhört, und es ist immer ein Preis zu bezahlen. Mich wird der Rabe anhören, und mein Preis ist bereits bezahlt – oder wird es sein. Ich könnte ihn um einen Gefallen bitten, der Rabe ist ein mächtiger Gott und könnte dafür sorgen … dass du …« Mawat machte eine vage Geste. »… dass du sein kannst, wer du bist.«
»Ich bin bereits, wer ich bin«, schnauztest du. »Mein Lord.« Und nach kurzem Schweigen: »Das ist nicht der Grund, weshalb ich hier bin.«
»Nein, ist es nicht«, bestätigte Mawat gekränkt, dann besann er sich und lächelte entschuldigend. »Sondern aus einem anderen Grund. Du bist hier, weil ich dich aus dem Bett in den Sattel befohlen habe, obwohl du kein guter Reiter bist, und jetzt sitzt du seit drei Tagen im Sattel, ohne zu klagen, und ich weiß, dass du inzwischen wund sein musst.«
Nach einer Weile erwidertest du: »Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde.«
»Nein?«, fragte Mawat überrascht. »Warum nicht? Es wäre viel bequemer für dich, oder etwa nicht? Du müsstest dich nicht mehr einwickeln, nichts mehr verstecken.« Und als du nicht reagiertest, fügte er hinzu: »Ah, jetzt bin ich wohl doch zu neugierig.«
»Ja, mein Lord«, bestätigtest du angespannt, aber ruhig.
Mawat lachte. »Dann höre ich wohl besser auf damit. Aber wenn du dich umentscheiden solltest, dann …«
»Ja, mein Lord«, sagtest du, dein Tonfall immer noch angespannt. Den Rest des Weges legtet ihr schweigend zurück.
***
Im Vergleich zu Städten wie Kybal, aus dem die Seide für Mawats Umhang stammte, oder dem weit entfernten Therete, von dem wahrscheinlich niemand in Iraden je gehört hat, ist Vastai klein. Oder erst Xulah, jener Stadt der Eroberer im heißen und trockenen Süden. Ja selbst im Vergleich zu Ard Vusktia auf der anderen Seite der Meerenge ist Vastai kaum mehr als ein großes Dorf.
Du folgtest Mawat durch die engen gepflasterten Straßen. Menschen in selbstgefärbten Grün- und Brauntönen, aber auch ein oder zwei, die feinere Kleider trugen, wichen euch aus, drückten sich stumm an die gelben Kalksteinmauern und blickten zu Boden. Dir fiel es nicht auf, aber die Straßen waren viel leerer, als sie es angesichts des für die Jahreszeit warmen Tages und der Zahl der Boote im Hafen hätten sein müssen.
Auch Mawat schien nichts zu bemerken. Ich glaube, er war schon innerlich angespannt gewesen, seit ihr den Wald verlassen hattet, auch wenn er es verbarg. Und jetzt, so schien es mir, spitzte sich die Anspannung zu, während seine Gedanken sich unweigerlich dem zweischneidigen Zweck der Reise zuwandten: seinen Vater sterben zu sehen, um dann in seine Fußstapfen zu treten. Er hielt weder an, noch wurde er langsamer oder drehte sich auch nur um, um sich zu vergewissern, dass du ihm folgtest. Er ritt einfach weiter die Hauptstraße entlang, über den großen gelb gepflasterten Platz vor den breiten Festungstoren und dann unbehelligt durch das Tor auf den Innenhof.
Der Platz war mit demselben gelben Stein gepflastert, der in ganz Vastai verwendet wurde. Das Haupthaus, lang und niedrig, die Küche dahinter, die Ställe und Lagerräume, mehrere zweistöckige Gebäude mit Schreibstuben und Wohngemächern, in der Mitte der Brunnen, jenes breite Steinbecken mit dem gemauerten Sims darum herum, und natürlich der hoch aufragende runde Turm – alles aus dem gleichen gelben Kalkstein.
Ein Rabe stieß herab, um sich auf deinem Sattelknauf niederzulassen, und du schrecktest auf.
»Keine Angst«, sagte Mawat. »Das ist er nicht.«
Der Rabe machte ein zirpendes Geräusch. »Seid gegrüßt«, sagte er, »seid gegrüßt.«
Während du den Vogel anstarrtest, stieg Mawat ab. Diener eilten herbei, um ihm sein Pferd abzunehmen. Er hob den Blick und bedeutete dir, es ihm gleichzutun, damit die Diener auch dein Pferd übernehmen konnten.
»Freust du dich, aus dem Sattel zu kommen?«, fragte er mit einem gut gelaunten, wenn auch ein wenig gezwungenen Lächeln.
»Ja, mein Lord«, antwortetest du mit gerunzelter Stirn. Der Rabe blieb ruhig sitzen, während die Diener dein Pferd wegführten.
Wie mir schien, hattest du gerade eine Frage stellen wollen, da stach dir ein Wirbel aus grüner und roter Seide ins Auge. Du drehtest den Kopf und sahst eine hochgewachsene Frau vorbeischreiten. Sie trug einen Korb mit gekämmter Wolle auf dem Kopf. Die in ihre Zöpfe geflochtenen Gold- und Glasperlen schwangen klickend hin und her, glänzend auf ihrer braunen Haut.
»Oho«, sagte Mawat und beobachtete, wie du sie beobachtetest, während ihr Rocksaum sich im Takt ihres lebhaften Gangs bauschte. »Jemand scheint deine Aufmerksamkeit erregt zu haben.«
»Wer ist die Dame?«, fragtest du. Und dann, vielleicht um dein Unbehagen zu verbergen: »Sie ist sehr …« Du wusstest nicht, wie du den Satz beenden solltest.
»Das ist sie«, bestätigte Mawat. »Ihr Name ist Tikaz. Sie ist Radihaws Tochter.«
Du kanntest den Namen, wahrscheinlich hatte Mawat ihn schon mehr als einmal genannt, seit du in seinen Diensten warst. Außerdem hatte wahrscheinlich so gut wie jeder in diesem Land schon einmal von Lord Radihaw gehört, dem ranghöchsten Berater des Statthalters und wichtigsten Mitglied des Rates der Weisungen. Er war zweifellos einer der mächtigsten Männer in ganz Iraden.
»Oh«, sagtest du nur.
Mawat prustete amüsiert. »Wir sind mehr oder weniger seit unserer Kindheit befreundet. Ihr Vater hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass ich sie heirate oder zumindest schwängere, damit er einen Enkel auf die Bank des Statthalters setzen kann. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch gar nichts dagegen, aber Tikaz …« Er wedelte mit der Hand, vielleicht um einen Gedanken zu verscheuchen. »… tut, was immer ihr beliebt. Lass uns in den Saal gehen und sehen, ob wir …«
Er wurde von einem Diener im lockeren schwarzen Überwurf eines Turmwächters unterbrochen. »Lord Mawat, wenn es mir erlaubt ist«, sagte der Diener mit einer Verbeugung. »Der Statthalter wünscht Eure Anwesenheit.«
»Natürlich«, antwortete Mawat mit leicht gezwungener Freundlichkeit.
Du legtest die Stirn in Falten, doch dann, wohl wissend, dass du hier in Vastai auf jedes Wort und jede Geste achten musstest, setztest du ein ganz und gar höflich-harmloses Gesicht auf.
»Komm mit«, sagte Mawat knapp. Es war weder eine Frage noch ein Angebot. Er wartete auch nicht auf deine Antwort, sondern drehte sich um und schritt über die blassgelben Steine des Turmhofs. Und natürlich folgtest du ihm.
***
Der Rabenturm ist eigentlich nur im Vergleich zu den Gebäuden um ihn herum ein richtiger Turm. Er steht an der äußersten Spitze der winzigen Halbinsel, auf der die Festung von Vastai erbaut ist: drei breite, runde Stockwerke aus gelblichem Stein mit einer Brüstung auf dem Dach. Im fensterlosen Erdgeschoss gibt es einen einzigen breiten Eingang, durch den du Mawat folgtest. Die Wachen sahen ihn nicht an und rührten sich auch nicht, als ihr eintratet. Das Erdgeschoss war mit noch mehr gelbem Stein gepflastert und mit Matten aus geflochtenen Binsen ausgelegt. Die Wache dort hob die Hand, um euch aufzuhalten, aber Mawat ignorierte sie und schritt die Treppe hinauf, entschlossen, aber nicht übereilt, den Blick geradeaus, die Schultern gestrafft.
Du gingst hinter ihm her und warfst dem unglücklichen Wachsoldaten einen Blick zu, vielleicht aus einem gewissen Mitgefühl für sein Dilemma, drehtest dich aber schon nach einem Moment wieder zu Mawat um. Als du die Stufen hinaufstiegst, zeigte sich gelegentlich ein Stirnrunzeln in deinem so sorgfältig ausdruckslosen Gesicht. Du kanntest die in Vastai übliche Etikette nicht, warst nicht mit ihr aufgewachsen und hattest nicht viel Übung darin, auch wenn ich sagen würde, dass du deine Sache recht gut machtest.
Es gibt ein Geräusch im Turm, ein ständiges, kaum hörbares Vibrieren. Nicht jeder nimmt es wahr, aber ich dachte, dass du es vielleicht hören konntest, denn du blicktest auf deine abgetragenen Stiefel, dann auf die Wand zu deiner Rechten und neigtest den Kopf ein Stück, als lauschtest du auf ein Geräusch. Schließlich erreichtest du den ersten Treppenabsatz mit dem weiten runden Zimmer dahinter. Mawat betrat es mit drei langen Schritten und blieb abrupt stehen.
Ein Podest. Darauf eine hölzerne Bank, in die ein Wirrwarr aus Figuren, stilisierten Blättern und Flügeln geschnitzt war. Neben der Bank kniete ein Mann in einer grauen Seidentunika mit roten Stickereien darauf. Auf der anderen Seite der Bank stand eine Frau in einem dunkelblauen Gewand, ihr dichtes graues Haar war kurz geschoren. Und auf der Bank selbst saß ein ganz in Weiß gekleideter Mann: weißes Hemd, weiße Hose, weißer Umhang. Es war ein makelloses, unbeflecktes Weiß, das nur durch das Eingreifen eines Gottes möglich ist oder durch die Arbeit von Dutzenden Dienern, die nichts anderes tun als bleichen und waschen.
Zweifellos nahmst du an, dass der Mann auf der Bank Mawats Vater sei, der Statthalter des Raben. Niemand sonst hätte es gewagt, sich darauf zu setzen. Wie jeder Iradeni weiß, ist das – vorausgesetzt, man überlebt – der letzte, endgültige Beweis dafür, dass der Rabe seinen neuen Statthalter akzeptiert hat. Du hattest die Bank noch nie gesehen, aber du erkanntest sie sofort.
Wahrscheinlich konntest du anhand der kantigen Gesichtszüge erraten, wer der kniende Mann war, denn du warst nur wenige Minuten zuvor seiner Tochter begegnet. Und selbst wenn nicht, war dir mit Sicherheit klar, dass es sich um den Lord Radihaw vom Rat der Weisungen handelte, denn wer sonst sollte sich so nahe neben dem Statthalter aufhalten? Damit musste es sich bei der Frau auf der anderen Seite um Zezume von den Stillen handeln. Außerhalb von Vastai sind die Zusammenkünfte der Stillen kaum mehr als eine Gelegenheit zu Tratsch und Völlerei für alte Frauen, doch in ihren Anfangstagen waren sie ein geheimer Religionsbund gewesen. Bis heute werden auf den Versammlungen der Stillen Rituale abgehalten, um Götter zu speisen und zu besänftigen, die schon lange aus Iraden verschwunden sind, und hier in Vastai erfüllen sie eine wichtige Funktion bei den Aufgaben des Statthalters.
Vor dem Podest standen drei Besucher aus Xulah, ihre Beine waren nackt, ihre Umhänge und Tuniken kurz, die Stiefel offen. Eine vierte Person, die etwas vernünftiger in Jacke und Hose gekleidet war, sprach gerade zum Statthalter.
»Nur um die Meerenge zu überqueren, Guter und Großzügiger. Nur diese drei Xulahni, die aus dem fernen Süden auf dem Weg in den hohen Norden sind, und ihre Diener.«
»Das ist eine lange Reise«, bemerkte der Lord Radihaw. »Und im Norden gibt es nichts außer Fels und Eis.«
»Sie wünschen Orte zu sehen, die sie noch nie gesehen haben«, sagte die Person in Jacke und Hose. »Wenn sie genug gesehen haben und nicht vorher sterben, werden sie nach Hause zurückkehren und einen Bericht über ihre Reisen schreiben, mit dem sie sich die Hochachtung ihrer Mit-Xulahni zu verdienen hoffen.«
Du beobachtetest die Szene und starrtest abwechselnd den weiß gekleideten Statthalter und die Gruppe halb nackter Xulahni an. Du hattest sicher schon von Xulah gehört, denn hin und wieder gelangen Waren aus Xulah über die Berge zum Volk der Tel, die südlich von Iraden leben. Oder die Waren finden ihren Weg auf ein Schiff, und jedes davon, das vom Schultermeer in den Nördlichen Ozean fährt, muss die Meerenge passieren und dafür Zoll an die Herrscher von Iraden und Ard Vusktia entrichten. Nur deshalb tragen der Statthalter, die hohen Mitglieder der Stillen sowie der Rat der Weisungen Kleidung aus Seide, trinken Wein und essen gelegentlich in Honig eingelegte Feigen.
Auch Mawats Blick war starr – er sah jedoch nicht die Xulahni an, sondern den Statthalter. Er schaute ungläubig zu Radihaw, dann stirnrunzelnd zu Zezume und schließlich wieder zurück zum Statthalter.
»Mawat«, sagte der Statthalter des Raben. »Willkommen zu Hause.«
Mawat erwiderte nichts und rührte sich auch nicht.
Da bemerktest du Mawats Gesichtsausdruck: seinen fassungslosen Blick, als hätte er sich in Sicherheit gewähnt, auf vertrautem Gebiet, um dann ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen. Er schien wie gelähmt, unfähig, auch nur zu atmen.
»Dies ist mein Erbe«, sagte der weiß gekleidete Mann auf der Bank über Mawats Schweigen hinweg, während die Xulahni ihn mit mehr oder weniger Interesse musterten.
»Komm zu mir«, fuhr er fort und deutete hinter sich, während Radihaw und Zezume ihn still wie Statuen flankierten.
Als Mawat sich nicht bewegte, wandte der Statthalter seine Aufmerksamkeit nach einem Moment wieder den Besuchern aus Xulah zu und sagte: »Ich werde über Eure Bitte nachdenken. Kommt morgen wieder.«
Das schien einen der Xulahni zu verärgern und dann, nachdem die Worte übersetzt worden waren, auch die anderen zwei. Sie sahen ihren Dolmetscher fragend an, dann einander. Der dritte wandte sich schließlich an den Statthalter und sagte mit seinem eigenartigen, fremdländischen Akzent: »Wir danken Euch, großer König.«
Aber der Statthalter ist kein König, und das Wort, das der Xulahni benutzte, stammte aus dem Telischen, wie es südlich von Iraden geläufig ist und das auch du beherrschst, wie ich glaube. Schließlich verbeugten sich die drei Xulahni und gingen.
Als sie fort waren, fragte Mawat mit tonloser Stimme: »Was hat das zu bedeuten?«
Einen Moment herrschte Stille – bis auf das allgegenwärtige, kaum hörbare Vibrieren, das mehr ein Gefühl ist, das man durch die Stiefelsohlen spürt, als ein Geräusch.
»Wo ist mein Vater?«, sprach Mawat weiter, als keine Antwort kam. »Und was tust du auf diesem Platz?«
Ah, nun warst du überrascht! Du hattest angenommen, der Mann auf der Bank sei niemand anderer als Mawats Vater, der schon dein ganzes Leben lang Statthalter des Raben gewesen war. Wie hättest du es auch besser wissen sollen?
»Lord Mawat«, begann Radihaw. »Bei allem Respekt, aber vergesst nicht, zu wem Ihr sprecht.«
»Ich spreche zu meinem Onkel Hibal«, erwiderte Mawat mit immer noch gepresster, tonloser Stimme. »Der unerklärlicherweise auf dem Platz des Statthalters sitzt, der allein meinem Vater gebührt. Außer der Rabe ist gestorben und der Statthalter ist ihm bereits in den Tod gefolgt, in welchem Fall der Turm schwarz beflaggt sein müsste und alle in der Festung in Trauer.« Er wandte sich der blau gekleideten Zezume zu. »Und diese Bank leer sein müsste, bis ich meinen rechtmäßigen Platz einnehme.«
»Es gab einige Komplikationen«, erwiderte Zezume. »Das Instrument starb, nur wenige Stunden nachdem der Bote zu Euch geschickt worden war. Viel früher, als wir erwartet hatten.«
»Ich verstehe immer noch nicht, Mutter Zezume«, beharrte Mawat.
»Komplikationen, ganz recht«, bestätigte der nach wie vor kniende Radihaw. »Ja, das ist die passende Beschreibung dafür.«
»Neffe«, warf Hibal mit einer Stimme ein, die Mawats irritierend ähnlich war. »Ich weiß, wie erschütternd das alles für dich sein muss. Bitte verstehe, dass wir niemals so gehandelt hätten, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Als das Instrument starb, ließ der Pfleger unverzüglich nach deinem Vater schicken, aber …« Hibal zögerte. »Er war nicht aufzufinden.«
»Nicht aufzufinden«, wiederholte Mawat.
»Lord Mawat«, meldete Radihaw sich wieder zu Wort, »die einzig mögliche Schlussfolgerung war, dass Euer Vater geflohen ist, anstatt seine vertragliche Schuld zu begleichen.«
»Nein«, widersprach Mawat. »Mein Vater ist nicht geflohen.«
»Er war unauffindbar, Mawat«, beharrte Zezume. »Ich weiß, wie verstörend das ist. Niemand von uns konnte es glauben.«
»Nehmt das zurück«, sagte Mawat, seine Stimme immer noch gepresst, aber gemessen. »Mein Vater ist nicht geflohen.«
»Wir konnten Euren Vater nicht finden«, beharrte Radihaw. »Nicht im Turm, nicht in der Festung und nicht in der Stadt. Also befragten wir den Raben nach seinem Aufenthaltsort – trotz aller Schwierigkeiten, die es bedeutet, zu einem Gott zu sprechen, der noch keinen neuen Körper hat, durch den er antworten könnte, fragten wir den Raben, was geschehen war. Seine Antwort war zweideutig.«
»Wie lautete sie?«, fragte Mawat.
»Sie lautete: Dies ist unverzeihlich. Es wird eine Abrechnung geben«, antwortete Radihaw.
»Ihr wart drei volle Tagesritte entfernt, Mawat«, warf Zezume ein.
»Und es gab dringende Angelegenheiten, die die Anwesenheit des Statthalters erforderten.«
»Wie bitte?«, fragte Mawat ungläubig. Er war jetzt sichtlich erzürnt. »Ihr wollt mir sagen, dass ein zerlumpter Haufen zitternder Xulahni die persönliche Aufmerksamkeit des Raben von Iraden erforderte?«
»Du warst zu lange nicht mehr hier, Neffe«, beschwichtigte der in Weiß gekleidete Hibal. »Es ist nur zu unserem Vorteil, wenn wir uns mit den xulahnischen Händlern gut stellen und Zugang zu ihren Gütern haben. Aus ihrem Land kommt mehr als nur Wein und Seide. Xulah hat Waffen und disziplinierte Soldaten, die wir ausleihen oder anwerben können, damit sie uns gegen die Tel zur Seite stehen, die unsere Grenzen im Südwesten bedrängen, wie du sehr gut weißt.«
»Ach, das mächtige Xulah wird uns also aus lauter Güte und Großherzigkeit ein Heer leihen, das danach friedlich wieder über die Berge abzieht?«, höhnte Mawat.
»Sarkasmus geziemt sich nicht für den Erben des Statthalters«, entgegnete Hibal.
»Es wurden keine Schwüre geleistet und keine Abmachungen getroffen«, erklärte Radihaw. »Es wurde nicht einmal verhandelt. Dies ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, die die Vernunft gebietet. Immerhin obliegt es dem Statthalter, stets vorauszublicken.«
»Fürwahr«, bekräftigte Hibal. »Angesichts der jüngsten Ereignisse solltest du hierbleiben und dich mit den hiesigen Angelegenheiten vertraut machen, denke ich, anstatt wieder zu deinem Grenzposten zurückzukehren. Du brauchst ein besseres Verständnis für die Probleme, denen wir in Vastai gegenüberstehen. Wir haben genug Krieger, um unsere Grenzen vor den wütenden Tel zu schützen. Erben jedoch, habe ich nur einen.«
»Mein Vater ist nicht geflohen«, wiederholte Mawat ein weiteres Mal. »Und du sitzt auf meinem Platz. Ich möchte den Raben befragen, wie das sein kann. Jetzt. Das ist mein Recht.«
Mawat würde dir nicht so stark vertrauen, wie er es tut – ja, er hätte dich gar nicht erst mitgenommen –, wenn du nicht schlau genug wärst, um zu erahnen, was hier vorging. Er hatte sein ganzes Leben lang nur ein Ziel vor Augen gehabt: nach dem Tod seines Vaters auf dieser Bank zu sitzen, über Iraden zu herrschen und dann seinerseits zu sterben, um die Macht des Raben zum Wohle Iradens zu stärken.
Das Amt des Statthalters bringt zahlreiche Privilegien mit sich, außerdem einen Anteil an der Herrschaft über Iraden sowie über Ard Vusktia jenseits der Meerenge, aber all das hat seinen Preis: Zwei Tage nach dem Tod des Instruments – jenes Vogels, der den Gott verkörpert, der sich selbst »der Rabe« nennt – muss auch der Statthalter sterben, als freiwilliges Opfer für den Gott. Kurz danach, während das nächste Instrument noch nicht geschlüpft ist, wird der nächste Statthalter berufen und vereidigt. Dieser Prozess dauert mehrere Tage, aber ein Rabenei, auch wenn es von einem Gott (oder zumindest von diesem Gott) bewohnt wird, braucht fast einen Monat, bis es ausgebrütet ist. Genug Zeit also, um alles Nötige zu arrangieren: dass der Statthalter stirbt, wie er es versprochen hat, und dass ein neuer Statthalter bereitsteht, um seinen Platz einzunehmen, bevor das Instrument schlüpft.
Statthalter zu sein, ist eine große Ehre, wenn auch eine nicht sonderlich hart umkämpfte, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Die Ehrgeizigen streben in der Regel eine Position im Rat der Weisungen oder das Amt der Mutter der Stillen an. Positionen mit Macht und Einfluss also, die die eigene Lebensspanne nicht begrenzen. Die Erben der Statthalter werden praktisch in ihr Amt hineingeboren und von klein auf dazu erzogen, es auszufüllen, genau wie Mawat. Doch von der Macht und den Privilegien einmal abgesehen: Sollten sie sich weigern, das Amt zu gegebener Zeit anzutreten, bleiben ihnen nur sehr wenige Alternativen.
»Wäre dies nicht mein rechtmäßiger Platz«, entgegnete Hibal gemessen, »könnte ich jetzt nicht mit dir sprechen. Hätte der Rabe mich nicht akzeptiert, wäre ich in dem Moment gestorben, in dem ich mich auf diese Bank gesetzt habe. Ich bin dieses Risiko um Iradens willen eingegangen, es gibt keinen Grund, den Gott erneut zu befragen. Du hast eine lange und anstrengende Reise hinter dir, an deren Ende dich dieser Schock erwartete. Ich wollte lediglich sicherstellen, dass du unverzüglich erfährst, wie die Dinge stehen. Geh, mein Neffe und Erbe, iss und ruh dich aus. Wir sprechen bald weiter.«
»Nehmt Euch einen Moment Zeit und denkt nach, Mawat, bitte«, drängte Zezume. »Versteht doch, wir konnten nicht anders handeln, und Ihr seid nach wie vor der Erbe des Statthalters, Ihr habt nichts verloren.«
»Nur meinen Vater«, widersprach Mawat. Und dann noch einmal: »Er ist nicht geflohen.«
Hattest du ihn schon einmal so erlebt? Normalerweise hat Mawat immer ein Lächeln auf den Lippen. Bis zu diesem Zeitpunkt war sein Lebensweg vorgezeichnet gewesen, er hatte all den Respekt genossen und jeden Luxus, den Iraden zu bieten hat. Aber manchmal verbeißt er sich in die Dinge, wird grimmig und unerbittlich und lässt nicht mehr los. So war er schon als Kind.
Wenn du es vorher noch nie erlebt hattest, dann erlebtest du es jetzt. Ich glaube, es hat dich erschreckt oder verängstigt, denn während dein Blick immer noch auf Mawat gerichtet war, wichst du einen Schritt zurück und legtest eine Hand auf die Wand, als müsstest du dich abstützen. Dann drehtest du den Kopf und starrtest deine Finger an, schließlich deine Füße, als spürtest du das schwache knirschende Vibrieren in den gelblichen Steinmauern.
Konntest du mich hören, Eolo? Kannst du mich jetzt hören?
Ich spreche zu dir.
***
Geschichten sind gefährlich für jemanden wie mich. Denn was ich sage, muss wahr sein, oder es wird wahr gemacht. Und falls es nicht wahr gemacht werden kann – wenn ich nicht über die dazu nötige Macht verfüge oder wenn das, was ich gesagt habe, schlicht unmöglich ist –, muss ich den Preis dafür bezahlen. Ich könnte zum Beispiel mehr oder weniger gefahrlos sagen: »Es war einmal ein Mann, der ritt nach Hause, um an der Beerdigung seines Vaters teilzunehmen und sein Erbe einzufordern, doch er fand die Dinge nicht so vor, wie er es erwartet hatte.« Ich bezweifle nicht, dass dergleichen sich mehr als einmal ereignet hat, seit es Väter gibt, die sterben, und Söhne, die ihnen nachfolgen.
Aber um tiefer zu gehen, müsste ich mehr Details schildern – die konkreten Handlungen konkreter Menschen und deren konkrete Folgen –, und da könnte ich unwissentlich eine Unwahrheit berichten. Daher ist es sicherer für mich, über das zu sprechen, was ich weiß. Oder ich spreche nur in Allgemeinplätzen. Oder ich sage gleich zu Beginn: »Hier ist eine Geschichte, die ich gehört habe«, und übertrage die Verantwortung damit auf den ursprünglichen Erzähler, dessen Worte ich lediglich wiedergebe.
Doch was ist das für eine Geschichte, die ich gerade berichte? Hier ist eine andere, die ich gehört habe: Es waren einmal zwei Brüder, und einer von ihnen wollte haben, was der andere hatte. Er wandte seinen ganzen Willen auf, um es zu bekommen, koste es, was es wolle.
Hier ist noch eine: Es war einmal ein Gefangener in einem Turm.
Und noch eine: Einmal riskierte jemand sein Leben aus Pflichtgefühl und Loyalität gegenüber einem Freund.
Und hier ist endlich eine, die ich wahrheitsgemäß berichten kann.
***
Wenn ich zurückblicke, ist meine erste Erinnerung die an Wasser. Wasser über mir und Wasser überall um mich herum, das mit großem Gewicht auf mich drückt. An den gleichmäßigen Wechsel von Dunkelheit und schwachem flackerndem Licht. An fedrige Lebewesen, die wie Blumen im Meeresboden wurzeln, sich in der Strömung wiegen und das Wasser nach den winzigen Organismen absuchen, die an ihnen vorbeitreiben. Fische mit schweren knochengepanzerten Köpfen und Saugmäulern. Krabbelnde Seeskorpione und Trilobiten, Ammoniten mit spindelförmigen Schalen. Ich hatte keine Namen für diese Dinge, wusste nicht, dass das Licht, wenn es denn da war, von einer Sonne kam oder dass es überhaupt etwas außer dem allgegenwärtigen, alles umgebenden Wasser gab. Ich existierte lediglich, ohne Dringlichkeit, ohne Urteil.
Doch selbstverständlich gab es etwas jenseits des Wassers: Luft und Land, kahlen Stein – außer dort, wo er von Moos bewachsen war – und winzige, blattlose Pflanzen. Später kamen Bäume und Farne hinzu und krabbelnde Kreaturen mit Außenskeletten, Skorpione, Spinnen und Tausendfüßler und schließlich sogar Fische, die aus dem Meer an Land krochen. Ich jedoch verspürte keinen Drang, mich zu bewegen oder auf Erkundung zu gehen. Ich hatte keine Fragen.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass ich schon lange vor diesen ersten Erinnerungen existierte. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Irgendwann, nach einem Erdbeben, das den Meeresboden unter mir erschütterte und das ruhige Wasser um mich herum, gefolgt von einer langen Zeit in kalter Dunkelheit, verschwanden die Trilobiten. Die knochengepanzerten Fische verschwanden ebenso und überließen den Fischen mit Kiefern und Schuppen die Herrschaft. Lange danach – ich weiß nicht, wie lange, ich habe nie versucht, die Zeitspanne zu messen, aber nach dem zu urteilen, was ich seitdem gelernt habe, muss es sehr, sehr lange gewesen sein – wurde das Wasser immer weniger, bis ich mich schließlich, ohne mich bewegt zu haben, auf dem Trockenen wiederfand. So bekam ich endlich eine Ahnung, eine vage Vermutung, dass ich nicht allein im Universum war, dass es auch noch andere Wesen wie mich gab.
In diesem neuen und (für mich) trockeneren, landgebundenen Zeitalter wimmelte es von krabbelndem Getier: Amphibien in allen Größen, gedrungene, Reptilien, die mit schnabelartigen Mäulern die vielen Farne und Schachtelhalme abweideten. Riesige langschnäuzige und langzahnige Raubtiere. Kleine zweibeinige Jäger, die mich an Vögel erinnert hätten, wenn es schon Vögel gegeben hätte, außerdem kleine haarige, beinahe hundeähnliche Tiere, doch auch Hunde gab es noch nicht.
Ich war nicht wie diese Wesen, genauso wenig, wie ich wie die Fische oder die Trilobiten gewesen war. Und als ich die ersten anderen Götter sah, wie sie durch die Hügellandschaft stürmten, in der ich lag, erkannte ich sie nicht. Ich spürte, wie die Erde bebte, wie die Luft trocken wurde und kalt und dann plötzlich heiß und feucht. Bäume schaukelten, schwankten und wurden umgeworfen. Ein Felshang in meiner Sichtweite brach ab und stürzte zu Tal. Ein Fluss in einigen Meilen Entfernung trat über die Ufer, umspülte die Hügel und ertränkte die Insekten und die kleinen vogelähnlichen Reptilien um mich herum. Ich selbst war zu groß, als dass die Flut mich hätte bewegen können, aber ich spürte, wie das Gestein unter mir aufbrach.
Ich hatte lange genug beobachtet, um beurteilen zu können, was normal war. Ich hatte Stürme gesehen, heftige Stürme, hatte die Erschütterungen ferner Erdbeben und Vulkane gespürt, aber das hier war anders. Zum ersten Mal, seit ich mich erinnern konnte, verspürte ich Angst.
Schließlich zog die Schlacht – denn nichts anderes war es – weiter. Doch sie war so plötzlich gekommen und so verschieden von allem gewesen, was ich je gesehen oder erlebt hatte, dass ich gar nicht anders konnte, als mich zu fragen, was das gewesen war und ob es wieder passieren würde.
Dies war also mein erster Anblick von den Göttern – mich selbst nicht mitgerechnet, denn damals wusste ich noch nicht, was ich bin. Das Ereignis war so erschreckend gewesen und so abrupt über mich gekommen, dass ich mich zum ersten Mal gezielt umsah und zu verstehen versuchte, was gerade passiert war. In einem späteren Zeitalter hätten bereits Menschen existiert, vielleicht hätten sie mich erkannt und mir gesagt, was ich bin, aber es gab noch keine Menschen.
Überrascht dich das? Ich weiß, Leute, die über diese Dinge nachdenken, nehmen gemeinhin an, dass die Götter unmöglich vor den Menschen existiert haben können. Schließlich leben sie von deren Gebeten und Opfergaben. Welcher Gott könnte ohne diese Grundnahrung, diese wichtigste aller Kraftquellen über längere Zeit existieren?
Ich kann dir nicht sagen, wovon ich gelebt habe. Ich kann nur sagen, dass ich gelebt habe. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie diese anderen Götter, deren Kampf ich bezeugt hatte, es angestellt haben. Wie sie sich überhaupt bewegen konnten, noch dazu mit einer so verheerenden und zerstörerischen Kraft. Aber sie taten es wie einige andere auch, von deren Existenz ich allerdings erst sehr viel später erfuhr. Eigentlich erst, als viele von ihnen bereits tot waren.
Nicht wenige Götter plagt noch heute eine geradezu abergläubische Furcht vor den Alten. Gerüchtehalber sind einige von ihnen noch am Leben, unglaublich mächtig und schwer zu töten. Sie sollen sogar von den Toten wiederauferstehen können.
Aber von alldem wusste ich nichts. Ich lag und beobachtete und dachte nach, während die Tiere um mich herum anderen Tieren wichen und die Pflanzen und Bäume sich veränderten. Langsam kam zum Moos das Gras hinzu und die Blumen erschienen. Und Vögel, auch wenn ich damals noch nicht ahnte, wie sehr die Vögel mein zukünftiges Leben verkomplizieren sollten.
Ich nehme an, ich hätte mich bewegen können und über die Erde wandern, wie diese anderen Götter es getan hatten. Aber ich wollte es nie, verspürte nie den Drang dazu. Ich wollte unter der Sonne liegen, hier, nichts anderes. In diesen Tagen konnte ich die Sonne sehen, und ich mochte sie sehr. Ich genoss ihre Wärme, ihr tägliches Kommen und Gehen, ihre stetige Bahn über den blauen Himmel und wie sie sich von Monat zu Monat veränderte. Ich genoss das Vorüberziehen der Sterne, die sich dicht und hell am Nachthimmel drängten, das gelegentliche Aufleuchten der Meteore, die funkelnden Kometenschweife. Ich hätte gerne gewusst, wer diese anderen Götter waren, doch ich wollte nicht tun, was sie getan hatten.
Ich war nach wie vor ganz allein und beobachtete die Sterne. Wusstest du, dass es neben ihren jährlichen Zyklen noch eine andere, größer angelegte Bewegung gibt, die weit langsamer erfolgt? Ich beobachtete und bewunderte sie, bis jemand kam und meine Einsamkeit durchbrach.
Irgendwann lag ich unter Eis begraben. Soweit ich es erkennen konnte, hatte es auch alles andere unter sich begraben, und dieser Zustand dauerte so lange, dass ich mich schon fragte, ob die Welt von nun an nur noch aus Eis bestünde, da fing es an, wieder zu verschwinden. Mein alter Hang und der geborstene Hügel auf der anderen Seite des Flusses waren von seinem Gewicht platt gedrückt worden, doch auf seinem Rückzug hinterließ das Eis neue Hügel, sie waren aus Kies, Geröll und Schlamm.
Ich lag auf einem davon und begann mich zu fragen, wie das möglich war. Ich hätte flach gedrückt werden müssen wie alles andere auch, eingeschlossen unter dem Gletscher oder begraben unter dem Schutt, der sich im Lauf der Zeit auf dessen Oberfläche angesammelt hatte. Aber dem war nicht so. Ich war oben geblieben und fand mich auf dieser neuen, rundlichen Erhebung inmitten einer weiten, grasbewachsenen Hügellandschaft wieder.
Ich hatte nicht unter dem Eis begraben werden wollen, also war es auch nicht geschehen. Wenn ich zurückdenke, hatte ich auch nicht unter den Sedimentschichten auf dem Meeresboden begraben werden wollen, also war auch das nicht geschehen. Ich hatte es nicht gewollt und hatte gehandelt, und das so subtil, dass ich selbst gar nichts davon gemerkt hatte.
Eines Nachts, während ich über all diese Dinge nachdachte, jagte ein Feuerball über den Himmel, heller als jeder Stern, den ich je gesehen hatte, und heller als jeder Komet. Er verschwand irgendwo im Westen, und kurz darauf spürte ich das Grollen eines Einschlags. Nach einer Weile regneten Kies, Erde, Wasser und Staub vom Himmel, und es roch nach Feuer. Tagelang verdeckten Rauch und Nebel die Sonne, noch wochenlang blieb es trüb.
Es war ein großes Ereignis gewesen, aber ich erkannte seine wahre Bedeutung für mich erst Jahre später, als ich zum ersten Mal Menschen sah.
Sie trugen Hirschfelle, auf die sie Muster aus Knochen, Steinen und Muscheln gestickt hatten. Sie trugen Speere aus Holz und Knochen bei sich, an deren Spitzen Klingen aus Schiefer befestigt waren. Mit diesen Speeren machten sie Jagd auf Rentiere und Elche, denen sie über die Graslandschaft folgten. Dabei wurden sie von anderen Tieren begleitet, die ich für Wölfe hielt, aber wie ich später erfuhr, waren nur ihre Vorfahren Wölfe gewesen, sie selbst waren keine.
Sie schlugen ihr Lager am Fuß meines Hügels auf, machten Feuer und entnahmen ihren Beuteln die Pilze, Beeren und anderen Dinge, die sie auf ihrem Tagesmarsch gesammelt hatten. Dann ließen sie sich nieder und kochten, beobachteten die Flammen oder erkundeten das sumpfige Ufer des Baches, der träge durch die Ebene floss, nach Dingen, die interessant für sie sein könnten.
Einer von ihnen kam auf meinen Hügel und sprach mich an. Das überraschte mich nicht, denn zu mir kamen ständig Tiere, um zu tun, was Tiere eben so tun. Diese hier waren zwar neu, aber nicht so sehr, dass ich ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Bis der Mensch Milch vor mir ausgoss.
Inzwischen weiß ich, warum das meine Aufmerksamkeit erregte und warum mich die Handlungen dieser Person so faszinierten, aber damals verstand ich es noch nicht. Doch anstatt dich mit der ermüdenden Schilderung meines langsamen Erwachens zu belästigen, sage ich es dir rundheraus: Die Person war eine Priesterin. Sie hatte von ihrer Vorgängerin – und die wiederum von ihrer eigenen Vorgängerin und die von ihrer – gelernt, nach Göttern Ausschau zu halten. Ein auffälliges Geschöpf (ein weißes Rentier, ein ungewöhnlich großer Adler, eines der damals noch seltenen Mammuts) oder ein ungewöhnliches Naturmerkmal konnte ein Hinweis auf die Anwesenheit einer Gottheit sein. Wenn eine Priesterin dergleichen sah, stellte sie sich, wenn möglich, dem Tier oder dem Objekt gegenüber und sprach eine Abfolge festgelegter Worte, führte bestimmte Handlungen aus und brachte dabei auch eine Reihe von Opfergaben dar. Dies wiederholten die Priesterinnen über Jahre oder sogar Generationen hinweg und gaben die Einzelheiten des Verfahrens an ihre Nachfolgerinnen weiter, bis der Gott entweder antwortete oder die Wanderungen ihres Stammes die Priesterin nicht mehr in die Nähe der Gottheit führten. Diese hier wusste, dass sie geduldig sein musste – aus eigener Erfahrung und aus der ihrer Vorgängerinnen. Denn einem Gott das Sprechen beizubringen, kann sehr lange dauern.
Und genau das war es, was sie und ihre Nachfolgerinnen taten. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich das begriff. Nun, für mich war es eigentlich gar nicht so lange, aber es brauchte mehrere Generationen von Priesterinnen. Das menschliche Gehirn erkennt und erlernt Sprache bemerkenswert gut. In der Regel reagieren Säuglinge schon bald nach ihrer Geburt darauf und lernen eine Sprache meist, indem sie den Menschen um sich herum zuhören. Aber ich war kein Menschenkind, und dass es so etwas wie Sprache geben könnte, war mir noch nie in den Sinn gekommen.
Du magst die Vorstellung von einem Gott ohne Sprache unglaubwürdig oder gar lächerlich finden. Denn wenn ihr Menschen etwas über Götter wisst, dann, dass sie ihre Macht über Sprache ausüben. Götter bewirken Dinge, nur indem sie sie aussprechen – vorausgesetzt natürlich, sie verfügen über die dazu notwendige Macht. Etwas auszusprechen, das er nicht durchsetzen kann, kann einen Gott schwer verletzen, und sich davon zu erholen, kann Jahrhunderte oder gar Jahrtausende dauern. Etwas völlig Unmögliches zu sagen – solche Dinge gibt es, das versichere ich dir –, ist sinnlose Vergeudung. Aber mit genügend Macht und sorgfältig gewählten Worten kann ein Gott alles tun, was möglich ist.
Wie also kann ein Gott ohne Sprache ein Gott sein? Und wenn die Menschen den Göttern die Sprache erst beibringen mussten, wie ist es dann möglich, dass die anderen Gottheiten, die ich vor so langer Zeit gesehen hatte, überhaupt etwas ausrichten konnten?
Die Antwort lautet: Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir versichern, dass meine Geschichte wahr ist.
***
Mawat hatte schon als Kind ein überschäumendes Temperament gehabt, wie ich bereits sagte, genau wie sein Vater und dessen Vater und Vatersvater vor ihm. Aber wenn du in einer Umgebung aufwächst, in der jedes andere Temperament genauso wild ist wie deines und außerdem über Macht und Autorität verfügt, die du (noch) nicht hast, musst du entweder lernen, dein Temperament zu zügeln, oder du läufst Gefahr, an deinen Gegnern zu zerbrechen.
Also gab sich Mawat geschlagen und schmollte. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um, schritt die Treppe hinunter und verließ den Turm. Du folgtest ihm, stelltest keine Fragen und versuchtest auch nicht, ihn einzuholen, sondern bliebst ein paar Schritte hinter ihm, während er über den gepflasterten Hof eilte. Ich glaube, dir fiel auf, wie hastig ihm alle Diener aus dem Weg gingen. Fast alle in der Festung wussten, dass der Statthalter geflohen war und Hibal noch vor der Ankunft des Erben eilig den Platz auf der Bank übernommen hatte, und sie alle ahnten, dass Mawat es schlecht aufnehmen würde. An jedem anderen Tag wäre der Hof von regem Treiben erfüllt gewesen: von Mägden mit Eimern voller Wasser oder Milch, von Stallknechten, die sich um die Pferde der Boten kümmerten, von Dienern bei ihren zahllosen Besorgungen, die sich gegenseitig grüßten und einen Moment innehielten, um miteinander zu plaudern, zu lachen oder sogar zu singen. Aber heute war nur das Gekrächze der Raben zu hören und das gepresste Flüstern der Dienerschaft, das sogleich verstummte, als Mawat auf den Hof trat.
Du folgtest ihm in ein schwach beleuchtetes zweistöckiges Gebäude gegenüber dem Turm, es war ganz aus Stein erbaut, drinnen waren die Wände weiß verputzt. Mawat ging an der besorgten Dienerschaft vorbei durch einen Vorraum und dort die Treppe hinauf. Dann trat er durch eine Tür, schlug sie hinter sich zu und ließ dich allein auf dem dunklen Flur zurück.
Du starrtest einige Augenblicke lang auf die schwere Eichentür, dann setztest du dich seufzend und lehntest dich mit dem Rücken gegen die Wand. Nach einer Weile schlossest du die Augen, und ich glaube, dann bist du eingedöst. Hinter der Tür war kein Geräusch zu hören. Schließlich schrecktest du auf, als eine Dienerin ein Tablett mit Milch, Käse, Brot und Würstchen darauf brachte.
»Du«, sagte sie und blieb vor dir stehen. »Bist du sein Diener?« Das Mädchen wirkte schlaksig, als wäre sie es noch nicht gewohnt, so groß zu sein. Ihr Wollrock war abgenutzt, aber sauber und fachmännisch geflickt und reichte ihr nicht ganz bis zu den Knöcheln.
Du blinzeltest, vielleicht noch im Halbschlaf. »Nein. Ja. Irgendwie schon.« Du setztest dich aufrecht hin und zogst deinen Umhang enger um dich. »Ist das für Lord Mawat?«
»Ich soll es ihm vor die Tür stellen. Für den Fall, dass er herauskommt. Das wird er aber nicht, sondern erst in ein paar Tagen, hat der Koch gesagt.«
Du runzeltest die Stirn. »Ich habe ihn noch nie länger als ein paar Stunden so erlebt.«
»Da habe ich etwas anderes gehört«, erwiderte das Mädchen. »Bist du ein Bauer? Du klingst wie ein Bauer.«
»Ich bin Soldat«, entgegnetest du. »Der … Adjutant von Lord Mawat.«
Die Dienerin schien das zu bezweifeln. »Nun, ich muss das hierlassen.« Sie bückte sich und stellte das Tablett neben der Tür ab. »Wenn er in ein oder zwei Stunden immer noch nicht herausgekommen ist, solltest du die Milch einfach trinken, sonst wird sie schlecht. Ich weiß nicht, warum der Koch sie überhaupt geschickt hat. Wir bekommen kaum frische Milch, und so ist sie nur verschwendet.«
»Er mag Milch«, widersprachst du. »Vor allem, wenn sie ein bisschen sauer ist.«
Das Mädchen rollte mit den Augen, drehte sich um und ging.
***
Hier ist eine Geschichte, die ich gehört habe:
Nach Jahren des Betens und Feilschens sowie vorsichtiger Verhandlungen gab der Gott des Waldes dem Orden der Stillen das Versprechen, die Iradeni künftig vor Krankheit und Invasion zu beschützen. Da sie aber aus Erfahrung wussten, wie launisch der Gott war, unternahmen sie regelmäßige Patrouillen an den Grenzen ihres Territoriums – vor allem südlich des Waldes, wo ihre Tel-Nachbarn manchmal Höfe oder Dörfer überfielen. Alle dreizehn Bezirke Iradens waren im Rat der Weisungen vertreten und entsandten Freiwillige für diese Aufgabe.
Lange Jahre gab es nur gelegentlich Überfälle, und fast alle wurden von den Freiwilligen mit Leichtigkeit zurückgeschlagen, ohne dass sie göttlicher Hilfe bedurft hätten. Aber mit der Zeit wurden die Angriffe der Tel kühner. Sie kamen mit mehr Soldaten, planten sorgfältiger und forderten Iradens Verteidigung systematisch heraus.
Als Reaktion darauf ordnete der Rat mit Zustimmung des Statthalters den Bau von Forts entlang der Südgrenze an. Genauer gesagt, stellte er Mittel für den Bau von Wällen und Gräben um die dortigen Lager bereit, die bereits mehr oder weniger dauerhaft waren. Denn auch wenn der Rabe und Waldgott selbstverständlich verhindert hätten, dass Iraden in ernsthafte Schwierigkeiten geriet, können Götter in der Regel eher jenen helfen, die bereits eigene Anstrengungen unternommen haben. Außerdem hatte der Rabe höchstselbst bestätigt, dass er stärkere Verteidigungsanlagen begrüßen würde.
So war die Lage, als Mawat das Kommando über die Grenztruppen übernahm. Die Truppe war zersplittert und manchmal auch widerspenstig, denn sie bestand größtenteils aus Adelssöhnen, die keine Autorität anerkennen wollten, sowie aus Bauern und Dorfbewohnern, die sich zur Erntezeit oder bei drohenden Familienstreitereien nicht selten nach Hause stahlen.
Ich habe gehört, dass Xulah ein stehendes Heer von vertraglich verpflichteten Soldaten unterhält, die geschworen haben, den Befehlen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen. Ich habe außerdem gehört, dass diese Vorgesetzten eine eigene Bezeichnung haben und ihr Rang zudem einen gewissen gesellschaftlichen Status mit sich bringt. Theoretisch kann jeder Soldat durch seine Verdienste in diese höheren Ränge aufsteigen, und wenn er das tut, müssen die ihm untergebenen Soldaten seine Befehle befolgen, egal, aus welcher Familie er stammt – ja selbst wenn es ein Bauer ist, der nun über die Söhne von Adligen befehligt. Theoretisch, wie gesagt, denn ich vermute, dass nur wenigen Bauern ein solcher Aufstieg erlaubt wurde. Trotzdem erscheint mir das System klug, und man kann vielleicht besser verstehen, wie Xulah sein Herrschaftsgebiet so weit ausdehnen konnte.
In Iraden ist das anders. Zwar muss derjenige, der die Grenztruppen befehligt, den Rat und den Statthalter hinter sich haben, aber das allein genügt nicht. Der gesellschaftliche Rang des Befehlshabers muss entweder so hoch sein, dass sich kein Adelssohn durch dessen Befehle gedemütigt fühlt, oder er muss sich ihrer Loyalität auf andere Weise versichern. Das ist zwar möglich, wie du sicher weißt, aber selten – zumindest bei Iradens Grenztruppen.
Als Mawat das Kommando übernahm, hatte er die Unterstützung von einem halben Dutzend Söhnen von Ratsmitgliedern. In ganz Iraden gab es keinen Befehlshaber von vergleichbar hohem Ansehen, dennoch wurde Mawats Autorität gelegentlich infrage gestellt.
Eineinhalb Jahre bevor du nach Vastai kamst, erschien ein Bote mit einer dringenden Nachricht im Lager, das die Waldstraße bewacht. Der Bote wollte die Nachricht nur Mawat persönlich überbringen, und Mawat empfing ihn allein in seiner Hütte. Als er die Nachricht gehört hatte, rief er nach seinem Adjutanten – dir – und bat außerdem um die Anwesenheit von drei Söhnen der Lords.
»Die Tel versammeln sich auf der anderen Seite der Hügel«, sagte er leise, als die Tür wieder geschlossen war. Damit meinte er die Hügelkette jenseits des Landes, das von den Göttern Iradens beschützt wird.
»Ah, wunderbar!«, rief ein Ratsherrensohn namens Airu. »Sollen sie nur alle an einem Ort zusammenkommen, damit wir sie dort ein für alle Male erledigen können. Ich werde meine Männer wecken.« Er machte Anstalten zu gehen.
»Es gibt noch mehr Neuigkeiten«, fuhr Mawat fort, bevor Airu weit gekommen war. »Sie haben eine Vereinbarung mit einer Gottheit getroffen, die sie Pirscherin nennen.«
Einer der Männer hüstelte. »Die Pirscherin lässt sich nicht auf Vereinbarungen ein. Jedenfalls nicht auf brauchbare.«
»Sie akzeptiert keine Opfergaben, die an Bedingungen geknüpft sind«, stimmte Mawat zu. »Sie legt sich nicht gerne fest und lässt sich leicht ablenken. Aber die Tel haben einen anderen Weg gefunden. Oder glauben es zumindest.«
Schweigen. Du standest an der Tür und hieltest Ausschau nach ungebetenen Gästen.
Schließlich sprach Mawat weiter: »Sie haben jemanden gefunden, der bereit ist, ihr sein Leben zu opfern.«
Die meisten Götter der Tel sind eher klein und an eine Handvoll Familien oder an einen bestimmten Ort gebunden. Es gibt keinen unter ihnen, der es mit dem Gott des Stillen Waldes aufnehmen könnte – abgesehen von ein oder zwei Flussgottheiten vielleicht, aber die ließen sich nie dazu überreden, gegen Iraden zu ziehen. Ja nicht einmal gegen Vastai, um Zugriff auf die Meerenge zu erhalten und die Reichtümer, die dort verschifft werden. Die Gottheiten der Tel waren den Göttern Iradens schlicht nicht gewachsen, was sie aber nicht davon abhielt, ihr Glück an den Grenzen Iradens zu versuchen. Allerdings arbeiteten sie selten für längere Zeit zusammen, und allein waren sie nicht mächtig genug, um viel auszurichten, ohne sich dabei selbst zu gefährden.
Doch mit dem richtigen Opfer kann jeder Gott mächtiger gemacht werden, und eines der mächtigsten Opfer ist – wie jeder Iradeni weiß – ein Menschenleben. Noch besser ist es, wenn dieses Opfer freiwillig und von eigener Hand erbracht wird, so wie es der Statthalter des Raben tut.
»Das macht keinen Unterschied«, protestierte ein anderer Adelssohn. »Die Pirscherin hält sich nicht an Abmachungen. Die Tel können ihr opfern, so viel sie wollen, sie wird es nur für ihre eigenen Zwecke verwenden.«
»Sie glauben, dass sie einen Weg gefunden haben, das zu verhindern«, entgegnete Mawat. »Sobald sie ihr Opfer dargebracht haben, wird die Pirscherin die geforderte Gegenleistung nach ihrem besten Vermögen erbringen.«
»Also reiten wir zu ihnen, bevor sie das Opfer darbringen können«, beharrte Airu. »Warum sind wir nicht schon längst auf dem Weg und vergeuden stattdessen kostbare Zeit?«
Mawat ignorierte die plötzliche Spannung im Raum und sagte ganz ruhig: »Der zeitliche Ablauf ist entscheidend für ihren Plan. Bringen sie das Opfer nur einen Moment zu früh dar, wird die Pirscherin zumindest einen Teil davon für andere Zwecke verwenden und nur armselige Dienste leisten. Oder zumindest nicht das tun, was die Tel von ihr erwarten. Das bedeutet, dass sie das Opfer noch nicht dargebracht haben und der Freiwillige nach wie vor unter ihnen ist, damit sie ihn exakt im richtigen Moment opfern können.«
»Was macht das für einen Unterschied?«, fragte Airu.
»Wenn wir über sie herfallen«, warf ein anderer, eher besonnener Adelssohn ein, »brauchen sie das Opfer nur zu töten, um die ganze Macht der Pirscherin gegen uns einzusetzen.«
»Und wenn schon?«, höhnte Airu. »Das wird nicht reichen, um den Raben zu besiegen, geschweige denn den Gott der Stillen. Ich frage euch noch einmal: Warum sind wir nicht schon längst auf dem Weg, sie zu vernichten, wo sie noch so schön versammelt sind und wir außerdem das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben?«
»Wenn wir zu offensichtlich handeln«, entgegnete Mawat scharf, »verspielen wir diesen Vorteil. Meine Informationen stammen zum Teil von unseren Spionen bei den Tel. Glaubst du, sie hätten nicht auch Spione bei uns? Und selbst wenn wir sie überrumpeln, glaubst du, sie würden nicht beim ersten Anzeichen unseres Angriffs ihr Opfer darbringen? Es würde vielleicht nicht genügen, um Iraden zu gefährden – ganz sicher nicht –, aber es würde viele unserer Männer das Leben kosten. Iradens Sicherheit mag gewährleistet sein, doch das Überleben jedes Einzelnen von uns ist es nicht. Lasst uns so vorgehen, dass möglichst wenige von uns sterben müssen.«
»Ich fürchte den Tod nicht!«, beharrte Airu. »Und meine Männer auch nicht. Der Rabe wacht über dich, Erbe des Statthalters, aber über uns nicht. Trotzdem sind wir keine Feiglinge wie du.«
Es wurde totenstill in der Hütte.
»Mein Schwert«, sagte Mawat gelassen, beinahe im Plauderton.
Du verließest den Raum und kehrtest mit Mawats Schwert zurück, dem mit dem goldenen Griff, und lehntest es neben ihm an die Wand.
»Wir sind hier, um gegen die Tel zu kämpfen, nicht gegeneinander«, sagte ein anderer Adelssohn.
»Ganz recht«, bestätigte Airu mit wütender Verachtung in der Stimme. »Ich habe keine Angst vor dir, Mawat.«
Mawat blieb ruhig. »Wir wollen nicht die Hälfte unserer Männer oder mehr bei einem törichten Angriff verlieren, den wir mit ein bisschen Bedacht zu unserem Vorteil wenden können. Macht eure Männer bereit, so schnell ihr könnt, Airu und ihr alle, aber auch so unauffällig, wie ihr könnt. Sobald ihr das Signal erhaltet, dass das Opfer gefangen genommen oder zumindest die damit verbundene Bitte verhindert wurde, könnt ihr euch auf die Tel stürzen.«
»Und wie soll das vonstattengehen?«, fragte einer der Adelssöhne. »Jemand müsste in das Lager der Tel eindringen, und sie werden das Opfer sicherlich gut bewachen. An ihrer Stelle würde ich den Betreffenden genau in der Mitte des Lagers platzieren, umringt von lauter Bewaffneten.«
»Tja, wie meine Quelle mir mitgeteilt hat, liegen die Dinge genau so, wie du es eben beschrieben hast«, antwortete Mawat. »Wir werden handverlesene Männer aussenden, die sich an den Wachen vorbeischleichen und dann das Opfer gefangen nehmen, ohne dass es dabei getötet wird.« Er sah Airu an. »Das ist natürlich nichts für dich, aber auch nicht gerade ein Auftrag für einen Feigling.«
Airu schnaubte.
»Wen willst du schicken?«, fragte ein anderer nervös.
»Oh, keine Angst«, antwortete Mawat. »Ich gehe selbst.«
***
Kurz vor der Morgendämmerung des nächsten Tages schlichst du mit Mawat leise durch das Lager der Tel. Die Quelle, die euch über die Anwesenheit und Pläne der Tel unterrichtet hatte, hatte euch auch Losungswörter genannt, dank derer ihr es bis hierher geschafft hattet. Was alles Weitere betraf, zählte Mawat zweifellos darauf, dass der Rabe ihn auch in Zukunft noch brauchen würde. Obwohl er sich nie ausschließlich auf dessen Unterstützung verließ, egal ,wie stark der Gott sein mochte. Er hatte auch dich mitgebracht: um zu kämpfen, wenn es dazu kommen sollte, aber auch, um statt seiner zu sprechen, falls nötig. Mawat konnte zwar etwas Telisch, doch sein Akzent hätte ihn verraten, sobald er den Mund aufmachte. Dein Akzent jedoch, der du südlich des Waldes aufgewachsen bist, würde kaum auffallen.
Das einzige göttliche Hilfsmittel, das Mawat bei sich trug, war einer der wenigen gottgesprochenen Gegenstände, die der Rabe je erschaffen hatte: eine Bronzescheibe, mit der sich rudimentäre Botschaften übermitteln ließen. Wenn ihr Besitzer die richtigen Worte sprach, leuchtete eine bestimmte Lampe auf. Diese Lampe war nun bei Airu, dem Mawat den Befehl gegeben hatte, die Tel anzugreifen, sobald sie brannte, aber nicht vorher.
Mithilfe all dieser Dinge – der Dunkelheit, den Losungswörtern, der Unterstützung, die der Rabe dem Erben des Statthalters gewähren würde, deinem Telisch und euren Kutten, die eure Gesichter verbargen – erreichtet ihr den Ort, an dem das freiwillige Opfer untergebracht war: ein kreisrundes Zelt auf einer Freifläche inmitten der anderen, kleineren Zelte. Eine einzelne Wache stand dösend am Eingang.
»Ich dachte, das würde der schwierigste Teil werden«, murmelte Mawat. »Sie scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Warum?« Und ein paar Augenblicke später: »Wahrscheinlich weil das Opfer freiwillig hier ist und sein Zelt in der Mitte eines Lagers von Bewaffneten steht. Trotzdem würde ich dem schlafenden Wachposten den Kopf abschlagen lassen, wenn ich der Kommandant wäre.«
Nachdem Mawat sich alles noch einen Moment lang angesehen hatte, ging er einfach zum Zelteingang und schlüpfte lautlos unter der Klappe hindurch. Du folgtest ihm. Die Wache rührte sich nicht.
Drinnen herrschte bescheidener Luxus: Saubere, eng gewobene Grasmatten bedeckten den Boden, hier und da brannten Kerzen auf Ständern aus polierter Bronze. Das Opfer selbst lag in einem Haufen von Decken auf einer Pritsche gleich neben der eisernen Feuerstelle. Es schien noch sehr jung zu sein, kaum aus dem Knabenalter heraus, und sehr dünn, beinahe unterernährt. Wahrscheinlich hatte sich jemand dazu verpflichtet, nach seinem Tod für seine Familie zu sorgen – entweder ein Lord der Tel oder die Pirscherin selbst, was aber eher unwahrscheinlich war.
Immerhin verbrachte der Junge die letzten Tage seines Lebens in einem gewissen Luxus: Die Pritsche, auf der er lag, war dick und weich gepolstert, die Decken darauf waren aus feinster Wolle. Auf einem niedrigen Tisch brannte eine Lampe aus getriebenem Gold, daneben standen ein charakteristisch geformter Krug sowie ein goldener Becher.
»Wein aus Xulah«, flüsterte Mawat. »Ich frage mich, ob noch mehr hier drinnen von südlich der Berge kommt.« Dann schüttelte er den Kopf – für solche Fragen war jetzt keine Zeit. Er musste sich beeilen und des Jungen habhaft werden, bevor die Tel euch doch noch entdeckten. Er gab dir ein Zeichen, dann gingt ihr auf den schlafenden Knaben zu.
Plötzlich schrie irgendwo am Rand des Lagers jemand auf.
»Airu!«, fluchte Mawat und stürzte sich auf den Jungen. Mit einer Hand hielt er ihm den Mund zu und griff mit der anderen nach seinem Arm. Du knietest dich auf den Knaben, und während er unter dir zappelte und gegen Mawats Hand anschrie, fesseltest du seine Arme.
Plötzlich wurde die Zeltklappe angehoben. Ein Mann mit einem Schwert in der Hand trat hindurch, und der mittlerweile aufgewachte – wenn auch noch nicht ganz geistesgegenwärtige – Wachposten folgte direkt hinter ihm.
Der Mann war groß, größer noch als selbst Mawat. Er blieb stehen und betrachtete die Szene. Der Wachposten schaute erschrocken drein, dann zog auch er sein Schwert.
»Halt ihn fest«, sagte Mawat scharf zu dir, stand auf und zog seine Waffe. Der Junge stieß einen durchdringenden Schrei aus und wehrte sich noch stärker, aber du hieltest ihn fest. Draußen ertönten weitere Schreie. Schritte entfernten sich in die Richtung, aus der du mit Mawat gekommen warst und wo Airu nun das Lager angriff. Außerdem hörtest du das Klirren von Schwertern – allerdings weiter entfernt, als dir lieb war, wie ich vermute.
Mawat und der große Tel standen sich schweigend gegenüber, während der Wachposten auf dich zukam. Das Opfer nutzte die Ablenkung, riss sich los und stolperte hastig von dir weg. Du sprangst hinterher, packtest den Jungen an der Taille und brachtest ihn zu Fall. Der Wachposten stolperte über euch beide, das Tischchen kippte um, Krug, Becher und Lampe fielen zu Boden, und das Öl ergoss sich über die Grasmatten.
Der Junge befreite sich ein zweites Mal, sprang auf und rannte auf den großen Mann zu, der Mawat genau in diesem Moment angriff. Du wolltest dem Knaben hinterher, doch der Wachposten kam bereits wieder auf die Beine und stellte sich dir in den Weg.
Dein Gegner war größer als du, aber du warst schnell – du zogst dein Messer, ducktest dich unter seinem Schwertarm hindurch und stießt ihm deine Klinge in die entblößte Achsel. Als ein Schlag seiner anderen Hand dich zurücktaumeln ließ, rissest du dein Messer wieder heraus, während der Wachposten keuchend auf die Knie sank und sich das Zelt mit Rauch füllte: Das Öl der umgekippten Lampe hatte die Grasmatten in Brand gesetzt.
Als Mawat und der große Mann die Klingen kreuzten, sprang der Knabe mitten zwischen die beiden hinein, und der Tel ließ sein Schwert mit einem zufriedenen Laut auf ihn niederfahren. Mawat wehrte den Hieb ab, doch die Wucht des Schlags riss ihm sein Schwert aus der Hand.
Da zogst du dein Schwert und stürztest dich hustend auf den großen Tel, während Mawat den Jungen festhielt und ihn aus dem verrauchten Zelt zerrte. Der Tel schlug dich zu Boden, drehte sich um und stürmte nach draußen, wo der Junge sich aus Mawats Griff zu befreien und in das brennende Zelt zurückzurennen versuchte, aber es gelang ihm nicht.
Der Tel öffnete den Mund, um weitere Soldaten herbeizurufen, aber es kam nur ein hustendes Krächzen aus seiner Kehle.
»Airu, verflucht seist du!«, bellte Mawat.
Wie als Antwort kam ein halbes Dutzend Berittener herangeprescht und umzingelte Mawat und den Knaben.
»Ich habe dir doch gesagt, dass wir sie nur anzugreifen brauchen!«, rief Airu vom Sattel aus. An seinen nackten Armen und seinem Schwert klebte Blut, und er grinste grimmig, während ein anderer Reiter den großen Tel erledigte.




























