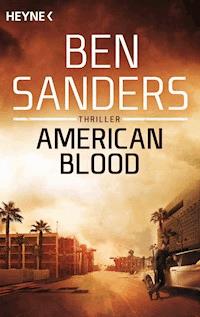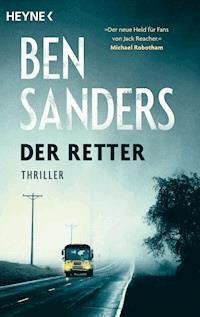
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Marshall-Grade-Reihe
- Sprache: Deutsch
Bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport kommt FBI-Agent Lucas Cohen noch einmal mit dem Leben davon. Doch für Erleichterung bleibt keine Zeit: Die Angreifer waren auf der Suche nach Marshall Grade – einem legendären Undercover-Cop, der von seinen Feinden unerbittlich gejagt wird. Niemand weiß, wo er sich im Augenblick aufhält. Cohen muss ihn so schnell wie möglich finden und warnen. Sonst kommen ihm die Killer zuvor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
BENSANDERS
D E R R E T T E R
T H R I L L E R
Aus dem Amerikanischen von Robert Brack
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Der ehemalige Undercover-Cop Marshall Grade führt ein Leben auf der Flucht. Die Liste seiner Feinde ist lang, der Preis für sein Kopfgeld hoch, und immer wieder muss er Namen und Wohnorte wechseln, um unentdeckt zu bleiben. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Als Marshalls einzige Kontaktperson, der FBI-Agent Lucas Cohen, entführt wird, wollen seine Geiselnehmer nur eines wissen: den Aufenthaltsort von Marshall. Cohen gelingt mit knapper Not die Flucht. Trotzdem ist klar: Marshall schwebt in Lebensgefahr. Jemand will ihn finden und töten.
Der Autor
Ben Sanders, geboren 1989 in Auckland, veröffentlichte seinen ersten Thriller im Alter von 21 Jahren. The Fallen erreichte direkt nach Erscheinen Platz 1 der neuseeländischen Bestsellerliste und hielt sich dort für mehrere Wochen. Zwei Fortsetzungen wurden ebenfalls zu Bestsellern und waren für den neuseeländischen Krimipreis nominiert.
www.ben-sanders.com
Lieferbare TitelAmerican Blood
Die Originalausgabe MARSHALL’S LAW erschien 2017 bei Minotaur Books, an imprint of St. Martin’s Publishing Group. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2018 Copyright © 2017 by Ben Sanders Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München Redaktion: Tamara Rapp Umschlaggestaltung: bürosüd, München, unter Verwendung eines Motivs von © Getty Images / Amy Stocklein Images Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-16379-2V001www.heyne.de
Für Kate
EINS
Lucas Cohen
Marvin Lisk vom Sheriffbüro in Los Alamos rief Cohen am Montagmorgen an und meinte, sie hätten Tommy Lee Warren verhaftet.
Cohen sagte: »Warum erzählen Sie mir das jetzt?« Sehr reserviert, aber er wusste, dass Marvin die Ironie heraushören würde.
»Na ja, er hat doch diesen Gerichtstermin bei euch verpasst, und ich dachte, Sie wollen ihn vielleicht hinbringen.«
Cohen stemmte die Ellbogen auf den Schreibtisch und schaute aus dem Fenster. Es war Anfang Dezember, kleine Schneeflocken fielen schräg herab und lagen schon fünf Zentimeter hoch auf dem Rasen vor dem Justizgebäude. Die Bäume am South Federal Place sahen aus wie gezuckert. Er schloss die Augen und kniff sich in die Nase, besonders energiegeladen war er nicht an diesem kalten Montag. Er sagte: »Wo haben Sie ihn denn aufgegabelt?«
»Postamt, ob Sie’s glauben oder nicht. Sie kennen doch diesen großen Parkplatz auf der Rückseite? Die Streife meldete, er hätte einfach da gesessen, auf der Bank zusammengesackt. Die dachten, er hätte einen Herzanfall.«
»War aber nicht so?«
»Nein. Der Kerl war bloß weggepennt, weil er irgendwas eingeworfen hatte. Der Wagen war auch gestohlen, also insgesamt ein guter Fang.«
»Hat er gesagt, was er da wollte?«
»Angeblich konnte er sich an nichts erinnern. Weil er zu viel gesoffen hatte, also stimmt’s wahrscheinlich sogar. Wie ich gerade sehe, hatte die Vorladung mit einer Drogensache zu tun, demnach hat er vielleicht versucht, sich dort was zu besorgen. Keine Ahnung.«
Ein Taxi fuhr vorbei, die Reifen knirschten über den frisch gefallenen Pulverschnee. Cohens Spiegelbild hing wie ein Wasserzeichen in seinem Blickfeld. Er sagte: »Wahrscheinlich besorgt er sich Crack per Mailorder, schickt Gutscheine ein oder so.«
»Klar, ich frag ihn mal.«
Cohen drehte sich mit seinem Stuhl um. Das Telefonkabel spannte sich um seinen Brustkorb, während er überlegte, wer ihm bei diesem Gefangenentransport helfen konnte. Dann sagte er: »Sind Sie sicher, dass Sie Tommy nicht behalten wollen?«
Lisk lachte. »Ganz sicher. Den können Sie gern übernehmen.«
Seine Wahl fiel auf Karen Kaminski. Normalerweise hätte er sich jemand anderen als Back-up ausgesucht, aber Karen war wenigstens keine Quasselstrippe, und sie war neu bei den Marshals, ein bisschen Praxis konnte ihr nicht schaden.
Sie erreichten ihr Ziel kurz vor zehn Uhr morgens. Das Sheriff’s Department von Los Alamos befand sich in einem Komplex mit dem ziemlich großspurigen Namen »Justice Center«. Eine Ansammlung hellbrauner Flachbauten, die an diesem Morgen unter der Schneedecke eher mickrig wirkten.
Ein Deputy führte sie in den Trakt mit den Hafträumen. Tommy Lee Warren war schon herausgebracht worden und stand mit Handschellen gefesselt hinter der Gittertür zwischen zwei Cops.
»Ah, Scheiße, wusste ich’s doch. Als die was vom Marshals Service gefaselt haben, dachte ich mir schon, dass Lucas Cohen mir die Ehre gibt.«
Cohen trat näher und warf einen Blick durch die Gitterstäbe, Karen erledigte derweil den Papierkram. »Na, wie geht’s denn so, Tommy?«
»Total beschissen. Kann mich seit Donnerstag an nichts mehr erinnern. Das ist echt ein Witz.«
»Darüber solltest du mal mit deinem Anwalt sprechen.«
»Na ja, am liebsten würde ich das mit jemandem besprechen, der mich anschließend rauslässt.«
Cohen legte eine Hand auf seine Pistole und lächelte ihn freundlich an, ganz der abgeklärte Gesetzeshüter. »Tut mir leid, Tommy.«
»Von wegen leidtun. Ihr könntet mir glatt erzählen, ich hätte Mrs. Obama gekidnappt, davon wüsste ich auch nichts mehr.«
»Wir können auf dem Rückweg ja bei einem Krankenhaus anhalten und ein MRT machen lassen.«
»Sehr witzig. Aber mal ernsthaft, ich hatte wirklich vor, am Freitag im Gericht zu sein.«
»Trotzdem warst du nicht da.«
»Ja, das meine ich ja. Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Wir haben eine lange Fahrt vor uns, Tommy. Du kannst mir das alles auch unterwegs erzählen.«
»Mach ich. Aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie ein Tonband mitlaufen lassen.«
Die Deputies halfen dabei, ihn in den Wagen zu bugsieren, dann ging es los. Tommy saß auf dem Rücksitz hinter dem Drahtgitter, Karen am Steuer. Cohen fuhr ganz gern auf dem Beifahrersitz, »riding shotgun«, wie man so sagte, und er hatte ja tatsächlich eine Flinte dabei. Außerdem eine Glock .40 im Gurt an der Hüfte und einen kleinen Smith & Wesson Airweight .38 über dem Fußgelenk. Tommy war schon mal für Drogenbesitz und einen Überfall verurteilt worden, war also nicht gerade ein Sonnenschein und auch kein Typ, bei dem man sich Schwächen erlauben konnte. Seine Taktik war, immer freundlich zu tun, damit er nahe genug an einen rankam, um zu spucken oder zu kratzen. Cohen hatte das am eigenen Leib erfahren.
Karen lenkte den Wagen auf die 502 Richtung Osten, die Wolken hingen dunkel und schwer am Himmel. Es fiel immer noch Schnee, die Luft war beißend kalt. Viel Verkehr war nicht: ein einzelnes Auto, ungefähr eine Viertelmeile hinter ihnen, ansonsten vor allem schwere Lastwagen auf der Gegenspur. Weiches gelbliches Licht aus Truck-Scheinwerfern durchschnitt das diffuse Grau des Morgens.
Tommy beugte sich vor und presste seinen Mund gegen das Gitter. »Wo geht’s denn eigentlich hin?«
Cohen sagte: »Du kannst eine Nacht umsonst in der Vollzugsanstalt in Santa Fe verbringen, und am nächsten Morgen hast du einen Gerichtstermin, so wie’s aussieht. Wer weiß, vielleicht darfst du ja anschließend wieder zurück in die Haftanstalt.«
Tommy war eine Weile still, schaute aus dem Fenster und klopfte mit dem Fuß auf den Boden. Dann sagte er: »Hey, wenn ich Ihnen jetzt was erzähle, hören Sie mir dann zu, oder wollen Sie einfach nur dasitzen und vor sich hin träumen?«
Cohen musterte ihn im Rückspiegel. Er durfte sich nicht umdrehen, wenn er vermeiden wollte, eine Ladung Spucke ins Gesicht zu kriegen. Tommy war ungefähr fünfunddreißig, hatte eine Halbglatze mit einem Kranz aus dünnen Haaren, die ihm über die Ohren hingen. Er sah nicht gerade gesund aus, und die verschorften Stellen, die vom Meth kamen, machten es auch nicht besser.
Cohen sagte: »Vielleicht hör ich ja zu, wenn du mir was Interessantes zu sagen hast.« Er rutschte in seinem Sitz etwas tiefer, behielt die Flinte aber zwischen den Knien und wandte sich an Karen. »Oder was meinst du?«
Sie war in North Carolina bei der Militärpolizei gewesen, bevor sie zu den Marshals gekommen war, und Cohen konnte sich nicht vorstellen, dass die Kollegen in der Army besonders erpicht darauf waren, sich Lügengeschichten auftischen zu lassen. Sie zuckte mit den Achseln. »Ich glaube, ich klinke mich da einfach mal aus.«
Tommy sagte: »Also, echt jetzt.«
Cohen seufzte. »Hör mal, Tommy, es liegt mir fern, dein Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. Wenn du Lust hast, dann rede, aber ich kann dir nicht versprechen, dass wir irgendwas davon in Betracht ziehen.«
Tommy ließ sich zurückfallen und atmete hörbar aus. »Hören Sie, ich verarsch Sie nicht. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern, was seit Donnerstag los war. Ist alles wie weggeblasen. Ich weiß nur noch, dass ich mir vorgenommen hatte, am nächsten Tag vor Gericht aufzukreuzen, und dann hat’s gerumst.«
Cohen blickte aus dem Beifahrerfenster. Jenseits der schneebedeckten Ebene erhoben sich weiße Bergkuppen, der schwere graue Himmel hing drückend über allem wie ein schweres Kissen. Alles wirkte düster, das weite Land war den Elementen schutzlos ausgeliefert.
Er fragte: »Wo hattest du denn den Wagen her?«
»Weiß ich nicht, das ist ja der Witz. Ich wache auf und denke bloß, was ist denn hier passiert? Verstehen Sie?«
»Ich versuche bloß rauszufinden, warum du so dämlich warst, den Gerichtstermin zu versäumen, wo du doch wusstest, das wir dich dann einsacken.«
»Ja, aber Sie haben’s ja nicht gemacht, sondern der Sheriff.«
»Und der hat mich angerufen, also bin ich beteiligt.«
»Ist doch egal, in meinem Kopf ist alles leer. Zumindest sollte der gute Wille was gelten. Wenn einer vor Gericht erscheinen will, so was muss doch berücksichtigt werden.«
Cohen sagte: »Das können wir gern als Anregung weitergeben. Was hattest du denn bei der Post vor?«
»Wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Vielleicht ’ne Weihnachtskarte an Sie schicken. Nee, wahrscheinlich wollte ich Ihnen sogar ein richtig fettes Geschenk schicken, das war’s!«
Cohen schwieg.
»Hey, Sie glauben mir ja doch nichts, egal was ich sage. Okay, ich bin’s gewohnt, wie ein Stück Scheiße behandelt zu werden. So gesehen ist das hier immerhin eine Aufwertung.«
Cohen schwieg.
»Aber wissen Sie, was echt witzig ist? Mein ganzes Leben lang haben alle immer ›Tommy‹ zu mir gesagt, nur jedes Mal, wenn ich geschnappt werde und in den Knast wandere, bin ich ›Tommy Lee Warren‹. Als wäre das eine besondere Auszeichnung, weil man dann wichtiger ist oder so. Trotzdem ist es allen scheißegal, was man sagt, sogar wenn jedes Wort wahr ist.«
Als das Auto sie rammte, fuhren sie ungefähr sechzig Meilen pro Stunde, und der harte Aufprall an der linken Seite des Hecks warf sie aus der Spur. Cohens Kopf wurde nach vorn geschleudert. Gegen das Armaturenbrett gestemmt, sah er Scheinwerfer im Seitenspiegel aufleuchten, während Karen sich mit dem Lenkrad abmühte, um den Wagen wieder in die Spur zu bekommen.
Sie hatte es fast geschafft, das irre Schlingern einzudämmen, und die langen Bremsspuren bei jedem Ausreißen verkürzten sich gerade, da wurden sie erneut gerammt.
Die Welt ruckte aus den Fugen, neigte sich in einem verrückten Winkel, und dann kippte der Wagen um, Airbags explodierten, und als sie sich seitlich überschlugen, spritzte das zersplitternde Glas wie bei einem Hurrikan durchs Wageninnere. Gequetschtes Metall kreischte auf, während sie sich wieder und dann ein drittes Mal überschlugen.
Der Wagen hätte sich beinahe noch einmal gedreht, stockte dann aber mitten in der Bewegung, als er nur noch auf zwei Rädern stand, und fiel wieder zurück. In Cohens Ohren war ein blechernes Klingeln, als würde eine verbeulte Glocke Alarm schlagen. Eine Gischt aus Blut und Glas wehte durch das Wageninnere, rechts und links der verbeulten Motorhaube stiegen Dampfschwaden auf. Er versuchte, den Airbag beiseitezuschieben, und warf einen Blick auf Karen, die schlaff in ihrem Sicherheitsgurt hing, den Kopf auf der Schulter. Er streckte die Hand nach ihr aus, als die Tür mit einem lauten Kreischen aufgerissen wurde. Kaltes Eisen an seiner Schläfe und eine Stimme, die sagte: »Keine Bewegung.«
Ein kurzes sägendes Geräusch, als sein Gurt zerschnitten wurde, dann packte der Kerl ihn an der Jacke und zerrte ihn raus auf die Straße. Er fiel mit dem Kopf voran in den Schnee, der so kalt war, dass er nach Luft schnappen musste. Er stellte fest, dass er die Flinte losgelassen hatte, ohne es zu merken, der Schock war zu groß, er hatte völlig den Überblick verloren. Eine andere Stimme, gedämpft und weiter entfernt, sagte: »Los, fessle ihn, und dann weg hier.«
Die Umrisse des Kerls waren total unscharf, alles lag im Nebel. Cohen spürte eine Hand an seiner Hüfte, Glock und Handschellen wurden ihm abgenommen und Telefon, Schlüssel und Portemonnaie aus den Taschen gezogen. Sie legten ihm die Handschellen an, und er geriet in Panik. Es war der schlimmste Albtraum jedes Polizisten, mit den eigenen Handschellen gefesselt zu werden und eine Kugel aus der eigenen Waffe in den Kopf zu bekommen.
»Bleibt ruhig, Arschloch.«
Eine Hand packte ihn am Kragen, die andere an den Handschellen, er wurde hochgerissen. An der Stelle, wo sein Gesicht im Schnee gelegen hatte, fühlte es sich taub und wulstig an. Sein Wagen stand schräg auf der Fahrbahn, zusammengedrückt wie nach der Schrottpresse. Tommy Lee Warren ragte mit dem Oberkörper so weit aus dem zerborstenen Seitenfenster, dass seine verkrampften Finger den Erdboden berührten. Karen Kaminski hing noch immer regungslos auf dem Fahrersitz. Cohen rief ihr etwas zu, gurgelnd wie unter Wasser, er verstand selbst nicht, was er sagte.
Das Fahrzeug, das sie gerammt hatte, parkte vor dem Wrack auf dem Seitenstreifen. Dort wurde er jetzt hindirigiert, und von kräftigen Händen gestoßen stolperte er vorwärts. Er stemmte sich dagegen, aber seine Schuhe rutschten über den glatten Boden. Sie schoben ihn auf die Ladefläche, er prallte mit den Schienbeinen gegen die Stoßstange und fiel seitlich hin, während hinter ihm die Hecktür zuknallte. Er spürte, wie der Wagen erzitterte, als die beiden Männer vorne einstiegen. Dann wurde das Geräusch des Motors allmählich vom Klingeln in seinen Ohren übertönt, als der Wagen beschleunigte.
Der Nebel lichtete sich nach einer Minute, wurde aber von Angst ersetzt, einer ganz realen, brutalen Angst. Er dachte an seine Frau und seine Töchter und malte sich ein Begräbnis ohne Leiche aus. Vielleicht war ja alles längst festgelegt, sie würden ihn nach Mexiko bringen und anschließend in Einzelteilen wieder zurückschicken. Schön säuberlich in mehrere Pakete verpackt, Stück für Stück.
Er versuchte, diese Gedanken wegzuschieben, um seinen Kopf klarzukriegen. Er fing an zu zählen, ganz langsam und systematisch, stellte sich die Zahlen dabei vor. Die Ziffern standen in der gleichen Schrift vor ihm, in der auch die Haftbefehle gedruckt waren – Times New Roman. Er kam bis dreißig und war schon wesentlich ruhiger. Sein Atmen wurde langsamer.
Er konnte sämtliche Gliedmaßen bewegen. Zwar tat ihm alles weh, aber es schien nichts gebrochen zu sein.
Offenbar war alles heil.
Für den Moment.
Mühsam wälzte er sich auf den Rücken. Der Wagen war ein SUV, wahrscheinlich ein Suburban, geradezu ideal für einen Gefangenentransport. Dunkel getönte Fenster im Heck, Metallgitter hinter den Rücksitzen zum Schutz der Passagiere. Es roch nach nassem Hund. Er biss die Zähne zusammen und stemmte sich hoch, um einen Blick auf die Vordersitze zu riskieren. Zwei Typen saßen da, beide mit Sturmhauben und schweren Winterjacken. Behandschuhte Hände am Lenkrad, ein dreieckiger Riss in der Kabinenbespannung über dem Gesicht des Beifahrers.
»Hinlegen, Arschloch.«
Cohen gehorchte. Seine Bauchmuskeln schmerzten, er ließ sich wieder zurückfallen.
So wie der Kerl redete, kam er jedenfalls nicht von hier. Eher von der Ostküste, Boston oder New York. Cohen drehte sich auf die linke Seite und zog die Knie an. Die .38er steckte noch immer im Halfter an seinem linken Knöchel. Die nutzte ihm aber nichts, solange seine Hände gefesselt waren, außer er positionierte sich so, dass er auf sie schießen konnte, wenn sie die Hecktür öffneten. Dazu mussten sie allerdings nebeneinander stehen, unbewaffnet und unfähig zu reagieren. Reines Wunschdenken. Wie der Name schon sagte, hatte ein .38er Airweight nicht besonders viel Durchschlagskraft. Was bedeutete, dass der Revolver im Augenblick eher ein Problem darstellte. Wenn sie das Ding bei ihm fanden, hatte er eher früher als später eine Kugel im Kopf.
Besser, er wurde nicht mit einer Waffe ertappt.
Er zog die Beine an, als wollte er in die Hocke gehen, drückte den Rücken durch und versuchte, an seinen Knöchel zu kommen. Es ging nicht. Er war sechsunddreißig Jahre alt und durchtrainiert, aber nicht sehr gelenkig. Fünfzehn Zentimeter fehlten. Das Tempo des Wagens war auch keine große Hilfe, es fühlte sich an, als würden sie knapp neunzig fahren, viel zu riskant bei diesem Wetter. Das Heck brach sogar in den weniger engen Kurven aus, der Wagen hätte sich schon mehrfach beinahe überschlagen. Ihm wurde schlecht davon, jede Kurve machte ihn regelrecht seekrank.
Er probierte es noch einmal. Ohne Erfolg. Er reichte nicht heran. Die einzige Möglichkeit bestand darin, die Hände unter die Oberschenkel zu schieben.
Der Truck ging in eine scharfe Linkskurve, er kippte auf den Rücken und versuchte, ein lautes Stöhnen zu unterdrücken.
»Scheiße, was machst du denn da hinten? Bleib endlich liegen.« Das war wieder der mit dem Ostküstenakzent.
Cohen holte tief Luft und drehte sich erneut auf die Seite, zog die Beine an, schob die Hände über Hintern und Oberschenkel nach unten. Sie waren jetzt nicht mehr auf dem Highway, fuhren langsamer über unebenes Gelände. Er kam mit den Händen bis zu den Kniekehlen, die Kette der Handschellen war ganz straff, die Metallringe schnitten ins Fleisch. Wieder drückte er den Rücken durch, schob die Brust raus, streckte sich. Eine bizarre Körperhaltung, seine Augen quollen hervor, Gelenke knackten. Er drückte den Rücken noch mehr durch, reckte den Hals. Jede Muskelfaser zum Zerreißen gespannt. Nur noch wenige Zentimeter. Ganz vorsichtig schob er den Saum der Hose mit der Spitze des Mittelfingers ein Stück weit hoch. Die Waffe lag nun frei. Der Truck rumpelte über einen von Schlaglöchern übersäten Weg, durch das Fenster fiel sein Blick auf schneebedeckte Nadelbäume. Wo waren sie? In Tesuque vielleicht, am Rand des Nationalparks. Er streckte sich erneut, das Gesicht zu einem angestrengten Grinsen verzerrt, ein Finger erreichte den Griff des Revolvers, und er zog ihn aus dem Halfter. Sein Mund war völlig ausgetrocknet vom schweren Atmen. Er rutschte dichter an den Rücksitz und suchte nach der Lücke zwischen Lehne und Ladefläche. Es gab einen schmalen Spalt, gerade breit genug, um den kleinen .38er aufzunehmen. Er schob ihn mit dem Lauf voran hinein, während der Truck auf dem unebenen Feldweg hin und her schlingerte. Die Fahrt wurde noch langsamer, die Bäume rückten näher. Wahrscheinlich ein Privatweg, den niemand einsehen konnte.
Nun musste er noch das Halfter loswerden. Wenn sie es entdeckten, würden sie es nicht einfach wegwerfen. Sie würden nach der Waffe suchen, und die wäre nicht schwer zu finden. Aber mit dem Halfter war es noch schwieriger als mit der Pistole. Es war mit einem langen Klettband um seine Wade geschnallt, das gerade mal einen Monat alt und noch steif und störrisch war. Es war unmöglich, das Ding lautlos abzuziehen, und das Geräusch würde er kaum mit einem Hustenanfall übertönen können. Was bedeutete, dass er warten musste, bis die Kerle aus dem Wagen waren.
Sie fuhren noch etwa zehn Minuten den Feldweg entlang. Ihm kam es vor, als würde er leicht ansteigen. Ab und zu ging es in die Kurve, offenbar fuhren sie in Serpentinen. Als sie eine Anhöhe passierten, spürte er ein Kitzeln im Bauch, dann ging es rasch bergab. Plötzlich bremste der Wagen scharf, und er rutschte gegen die Rücklehne. Der Fahrer zog die Handbremse an und schaltete den Motor aus.
Er lag auf dem Rücken und schaute aus dem Fenster. Die Äste der Nadelbäume wurden von schweren Schneemassen niedergedrückt. Spitze Zweige ragten aus dem blendenden Weiß. Erneut bog er den Rücken durch, strengte sich an und bekam endlich den Klettverschluss zu fassen. Sein altes, ausgeleiertes Halfter wäre jetzt perfekt gewesen, das hätte er fast lautlos aufreißen können, aber Loretta hatte ihn überredet, das Ding wegzuwerfen, weil es seine Socken ruinierte. Es wäre besser gewesen, er hätte nicht auf sie gehört.
»Los, raus aus dem Wagen.«
Sie sprachen leise, obendrein wurden die Worte von dem Klingeln in seinen Ohren gedämpft. Die beiden Vordertüren gingen auf, nicht ganz unisono, und wurden zugeschlagen.
Er riss an dem Band und rutschte ab.
Mit zusammengebissenen Zähnen drückte er den Rücken noch mehr durch und umfasste das Band zum zweiten Mal. Sie kamen jetzt um den Truck herum zur Heckklappe, stritten sich lautstark.
Jetzt …
Er zog, so fest er konnte. Ein langer, starker Ruck und das Halfter löste sich. Eine Sturmhaube tauchte vor dem Rückfenster auf.
Scheiße, hoffentlich hatte der nicht …
Die Heckklappe schwang auf. Eisige Kälte und ein leichter Duft nach Tannennadeln.
»Was zum Teufel machst du da? Was soll das?« Eine andere Stimme, eher hier aus der Gegend.
Er tat so, als wäre er nicht ganz bei sich, murmelte irgendwas. Das Halfter war außer Sichtweite hinter seinem Bein.
Der Ostküstentyp war etwas weiter entfernt und sagte: »Willst du die Karre gleich abfackeln oder noch warten?«
Der Mann an der Heckklappe drehte sich um. »Macht keinen Sinn, sie abzufackeln, bevor er hier ist. Ich will nicht in der Kälte rumstehen. Außerdem könnte jemand den Rauch bemerken.«
»Wann will er denn hier sein?«
Jetzt machte der Typ einen Schritt vom Truck weg. »Keine Ahnung. Hat er keine Nachricht geschickt?«
Cohen tastete den Boden ab und fand das Halfter.
»Weiß ich nicht.«
»Dann guck auf dein Telefon, das wäre immerhin mal ein Anfang.«
»Kümmer dich doch selbst drum.«
Cohen schob das Halfter in die Lücke, aber der Klettverschluss wollte nicht ganz rein. Na, los doch, verdammt …
Der Mann vor der Heckklappe packte ihn am Fußgelenk und zerrte ihn aus dem Kofferraum. Cohen knallte auf den gefrorenen Boden, der so fest war wie Beton. Er schnappte nach Luft.
»Halt die Klappe.«
Cohen blickte hoch. Der Typ starrte ihn durch die Gucklöcher seiner Sturmhaube an, in der einen Hand eine Pistole.
Cohen sagte: »Das ist eine Entführung.«
Beide lachten. Der andere stand ein paar Meter entfernt, die Hände in die Hüften gestemmt, und spähte durch die Bäume.
Der Typ vor Cohen sagte: »Ist uns auch schon aufgefallen.«
»Mit so was bringen Sie sich bloß in Schwierigkeiten.« Cohen versuchte, ruhig und besonnen zu klingen, als wäre er schon oft in so einer Situation gewesen.
»Wir haben uns schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gehängt, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen.« Die Maske hatte keine Mundöffnung, seine Lippen bewegten sich hinter dem Stoff. Er kauerte sich vor Cohen nieder. »Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn wir dich jetzt laufen ließen, hätten wir nichts gewonnen.«
»Sie würden sich zehn Jahre Knast ersparen.«
»Falls sie uns kriegen.«
Cohen überlegte kurz. »Kennen wir uns?«
Der Typ schüttelte langsam den Kopf. »Nee, du kennst uns nicht. Wir sind bloß irgendwer.«
»Aber sehr wahrscheinlich kenne ich denjenigen, der Sie angeheuert hat, oder?«
Der Mann gab keine Antwort.
Cohen sagte: »Können Sie mir die Handschellen abnehmen? Meine Schulter tut höllisch weh.«
»Na, so ein Pech.«
Der Mann beugte sich näher zu ihm. Am unteren Ende der Maske waren ein paar dunkle Locken zu sehen. »Du wirst uns ein paar Fragen beantworten.«
»Gern. Aber wenn Sie Marshals werden wollen, müssen Sie vier Jahre auf dem College gewesen sein und über Erfahrungen im Justizbereich verfügen.«
»Na klar, du bist echt witzig.« Er drückte den Lauf seiner Waffe gegen Cohens Knie.
»Was wollen Sie denn wissen?«
»Deine Stimme ist ja auf einmal so klar und deutlich. Eben warst du noch ganz schön durcheinander.«
»Was wollen Sie von mir?«
Der Wald wirkte düster und morsch, der Frost schluckte alle Geräusche. Die Äste hingen voll Schnee. Der Mann sagte: »Der Marshal Service in Santa Fe hat einen ehemaligen Polizisten aus New York im Zeugenschutzprogramm. Er heißt James Marshall Grade. Aber alle nennen ihn bloß Marshall.«
Cohen antwortete nicht. Die Angst kehrte zurück. Sie wollten also gar nichts von ihm. Er war nur ein Mittel zum Zweck, ein nützlicher Informant. Er schaute sich um. Der Feldweg endete an der Stelle, wo der Suburban angehalten hatte. Vermutlich war es eine Feuerschneise. Die Chancen, dass jemand mitten im Dezember hier vorbeikam, waren gleich null.
Der Typ stand auf und richtete seine Waffe auf Cohens Kopf. »Jetzt wäre es an der Zeit zu reden.«
»Ich habe keine Ahnung, wo er ist.« Er versuchte, ruhig und gleichmäßig zu sprechen.
»Du lügst doch.«
»Nehmen Sie mir die Handschellen ab.«
»Fang an zu reden, dann denk ich drüber nach.«
»Wenn ich hier gefesselt liegen bleibe, erfriere ich, und Sie werden überhaupt nichts rausfinden.«
»Also gibt’s da was, das du uns erzählen kannst.«
»Nehmen Sie mir die Handschellen ab.«
Der Mann verpasste ihm einen Tritt in den Magen. Cohen würgte und krümmte sich. Er biss die Zähne zusammen, schnappte nach Luft und bekam eine Portion Staub in den Mund, die nach Eis schmeckte.
»Red schon.«
»Die Handschellen.« Er stieß es ächzend hervor.
»Ach, komm schon, Mann, nimm sie ihm ab. Wahrscheinlich ist er noch völlig fertig von dem Unfall.«
Der Typ, der vor ihm stand, sagte: »Herrje«, kniete sich dann aber hin und tastete Cohen von oben bis unten ab. In der Jacke war nichts, auch nicht in den Hosentaschen. Er ließ die Hände über seine Beine gleiten.
»Dreh dich um, Arschloch.«
Cohen drehte sich um. Hörte ein Geräusch, als würde jemand Schlüssel sortieren, es dauerte eine Weile, wahrscheinlich weil der Typ Handschuhe trug. Dann spürte er, wie die Handschellen aufgeschlossen wurden. Es klickte zweimal, als die Schlüssel griffen. Er wälzte sich auf den Rücken und rieb sich die Handgelenke. Der Typ stand immer noch dicht vor ihm, die Pistole auf seinen Kopf gerichtet. Ein kleiner Anreiz, um sich gut zu benehmen.
»Und jetzt rede.«
Cohen sagte: »Ich kenne den Mann.«
»Ja, klar, wir wissen, dass du ihn kennst.« Der Lauf zielte inzwischen auf seine Nase, als wäre die Waffe eine Art Lügendetektor.
»Ich weiß nicht, wo er ist. Niemand weiß das. Er hat nie die Wohnung bezogen, die wir ihm zugewiesen haben. Er hat sie untervermietet.«
»Aber du hast Kontakt zu ihm.«
Cohen schüttelte den Kopf. »Niemand weiß, wo er ist.«
Keine Antwort. Der Wald verharrte in gespanntem Schweigen. Die malerischen, schneebedeckten Tannen bildeten einen eigenartigen Hintergrund für ihr Frage-und-Antwort-Spiel. Der Typ sagte: »Im letzten Jahr kam ein Killer aus New York hierher. Er hat ihn in Santa Fe aufgetrieben.«
»Marshall hat ihn umgelegt.«
Keine Antwort.
Cohen ergänzte: »Und jetzt ist er verschwunden.«
Der Mann stand da und sah auf ihn herab, die Waffe lag ganz ruhig in seiner Hand. Er sagte: »Ein Freund von uns ist auf dem Weg hierher. Du kannst entweder jetzt mit uns reden oder später mit ihm. Aber ich warne dich, er ist ziemlich hart drauf.«
»Ich muss mal pissen.«
Der Mann schien darüber nachzudenken. Er musterte Cohen, als wollte er ein Geschäftsangebot abwägen. Als hätte er Angst, übertölpelt zu werden. Doch dann trat er zurück und hob die Waffe. »Wenn du abzuhauen versuchst, schieß ich dir ins Bein. Also mach schön langsam.«
Cohen drehte sich zur Seite, zog die Knie an und stemmte sich hoch. Ganz langsam, einen Arm immer ausgestreckt, um weiterhin benommen zu wirken.
»Zwei Meter, mehr nicht.«
Cohen suchte sich einen Baum aus und trat darauf zu, zog ein Bein leicht nach und schwankte beim Gehen. Schließlich postierte er sich, die Knie leicht gebeugt, und stützte sich mit einem Arm am Stamm ab. Nach dem Pinkeln schüttelte er die Tropfen ab, packte alles wieder dahin, wo es hingehörte. Was nicht einfach war, mit nur einer Hand, aber es fühlte sich ganz angenehm an, einen Halt zu haben. Seine Pisse schlängelte sich als kleiner Bach durch den Schnee.
Er drehte sich um, und der Mann ließ ihn vorbei, den ausgestreckten Arm mit der Waffe auf Cohens Kopf gerichtet. Cohen schritt auf den Suburban zu, fühlte sich jetzt schon wieder sicherer.
»Runter auf den Boden, Kumpel.«
Cohen sagte nichts. Er war fast da …
»Auf den Boden – sofort!«
Scharf genug, dass es ihm kalt den Rücken herunterlief. Doch er sagte: »Ich geh lieber da rein. Mir ist kalt.«
Er hob ein Knie auf die Ladefläche des Trucks und streckte die Hand nach der Rücksitzlehne aus …
»Arschloch. Ich hab dir nicht erlaubt, in den Wagen zu steigen.«
Eine Faust packte ihn am Kragen, und er wurde zurückgezerrt. Der Typ trat ihm die Beine weg, und Cohen fiel auf den Bauch, die Hände unter der Brust, bekam Tritte gegen die Rippen, stöhnte vor Schmerz und krümmte sich.
»Vollidiot. Bleib da liegen.«
Cohen zählte bis fünf, holte tief Luft und spürte, wie sein Puls sich beschleunigte. Dann fuhr er herum und schoss dem Mistkerl mit seinem Revolver in den Kopf.
Es war ein schöner kurzer Moment, als die Gehirnmasse des Typen wie ein rosafarbener Nebel hinter ihm wegspritzte und seine Leiche umkippte. Der andere, der ein paar Meter entfernt stand, wirbelte bei dem Knall erschrocken herum, zuckte zusammen und hob abwehrend eine Hand. Auch er hatte eine Waffe, aber statt sie auf Cohen zu richten, rannte er los. Cohen zielte und drückte dreimal ab. Alle drei Kugeln gingen ins Leere, weil sein Arm zitterte. Der Mann schaffte es den Hügel hinauf, rannte weiter und verschwand. Nur seine hektisch knirschenden Schritte auf dem schorfigen Schnee waren zu hören, die allmählich leiser wurden, während er im Unterholz Schutz suchte.
Die Schlüssel steckten noch. Cohen fand ein Telefon in der Tasche des Toten und fuhr über den Highway zurück, diesmal in bequemerer Haltung als mit Handschellen gefesselt auf der Ladefläche. Er bemerkte weder den Geflüchteten noch sonst etwas Verdächtiges. Alles war weiß und tot, nicht mal Vögel waren zu sehen.
Schließlich hielt er auf dem Standstreifen und forderte Verstärkung an. Seine Stimme zitterte, was auch der Frau in der Zentrale nicht verborgen blieb, die ihm mit zuckersüßer Stimme versicherte, die Unterstützung wäre in null Komma nichts bei ihm. Er legte auf und rief Miriam im Büro der Marshals an.
Sie sagte: »Dein Anruf hat ja eine ziemliche Aufregung erzeugt.«
»Ich hab doch immer gesagt, dass ich ein aufregender Mann bin, Miriam.« Aber er rang noch zu sehr nach Atem, um das locker rüberzubringen. »Hier draußen ist was vorgefallen, das mich wohl noch eine Weile festhält. Wärst du so nett und rufst Mrs. Cohen an und sagst ihr, dass ich heute später komme? Ich würde es ihr ja selbst sagen, aber ich muss erst mal meine Gedanken ordnen.«
»Mach ich. Geht’s dir so weit gut?«
»Ja, ich glaube schon.« Aber auch darüber musste er wohl noch mal nachdenken.
Es dauerte zwanzig Minuten, bis sie da waren. Als Erstes wollte er wissen, wie es Karen ging, doch niemand konnte ihm eine verbindliche Antwort geben. Sie war in einem kritischen Zustand, und Tommy Lee Warrens Leben hing an einem seidenen Faden. Er lieh sich ein Telefon und machte einen weiteren Anruf, während die Sanitäter im Krankenwagen seinen Blutdruck maßen und ihm ein Thermometer ins Ohr schoben.
Was Marshall betraf, hatte er nicht gelogen. Niemand wusste, wo er war. Cohen hatte zwar eine Telefonnummer, erreichte allerdings bloß den Anrufbeantworter, wie jedes Mal. Er ging sofort an.
Cohen sagte: »Rufen Sie mich zurück, wenn Sie das hier hören. Ein paar Leute sind auf der Suche nach Ihnen und wollen Sie umbringen.«
ZWEI
Marshall
Er traf sich mit Henry Lee auf dem Parkplatz des Galaxy Diner nicht weit vom Merritt Parkway in Bridgeport, Connecticut. Sie hatten sich seit sechs Jahren nicht gesehen. Marshall war das ganz recht, aber er wusste auch, dass Henry jemand war, den man um Rat fragen konnte, wenn Killer auf einen angesetzt wurden.
Marshall sagte: »Als wir uns das letzte Mal trafen, haben Sie sich noch nicht Henry Lee genannt.«
Sie saßen im Heck von Henrys Cadillac Escalade, der ausgestattet war wie ein Privatjet: Auf der linken Seite hinter dem Fahrer befand sich ein elfenbeinfarbenes Ledersofa, gegenüber ein Sessel und eine Minibar. An der Hintertür war ein LED-Bildschirm angebracht, auf dem CNN ohne Ton lief. Marshall saß auf dem Sessel mit einem Becher Kaffee aus dem Galaxy in der Hand, Henry auf dem Sofa, ebenfalls mit einem Becher Kaffee, in den er einen Schuss Jack Daniel’s No. 7 gekippt hatte. Er trug einen eierschalenfarbenen Anzug, vielleicht weil er genauso aussehen wollte wie sein Auto. Er legte ein Bein übers andere und wippte mit dem Fuß. »Ja, ich war eine Weile weg. Dachte mir, es ist Zeit, reinen Tisch zu machen und noch mal ganz neu anzufangen.«
»Sogar mit dem Namen.«
»Ja, sogar mit dem Namen. Den hab ich von diesem Nick-Cave-Song. Kennen Sie den?«
Marshall nickte. »Das nächste Mal können Sie sich ja ›Abattoir Blues‹ nennen. Das passt auch ganz gut zum Thema.«
Henry blinzelte und neigte seinen Becher leicht nach vorn. Er war jetzt ungefähr vierzig. Sie hatten sich kennengelernt, als Marshall noch beim NYPD war, in der Abteilung für Drogenbekämpfung in Brooklyn South. Henry war als Dealer verhaftet worden, aber die Anklage war auf Kokainbesitz heruntergestuft worden, nachdem er sich bereit erklärt hatte, gegen ein paar Kollegen auszusagen. Er sagte: »Hab gehört, Sie haben jetzt auch einen neuen Namen.«
Marshall stellte seinen Becher auf den Oberschenkel und balancierte ihn so aus, dass ein Finger genügte, um ihn senkrecht zu halten. Er spähte durch die mit Regentropfen überzogene Frontscheibe. Der Caddy stand auf dem Parkplatz hinter dem Diner, doch man konnte von hier aus die Straße einsehen. »Wer hat Ihnen das denn erzählt?«
Henry nippte an seinem Kaffee. Der Anteil Jack Daniel’s war ziemlich hoch, und er zuckte kurz zusammen. »Ach, wissen Sie, wenn man alle Schnipsel zusammenklebt, ergibt sich irgendwann ein Bild.«
Marshall sagte nichts dazu. Vor zwei Wochen noch war er in Eureka in Kalifornien gewesen und hatte ein angenehmes Leben geführt. Und dann hatte er an einem Mittwochmorgen bei Starbucks in der New York Times geblättert und war auf eine Meldung gestoßen, in der von einem Marshal in Santa Fe die Rede war, den man zwei Tage zuvor gekidnappt hatte. Also hatte er ein paar alte Nummern gewählt, und Henry Lee war einer der wenigen gewesen, die zurückriefen.
Henry sagte: »Wie ich hörte, ist diese Sache mit Tony Asaro ziemlich in die Binsen gegangen.«
Marshall schwieg.
»Anscheinend dachte er, Sie wären ein korrupter Bulle, und dann stellte sich heraus, dass Sie undercover ermittelt haben.« Er setzte ein wölfisches Grinsen auf.
Marshall hielt den Blick auf die Straße gerichtet. Es schneite nicht, war aber eiskalt und stürmisch. Ein Auto hinter dem anderen auf der Main Street. Niedrige Bürogebäude aus Beton und ein Laden für Autoreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, beide mit leer gefegten Parkplätzen davor. Er war schon vor drei Stunden hergekommen, um alles im Blick zu haben und sicherzugehen, dass nur sie beide an diesem Rendezvous teilnahmen.
Er sagte: »So was in der Art.«
Henry ließ sich nicht abbügeln, er wollte mehr Details. »Und dann war da noch was mit einem Killer aus Dallas, der hinter Ihnen her war und plötzlich in Albuquerque tot aufgefunden wurde.«
»Santa Fe.«
Henry hob entschuldigend die Hand. »Santa Fe, klar.« Er musterte sein Gegenüber prüfend.
Marshall nahm einen großen Schluck und überlegte, wie viel er sagen durfte. Am liebsten hätte er überhaupt nichts erzählt, aber dann tat Henry es ihm wahrscheinlich gleich. Und Marshall brauchte dringend ein paar Informationen. Er warf einen Blick auf die Minibar, wo er als Geste des guten Willens den Inhalt seiner Taschen ausgebreitet hatte: Geldbörse, Schlüssel und das iPhone, das er am Morgen gekauft hatte, lagen alle säuberlich nebeneinander auf einem kleinen Ausstellungskatalog des Museum of Modern Art in New York City. Er sagte: »Die Asaro-Leute wurden ziemlich ungemütlich, weshalb der Marshals Service mich vorsichtshalber in die Wüste geschickt hat.« Er imitierte Henrys Körperhaltung und schlug ebenfalls ein Bein über das andere. »Ich bin dann in so eine Sache reingeraten und einem von Asaros Männern in die Arme gelaufen.«
»Der Dallas-Typ?«
»Ja, der Mann aus Dallas.«
»Und den haben Sie umgenietet?«
Marshall schüttelte den Kopf. »Hätte ich gern. Er hat mich ziemlich erwischt. Der Deputy Marshal hat ihn dann erschossen.« Er deutete mit dem Daumen auf eine Stelle neben der Brustmitte.
Henry zuckte erneut zusammen. »Die Bundespolizei hat diese Glock 40. Die sind ziemlich solide.« Kurzer Schluck. »Hat er noch was gesagt, oder war er gleich hinüber?«
»Konnte noch ein paar Dinge erzählen, aber viel Zeit blieb ihm nicht dafür.«
Henry erwiderte nichts.
Marshall sagte: »Sind Sie immer noch im gleichen Geschäft wie beim letzten Mal, als wir uns trafen?«
Henry streifte den Bildschirm, auf dem CNN lief, mit einem Blick und überlegte. »Ich schätze, ich bin immer noch so ähnlich aufgestellt, aber die Details möchte ich hier nicht breittreten.« Er runzelte die Stirn.
»Darauf bin ich auch gar nicht sonderlich erpicht. Da wir uns hier oben in Connecticut treffen, gehe ich mal davon aus, dass Sie vorsichtig sein müssen. Außerdem sitzen wir nicht in einer Kneipe, sondern auf dem Parkplatz, um miteinander zu reden. Das scheint mir ebenfalls auf einen gewissen Lebensstil hinzudeuten.«
Henry schwieg.
»Vielleicht. Ich spekuliere natürlich nur.«
Henry sagte: »Ich komme gerade aus Boston, also ist das hier ein guter Zwischenstopp.« Er machte eine Kopfbewegung Richtung Galaxy Diner. »Und selbst wenn die dort einen Michelin-Stern hätten, würde ich lieber hier draußen sitzen.« Er machte eine ausholende Handbewegung. »Das hier ist echter Luxus.« Er lachte. »Ich hatte mir allerdings schon Sorgen gemacht, die Leute könnten es vielleicht ein bisschen übertrieben finden. Also sorge ich dafür, dass auf dem Bildschirm immer die Nachrichten laufen, damit alle gleich sehen, dass ich die Dinge ernst nehme.«
Marshall nickte und warf erneut einen Blick zur Straße. Die Sicht war nicht besonders gut. Das Licht im Wageninnern wurde von den Scheiben reflektiert.
Henry sagte: »Zugegeben, als Sie anriefen, dachte ich zuerst, Sie wollten mich irgendwie reinlegen, weil sie immer noch bei den Cops sind.«
Ein paar Sekunden herrschte Schweigen, Henrys Fuß bewegte sich nicht mehr. Die Heizung summte leise vor sich hin. Marshall schüttelte den Kopf. »Mein Verhältnis zum NYPD ist nicht mehr so besonders rosig.«
Henry musterte ihn eine Weile. Dabei schürzte er die Lippen, als wüsste er nicht, ob er die Frage stellen sollte, die ihm gerade in den Sinn gekommen war. Schließlich entschied er sich dafür und sagte: »Soweit ich gehört habe, ist Ihre Tarnung aufgeflogen, als Sie Asaros Sohn erschossen haben.«
Marshall gab keine Antwort. Im Auto roch es nach neuem Leder, wenn er noch länger hier herumsaß, würde er einschlafen.
Henry sagte: »Hatte er die Waffe gezogen?«
»Hat sie sogar auf mich gerichtet. Darum ging es vor allem.«
Henry erwartete weitere Erklärungen, aber Marshall ließ es dabei bewenden. Henry machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er damit die Fragestunde beenden, und sagte: »Spielt ja auch keine Rolle. Ich war bloß neugierig.« Er nahm einen Schluck und fuhr fort: »Wie auch immer, was kann ich für Sie tun?«
Marshall stellte seinen Becher auf den Rand der Minibar und drehte ihn so, dass er das Firmenlogo sehen konnte. »Haben Sie von dem US-Marshal gehört, der in New Mexico gekidnappt wurde?«
Henry Lee stieß einen Pfiff aus und zupfte an seiner Jacke. »Ja, war in den Nachrichten. Ziemlich heftig.«
»Mhm, das ist wohl wahr.«
Henry drehte sich zum Bildschirm, aber er schien eher nachzudenken und gar nicht wahrzunehmen, was da zu sehen war. Schließlich wandte er sich wieder an Marshall. »Um was geht es also?«
»Ich würde gerne erfahren, ob Sie was darüber wissen.«
Henry verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Damit hab ich schon lange nichts mehr am Hut. Warum interessiert Sie das denn?«
Marshall sagte: »Weil die den Mann gefragt haben, wo ich bin. Was bedeutet, dass diejenigen, die dahinterstecken, mich im Visier haben.«
Henry schaute auf. »Asaro?«
Marshall sagte: »Tony Asaro ist im Bundesgefängnis, also denke ich nicht, dass er persönlich was damit zu tun hat. Aber es wird wohl jemand aus seinem Clan sein. Er hat einen Sohn und eine Tochter.«
Henry verzog das Gesicht. »Also, der Sohn ist auch im Knast.« Er legte den Kopf zur Seite und tat so, als müsste er sich einen Ruck geben. »Aber die Tochter, ja, klar, wie heißt die noch?« Er schnippte mit den Fingern. »Chloe, genau. Der geht’s ganz gut, würde ich sagen.« Er lächelte. »Hab gehört, Sie hatten auch mal mit ihr zu tun.«
Marshall hatte keine Lust, auf dieses Thema einzugehen.
Henry zuckte mit den Schultern. »Schon gut, war nur so dahingesagt.«
»Das letzte Mal hab ich mit ihr gesprochen, nachdem ich die Wiederwahltaste auf dem Telefon des Toten gedrückt hatte.«
»Wessen Telefon? Das von dem Dallas-Typen?«
»Ja. Chloe Asaro hat ihn auf mich angesetzt und erklärt, sie würde niemals aufhören, nach mir zu suchen.« Er machte eine Geste, die zeigte, dass es eigentlich keine Frage war, wer hinter ihm her war.
Henry fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte: »Verdammte Schlampe.«
»Ja, ich bin wirklich froh, dass der Sohn jetzt tot ist. Das ist die beste Nachricht des Tages.«
»Und wo ist Chloe jetzt?«
»Genau das würde ich gern rausfinden.«
Henry streckte das Kinn vor und strich mit dem Daumen über die Unterseite, langsam und nachdenklich. Dann lächelte er entschuldigend. »Nein, wirklich, ich weiß nichts darüber. Gut möglich, dass die es auch auf mich abgesehen haben. Nach allem, was ich vor Gericht gegen sie ausgesagt habe, könnte mein Tod ihnen einiges wert sein. Ich hatte zwar einen Sack über dem Kopf, aber Sie wissen ja selbst, dass nichts geheim bleibt, stimmt’s?«
»Der Aufenthaltsort von Chloe offenbar schon.«
Henry zuckte mit den Schultern und breitete die Hände aus. Er dachte kurz nach und sagte dann: »Warum waren sie denn hinter dem Marshal her?«
»Na ja, weil sie mich gesucht haben und weil die Bundespolizei in New Mexico der beste Ort war, um damit anzufangen. Informationen aus dem Zeugenschutzprogramm werden ja nicht einfach so ausgeplaudert, es sei denn, man hält jemandem eine Pistole unter die Nase. Jedenfalls stelle ich mir das so vor.«
Henry nickte langsam und starrte ins Leere. Die Haut an seinem Hals wirkte schlaff und alt. »Was genau ist denn passiert? Sie haben ihn sich geschnappt und nach Ihrem Aufenthaltsort gefragt?«
Marshall nickte. »Er saß in einem Gefangenentransport, als zwei Typen ihn überfielen, in den Kofferraum warfen und anschließend nach mir fragten.«
»Hat er ihnen irgendwas erzählt?«
Marshall schüttelte den Kopf. »Sie wollten wissen, wo ich bin, aber er wusste es nicht.«
»Und dann ließen sie ihn wieder gehen?«
»Nein. Sie hatten vergessen, nach seiner zweiten Waffe zu suchen.«
Henry sagte: »Oh, Scheiße. Deswegen hieß es nur ›versuchter‹ Mordanschlag.«
»Genau.«
»Also gut, jetzt mal ganz ernsthaft. Bis zu dem Moment, als Sie anriefen, hatte ich Ihren Namen seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Ich dachte, die hätten Sie längst vergessen.«
»Offenbar nicht.«
Henry zuckte mit den Schultern, als wäre das keine große Sache.
Marshall sagte: »Vielleicht können Sie sich ja mal umhören, das würde mir helfen. Schicken Sie einfach ein paar E-Mails herum. Vielleicht weiß ja irgendjemand, wo Chloe Asaro sich aufhält.«
Henry nickte. »Bei so was muss man ziemlich vorsichtig sein. Aber meinetwegen, ich will sehen, was sich machen lässt.« Er schaute wieder auf den Bildschirm und fuhr fort: »Wie lange sind Sie schon zurück?«
»Nicht sehr lange.«
Genau genommen waren es neun Tage. Er war am Abend der Starbucks-Offenbarung abgereist und fünf Tage lang mit Bussen unterwegs gewesen. Von Eureka nach L. A. und dann ein Dutzend Stationen mit Überlandbussen. Er wäre gerne wieder nach Kalifornien gegangen. Dort hatte es jetzt wahrscheinlich schon über fünfundzwanzig Grad, und man musste nicht mal eine Jacke tragen.
Henry sagte: »An Ihrer Stelle würde ich bleiben, wo ich bin.«
»Das würde ich auch, wenn die nicht nach mir suchen würden.« Marshall zog den Reißverschluss hoch und wappnete sich für die Kälte draußen. Dann beugte er sich noch einmal vor. »Eine Frage hätte ich noch.«
»Ja?«
»Kennen Sie den Kerl da auf der anderen Straßenseite, der uns die ganze Zeit beobachtet?«
DREI
Marshall
Marshall sagte: »Sehen Sie nicht auf. Er steht da links, auf dem Parkplatz des Reifenladens.«
Henry legte einen Arm auf die Rücklehne des Sitzes und spähte darüber hinweg. »Was gibt’s denn da zu sehen?«
»Da steht eine Pontiac-Limousine weiter hinten. Die kam kurz nach mir.«
Henry beugte sich vor. An einer Seite seines Kopfes fehlten die Haare rings um eine tiefe Einkerbung, die von einem Messer stammen musste. Marshall roch den Jack Daniel’s. Henry sagte: »Da sind jede Menge Autos.«
Marshall schüttelte den Kopf. »Nein, da sind genau sieben. Und der Pontiac ist der einzige Wagen, in dem jemand sitzt.«
»Man kann doch gar nichts erkennen, da sind viel zu viele Reflexionen auf der Scheibe.«
»Ich hätte bestimmt bemerkt, wenn jemand ausgestiegen wäre. Das war aber nicht der Fall.«
Henrys Jackett war aufgegangen. In seiner Brusttasche steckte ein blauer Parker-Kugelschreiber. Gehörte wahrscheinlich zu seinem seriösen Gebaren, genau wie der Bildschirm mit den CNN-Nachrichten. Er sagte: »Na und?«
Marshall sagte: »Da sitzt jemand drin und beobachtet mich – oder Sie.«
Henry schwieg, lehnte sich zurück und brachte die Aufschläge seines Jacketts wieder in Ordnung. Geziert winkelte er die Ellbogen dabei an. »Ist Ihnen jemand hierher gefolgt?«
Marshall schüttelte langsam den Kopf und schaute weiter in die gleiche Richtung. »Ganz bestimmt nicht.«
»Mir auch nicht.«
»Sind Sie da ganz sicher?«
»Ziemlich. Ich hab am Heck eine Kamera, die mir zeigt, wer hinter mir herfährt.«
Marshall warf einen Blick über die Straße, um die Lage einzuschätzen. »Es wäre besser, wenn Sie sich ganz sicher wären.«
Henry schwieg.
Marshall sagte: »Es wäre natürlich möglich, dass Sie jemandem mitgeteilt haben, Sie würden mich treffen. Um mich reinzulegen.«
Vielleicht hatte er das sogar selbst in die Wege geleitet und abgewartet, was passieren würde.
Sie schauten einander an. Henry hielt Marshalls starren Blick eine ganze Weile lang aus. Marshall zählte die Sekunden, indem er mit einem Finger auf die Armlehne tippte.
Schließlich sagte Henry: »Ich hab nichts gemacht.«
»Tja.«
»Ich trage eine Waffe, nur damit Sie es wissen. Für den Fall, dass Sie was gegen mich im Schilde führen.«
Das war immerhin eine Chance, aber keine besonders gute, wenn da drüben ebenfalls eine Waffe im Spiel war. Marshall schaute durch die mit Regentropfen benetzte Scheibe. Der Escalade hatte einen Streifen mit LED-Leuchten am Rand des Daches, die einem Betrachter sofort ins Auge fielen. Marshall sagte: »Sie wüssten es, wenn derzeit jemand hinter Ihnen her wäre?«
Henry berührte gedankenverloren seinen Kugelschreiber, als suchte er eigentlich nach Zigaretten. »Weiß ich nicht. Könnte natürlich sein. Wie ich schon sagte, von meiner Aussage war eine ganze Menge Leute angepisst. Und tatsächlich war es dunkel, als ich hierhergekommen bin, es könnte sich also jemand an mich drangehängt haben. Sie kennen das ja, manchmal sieht man nur noch Scheinwerfer.«
Marshall nickte. »Wir werden es gleich wissen.«
»Was haben Sie vor?«
»Ein Gespräch führen, um rauszufinden, was Sache ist.«
»Wollen Sie ihn etwa umnieten?«
»Von wollen kann nicht die Rede sein. Aber es könnte nötig werden, falls er die Absicht hat, mich umzunieten.« Er schaute Henry direkt an, als er das sagte.
Henry erwiderte seinen Blick, er wirkte eher gelangweilt. »Was soll denn der Scheiß? Ich hab Sie nicht reingelegt, verdammt.«
Marshall dachte nach. Bezog alle Möglichkeiten und Perspektiven mit ein und auch die Tatsache, dass Mord im Spiel sein könnte. Dann sagte er: »Na gut.«
»Na gut, was?«
Marshall schwieg.
Henry richtete sich auf und suchte hinter sich nach etwas. Schließlich fand er die Fernsteuerung und schaltete den Bildschirm aus. »Was wollen Sie denn tun? Der ist entweder wegen Ihnen oder wegen mir da; ich hab Sie jedenfalls nicht verpfiffen.«
Marshall starrte auf seine verschränkten Hände und tippte die Daumen gegeneinander. »Ich hab weiter oben an der Straße geparkt. Sie können mich da rauslassen, und dann warten wir ab, wem er folgt.«
Kurzes Schweigen, Henry ließ es sich durch den Kopf gehen. »Was ist, wenn er mir folgt?«
»Dann folge ich ihm.«
»Und was dann?«
Marshall wartete ein paar Sekunden lang und sagte endlich: »Denken Sie sich was aus.«
Henry schwieg.
Marshall deutete mit dem Kopf an ihm vorbei zur Straße. »Mein Wagen steht weiter oben an der Main Street. Sie setzen mich einfach da ab und fahren dann weiter.«
Henry gähnte und blinzelte, wie um seine Nervosität loszuwerden. »So ein Scheiß. Aber meinetwegen, okay.«
»Gut.«
Marshall schob seine Geldbörse und das Telefon in die eine Hosentasche, drehte sich dann zur anderen Seite und verstaute seine Schlüssel. Schließlich klemmte er sich den MoMA-Katalog unter den Arm, stieg aus und nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Hinten gab es nur die eine Tür, weshalb Henry ihm nach draußen folgen und dann um die Motorhaube herumgehen musste, um zur Fahrerseite zu gelangen. Die Hände hatte er tief in die Taschen seines leichten Anzugs geschoben, der nicht für diese Kälte gemacht war.
Henry nahm Platz, knallte die Tür zu und legte sein Telefon auf die Konsole zwischen den Sitzen. Er warf einen Blick auf den Schlüsselbund in seiner Hand und suchte nach dem richtigen. »Was meinen Sie, ist das ein ’72er Catalina?«
Marshall warf einen Blick auf den Pontiac. »Ja, könnte sein.« Er blätterte in seinem MoMA-Katalog. Auf dem Titel war Warhols Bild mit der Campbell-Dose zu sehen. »Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er einen guten Geschmack hat, was Autos betrifft.«
Henry drehte den Zündschlüssel. Der Escalade sprang locker an und summte geduldig im Leerlauf vor sich hin. »Woher wollen Sie denn wissen, dass es ein Mann ist?«
»Ich wurde noch nie von einer Frau beschattet.«
Henry nickte, seine Mundwinkel sanken herab. Er schaltete die Scheinwerfer ein und ließ die Scheibenwischer einmal über die Windschutzscheibe gleiten. Er beugte sich so weit vor, dass sein Kinn beinahe das Lenkrad berührte und sagte: »Und woher wollen Sie wissen, dass es nur einer ist? Es könnten noch andere da sein, die wir nicht bemerkt haben.«
Marshalls Blick huschte über den Parkplatz. Die Karosserien der Fahrzeuge glänzten feucht im Regen, das Licht der Straßenlaternen spiegelte sich in den dunklen Fenstern. Er wäre jetzt gern wieder in Kalifornien gewesen oder sogar in New Mexico. Bei einem schönen mexikanischen Essen. Am liebsten Enchiladas mit grünen Chilis. Er sagte: »Das glaube ich nicht.«
»Aber es könnte sein.«
»Wenn es mehrere wären, dann wären die längst rübergekommen und hätten uns hier im Wagen erledigt.«
»Und was wird der Typ da drüben jetzt machen?«
Marshall warf einen Blick in den Seitenspiegel. Hinter ihnen war nichts zu sehen bis auf die Rückseite der Küche vom Diner. Sonst nur fensterlose Backsteinwände, Entlüftungsgitter, aus denen Dampf strömte, und ein Berg aus alten Kartons. Die Rücklichter warfen einen rötlichen Schimmer auf alles. Er sagte: »Der wartet auf eine günstige Gelegenheit, um das zu tun, was er sich vorgenommen hat. So läuft das in den meisten Fällen.«
»Aufregend.«
»Ja, genau. Biegen Sie links ab.«
Henry löste die Bremse und verließ die Parkbucht. Die Motorhaube hob und senkte sich, als sie die Fahrrinnen kreuzten. Er wartete kurz, bis sich im Verkehr eine Lücke auftat, und bog dann auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Der große Wagen kam schnell in Fahrt.
Marshall beugte sich vor und warf erneut einen Blick in den Seitenspiegel. Die Scheinwerfer des Pontiacs flammten auf, die dunkle Limousine setzte sich in Bewegung.
»Langsam. Wir wollen ihn ja nicht verlieren.«
Henry nahm Gas weg und schaute ihn an. »Was soll denn das mit dem Buch eigentlich?«
Marshall sagte: »Damit ich was zu lesen habe. Ich hatte ja den ganzen Abend Zeit.«
»Ja, gut, aber wieso ausgerechnet diese, äh, Kunstscheiße?«
Statt zu antworten, beobachtete Marshall, wie der ’72er Pontiac Catalina – oder was es auch war – sich fünf Wagen hinter ihnen in den Verkehr einfädelte. Um diese Zeit wirkte das wie eine Drohung. Regen auf schwarzem Glas. Die Straße mit ihren nächtlichen Farben wirkte wie ein Graffititraum. Unangenehme Dinge kündigten sich an. Jedenfalls sagte ihm das sein Gefühl.
Henry beugte sich zu ihm und schnippte mit den Fingern. »He, wieso ausgerechnet diese Kunstscheiße?«
»Ich versuche, mich zu bilden.«
Henry hielt das Lenkrad mit den Knien fest und pustete in die Hände. »Mit Erfolg?«
»Weiß ich noch nicht. Ich bin erst halb durch.«
Sie hielten an einer Ampel. Henry schaute in den Rückspiegel und riss den Mund auf, um seine Zähne zu checken.
Marshall sagte: »Ich stehe da vor dem Waschsalon. Nur noch ein kleines Stück auf der rechten Seite.«
»Lassen Sie sich ein paar Klamotten reinigen?«
Die Ampel wurde grün. Sie bewegten sich mit dem Verkehrsstrom voran. Henry setzte den Blinker und bog an der richtigen Stelle ab. Vor dem Waschsalon parkten drei Autos mit den Kühlern vor dem hell erleuchteten Schaufenster, man sah nur ihre Silhouetten. Drinnen saßen zwei Personen und starrten die rotierenden Wäschetrommeln an.
Henry sagte: »Wahrscheinlich ist das eine gute Methode, um jemanden zu hypnotisieren. Setz sie einfach vor einen Wäschetrockner, lass das Ding fünf Minuten laufen und flüstere ihnen währenddessen irgendeinen Mist ins Ohr. Und gib ihnen irgendein Pulver zu schnupfen, um die Wirkung zu verstärken.«
Marshall sagte: »Meiner ist der Ford ganz hinten. Fahren Sie da auf den Schotter rauf.«
»Ich könnte Sie auch hier rauslassen.«
»Nein. Halten Sie da vorn.«
Henry zuckte mit den Schultern, als wäre es ihm egal. Sie rollten an den parkenden Autos vorbei und federten dann ganz sanft auf die Betonplatte des Parkplatzes, aus dem ein größerer Teil herausgebrochen war, der offenbar erneuert werden sollte. Schräge Parklücken in den Ecken. Henry fuhr mit einer Hand, die Handfläche locker auf das Lenkrad gelegt, und parkte direkt neben dem Ford. Der Kies unter den Reifen knirschte, das Licht ihrer Scheinwerfer wurde von der Schaufensterscheibe reflektiert. Eine Weile standen sie im Leerlauf da, während graue Abgasschwaden hinter ihnen aufstiegen.
Henry sagte: »Folge ich Ihnen, oder folgen Sie mir?«
»Ich folge Ihnen.«
»Wo ist er denn jetzt?«
»Da hinten am Straßenrand.« Marshall holte seine Schlüssel aus der Tasche und schob die Tür auf. Die kalte Nachtluft schlug ihm entgegen. »War nett, Sie zu treffen, Henry.«
»Ja.«
»Ich melde mich wieder.«
Er ließ das Buch fallen, als er ausstieg, und hob es eilig wieder auf, fast ohne innehalten zu müssen. Der Cadillac stieß rückwärts in einem scharfen Bogen aus der Parklücke und fuhr davon. Schmutzwasser spritzte auf. Marshall ging mit hochgezogenen Schultern zu seinem Ford, die Kälte setzte ihm zu. Es war ein Leihwagen. Um ihn zu bekommen, hatte er den Führerschein vorzeigen müssen – und damit seine eigene Regel missachtet, nie seine Identität preiszugeben. Er hatte es damit gerechtfertigt, dass er schon vergangene Woche beim Einchecken in das Hotel seinen Namen genannt hatte, womit sein Vorsatz, anonym zu bleiben, ohnehin Makulatur war. Und Henry hatte ihm auch keine Wahl gelassen. Er hatte darauf beharrt, dass sie sich nur an diesem Tag und nur in Connecticut treffen könnten. Ohne Auto wäre das nicht zu schaffen gewesen.
Er spähte über das Dach seines Fords zur Straße, während er die Tür aufschloss. Der Verkehr war nicht mehr so dicht. Das stetige Geräusch von Reifen auf der nassen Fahrbahn. Der Pontiac stand immer noch da und schien sich nicht darum zu kümmern, dass Henry Lees Escalade sich zügig entfernte.
Er stieg ein und schaltete die Innenbeleuchtung ein. Der Pontiac war jetzt nicht mehr zu sehen, nur das Licht seiner Scheinwerfer drang noch durch die beschlagenen Fenster. Er wischte Schmutz und Feuchtigkeit von dem Kunstkatalog und legte ihn sich mit dem Titel nach unten auf den Schoß. Nachdem er noch einmal mit dem Ärmel über den Einband gewischt hatte, machte er mit dem Daumennagel eine Kerbe in die Mitte, ein hübsches kleines X. Dann hielt er das Buch ins Licht und musterte es prüfend. Die beiden Balken des X waren gleich lang und verliefen in einem Dreißig-Grad-Winkel zum Seitenrand. Geradezu ästhetisch. Das Kreuz lag vielleicht nicht exakt in der Mitte, aber das war noch halbwegs akzeptabel. Insgesamt gar nicht so schlecht, angesichts der Tatsache, dass er nur mit Augenmaß gearbeitet hatte.
Er blätterte ziemlich weit nach hinten, bis Seite dreihundertneunundfünfzig, zu dem Kapitel über Trisha Donnelly. Das Buch roch immer noch neu. Er hielt den Stein hoch, den er zusammen mit dem Band aufgehoben hatte, und musterte ihn im Licht der Lampe. Kein schlechtes Exemplar. Leicht pyramidenförmig und ungefähr zweieinhalb Zentimeter lang. Er hatte ja keine Wahl gehabt, sondern das nehmen müssen, was unter dem heruntergefallenen Buch lag, aber der hier war ziemlich gut für seine Zwecke.
Er umfasste den Autoschlüssel, stieß die Spitze in die Mitte des Buchs, mitten durch Trisha Donnellys »Satin Operator«, und ruckte daran, bis er auch die letzte Seite durchstochen hatte. Der hintere Einband stellte noch eine besondere Herausforderung dar, aber schließlich war er an der markierten Stelle ganz durch und zog den Schlüssel wieder heraus, um anschließend den Stein in das Loch zu drücken. Die Seiten quietschten, als er ihn hineinquetschte. Er zerstörte Text, den er noch nicht gelesen hatte, doch er wollte auf keinen Fall die Vorderseite des Einbands beschädigen.
Er schob den Schlüssel ins Zündschloss und schaltete die Lüftung ein, um die Windschutzscheibe freizubekommen. Der Pontiac lag immer noch auf der Lauer. Er klappte das Buch sorgfältig zu und legte es so auf den Beifahrersitz, dass der Stein sich oben befand. Dann schaltete er die Innenbeleuchtung aus und startete den Motor.
Nun ging es in südlicher Richtung den Merritt Parkway entlang. Zwischen ihm und dem Pontiac lagen fünf Fahrzeuge. Marshall hielt sich mit fünfundsechzig Meilen pro Stunde auf der rechten Spur, um es dem Verfolger leicht zu machen. Nach dieser langen Wartezeit wollte der ihn bestimmt nicht verlieren. Der Ford ließ sich gut fahren, es war ein Fusion, gerade mal ein Jahr alt und ideal, um mit dieser Geschwindigkeit über den Highway zu gondeln. Der Motor klang weich und nagelneu. Er hatte das Radio eingeschaltet, achtete aber kaum darauf, der Empfang war immer wieder leicht gestört. Zäher Verkehr auf der vierspurigen Straße, zwei unendliche Reihen von Scheinwerfern aus der Gegenrichtung. Dunkle, scharf skizzierte Baumreihen am Straßenrand. Keine Sterne am Himmel.
Er suchte nach einem Diner, am liebsten einem mit großem Parkplatz davor. Das Merritt war eher nicht geeignet. Wenn er eine Abfahrt nahm, hätte er wahrscheinlich mehrere kleinere Lokale zur Auswahl, aber die Interstate kam ihm für seine Zwecke geeigneter vor. Je dichter der Verkehr, umso mehr Gäste im Diner. Und umso größer der Parkplatz.
Er fuhr weitere zwanzig Minuten den Parkway entlang, wechselte in Norwalk auf die US 7 und dann auf die I-95 Richtung Süden. Jetzt waren nur noch zwei Scheinwerferpaare hinter ihm, einer davon zweifellos der Pontiac. Er beschleunigte wieder auf seine fünfundsechzig Meilen und überlegte, wie er die Sache anpacken, wie weit er gehen sollte. Er legte den linken Arm auf den Fenstervorsprung und hielt das Lenkrad mit einem Finger fest, um lässig zu wirken; er bemühte sich, nicht zu oft in den Rückspiegel zu schauen.
Fünf Minuten hinter Norwalk fand er, was er suchte: das Reklameschild eines Diners mit grellroter Schnörkelschrift und vier Meter hohen Burgern. Die Art von greller Beleuchtung, die signalisiert, dass den Gast etwas Einmaliges erwartet. Nächste Ausfahrt. Er fuhr rechts raus, und der Pontiac folgte ihm brav, er war schon seit geraumer Zeit ohne Puffer hinter ihm hergefahren.
Er erreichte das Ende der Abfahrt und konnte die Leute im Diner sehen, das sich direkt neben der Fahrbahn befand. Es war ein Backsteingebäude mit einem Säulenvorbau in der Mitte, der wohl ein Gefühl von Größe vermitteln sollte. Davor erstreckte sich gut ein halber Morgen Parkfläche. Hier und da waren vereinzelte Autos geparkt, bewacht von einigen Laternen.
Marshall fuhr am Stoppzeichen vorbei und stellte sich in eine Parkbucht dicht neben dem Säulenvorbau. Die Menschen in den Nischen am Fenster schauten ihm mit leeren Gesichtern zu und schienen ganz ins Kauen versunken. Er schaltete den Motor ab und blieb einen Moment lang sitzen, um im Rückspiegel nach dem Pontiac zu sehen, der am Ende der Zufahrt angehalten hatte. Er nahm das Buch vom Beifahrersitz, steckte es in seine Jacke und zog den Reißverschluss hoch. Der Pontiac näherte sich. Marshall stieg aus, einen Arm dicht am Körper, damit das Buch an seinem Platz blieb. Ein scharfer Wind wehte, es war kalt und der Himmel rabenschwarz. Das einzige Geräusch kam vom Highway. Hier und da schimmerten die glatten, glänzenden Flächen von Pfützen im Licht der Laternen.
Er schloss den Ford ab und beobachtete, wie der Pontiac dicht an der Straße bremste und seine Scheinwerfer erloschen. Das tiefe Wummern des Motors erstarb, als er durch die Tür zwischen den Säulen trat. Das Lokal war ungefähr zur Hälfte gefüllt. Die übliche warme, lärmende Diner-Atmosphäre, ketchuprote Kunstledersitze, der Geruch nach Fett, der alle umwehte, die von der riesigen Reklametafel angelockt worden waren.
Eine birnenförmige Kellnerin lächelte ihn an. »Einen Tisch für Sie?«