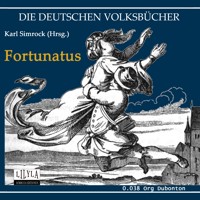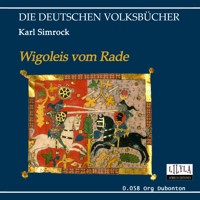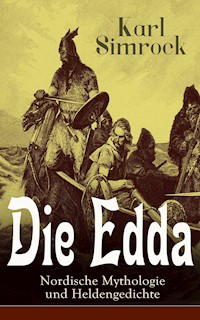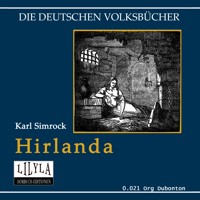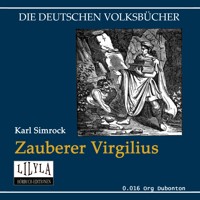Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Karl Simrocks 'Der Rhein' ist ein fesselndes literarisches Werk, das sich mit der Bedeutung des Rheins als kulturelles Symbol in der deutschen Literatur auseinandersetzt. Der Autor kombiniert historische Fakten mit poetischen Beschreibungen des Flusses, um eine tiefgründige Darstellung seiner Schönheit und Vielseitigkeit zu schaffen. Simrocks eleganter Schreibstil verleiht dem Text eine lyrische Qualität, die die Leser in eine faszinierende Welt des Rheins eintauchen lässt. Das Buch bietet einen einzigartigen Einblick in die kulturelle Identität Deutschlands und zeigt auf, wie der Rhein als Inspirationsquelle für zahlreiche Künstler und Schriftsteller gedient hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Rhein
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Wie einst das politische Deutschland in zehn Kreise, so hat man nun das malerische und romantische Deutschland in ebenso viele Sektionen geteilt. Von allen Teilungen, welche Deutschland erlitten hat, lasse ich mir diese am liebsten gefallen, weil sie für mich den wesentlichen Vorzug vor den früheren hat, daß ich bei ihr nicht totgeteilt worden bin wie bei jenen, die mich weder mit einem Herzogtum noch mit einem Kreis bedacht hatten. Bei dieser neuen Teilung bin ich aber keineswegs zu kurz gekommen: der größte und edelste deutsche Strom ist mir anheimgefallen und an seinen Ufern Länder, die einst als die köstlichsten Edelsteine in der deutschen Kaiserkrone glänzten und noch jetzt der Stolz, das Entzücken Europas sind.
Ich muß mächtige Freunde bei dem Leipziger Kongreß gehabt haben, daß man mir, dem Geringsten unter allen Teilnehmern, wenn ich überhaupt ein Recht hatte, mitzuteilen, gerade das allerkostbarste Stück des weiland Heiligen Römischen Reiches auf den Teller gelegt hat. Denn jetzt, wo die Verträge abgeschlossen und verbürgt sind und der Handel nicht mehr zurückgehen kann, jetzt darf ich es wohl sagen, daß sich die Übrigen fast nur in die Schalen geteilt und mir den schmackhaften Kern allein überlassen haben.
Hatten sie wohl bedacht, daß das Deutsche Reich ursprünglich auf die fränkischen Länder gegründet war, die zu beiden Seiten des Rheins liegen, daß ihr Besitz den nächsten Anspruch auf die Kaiserkrone gab? Aus dem Frankenreich, das sich am Rhein gebildet hatte, war ja Deutschland erst als ein einiges Ganzes hervorgegangen. Auch späterhin, als es schon sächsische und schwäbische Kaiser geben konnte, blieb doch der Vorzug der rheinfränkischen Länder ungeschmälert, denn erstlich wurde der deutsche König durch die Wahl seinem Recht nach ein Franke, das heißt ein Rheinländer, und dann mußte sowohl die Wahl selbst als auch die Krönung in den bevorzugten rheinischen Ländern, in Frankfurt und Aachen, geschehen, wenn sie gültig sein sollte.
Das sind freilich jetzt veraltete Dinge; auch will ich unter dem Vorgeben, daß die deutschen Kaiserstädte in meine Sektion fallen, nicht etwa eine papierene Krone in Anspruch nehmen. Nicht für mich, für das Rheinland behaupte ich einen Vorzug, und diesen verdient es durch Eigenschaften, die nicht in Gefahr sind, zu veralten. Natur und Geschichte haben es durch Gaben ausgezeichnet, die der Himmel selbst nicht zurücknehmen kann. Das schönste deutsche Land ist zugleich das reichste an historischen und mythischen Erinnerungen. In beiden Beziehungen ist hier Deutschlands klassischer Boden. Einst besaß ihn ein Volk des klassischen Altertums, dessen Denkmale noch täglich aus seinem Schoß hervorgewühlt werden. Seitdem hat er durch das ganze Mittelalter den vornehmsten Schauplatz der deutschen Geschichte hergegeben, alle Schicksale unseres Volks sind auf ihm entschieden worden, die edelsten Blüten deutscher Kultur hat er hervorgetrieben. Und wäre seine Vergangenheit nicht so reich und groß, könnten wir alles auslöschen, was auf den Blättern der Geschichte von den Rheinlanden geschrieben steht, so würde die Gegenwart den rheinischen Boden von neuem zum klassischen stempeln. Seine Naturschönheiten allein sichern ihm diesen Ehrentitel, noch mehr die üppige Kultur, die den Reiz jener erhöht, dann seine vielen blühenden Städte, die mit allen Schätzen der Kunst und des Gewerbefleißes prangen, am meisten aber seine biederen, wahrhaft gebildeten, noch nicht durch die überall einreißende Überfeinerung um Kopf und Herz betrogenen Bewohner.
Deutschland, dem die Donau nur in ihren Anfängen gehört, hat einen zweiten Strom wie den Rhein nicht aufzuweisen. Wir gehen weiter und sagen: Europa, das heißt hier die Welt, besitze seinesgleichen nicht. Man hat Deutschland das Herz Europas genannt; weil aber das Herz der Sitz der Leidenschaften ist, so wollten einige dem immer heftig aufgeregten Frankreich die Ehre vindizieren, für das Herz Europas zu gelten. Gesteht man Deutschland und Frankreich gleiche Ansprüche darauf zu, so muß das im Herzen beider gelegene Rheinland den Sieg über beide davontragen. Entscheidet man sich für das tiefer fühlende Deutschland, so lehrt die richtige Ansicht von dessen natürlichen Grenzen, daß der Rhein mitten durch das Herz dieses Weltherzens fließt. Die Welt ist zwar rund, mithin ihre Mitte wie ihr Ende überall; aber als eine Wohnstätte der Völker hat die Erde ihre Mitte da, wo sich die mächtigsten und gebildetsten Nationen begegnen. Und auch dies entscheidet für den Rhein, denn an seine Ufer, die England alljährlich mit zahllosen Abgesandten überschwemmt, grenzen außer Frankreich die wichtigsten deutschen Staaten: Österreich, Preußen, Bayern und Württemberg, anderer zweiten und dritten Ranges nicht zu gedenken; die Schweiz und Holland liegen in seinen Quellen und Mündungen, und Belgien wird durch eine Eisenbahn mit ihm in Verbindung gesetzt. Durch diese und ähnliche großartige Unternehmungen, die teils schon im Bau begriffen, teils beschlossen und genehmigt sind, wohin auch der Donau-Main-Kanal gehört; wird das Rheintal immer mehr das werden, was es jetzt schon ist: die Hauptstraße der gebildeten Welt, der Markt und Sammelplatz aller Nationen, der große Korso für die Faschingsfreuden der schönen Jahreszeit, zu welchen einzuladen sich dieses irdische Paradies mit immer neuen Reizen schmückt. Nirgends ist der Völkerverkehr lebendiger, die stündlich abgehenden Schnellposten mit ihren Beiwagen, die goldglänzenden Dampfschiffe, vor deren umgeschwungenen Rädern der Strom nicht zur Ruhe kommt, die geräumigen, mit der verschwenderischen Pracht der Paläste eingerichteten Gasthöfe wissen die Menge der Reisenden nicht fortzuschaffen, die Zahl der Fremden nicht unterzubringen. Man ist nicht mehr in Deutschland, man fühlt sich in der großen Welt. Für die Bedürfnisse der Reisenden, für alle erdenklichen Bequemlichkeiten wird mit einem Raffinement gesorgt, das man ohne Lächeln nicht wahrnehmen kann. Reisebücher, Karten, Panoramen, malerische und plastische Darstellungen einzelner Gegenden wie größerer Strecken, Sagensammlungen in Versen und Prosa und tausend andere Reisebehelfe sind in allen Kunst-und Buchläden in solcher Fülle zu kaufen, daß zwischen Mainz und Köln kaum ein Haus, kaum ein Baum gefunden wird, der nicht schon eine Feder oder einen Grabstichel in Bewegung gesetzt hätte. Diese Gegend ist so vielfältig beschrieben, abgebildet und dargestellt worden, daß man zuletzt das Postgeld schonen und sie mit gleichem Genuß in seinen vier Wänden bereisen kann. Auf eine solche malerische Reise im Zimmer ist es auch hier wieder abgesehen.
Den Namen Rhein (hrên, Rhenus) führte der Strom schon, ehe deutsche Völker seine Ufer in Besitz nahmen. Es hat so wenig gelingen wollen, ihn aus dem gleichlautenden deutschen Wort (rein) als aus einem griechischen, welches fließen bedeutet, abzuleiten. Mag aber sein Name in seiner ältesten Form keltisch sein, der Strom selbst ist seit fast zwei Jahrtausenden deutsch wie seine Anwohner, die mit den Kelten selbst auch jenes keltische »hren« verdrängten und durch eine ähnlich klingende appellative Flußbenennung ersetzten. Uns hieß also der Rhein der Fluß überhaupt, gleichsam der Fluß aller Flüsse. Und von jeher war dieser Name ein süßer Klang in einem deutschen Ohr. Wie oft und gern flochten die Minnesänger ihr sehnsüchtiges »alumbe den rîn« ihren schönsten Liedern ein, zuweilen ohne weiteren Grund, nur des lieben Namens willen. Heute noch, wenn es in unserem Nationalgesang, in dem Rheinweinlied des trefflichen Claudius, an die Stelle kommt, wo es heißt: »Am Rhein, am Rhein!«, wie stimmen alle Kehlen vollkräftig mit ein, wie klingen alle Römergläser an, wie schüttelt der Deutsche dem Deutschen die Hand, wie fühlen sich alle Teilnehmer des Festes, so zufällig sie zusammengekommen seien, in dem Gedanken an den geliebtesten unserer Ströme befreundet und verbrüdert!
Was ist es, das diese magische Wirkung auf die Gemüter ausübt? Ist es der Duft der Rebenblüte, der sich im Becher verjüngt, oder der edle Geist des Weins, der von dem Zauberwort erlöst in uns überströmt? Oder weht uns der frische Hauch des Rheintals an, die gesunde Alpenluft, die der Strom von den Gletschern seiner Heimat bei sich führt? Ist es der königliche, tiefgehende Fluß selbst, der seine klaren, grünen Wogen mit deutscher Ruhe von der Schweiz bis Holland wälzt? Sind es seine gepriesenen, vielbesungenen Ufer, das jährliche Ziel einer neuen Völkerwanderung? Sind es die sanft geschwungenen Rebenhügel, denen der geistreichste Most entströmt, oder die starren Felsen, von denen Schlösser und Burgen als Zeugen einer großen Vergangenheit niederblicken? Ist es der kräftige Genius des Mittelalters, an den jene Ruinen mahnen, oder der Geist der neueren Zeit, der nirgends vernehmlicher als am Rhein zu uns spricht? Sind es die geschichtlichen Erinnerungen oder die alten vertrauten Sagen? Ist es die schöne Gegenwart oder die lachende Zukunft, was uns vor die Seele tritt, wenn der Name Rhein uns ergreift? Dies alles erschöpft den Zauber des Wortes nicht, und wenn sich noch tausend andere Vorstellungen unbewußt mit jenen verbänden, so würde doch die Magie des Namens unenträtselt bleiben. Wer sich aber auf die Anatomie der Gefühle verstände, wer seine leisesten Empfindungen zergliedern könnte, der würde vermutlich finden, daß in dem Namen des Rheins etwas Heiliges, etwas Heimatliches liegt, das seine Wirkung nicht verfehlt, obgleich wir sie uns nicht zu erklären wissen.
Ja, der Rhein ist uns ein heiliger Strom, und seine Ufer sind die wahre Heimat der Deutschen, der ehrwürdige Herd aller deutschen Kultur. Was dem Inder der Ganges, das ist dem Deutschen der Rhein. Religion, Recht, Kunst und Sitte haben sich von ihm aus über die Gaue unseres Vaterlandes verbreitet. Dies allein gibt uns ein Licht über die geheimnisvolle Wirkung seines Namens.
Wir behaupten nicht gerade, daß die Deutschen dem Rhein jemals göttliche Ehre erwiesen hätten. Daß aber die alten Franken und Alemannen, die um den Rhein wohnten, Flüsse und Quellen verehrten, ist bekannt. »Das Volk betete«, sagt Grimm, »am Ufer des Flusses, am Rande der Quelle, zündete Lichter an, stellte Opfergaben hin.« Obgleich es kein ausdrückliches Zeugnis meldet, so ist es doch glaubhaft, daß diese Verehrung ihrem Hauptfluß, dem Rhein, vorzugsweise gegolten habe. Die bekannte Wasserprobe zur Ermittlung der Echtheit oder Unechtheit neugeborener Kinder würde dahin deuten, wenn es gewiß wäre, ob sie Kelten oder Germanen zugeschrieben werden müsse. Die ältesten Anwohner hielten nämlich den Rhein mit einer solch wunderbaren Natur und Eigenschaft begabt, daß sie ihre Kinder gleich nach der Geburt zur Prüfung ihrer ehelichen Erzeugung dem Strom übergaben, der die rechtmäßigen Abkömmlinge sanft wieder an das Ufer spülte, die unechten aber »mit ungestümen Wellen und reißenden Wirbeln als ein zorniger Rächer und Richter des Unreinen« unter sich zog und ersäufte. Ein deutsches Volkslied, auf das auch eine Handwerksgewohnheit anspielt, erwähnt eine ganz ähnliche Prüfung noch ungeborener Kinder, bei denen der Rhein ebenfalls über echt oder unecht entscheidet. Als herrschende Sitte des Volkes, bei dem der Ehebruch so selten war, ist dies freilich nicht zu denken; was aber in einer solchen Überführungsweise Widersinniges liegt, wird noch mehr Bedenken erregen, sie dem besonnenen Germanen zuzuschreiben. Indessen darf man religiöse Bräuche nicht vor den Richterstuhl des alles verzehrenden Verstandes ziehen, und dieser namentlich hat doch auch seine poetische Seite.
Nach der indischen Legende, die wir durch Goethe kennen, schöpft die reine, schöne Frau des Brahmanen täglich aus dem heiligen Ganges ohne Krug und Eimer, weil sich dem seligen Herzen, den frommen Händen die bewegte Welle zu kristallener Kugel gestaltet. Aber nur solange sie rein bleibt: sobald der leichteste Schatten auf sie fällt, nur ein verwirrendes Gefühl die heilige Ruhe ihres Busens trübt, rinnt ihr das Wasser durch die Finger nieder. Auf ganz übereinstimmenden Begriffen beruht die schöne Sage von der heiligen Ritza zu Koblenz, die trockenen Fußes über den Strom ging, der sie aber gleich zu tragen weigerte, als ein Zweifel die Heiterkeit ihres gläubigen Bewußtseins störte. Beide Überlieferungen setzen die Heiligkeit des Flusses voraus. Auch hier, wie bei jener Wasserprobe, trägt der Strom das Schuldlose, Reine, während das Versinken ein Verdammungsurteil enthält.
Alles eigentümliche Leben, Religion und Sitte der Inder haben sich im mittleren Tal des Ganges geschichtlich entwickelt. Nicht viel geringer war der Einfluß des Rheintals auf die Bildung der germanischen Völker und zunächst des deutschen. Der Unterschied ist freilich der, welcher überhaupt zwischen der Entwicklung des indischen Volkes und des deutschen stattfindet. Dem Inder wurde die Bildung nicht von außen gebracht, ihm war es gegeben, in der Heimat, am eigenen Herd allmählich zum Bewußtsein zu erwachen und wie die Pflanze aus dem Keim die Reihe seiner geistigen Metamorphosen aus sich selbst hervorzutreiben. So gut hatte es der Deutsche nicht, oder vielleicht, er hatte es besser. Gleich bei seinem ersten Auftreten auf der Bühne der Weltgeschichte stieß er am Rhein auf die Römer, ein Volk, das eben auf der Höhe seiner Macht und Bildung stand. Wenn die deutschen Völkerschaften, die damals das Rheintal bezogen, unter der dreihundertjährigen Herrschaft der Römer von ihrer Bildung und Sitte sich vieles aneigneten, so dürfen sie doch stolz darauf sein, daß sie anders als die benachbarten Gallier sich die eigene Sprache bewahrten. Und solange ein Volk seines Siegers Sprache nicht annimmt, ist es nicht wahrhaft besiegt. Und so waren es auch rheinische Völker, Franken, Burgunder und Alemannen, welche die römische Macht am Rhein und in Gallien vernichteten und dann doch des Römers Sitte und Bildung, ja sogar seine Religion über das ganze Land ihrer Stammgenossen verbreiteten, ja weiter bis in die slawischen und awarischen Länder, welche unsere östlichen Marken deckten. Aus einem am Rhein entstandenen Staat, dem fränkischen, ging dann das Deutsche Reich hervor, und durch das ganze Mittelalter blieb das Rheinland der Mittelpunkt seines politischen wie seines geistigen Lebens. Als sich diese Epoche zu Ende neigte, begünstigten die am Rhein erfundene Buchdruckerkunst und die Reformation, an der das Rheinland durch Zwingli und Melanchthon beteiligt ist (um von Reuchlin, Bucer, Ulrich von Hutten, Erasmus von Rotterdam usw. zu schweigen), die aber ohne Gutenbergs Erfindung unmöglich geblieben wäre, die Bildung anderer Herde für das wissenschaftliche und literarische Streben, während die Kunst noch immer ihren alten Wohnsitzen getreu blieb.
Schon früher war im Schoß des Rheinlands ein Fürstengeschlecht erblüht, das im Südosten einen mächtigen Staat gründete und die Kaiserkrone gleichsam erblich trug, wodurch die politische Bedeutung der Rheinlande und die Macht der vier rheinischen Kurfürsten sank. Der Deutsche Orden, dessen erste Großmeister Rheinländer waren, erwarb gleichzeitig ein Land im Nordosten. Dessen Namen führt jetzt der Staat, dem die rheinischen Länder gehören, aus welchen einst das fränkische Reich hervorgegangen war, denen also Frankreich und Deutschland ihren Ursprung als Staatenkörper verdankten. Durch einen so seltsamen Umschwung der Dinge geschah es, daß jetzt beträchtliche Teile des einst gebietenden Rheinlands von jenen slawischen und awarischen Ländern aus beherrscht werden, die ihm Gesittung und Bildung schuldig sind.
Der Rhein ist nicht Deutschlands Grenze; wenn auch einem geliebten deutschen Dichter die unbedachte Äußerung entschlüpfte, daß er Germaniens Grenze bewache, so genügt doch zum Beweis des Gegenteils die einfache Wahrnehmung, daß seine beiden Ufer von deutsch redenden Völkern bewohnt werden. Daß er sich zur Grenze sowenig schicke als irgendein Fluß, bewies der Gallier selbst, eben indem er ihn überhüpfte, sobald er ihn erreicht hatte. Weit entfernt, Deutschlands Grenze zu bilden, fließt der Rhein vielmehr mitten durch das alte Deutschland. Unsere natürliche Grenze gegen Westen bildet nämlich ein Gebirgszug, der sich jenseits der Maas und der Schelde hinzieht; obgleich auch noch diesseits dieser deutschen Pyrenäen welsch redende Stämme unzusammenhängende Wohnsitze haben. Als unser Volk das ihm von der Natur vorgezeichnete Gebiet einnahm, scheinen sie sich auf diese Höhen geflüchtet zu haben, deren Besitz ihnen streitig zu machen sich nicht lohnte. Gegen Osten haben wir seit dem zwölften Jahrhundert bedeutende Erwerbungen gemacht; aber was wir dort gewannen, büßten wir im Westen ein. Das alte Deutschland reichte kaum bis zur Elbe, da bis an die Saale sorbische Völker saßen und noch jetzt in Böhmen, selbst diesseits der Elbe, unsere Sprache nicht herrscht, obgleich sie nördlich und südlich von diesem Land mehr als hundert Meilen weiter vorgedrungen ist. Man könnte mittels der Redensart »dort im Reich«, womit man in den später erworbenen Provinzen das alte Deutschland zu bezeichnen pflegt, dessen Grenzen ziemlich genau feststellen. Wer aber sein Gebiet auf der Karte überblickt, dem kann nicht entgehen, daß es gerade in seiner Mitte vom Rhein durchflossen wird. Dies zur Rechtfertigung unserer obigen Andeutung, daß der Rhein durch das Herz Deutschlands fließe. An das politische Deutschland, dessen Grenzen wandelbar sind, dachten wir dabei nicht; auch kümmert uns hier nur das malerische und romantische.
Der Rhein ist also die Mitte Deutschlands. Die entgegengesetzte Ansicht konnte sich nur bilden, als die in jenen awarischen und slawischen Ländern entstandenen Staaten große Teile des alten Deutschlands zu beherrschen anfingen. Von dort aus gesehen mag sich freilich das geräumige überrheinische Deutschland so verkürzen, daß es als eine mathematische Linie dem Blick verschwindet. Erinnere ich mich doch, daß ein Königsberger gesprächsweise äußerte, Frankfurt a. M. liege hart an der italienischen Grenze. Solchen optischen Täuschungen, welchen sich akustische zugesellen mögen, ist es ähnlich, wenn in jenen östlichen Provinzen die Meinung verbreitet ist, als ob in den Rheinlanden französische Sprache, Sitte und Gesinnung vorherrschen würden, ja als ob ihre Bevölkerung aus deutschen und gallischen Elementen gemischt sei. Nichts kann irriger sein als diese Ansicht. Zwar ist Gallien von den Rheinlanden aus germanisiert worden, aber daraus folgt nur, daß in den Franzosen rheinländisches Blut fließt, nicht in den Rheinländern französisches. Wenn es auf die Reinheit der deutschen Abstammung ankäme, so wäre diese bei den Rheinländern geringerem Zweifel unterworfen als bei den östlich wohnenden Deutschen, die der Vermischung mit Wenden, Sorben, Tschechen und Awaren weit verdächtiger sind. Deutsche Art, Sprache und Sitte kann sich nirgends in so lebendiger Eigentümlichkeit ausgeprägt finden als in dem Land, das als ihre ursprüngliche Heimat zu betrachten ist, von der aus sie erst durch Kolonisation in die östlichen Marken verpflanzt wurde, wo sie sich, in einigen wenigstens, sogar noch heutzutage nur dünn aufgetragen findet. Seltsam wäre es, wenn die Anschuldigung wegen französischer Gesinnung auf besseren Gründen beruhte. Es scheint aber hier freie Gesinnung mit französischer verwechselt zu werden. Freigesinnt ist der Rheinländer durchaus, aber eben das bürgt dafür, daß er die Fremdherrschaft wie jede andere Knechtschaft verabscheut. Was er an seinen westlichen Nachbarn ehrt und schätzt, sind vor allem ihre Freiheitsliebe und ihre Nationalität. Wie sollte er vor Bewunderung jener Tugenden an dem Fremden sie an sich selber verleugnen? Die Anhänglichkeit an das französische Recht, das der Rheinländer als sein Palladium betrachtet und sich ungern entreißen und verderben läßt, gilt nicht seinem Namen, sondern der Sache, die dem Wesen nach deutscher ist, als sich irgendeine andere Gesetzgebung rühmen darf. In der Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens, in dem Geschworenengericht erkennt der Rheinländer ursprünglich deutsche Institute, die, durch fremdes Recht aus der Heimat verdrängt, jetzt unter fremdem Namen wieder dahin zurückgekehrt sind. Heil ihm, wenn es ihm diesmal gelingt, sie zu bewahren!
Der nachstehende Versuch über das malerische und romantische Rheinland hat zunächst die Strecke zwischen Mainz und Köln, mit Einschluß von Frankfurt und Aachen, zum Gegenstand, welche als die malerischste, das heißt reichste an Naturschönheiten, zugleich in romantischer Beziehung, durch historische und mythische Erinnerungen, die sich überall aufdrängen, das meiste Interesse bietet. Weil wir aber nicht gern etwas Unvollständiges liefern und auch wohl voraussetzen dürfen, daß dem Leser ein Ganzes willkommener ist als ein Fragment, so schicken wir eine gedrängte Übersicht des Rheinlaufs von den Quellen bis Mainz voraus und gedenken auch späterhin den Strom nicht zu entlassen, bis wir ihn seinem Vater Ozean ans Herz gelegt haben. Diese Rücksicht glauben wir ihm um so eher schuldig zu sein, als wir ja auch in jedes sich rechts oder links öffnende reizende Seitental einen Blick werfen und uns nach dem Ursprung und den Schicksalen der sie durchströmenden Flüsse oder Bäche erkundigen wollen. Dürften wir dem Rhein, dem Hauptgegenstand unserer Darstellung, gleiche Aufmerksamkeit versagen? Bei der zunächst folgenden Übersicht bitten wir aber den Leser, der vielleicht bemerken wird, daß wir an manchem absichtlich vorübergehen, zu bedenken, daß es unsere Pflicht war, Kollisionen sowohl mit der Sektion Schwaben als auch mit einem eigenen Buch (»Rheinsagen«, Bonn bei Weber) zu vermeiden.
Eingang
Inhaltsverzeichnis
Ein Strom ist wie ein Baum, seine Quellen gleichen Wurzeln und Fasern, seine Mündungen Ästen und Zweigen. Aber den Zuflüssen, die der Strom empfängt, nachdem er durch das Zusammenrinnen seiner Quellbäche Namen und Dasein empfangen hat, entspricht am Baum nichts. Wie sehr lahmt also das Gleichnis! Denn die Wasser, die ihm noch späterhin zueilen, sind gerade die beträchtlichsten.
Doch hier hat Willkür geschaltet. Jene Namengebung ist nur eine Übereinkunft. Was man sich gewöhnt hat, die Quellen des Rheins zu nennen, entspringt nur in Graubünden; aber alle anderen Kantone der deutschen Schweiz senden ihm ihre Gewässer zu. Er empfängt sie meist durch den herrschenden Strom der deutschen Schweiz, die Aar, welche als die Hauptquelle des Rheins gelten würde, wenn er nicht schon vor ihrer Einmündung diesen Namen führte.
Auf seinem weiteren Lauf zollt dem Rhein der größte und älteste Teil Deutschlands. Alles ihm links liegende deutsche Land erkennt seine Herrschaft und sendet ihm durch Ill, Nahe, Mosel und Maas den schuldigen Tribut. Rechts huldigt ihm Schwaben durch Kinzig und Neckar, Ostfranken durch den Main, Hessen durch die Lahn, Altsachsen durch Ruhr und Lippe. Mittels des Mains reicht sein Flußgebiet durch das östliche Deutschland bis an die Grenze Böhmens.
Wie die Schweiz das Quellenland des Rheins ist, das den Strom bildet, so ist Holland das Land der Mündungen, das der in der Schweiz wurzelnde Baum durch seine Äste und Verzweigungen seinerseits eigentlich erst hervorgebracht hat. Aber auch hier begegnet uns die Willkür der Benennungen. Waal, Ijssel und Lek, was sind sie anderes als Äste, Arme des Rheins? Und gerade das Land, das der Rhein geschaffen hat, das aus seinen allmählichen Anschwemmungen entstanden ist, bewies sich so undankbar gegen ihn, daß es den Namen des herrlichen Stroms seinem schwächsten Zweig beilegte und ihn so in den Ruf brachte, als versiege er im Sand. Doch vielleicht ist der Holländer von dieser Anklage des Undanks freizusprechen. Gerade der achtbare Sinn des Volks, der, Neuerungen abhold, den Überlieferungen der Väter getreu bleibt, ist es vermutlich, welchem der unbedeutendste Sprößling des Stroms den stolzen Namen schuldig war. Was jetzt in jenen Niederungen wie zum Spott der Rhein, auch der Alte Rhein heißt, war einst wirklich das Bett des Stroms, durch das er, wenn nicht alle, doch die größte Masse seiner Gewässer dem Ozean zuführte. Als diese sich andere Wege suchten, blieb dem verlassenen Bett ein spärliches Wässerchen und ein anspruchsvoller Name.
Erster Teil: Von den Quellen bis Mainz
Inhaltsverzeichnis
Quellen des Rheins
Inhaltsverzeichnis
Bekannt ist, daß edle Weine nur auf Bergen gewonnen werden. Aber viel höher müssen die Gebirge sein, welchen schiffreiche Wasser entspringen sollen. Ihr Scheitel pflegt den Himmel zu berühren, von dem der Strom, wie ein unmittelbares Geschenk der Gottheit, sich herabzusenken scheint. Schon die alte Großmutter Edda sagt: »Heilige Wasser rinnen von Himmelsbergen.« So hat auch der Rhein, wie alles, was den Menschen frommt, a Jove principium. Die Rheinquellen sind der Welt weder so entrückt noch so unzugänglich wie die des Nils. Dennoch bleiben seine ersten Ursprünge in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Viele hundert Reisende besuchen jährlich die Quellen des Rheins; aber ihre Beobachtungen kommen der Welt nicht zugute, während eine Reise nach den Nilquellen nicht leicht unbeschrieben bleibt. Die Natur selbst war beflissen, ihre innerste Werkstätte dem Blick der Menschen zu entziehen. Wir klettern über die schlüpfrige Eisdecke der Gletscher, uns schrecken ihre klaffenden, gähnenden Schrunde nicht; aber was sich da unten in der inneren Halle begibt, über deren Eisgewölbe wir unser Leben in Gefahr setzen, das können wir nur vermuten und ahnen.
Doch sind es nicht immer die höchsten Gebirge, welche die größten Ströme in die Welt schicken. Der Montblanc, der höchste Berg Europas, gibt keinem namhaften Fluß den Ursprung, während der größte europäische Strom, die Donau, einem vergleichsweise unbedeutenden Gebirge entspringt. Auch in der Schweiz kommen nur Nebenflüsse des Rheins von den höchsten Alpen, da doch die viel niedrigere Kette, die vom Gotthardpaß über den Splügen hinaus bis zum Juliergebirge reicht, bedeutende Ströme nach allen vier Gegenden der Welt entläßt. Die höchsten und niedrigsten Bergzüge scheinen gleich ungeeignet, großen Strömen das Dasein zu verleihen. Gebirge mittlerer Höhe, deren Schnee bei mäßiger Wärme zerrinnt, sind die wasserreichsten: sie können die Flüsse, die an ihren milchweißen Brüsten saugen, den größten Teil des Jahres überflüssig tränken, während die höchsten, mit ewigem Schnee bedeckten Firne selbst bei der glühendsten Sonnenhitze kaum zu schmelzen beginnen. In ihnen hat die Natur unerschöpfliche Vorratskammern angelegt, die dann am ergiebigsten spenden, wenn alles umher vor Durst verschmachten will. In trockenen Sommern würde die Donau versiegen, wenn ihr nicht aus Gebirgsgegenden Zuwüchse kämen, die höher liegen als der Fels, wo ihre Quelle entspringt. Umgekehrt hat der Rhein an den Eisgebirgen seiner Heimat einen Rückhalt, wenn seinen niedrig geborenen deutschen Tributären das Wasser ausgeht.
Jene Alpenkette mittlerer Höhe, welche außer dem Rhein noch drei andere Ströme entsendet, nämlich die Rhône, den Inn und den Tessin, hieß den Alten Adula; uns heißt sie St. Gotthard, obwohl gewöhnlich nur ihr westlichster Paß so genannt wird. Da Hart (Hard) Gebirge heißt, so bleibt unentschieden, ob sie diesen Namen zu Ehren des höchsten Gottes oder des heiligen Gotthard führt, dem an der Quelle des Vorderrheins, also weit oben vom Gotthardpaß, eine Kapelle erbaut war. Wer von dem Gipfel dieses Gotthard die übrigen, viel höheren Gebirgsspitzen erblickt, dem scheint es, als ob sie sich alle gegen ihn verneigten wie gegen Josefs Garbe die Garben seiner Brüder. Und wohl verdient diese Verehrung das Gebirge, welches als die eigentliche Wasserscheide zwischen der Nordsee und dem Mittelländischen Meer zu betrachten ist, denn jener schickt es den Rhein, diesem die Rhône, den Tessin und mittels der Donau den Inn zu.
Doch nicht bloß die Wasser scheidet der Adula, auch das Wetter, und was wichtiger ist: die Völker. Aus dem Livinental, das der Tessin gebildet hat, kam ich nach Airolo, um über den breiten Rücken des Gotthard in die deutsche Schweiz zurückzuwandern. Der Wirt, Herr Camossi, bei dem wir uns zu dem großen Übergang stärkten, wünschte uns in der welschen Sprache seines Landes zu der heiteren Witterung Glück, mit welcher der Himmel unser Unternehmen sichtbar begünstigte. Wirklich blieb uns diese bis auf das Hospiz treu, das auf dem Gipfel liegt, wo wir die letzten Laute italienischer Zunge vernahmen. Doch waren die Vorgänger unserer tessinischen Wirte Deutsche gewesen. Gleich hinter dem Hospiz, wo der Weg sich nördlich senkt, sahen wir einen dichten deutschen Nebel liegen, unter den wir schlüpfen mußten. Da war der heitere Himmel Welschlands verscherzt, der Regen goß in Strömen nieder, und als wir unten das Dorf Hospental erreichten, empfing uns der treuherzige Wirt mit den allzu deutschen Worten: »Was habt ihr für schlechtes Wetter!«
Nicht überall freilich scheidet der Rücken des Adula Deutsche und Welsche so scharf wie am Gotthardpaß. Weiter rechts, wo der Rhein in drei Bächen seinen nordöstlichen Abhängen entspringt, und tiefer in Graubünden wohnen Deutsche und Churwelsche in wunderlicher Mischung durcheinander. Die romanische Sprache, welche letztere reden, ist aber keine Tochter der lateinischen, sondern ihre gleichalte Schwester. Auch hier mögen es Flüchtlinge sein, die in diesen unwirtlichen Bergöden Schutz gesucht und gefunden haben. Wenigstens werden die Räter für Nachkommen jener Tuscier ausgegeben, die bei dem Einbruch der Gallier unter Brennus aus dem heutigen Toskana in die Gebirge zurückgewandert seien, wo ihre ursprüngliche Heimat war.
Also vernimmt der Rhein, Deutschlands Hauptstrom, in seiner frühesten Kindheit eine fremde Zunge? Wird an seiner Wiege welsch gesprochen? Ist Welsch wohl gar seine Muttersprache? Nicht doch! Der Rhein ist in Graubünden erst ein neugeborenes Kind, das vor Schreien und Heulen überhört, was um ihn her gesprochen wird. Zu rauschend stürzt sich der Vorderrhein in Wasserfällen dem Ziel zu, wo ihn der Hinterrhein erwartet; mit zu donnerähnlichem Getöse drängt sich dieser durch die furchtbaren Abgründe der Via Mala; auch der vereinigte Strom braust noch zu ungestüm über Klippen und Felsen hinab, als daß ein Laut menschlicher Rede zu seinem Ohr gelangen könnte. Weiterhin aber und in seiner Wiege, dem Bodensee, vernimmt der beruhigte Strom nur deutsche Klänge.
Die drei Bäche, in denen der Rhein wurzelt, sind unter dem Namen Vorder-, Mittel-und Hinterrhein bekannt. Jeder hat seine eigenen Quellen. Einige nehmen nur einen Vorder-und Hinterrhein an, indem sie den Mittelrhein als einen der vielen Zuflüsse des Vorderrheins betrachten. Den drei Wurzelbächen entsprechen drei Alpentäler, die von den nördlichen Ästen des Adula gebildet werden. Am westlichsten liegt das Tavetscher Tal, wo der Vorderrhein zwischen den Eishöhen des Crispalt und des hohen Badus entspringt. Von den Gletschern des letzteren ergießen sich drei kalte Ströme in den Tomasee, einen von himmelhohen Felsen umstarrten Wasserbehälter, aus welchem die Hauptquelle des Vorderrheins hervortritt. Oberhalb des Dörfchens Tschamut vereinigt sich mit ihr ein anderer, im benachbarten Gämertal entsprungener Bach, unterhalb ein dritter, der aus dem Cornäratal kommt. Bei der vormals gefürsteten Benediktinerabtei Disentis nimmt er den Mittelrhein auf und setzt dann mit unverändertem Namen seinen Lauf fort, bis aus der Vereinigung mit der dritten Wurzel, dem Hinterrhein, unser Rhein hervorgeht. Der Mittelrhein kommt aus dem wohl von ihm genannten Medelser oder Liebfrauental, wo er auf dem Lukmanier, einem Ast des Gotthard, im Tal Cadelimo entspringt. Auch er hat mehrere Quellen, die bei Stinsch zusammenlaufen und aus kleinen Seen kommen, die von den Wassern des Lukmanier getränkt werden. Darunter ist der See Dim bei St. Maria der bedeutendste.
Zwischen dem Mittel-und dem Hinterrhein liegen noch mehrere, von anderen Ästen des Adula gebildete Täler: das Somvixer Tal, das Lugnezertal, aus welchem der Glenner bei Ilanz, der ersten Stadt am Rhein, dem Vorderrhein zufällt, und Safien, »das Land schöner Weiden«, dessen Großer Rabiusa genannter Bach durch das Versamtobel in das gleiche Bett sich ergießt.
Östlicher und südlicher als die genannten Bergwasser entquillt der Hinterrhein, die mächtigste Wurzel des Stroms. Unter dem ungeheuren Mantel des Rheinwaldgletschers verbirgt er unerschöpfliche Quellen. Zwölf Bäche durchbrechen die Eismassen dieses acht Stunden langen Gletschers, um sich in weiten Bogen in einen tiefen Schlund zu stürzen. Außer ihm sind der Hinterrhein-und der Moschelhorngletscher die bedeutendsten dieses Tales. Paradies und Hölle grenzen hier nahe aneinander. Jenen Namen führt nämlich eine Gegend bei dem Dorf Hinterrhein, die nur aus Schneefeldern und Felsblöcken besteht; diesen ein daneben befindlicher bodenloser Abgrund.
Von den Felsenhörnern, die das Rheinwaldtal von allen Seiten einschließen, erheben sich einige mehr als 10 000 Fuß über das Mittelländische Meer. Das Tambohorn jenseits des Splügen wird vom Dom zu Mailand aus gesehen. Es selber gewährt denen, die es zu ersteigen wagen, eine unermeßliche Aussicht. Von diesen ewigen Firnen stürzen sich unaufhörlich Lawinen auf die Gletscher herab, deren wohl vierzig das Rheinwaldhorn umstarren.
Vor meiner Reise nach der Schweiz hatte ich ganz unrichtige Vorstellungen von Gletschern sowohl als von Lawinen. Ich finde, daß es anderen auch nicht besser ergeht. Solche Begriffe werden von Schriftstellern verbreitet, die nie die Regionen des ewigen Schnees betreten haben. Gletscher dachte ich mir als himmelhohe Eisberge, von welchen ich die Lawinen herabrollen, nicht herabstürzen ließ. Von dem Bezug beider auf die Bildung der Ströme hatte ich keine Ahnung. Ein Gletscher ist aber kein Eisberg, sondern ein abschüssiges Tal, eine Schlucht zwischen zwei schneebedeckten Gebirgen. Die Lawinen kommen nicht von den Gletschern, umgekehrt sind es gerade die Gletscher, auf welche die Lawinen sich niederzustürzen pflegen. Leider wandeln sie oft ungewohnte Wege und richten dann jene furchtbaren Zerstörungen an, durch die sie der Schrecken der Alpenbewohner sind.
Ebenso falsch ist die Vorstellung, als ob die Lawinen sich beim Niedersturz gleich Bällen oder Kugeln um ihre eigene Achse drehten. Ihre Fortbewegung ist mehr ein Rutschen als ein Rollen. Wir können etwas Ähnliches in unserer Heimat beobachten, wenn im Winter beim Eintritt gelinderer Witterung der Schnee auf hohen Turmdächern sich löst und hinabgleitet, wo auch der tiefer liegende weggeschoben, nicht aufgerollt wird. Sitzt der untere noch festgefroren auf dem Dach, so schabt ihn der obere im Hinabrutschen fort, wodurch die im Fall begriffene Masse sich häuft und an Volumen wie an Geschwindigkeit zunimmt. Die Erscheinung bleibt die nämliche, nur ist sie größer und furchtbarer, wenn sie sich auf den steilen Abhängen der Hochgebirge begibt. Dann verkündet ein donnerähnliches, dumpfes Getöse das Naturereignis, und der Druck der Luft ist so heftig, daß er allein hinreicht, Häuser und Bäume niederzubrechen, Menschen und Vieh zu ersticken. Viel größer noch ist die unmittelbare Wirkung, die Dörfer und Wälder fortreißen, Ströme verstopfen und, wie es vom Glauben heißt, Berge versetzen kann. So begab es sich mit dem Dorf Rueras, das nicht weit von Ciamut im Tavetscher Tal liegt, wenige Stunden von der Quelle des Vorderrheins, daß es von einer Lawine fortgeschoben wurde, und zwar zum Teil so sanft, daß die Einwohner am Morgen nicht begriffen, warum der Tag anzubrechen säume. Die Verschütteten wurden meist lebend hervorgegraben. Wenn die Lawinen rollend, nicht gleitend sich fortbewegen würden, so würden die guten Bewohner von Rueras durch den Umschwung wohl unsanfter geweckt und nicht so zahlreich gerettet worden sein.
Gletscher sind Eisströme, die sich in Bergspalten zwischen ewigen Schnee niedersenken. Dem Auge als erstarrte Flüsse von starkem Gefälle sich darstellend, beginnen sie bei der Schneelinie und steigen allmählich herab zu den Wohnungen der Menschen. Nichts reizt darum so sehr zum Nachdenken als der Anblick der Gletscher. War dies ursprünglich flüssiges Element, was brachte es plötzlich zum Erstarren? Und war es von Anfang an starr, wie geriet es in Fluß?
In der Talrinne zwischen hochragenden Felshörnern sammelte sich der von ihnen niederfallende Schnee, sei es, daß ihn Sturmwinde anhäuften, oder daß er in Lawinen niederstürzte. Diese Schneemasse verwandelte sich, indem sie das Tal niederglitt, in Eis, zum Teil auch in Wasser, das, von jenem bedeckt, nur durch die Spalten und Schrunde des Eisgewölbes noch gesehen und gehört wird. Die Umwandlung des Schnees in Eis begab sich allmählich durch Auftauen und Wiedergefrieren. Von oben wirkte die Sonnenhitze, von unten und von den Seiten die Erdwärme. Der Schnee begann zu schmelzen; aber von der Nachtkälte ergriffen, gefror er. So bildeten sich Eispaläste, die von niemand als von dem Flußgott bewohnt werden, der unten aus der kristallenen, smaragdgrünen Grotte den fertigen Strom entläßt. Ist dies die Urne, welche die Alten ihren schilfgekrönten Graubärten von Flußgöttern in die Arme gaben?
Die Gletscher, unerschöpfliche Quellen der Flüsse, können selbst schon als deren Anfänge betrachtet werden. Wir nannten sie Eisströme, denn sie sind, wenn auch unmerklich, im Strömen, im Fortrücken begriffen. Die obere Masse, die beständig neuen Zuwachs erhält, drückt auf die tiefer liegende, bis die unterste Stütze, an der Erdfläche geschmolzen und vom Wasser unterfressen, zusammenbricht, worauf mit krachendem Getöse der ganze Gletscher durch seine eigene Schwere fortgeschoben wird. Eine Reihe von Jahren mag aber darüber hingehen, bis die Eismassen, aus denen der heutige Rheinwaldgletscher besteht, geschmolzen das Rheintal hinabflossen und aus den Lawinen des Adula ein neuer, dem heutigen vielleicht sehr unähnlicher Gletscher hervorging.
Graubünden
Inhaltsverzeichnis
Rätien hieß das Land, ehe es durch den in den obersten Rheintälern gestifteten Grauen Bund den heutigen Namen erhielt. Auch Graubünden hat seine Telle usw., ihre Namen sind nicht zu gleicher Berühmtheit gelangt; nicht um Ruhm ja traten sie zusammen, sondern für ihr Volk, und dieses erfreut sich noch heute der von ihnen gegründeten Freiheit. Die Geschichte könnte die Namen ganz entbehren, viele Wohltäter des Menschengeschlechts nennt sie nicht; die Sage ist dankbarer, sie behält uralte ehrwürdige, der Geschichte entfallene Namen, und im Fall der Not setzt sie den einen statt des andern. Oft aber borgt die Geschichte, die ärmere Schwester, von der Sage, bis die Kritik hinzutritt und jeder ihr Eigentum wieder zuweist. So hat man neuerdings Tells Apfelschuß aus der Geschichte in die Sage verwiesen, ja selbst Tells wie Geßlers Dasein geleugnet. Wenn aber die Sage aus lebendiger Anschauung den Sohn der Alpen schildert, wie er das Leben täglich für sich und andere wagt und doch der Dränger Unbill langmütig erträgt und nur, wenn er aufs Äußerste gebracht wird, zu dem sicher treffenden Pfeil greift, ist das nicht auch Geschichte?
Aber leugne man nur die Telle, die Eidgenossenschaft freier Schweizer bleibt eine unleugbare Tatsache. So möge auch Graubündens Freiheit noch blühen, wenn einst der Dolch der Kritik die Namen der Männer getroffen hat, die zu ihrer Gründung den ersten Anlaß gaben.
Der Geist der Freiheit weht am ganzen Rhein, von den Quellen zu den Mündungen: der Schweizer ist nicht freier als der Friese; beide nicht freigesinnter als die zwischen ihnen im Rheintal wohnenden Völker. Aber in der Schweiz und in Rätien waren die Landvögte und Kastellane früher bedacht, das Volk zu drücken und zu drängen, bis der lang gesponnene Faden seiner Geduld entzweiriß.
Im Schamser Tal, dem der kaum entsprungene Hinterrhein aus dem Rheinwaldtal in schönen Wasserfällen durch die Bergenge Roffeln zueilt, liegt auf einem hohen Felsen die Feste Bärenburg. Jenseits, doch tiefer unten, lag in Donath, dem Hauptort des Tals, das Schloß Fardün. Beide ließ Graf Heinrich von Werdenberg zu Sargans durch seine Kastellane verwalten. Diese sollten die Menschheit gehöhnt und das Volk unleidlich gedrückt haben. Der auf der Bärenburg zwang die Bauern, mit dem Vieh aus dem Schweinstrog zu essen; der von Fardün trieb den Landleuten seine Herden in die Saat. Schweigend ertrug es das Volk, bis Johannes Caldar des Kastellans Pferde, die man ihm in die Saat schickte, erstach. Das sollte er in Ketten büßen; aber die Seinigen lösten ihn mit schweren Summen. Denn Johannes Caldar war vermögend und edlen Geschlechts; aber selbst Edle schonten die Unterdrücker nicht.
Als Johannes Caldar mit den Seinen, die ihn befreit hatten, zu Tisch saß, trat der Kastellan von Fardün ins Gemach. Den Eintrittsgruß blieb er schuldig; statt dessen spuckte der Übermütige in den Brei, der den Tischgenossen zum Mahl bereitet stand. Da ergrimmte Caldar, faßte den Wüterich im Genick, drückte sein Haupt in die besudelte Speise und zwang ihn, den Topf selber zu leeren. Ob er noch strengere Rache an ihm genommen hat, wissen wir nicht; aber das aufgerufene Volk stürmte den Zwinger, Fardün und Bärenburg wurden gebrochen, und der Grund zur Freiheit des Tals war gelegt. Vielleicht fielen damals auch andere benachbarte Burgen. Von Hohenrealt wird erzählt, daß der letzte Zwingherr, als er, von den Schamsern und seinem Volk belagert, das Schloß nicht länger halten konnte, sich mit seinem Pferd von der senkrechten Felsenwand Tusis gegenüber in den Rhein hinabgestürzt habe; eine Tat, die eines besseren Täters wert wäre.
Einen anderen Vorfall, der zur Befreiung Hohenrätiens Veranlassung war, sei uns erlaubt mit Zschockes wenig veränderten Worten zu berichten:
»Im hohen grünen Tal des Engadin, von dessen Gletscherhöhlen der Innstrom hervorbraust gegen Tirol, war die Burg Gardovall, auf dem Felsen ob dem Dorfe Madulein, der Schrecken des Landes. Der grausame Kastellan von Gardovall sah eines Tages die Schönheit eines Mägdleins aus dem gegenüberliegenden Dorf Camogask. Und er schickte seine Knechte hinüber, die sollten ihm das Mägdlein zuführen. Da erschrak des Mägdleins Vater, und die Tochter verzweifelte fast. Der Vater aber faßte ein Herz und sprach zu den Knechten: ›Sagt dem gnädigen Herrn, ich werde ihm mein Kind zum Morgen selber zum Schloß bringen.‹ Als sie fort waren, lief der Vater zu seinen Nachbarn und Freunden, erzählte, was geschehen sei, und rief: ›Sind wir, Menschen, dieses Herren Vieh?‹ Da kochte Zorn in aller Brust und sie schworen in der Nacht zusammen, dem Elend des Tals ein Ende zu machen oder unterzugehen.
Im Frühschein führte Adam, der Camogasker, seine schöne Tochter in Feierkleidern wie eine Braut geschmückt nach Gardovall. Einige der Verschworenen folgten wie im Brautgeleit; andere hatten sich um das Schloß im Hinterhalt versteckt, alle bewaffnet.
Kaum sah der Kastellan das Mägdlein ankommen, so sprang er fröhlich von den Stiegen des Schlosses nieder und wollte die Unschuld vor den Augen des Vaters umarmen. Da zückte Adam von Camogask das Schwert und stieß es in das Herz des Ungeheuers. Er und die Seinen stürmten in die Burg, erschlugen die Knechte, gaben das Zeichen der Freiheit aus den Fenstern, und der Hinterhalt drang nach. Gardovall ging in Flammen auf. Frei war die Landschaft unter den Innquellen von der Gewaltherrschaft des Zwingherrn.«
Bis hierher wissen wir die Namen der Handelnden, der Dränger wie der Bedrängten; und doch sind dies nur vereinzelte Vorfälle, die ohne das, was sich weiterhin Dauerndes begab, ebenso erfolglos dastehen würden wie Tells Schuß in der Geschichte der Waldstätte. Nicht in der hohlen Gasse, auf dem Rütli wurde die Freiheit der Schweizer gegründet. Und so wurde Hohenrätien weder auf Gardovall noch in Johannes Caldars bescheidenem Gemach befreit, sondern im einsamen Wald bei Truns, zwischen Disentis und Ilanz, am Vorderrhein. Die Namen der kühnen Männer, die hier bei stiller Nacht tagten und des Landes Freiheit berieten, kennen wir nicht; doch meldet die Sage, sie seien Vorsteher der Dorfschaften, wohlbetagte Männer mit langen, grauen Bärten gewesen. Noch will man auf der nahen Wiese von Tavanasa in den Ritzen der Felsen die Nägel bemerken, an welche die freien Männer ihre Brotsäcke hingen, da sie, bei der Quelle lagernd, die mitgebrachten Vorräte verzehrten. Dem weisen Abt von Disentis, Herrn Peter von Pontaningen, wird nachgerühmt, daß er ihr Unternehmen begünstigt und gefördert habe. Durch seine Vermittlung kamen 1424 die Vornehmen und Gemeinen des Landes in Truns vor der Kapelle St. Annen unter freiem Himmel, bei der großen Linde, wie es des Landes Sitte ist, zusammen, hoben die Hände auf und beschworen den sogenannten Grauen oder Oberen Bund, der noch besteht und bestehen soll, solange Täler und Berge sind. Von diesem Bund heißen die Räter Graubünder; aber es ist ungewiß, warum der Bund grau genannt wird: ob die höchsten Alpen, in deren Angesicht er geschlossen wurde, damals graue (Alpes grajae?) hießen oder ob das Volk sich in graues Tuch kleidete. Mitwirken mochte wohl der Gegensatz gegen den auf Veranlassung des Bischofs von Chur früher geschlossenen Gotteshausbund, welcher von der Tracht der Geistlichen der Schwarze Bund hieß. Späterhin bildete sich noch ein dritter, von den zehn toggenburgischen Gerichten in Rätien genannter Bund; aber der Name Graubünden ging auf alle rätischen Landschaften, selbst auf diejenigen über, die ursprünglich zum Schwarzen Bund gehört hatten.
Via Mala
Inhaltsverzeichnis
Mit Zillis, dem letzten Ort in dem freundlichen Schamser Tal, schließt dieses völlig ab. Ein furchtbar hohes Gebirge, das von dem Piz Beverin zum Matterhorn streicht und das Schamser von dem fruchtbaren Domleschger Tal trennt, schiebt sich plötzlich vor und sperrt dem Rhein wie dem Wanderer die Straße. Jener findet aber einen Ausweg durch eine Bergspalte, das Verlorene Loch genannt, die vielleicht einst ein Erdbeben in das Gestein riß; dieser muß sich, um weiterzukommen, der berüchtigten Via Mala bedienen. Letztere ist zwar seit dem neuen Wegebau vom Jahre 1817 nicht mehr gefährlich, dennoch wird sie niemand ohne Schaudern zurücklegen. Auf einer Strecke von einer dreiviertel Stunde mußten die Felsen neben den tiefen Abgründen des Verlorenen Lochs gesprengt werden, um einen Weg zu gewinnen. Dreimal wechselt dieser auf der rechten und linken Seite der Schlucht, die durch Brücken verbunden sind, von denen die mittelste vierhundert Fuß hoch über dem in der tiefen Spalte kaum sichtbaren, kaum hörbaren Rhein hängt. Über der Brücke türmen sich die Felsen noch himmelhoch, unter ihr stürzt sich der Rhein in der Bergenge, die ihn zwängt, mit Ächzen und Stöhnen von Fels zu Fels; aber auf der hochschwebenden Brücke erreicht fast kein Laut davon des Wanderers Ohr. Mit einer so gewaltigen Natur durfte es der Mensch aufnehmen! Weit gefährlicher sieht diese Brücke sich an, mehr Kunst und Kühnheit gehörten dazu, sie über diese Schlünde zu wölben, als die unter dem Namen der Teufelsbrücke verrufene über die Reuss. Und so ist auch mit der Galerie bei Rongella, die 216 Fuß lang, 15 Fuß breit und 10 Fuß hoch durch Felsen gesprengt werden mußte, das Urner Joch nicht zu vergleichen.
Domleschger Tal
Inhaltsverzeichnis
Überrascht tritt der Wanderer bei Thusis, am Fuß des Heizenbergs, den der Herzog von Rohan den schönsten Berg der Welt nannte, aus dem Verlorenen Loch. Hier öffnet sich das reiche Domleschger Tal, von Tomils, einem unbedeutenden Dorf, Tomiliasca genannt, was dann in Domleschg überging – ein Wink für die Leser Johannes von Müllers, der sich immer der selteneren lateinischen Form bedient. Zweiundzwanzig Dörfer bald am Ufer, bald auf dem Gebirge, und fast ebensoviel, zum Teil noch bewohnte Schlösser und Burgen, beleben diese schöne, fruchtbare Gegend, wo die ersten Reben an den Ufern des Rheins gezogen werden. Die Weiße Albula und die Schwarze Nolla fließen hier dem Rhein zu, welchen letztere durch den Mergelschiefer, dessen aufgelöste Bestandteile sie massenweise bei sich führt, nicht nur bis über Graubünden hinaus schwärzt, sondern oft sogar zu verstopfen droht.
Am Ende des Tals bei Reichenau vereinigen sich die beiden Arme des Rheins und bilden schon einen Strom, der die Breite von 256 Fuß hat, der jedoch seines ungestümen Laufs wegen noch nichts als Flöße trägt; Schiffe würde er zertrümmern. »Et navigari ab ortu poterat primigenio copiis exuberans propriis, ni ruenti curreret similis potius quam fluenti«, sagte schon Ammianus Marcellinus. Reisebücher empfehlen, die Vereinigung dieser Gewässer von der Terrasse des schön gelegenen Schlosses des Herrn Oberst von Planta aus anzusehen. Dieses Schloß ist auch durch die Schule merkwürdig, welche der Bürgermeister von Tscharner der Ältere für eine kurze Zeit in demselben angelegt hatte. Hier war es, wo Ludwig Philipp, der jetzige König der Franzosen, während seiner Verbannung unter einem angenommenen Namen die französische Sprache und die Anfangsgründe der Mathematik lehrte, wie er sich selbst, von seinen Schülern umgeben, in einem Gemälde darstellen ließ, das im Palais Royal gezeigt wird.
Chur
Inhaltsverzeichnis
Schon oberhalb von Chur (Curia, Coire), zu Disentis, wo der Mittelrhein sich im Vorderrhein verliert, haben wir eine Abtei angetroffen, von deren Stiftung noch späterhin die Rede sein wird. Es war also nicht streng richtig, wenn Kaiser Maximilian Chur das oberste Stift in der langen Pfaffengasse, dem Rheintal, nannte. Allein er scheint dabei an einfache Klöster und Abteien, selbst wenn sie »gefürstete« hießen, nicht gedacht zu haben, wie er denn auch das mächtige St. Gallen überging. Er sprach nur von Bistümern, und so verstanden ist das gewählte Beiwort viel unbedenklicher, als wenn er Konstanz das größte, Basel das lustigste, Straßburg das edelste, Speyer das andächtigste, Worms das ärmste, Mainz das würdigste und Köln das reichste nannte. Aber mit wie vielen berühmten und weit herrschenden Stiftern verdiente das Rheintal einst den Namen der Pfaffengasse, die doch noch keine Bistümer waren! Und selbst unter diesen ist Trier vergessen, vermutlich weil sein Sitz nicht am Rhein lag. Um das Beiwort wäre Kaiser Max nicht verlegen gewesen: er hätte es das älteste genannt.
Erst unterhalb Chur, dieser Hauptstadt Graubündens, nimmt der Rhein, durch die aus dem Schanfigger Tal heranströmende Plessur verstärkt, einige Schiffbarkeit an. Den folgenden Zufluß, den er dem alten Bad Pfäfers gegenüber durch die Gebirgswasser des Landquart empfängt, erwähne ich nur, um eines unserer liebenswürdigsten Dichter zu gedenken, des trefflichen J. Gaudenz von Salis-Seewis, der in Malans wohnt, einem kleinen Flecken bei der Mündung des Landquart. Nicht weit davon liegen auch sein Geburtsort Seewis, von dem seine Linie heißt, und Schloß Marschlins, das Erbe seiner Väter.
Grafschaft Vaduz
Inhaltsverzeichnis
Die folgenden Gegenden hat ein anderer deutscher Dichter beschrieben, und keiner der unberühmtesten. Nachdem nämlich der Rhein Graubünden, seine Geburtsstätte, verlassen hat, bespült er links, schon von Pfäfers abwärts, St. Gallen, einen Kanton der Schweiz, rechts eine zum politischen Verband Deutschlands gehörige freie Grafschaft, deren Namen die Überschrift angibt. Sie bildet einen für sich bestehenden Staat, den man mit Unrecht als Fürstentum Liechtenstein aufführt, bloß weil er von dem Fürsten von Liechtenstein beherrscht wird, der diesen Namen von anderen mediatisierten Besitzungen empfing. Als Besitzer der freien Grafschaft Vaduz, die das Glück hat, selbst auf Spezialkarten unbemerkt zu bleiben, ist der Fürst von Liechtenstein souveränes Mitglied des Deutschen Bundes so gut als der König von Preußen und der Kaiser von Österreich und hat wie diese Sitz und Stimme im Plenum der Bundesversammlung.
Der Leser hat sich unterdes besonnen, welcher deutsche Dichter wohl die Grafschaft Vaduz beschrieben habe, und tippt jetzt auf unseren zu früh verstorbenen Wilhelm Hauff, dessen Roman »Lichtenstein« aber in anderen Gegenden spielt. So leicht war auch unser Rätsel nicht zu lösen: der Dichter, den wir meinen, hat dieses Ländchen beschrieben, ohne es zu nennen, und wenn wir seinen Namen hersetzen – er heißt Goethe –, so bleibt dem Leser immer noch zu raten, in welchem seiner Werke sich diese Beschreibung finde. Wir müssen ihm zu Hilfe kommen, denn obgleich wir ihm zutrauen, daß er seinen Goethe aufmerksam gelesen habe, so riete er doch vielleicht auf »Hermann und Dorothea«, auf die »Wahlverwandtschaften« oder ein anderes naturschilderndes Werk des Dichters und verfiele eher auf die Novelle »Wer ist der Verräter?« als auf die namenlose, welche das 15. Bändchen der Ausgabe letzter Hand enthält. Mit dieser noch nicht genug gewürdigten Erfindung hat sich der Dichter viele Jahre lang getragen. Die Idee dazu faßte er bald nach Vollendung seines »Hermann«, wie aus dem Briefwechsel mit Schiller hervorgeht. Er zweifelte aber, ob sich der Gegenstand mehr zur epischen oder zur lyrischen Behandlung eigne, ja einmal äußert er die Besorgnis, das eigentlich Interessante des Sujets möchte sich zuletzt gar in eine Ballade verflüchtigen. Schiller riet ihm zu gereimter, strophenweiser Behandlung. Später enthält der Briefwechsel kein Wort mehr über diese Angelegenheit. Vermutlich hat Goethe erst nach dem Tode seines Freundes den alten Plan wieder hervorgesucht, der sich ihm jetzt zur Novelle gestaltete. Diese spät gezeitigte Frucht des Goetheschen Lebensbaums ist eine der köstlichsten und süßesten. Mehr darüber zu sagen ist hier nicht der Ort; wenn wir aber den Beweis liefern sollen, daß Vaduz der gewählte Schauplatz sei, so müssen wir den Leser ersuchen, einen Blick in die Novelle zu werfen. Wir sehen einen Fürsten und eine Fürstin in einem Schloß residieren, das in einiger Höhe über dem Ort, jedoch tief unter den hohen Ruinen der alten Stammburg liegt. Der Ort wird zwar eine Stadt genannt, da doch Vaduz nicht viel mehr als ein Flecken ist; aber es fragt sich, ob der Dichter nicht Ursache hatte, in diesem einen Punkt, der vielleicht befremdet hätte, von der Wirklichkeit abzuweichen. Alles Übrige stimmt überein. »Der Weg«, heißt es ferner bei dem Lustritt nach der Stammburg, »führte zuerst am Fluß hinan, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Wasser, das aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und ferne Länder belegen sollte.« Wer sieht nicht, daß der Rhein gemeint ist? Sigmaringen, das einzige Fürstentum, das die Donau durchfließt, hat keine Stammburg wie die geschilderte. Wenn aber der Rhein gemeint ist, so liegt kein anderes Fürstentum an dem noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Fluß.
Was ist aber hiermit für den Dichter oder für die Gegend gewonnen? Für den Dichter nichts, als daß wir sehen, wie er eine schöne, durch Natur und Geschichte verherrlichte Gegend in sich aufzunehmen und verschönert wieder hervorzuzaubern verstand. Für die Gegend viel, denn sie kann nur gewinnen, wenn wir sie mit den Augen des Dichters betrachten. Goethes eigentümliche Gabe zu landschaftlichen Schilderungen ist schon öfter bemerkt worden, ein geistreicher Franzose schreibt ihm deshalb ein panoramisches Talent zu; ein Ausdruck, an dem der Dichter seine Freude nicht verbergen konnte. Aber nirgends tritt dieses Talent außer in »Hermann und Dorothea« glänzender hervor als in der fraglichen Novelle. Wie anschaulich wird uns z. B. die alte Stammburg geschildert. Doch wir widerstehen der Versuchung, die Stelle mitzuteilen.
Toggenburg
Inhaltsverzeichnis
Der Deutsche nimmt es übel, wenn man von Goethe spricht, ohne auf Schiller zu kommen. Allerdings wäre dazu die schicklichste Gelegenheit bei der Hand, indem das der Grafschaft Vaduz gegenüberliegende Toggenburger Land wohl laut genug an ihn mahnt. In der Tat kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß hier, und nicht am Niederrhein bei Rolandseck, wie die meisten Reisebücher fälschlich melden, die Szene von Schillers »Ritter Toggenburg« zu suchen ist. Nicht in Nonnenwerth, sondern im Kloster Fischingen bei Toggenburg weilte die Liebliche, in deren Nähe sich der Toggenburger nicht eine Burg, wie Rolandseck gewesen ist, sondern eine Hütte baute. Mit dem Namen des Toggenburgers, nicht Rolands, des Paladins, nennt der Dichter seinen Helden, ja er läßt über dessen Heimat keinen Zweifel übrig in den Worten:
Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz.
Dazu kommt noch, daß sich in Toggenburg eine Begebenheit zugetragen hat, welche die Ballade veranlaßt haben könnte. Wir meinen die wunderbare Geschichte der heiligen Itha, von der es ein sehr verbreitetes deutsches Volksbuch gibt und die in allen katholischen Ländern als Legende gang und gäbe ist. Sie hat eine sehr nahe Verwandtschaft mit der von der heiligen Genoveva, erinnert aber zugleich an Rossinis »Gazza ladra«. Kürzer als mit den Worten Johannes von Müllers wüßten wir sie nicht zu berichten:
»Ein Rabe entführte der Gräfin Idda von Toggenburg, des Geschlechts von Kirchberg, ihren Brautring durch ein offenes Fenster: ein Dienstmann Graf Heinrichs fand ihn und nahm ihn auf; der Graf erkannte ihn an dessen Finger. Wütend eilte er zu der unglücklichen Idda und stürzte sie in den Graben der hohen Toggenburg; den Dienstmann ließ er an dem Schweif eines wilden Pferdes die Felsen herunterschleifen. Indes hielt sich die Gräfin an einem Gebüsch, wovon sie in der Nacht sich losmachte; sie ging in einen Wald und lebte von Wurzeln und Wasser im Glauben an den Retter der Unschuld. Als letztere klargeworden war, fand ein Jäger die Gräfin Idda. Allein obschon Graf Heinrich viel bat, wollte sie nicht mehr bei ihm leben, sondern blieb still und heilig in dem Kloster zu Fischingen.«
Der Schluß hat unstreitig einige Übereinstimmung mit der Ballade. Aber Valentin Schmidt geht wohl zu weit, wenn er behauptet, daß man die hohe Vortrefflichkeit des Schillerschen Gedichts nur würdigen könne, wenn man diese Legende lebhaft im Gedächtnis habe. Er glaubt nämlich, die Ballade setze die Legende voraus. Doch hören wir ihn selber:
»Die schwergekränkte Gattin, deren Unschuld endlich anerkannt ist, spricht die erste Strophe zu dem von Reue, Scham und Sehnsucht nach Wiedervereinigung still weinenden Gatten. Das Heftig-in-die-Arme-Pressen beim Abschiednehmen deutet auf das frühere eheliche Verhältnis, das seit jener furchtbaren Störung nach Iddas Willen nunmehr einem unvergänglichen Bund auf immer weichen muß. Der Zug des Ritters gegen die Ungläubigen, zugleich um Buße zu tun und Ruhe zu gewinnen, erreicht wenigstens den letzten Zweck nicht. Die Neigung zur früher mißhandelten und verstoßenen Gemahlin nimmt nur zu. Nicht länger als ein Jahr hält er es aus in der Ferne. Dann kehrt er zurück voll der irdischen Hoffnung, sie begütigt und versöhnt zu finden. Aber erst jetzt tritt der echte und fruchtreiche Schmerz ein, und mit ihm die wahre Reue und Buße. Die Nonne kann nicht wieder zur Ehefrau werden, jeder Weg, die irdische Neigung zu befriedigen, ist zerstört, und so muß sich auch des Ritters Trieb, welcher nach dem Besitz selbstisch haschte, notgedrungen in einen nicht sinnlichen verwandeln. Allein sehr entfernt ist er noch von der Leidenschaftslosigkeit und heiteren Seelenruhe Iddas. Sie, ›des Himmels Braut‹, sie, ›die Gott getraut‹, ist ein ruhiges engelmildes Bild, durch dessen erquickenden Anblick nur sein Hinaufschwingen zum Ewigen vermittelt wird. Ihm allein, ohne ihre kräftigende Nähe, würde dies nicht gelingen.«
Obwohl ich der Meinung bin, daß Schillers Gedicht für sich allein recht wohl bestehen könne und der Beziehung auf die Legende nicht bedürfe, um als vortrefflich gewürdigt zu werden, so mag es doch Stimmungen geben, wo wir die sentimentale Liebe des Toggenburgers, der sich und die Welt so ganz über einer Geliebten vergißt, die ihn ohne allen Grund verschmäht, mit unseren Begriffen von männlicher Würde nicht im Einklang finden, wo uns daher seine völlige Hingebung an dieselbe bis in den Tod erklärlicher scheinen würde, wenn wir sie mit dem Gefühl der Reue und dem Bedürfnis der Buße zu verbinden wüßten.
In einer solchen Stimmung war es vielleicht, daß ich mich verleiten ließ, die Legende der heiligen Itha, wie sie das Volksbuch meldet, als Einleitung zu Schillers »Ritter Toggenburg« zu behandeln. Um die genaue Verbindung der Legende mit der Ballade zu zeigen, auf die es dabei abgesehen war, setze ich jene hierher und lasse ihr die erste Strophe der Ballade unmittelbar folgen. Der Leser, dem die folgenden Strophen im Gedächtnis sind, wird nun imstande sein, sich für oder wider eine solche Verbindung zu entscheiden:
Itha von Toggenburg
»Wem hast du den Ring gegeben? Die so züchtig schien! An des Jägers Finger eben, Falsche, sah ich ihn. Den Verräter schleiften Pferde Nieder in sein Grab; Daß die Schmach gerochen werde, Sollst auch du hinab.«
Reden will die Gräfin, wenden Schimpflichen Verdacht; Zornesflammen ihn verblenden, Hat des Worts nicht acht. Hebt sie auf mit starkem Arme, Von dem hohen Saal Stürzt der Wüterich die Arme Tief ins tiefe Tal.
Gute Geister schweben nieder Aus des Himmels Zelt, Spreiten himmlisches Gefieder, Daß sie sanfter fällt; Betten ihr auf weichem Moose, Und erwacht sie jetzt, Ruht die Reine, Fleckenlose Heil und unverletzt.
»Gnade deiner Magd erwiesen Hast du, süßer Christ, Nimmer wird es ausgepriesen, Wie du gnädig bist. Heiligend zu neuem Bunde Lädt der Gnade Schein: Dir von dieser Schreckensstunde Leb’ ich, Herr, allein.«
Wo sich Ranken dicht verstricken Bei des Adlers Horst, Birgt sie vor der Menschen Blicken Sich im tiefen Forst; Nährt den Leib von Waldeskräutern, Schöpft aus klarer Flut, Sucht die Seele nur zu läutern In der Andacht Glut.
Baut ein Hüttchen dann von Zweigen, Deckt’s mit Rinde rauh: Betend in der Wildnis Schweigen Kniet die heil’ge Frau. Hat in Kreuzesform verbunden Sich zwei Stäbe Holz, Wunderbare Lust empfunden, Wenn das Herz ihr schmolz.
Wollt’ es dann nicht länger tagen, Helles Licht herbei Bracht’ ein Edelhirsch getragen Zwischen dem Geweih. Und so saß sie viele Tage, Saß viel Jahre lang, Lauschend ohne Schmerz und Klage Himmlischem Gesang.
Doch des Grafen Herz durchschnitten Scharfe Zweifel oft, Ohne Schuld hat sie gelitten Fürchtet er und hofft. Spät verhört er seine Leute, Allzuspät fürwahr Wird dem Toggenburger heute Ithas Unschuld klar.
Jenen Ring, des Bräut’gams Gabe, Glänzend war sein Schein, Diebisch haschend trug ein Rabe Ihn vom Fensterstein, Hielt das leuchtende Geschmeide Froh im Schnabel fest, Seine Jungen spielten beide Gern damit im Nest.
Zogen Jäger drauf im Walde Streifend da vorbei, Hört der eine bei der Halde Flügger Raben Schrei. Sieht den Ring im Neste blitzen, Schiebt ihn an die Hand, Froh, das Kleinod zu besitzen, Kommt er heimgerannt.
Tückisch lauschen grimme Strafen Seiner Goldlust dort; Aber schwer gereut den Grafen Bald der Doppelmord. Nächtlich fährt er aus dem Schlummer, Träumt bei hellem Tag, Da vernimmt er, was den Kummer Wohl besänft’gen mag.
»Nicht gestorben ist die Reine, Im verwachsenen Wald, Vor dem Kreuze knieet eine Selige Gestalt. Manche würden sie nicht kennen, Ach, ihr schwand der Leib, Doch ich weiß sie dir zu nennen: Itha ist’s, dein Weib!«
Neubelebt, sie zu begrüßen, Stürzt der Graf hinzu, Knieet nieder ihr zu Füßen, Flehet: »Heil’ge du,
Vorarlberg
Inhaltsverzeichnis