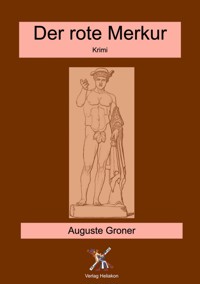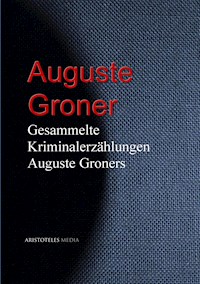Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses eBook: "Der rote Merkur (Wiener Kriminalroman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Auguste Groner (1850-1929) war eine österreichische Schriftstellerin. Sie veröffentlichte auch unter den Pseudonymen Olaf Björnson, A. von der Paura, Renorga und Metis. Zunächst schrieb die produktive und vielseitige Feuilletonschriftstellerin Rätselgedichte, Jugend- und historische Heimaterzählungen. Für ihr Werk wurde sie bereits 1893 von der Literarischen Abteilung der Weltausstellung in Chicago geehrt. Seit 1890 erschienen auch zahlreiche Kriminalerzählungen und -Romane, die teilweise ins Skandinavische und Englische übersetzt wurden. Groner erfand den ersten Seriendetektiv der deutschsprachigen Literatur, Joseph Müller, der das erste Mal in der Erzählung Die goldene Kugel erscheint, die erstmals 1892 veröffentlicht wurde. Aus dem Buch: "Sie sind schon wieder gereizt. Ihre Braut kam im Verlauf unserer Unterhaltung ganz von selbst darauf zu sprechen, daß sie mit Ihnen einen Teil des Abends verbrachte, und dabei äußerte sie, daß sie fürchte, Sie seien krank, da Sie sonst doch schon durch die Zeitungen wissen müßten, was geschehen sei. Sie seien aber heute noch nicht zu ihr gekommen. Bei dieser Gelegenheit ließ sie durchblicken, daß sie beide der Tante wegen des Hochzeitsaufschubes schon längere Zeit zürnten, und daß Sie gestern noch eine harte Bemerkung über Frau Schubert machten."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der rote Merkur (Wiener Kriminalroman)
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel.
Ein gräßlicher, naßkalter Tag war der letzte Tag des Novembers. Vor einer Buchhandlung in der Wiener Ringstraße schritt ein junger Mann fröstelnd auf und nieder, ein recht hübscher Mensch. Eine große Ungeduld und eine peinvolle Unruhe schienen ihn immer wieder auf und ab zu treiben.
Wie oft hatte er schon die Uhr gezogen, wie oft war er schon im Begriffe gewesen, die Buchhandlung zu betreten!
Endlich schlug es zwölf von den Türmen, und gleich darauf traten drei Herren aus der Buchhandlung auf die Straße heraus.
Merkwürdigerweise zog sich der so ungeduldig Wartende jetzt unter den nächsten Torbogen zurück. Er ließ die beiden vorderen vorbeigehen, erst den dritten, eine große und schlanke Gestalt, rief er leise an.
»Otto,« wiederholte er, »komm mit mir. Wir gehen gleich hier durch.«
Der Angerufene schaute den Wartenden köpfschüttelnd an und sagte: »Was bringt denn dich hierher? Und wie siehst du aus? Es ist doch hoffentlich nichts geschehen, Fritz? Ist der Mutter etwas zugestoßen? Hast du schlechte Nachrichten von daheim?«
Otto Falk faßte seines Stiefbruders Arm fest und zwang ihn so, stehen zu bleiben. Seine Augen suchten jedoch vergeblich des anderen Blick.
»So rede doch!« drängte Otto. »Was ist geschehen?«
»Daheim ist nichts geschehen. Es ist wenigstens kein Brief gekommen. Aber mir ist etwas passiert.«
»Was?«
»Ich habe mehr Geld verbraucht, als ich hatte.«
»Du hast also mit anderen Worten Schulden gemacht?«
»Auch.«
»Was heißt das? Fritz – du hast eine Kasse unter dir. Du wirst doch nicht –«
Otto Falk, der redliche Mensch, der, seit er seinen bescheidenen Gehilfengehalt bezog, jede Krone nicht einmal, sondern zehnmal umdrehte, ehe er sie ausgab, war sehr blaß geworden.
»Schüttle mich doch nicht so!« murrte der Jüngere, sich dem Griff des anderen entziehend. »Damit kommen die achthundert Kronen, die ich ersetzen muss, nicht wieder in meine Kasse, und sie müssen doch morgen früh dasein, sonst zeigt mich Prantner, der alte Schnüffler, der dahintergekommen ist, daß ich nicht ganz korrekt –«
»Nicht ganz korrekt –«
»Gebucht habe,« vollendete Fritz, »beim Chef an. Was danach kommt, kannst du dir ausrechnen. Ich warte es jedenfalls nicht ab. Ich bin heute den ganzen Vormittag herumgerannt, um das Geld zu beschaffen. Aber mir leiht niemand mehr etwas.«
»Und da kommst du nun zu mir, den du sonst niemals findest!«
»Ich bitte dich, Otto, sei nicht sentimental! Hilf mir lieber! Sonst muss ich – Na, mir täte es dann nur um unsere Mutter leid, denn die überlebt das nicht.«
Otto, der schon nach seines Stiefbruders ersten Worten stehen geblieben war, mußte sich an die Mauer lehnen. »Nein, sie überlebte das nicht!« wiederholte er bitter. »Ihr Liebling darf nicht zugrunde gehen, wenn die alte kranke Frau noch weiter leben soll. Du wirst also keine Dummheiten machen. Das heißt, wenn ich es verhindern kann, daß du ins Zuchthaus kommst.«
»Otto!«
»Ach glaub' gar, du willst noch den Beleidigten spielen!«
»Noch ist die Sache nicht bekannt.«
»Nur Herrn Prantner und mir und dir. Aber wenn auch nur du allein wüßtest, daß du ein Dieb bist, müßtest du es spüren, daß du nicht mehr zu beleidigen bist.«
»Ach was, laß doch die moralischen Bedenken! Sag mir lieber, ob du mir helfen willst.«
»Wollen? Nein! Aber ich muß wohl.«
»Du hast immer solch liebenswürdige Manieren gehabt.«
»In liebenswürdigen Manieren bist du mir über. Solch glatte Burschen, wie du einer bist, die machen sich rascher beliebt.«
»Du beneidest mich um meine angenehmere Stellung, meinen höheren Gehalt. Was kann ich dafür, daß ich es weiter gebracht hab' als du?«
»Ja, weiter hast du's gebracht!« stieß Otto hervor, warf seinem Stiefbruder einen verächtlichen Blick zu und ging dann rasch weiter.
Die Zähne zusammenpressend, folgte ihm Fritz. »Wie ich diesen Tugendprotz hasse! Und nun muß ich ihm wie ein Hund nachlaufen!« stieß er zwischen den Zähnen hervor und bohrte den tückischen Blick schier in den Leib dessen, von dem jetzt sein Geschick abhing.
Ihr nächstes Ziel war nach etwa zehn Minuten erreicht. Vor einem gemütlichen Hause, nahe dem Theater an der Wien, blieb Otto, der sehr schnell gegangen war, stehen und hieß den hinter ihm herkeuchenden Fritz einstweilen auf ihn warten, dann eilte er in das Haus.
Nach wenigen Minuten kam er schon wieder zurück und ging, ohne ein Wort zu verlieren, weiter.
»Was hast du denn vor?« erkundigte sich Fritz, »Könnte ich nicht irgendwo auf dich warten? Ich habe außer dem Frühstück heute noch nichts im Leibe.«
»Ich auch nicht,« erwiderte Otto schroff, setzte aber nach einer Weile weniger unfreundlich hinzu: »Es hat in der Tat keinen Zweck, daß du mitrennst. Ich habe im Freihaus1 zu tun. Erwart mich in dem kleinen Restaurant, das dicht daneben liegt.«
Dann ging er eilig davon.
Fritz ließ sich jetzt Zeit. Ein höhnisches Lächeln machte, daß sein hübsches Gesicht augenblicklich recht unangenehm wirkte.
Er saß sehr lange in dem Gasthause, bis Otto, sichtlich abgehetzt, eintrat.
Mit einem schweren Seufzer ließ er sich in der tiefen Fensternische nieder, in der Fritz einen kleinen Tisch in Beschlag genommen hatte.
»Nun?« fragte der Wartende.
»Laß mich nur zuerst zu Atem kommen,« erwiderte Otto, wischte sich den Schweiß von der Stirne und bestellte bei dem herzueilenden Kellner Suppe und eine billige Fleischspeise.
Nach einer Weile sagte er: »Du hast, wie ich sehe, einen Hasenrücken verspeist?«
Fritz überhörte diese Anzüglichkeit. »Also was bringst du?« fragte er noch einmal.
»Einhundertfünfzig Kronen habe ich schon. Ein Bekannter hat sie mir gegeben. Ich ließ ihm einen Schuldschein und mein Postsparkassenbuch, das auf so viel lautet.«
Fritz war offenbar sehr wenig erbaut über den geringen Betrag. Er zuckte nur die Schultern.
»Hast du denn gar nichts, das du hergeben könntest? Wie steht es denn mit deinen eleganten Kleidern? Und Schmuck hast du doch auch und Uhr und Kette.«
»Wird alles heute noch verkauft.«
»Ich kann dir einen Händler schicken, der dir das Fell nicht zu sehr über die Ohren ziehen wird.«
»Es werden kaum hundert Kronen bei der Geschichte herauskommen.«
»So«
»Ich glaube, ich habe dir schon angedeutet, daß ich so ziemlich bis an den Hals in Schulden stecke.«
»Mußt schön gelebt haben!«
»Na, wie ein Bettelmönch freilich nicht. Man ist nur einmal jung.«
»Auch ich bin jung, aber –«
»Aber du warst immer ein Knauser.«
»Wie genau du das weißt! Ein Knauser also! Ja – das war ich. Heute wirst du vielleicht Gott dafür danken, denn hoffentlich kann ich dir gerade meines soliden Rufes wegen das Geld beschaffen. Man hat mir Hoffnung gemacht.«
»Nur Hoffnung?«
»Glaubst du denn, die kleinen Leute, aus denen sich mein Bekanntenkreis zusammensetzt, brauchen nur so in die Tasche zu greifen, um die Hunderter herauszuziehen?«
»Warst du schon bei der Schubert?«
»Bei der Tante meiner Braut? Was fällt dir ein?«
»Die Frau hat doch Geld.«
»Wie du nur auf diese Idee kommen kannst!«
»Daß sie Geld hat? Auf diese Idee hast du selbst mich gebracht.«
»Ich?«
»Ja. Du hast einmal gesagt, daß die Alte eine Heimlichtuerin und daß sie mißtrauisch ist. Womit sollte sie denn heimlich tun? Weshalb sollte sie denn mißtrauisch sein? Da ist doch Geld dahinter.«
»Da kann es sich nur um ihr bißchen Erspartes, um ein paar Kronen handeln.«
»Das glaube ich nicht.«
»Also glaub was du willst.«
»Nein, was vernünftig ist. Deine Anna trägt ja Diamantohrgehänge.«
»Woher weißt du denn das?«
»Ach bin euch einmal nachgegangen.«
»Und da hast du diese wunderbare Entdeckung gemacht? Warum hast du mich denn nicht angesprochen?«
»Weil ich auch nicht allein war und überdies weiß, daß du mit mir keinen Umgang haben willst. Die Ohrringe sind mindestens sechshundert Kronen wert.«
»Hast du sie so gut abgeschätzt?«
»Die Dame, die ich begleitete, kennt sich in Schmucksachen aus.«
»Nun, die Ohrringe könnten ja auch falsch gewesen sein.«
»So altmodisch geformte Schmuckstücke sind nie falsch. Damals dachte ich gleich, daß deine Heirat nicht nur eine reine Liebesheirat sein wird.«
»Meinst du? Nun, dieser rautenbesetzten Ohrringe wegen brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Allerdings hat Frau Schubert sie Anna geschenkt, aber die alte Frau hat sie nicht gekauft, sie sind ihr auch geschenkt worden. Von einer jungen Dame hat sie sie bekommen, bei der sie zwölf Jahre hindurch Mutterstelle vertrat.«
»Mutterstelle bei einer jungen Dame, die solche Geschenke machen kann! Da wird diese zwölfjährige Mutterstelle der Alten ein hübsches Geld eingetragen haben.«
»Laß dieses ganz zwecklose Rechnen. Denk lieber an deine eigenen Verhältnisse, in die ich jetzt leider auch mit hineingezogen werde, und unter denen ich bitter leiden muß, denn natürlich ist jetzt meine Heirat weit hinausgeschoben. Mit Schulden heirate ich nämlich nicht, so weit wirst du mich kennen. Und da ich jetzt gezwungen bin, deinethalben – nein, unserer kranken Mutter wegen Schulden zu machen, muß ich noch lange auf Anna verzichten.«
Die Traurigkeit, mit der Otto das sagte, rührte seinen leichtsinnigen Stiefbruder denn doch ein wenig. Er streckte Otto die Hand hin und sagte hastig: »Ich verspreche dir –«
Sein Stiefbruder nahm die Hand aber nicht und fiel ihm bitter ins Wort: »Daß du dich von nun an einschränken wirst, um diese Schuld zurückzuzahlen? Versprich lieber nichts, denn halten würdest du es doch nicht. Ein Genußmensch, wie du einer bist, kann sich ja doch nichts versagen. Auch sagte ich es ja schon, nicht dir, sondern nur unserer alten Mutter, die, ehe ich einen Stiefvater und dich dazu bekam, so sehr gut gegen mich war, bringe ich dieses schwere Opfer.«
Fritz antwortete nicht und sah jetzt wieder recht finster vor sich hin. »Wenn dir die Schubert das Geld leihen würde –« fing er dann wieder an.
»Die alte Frau laß endlich in Ruhe!« sagte Otto scharf. »Ob sie viel oder wenig hat, geht uns nichts an. Dich schon gar nicht. Aber du gehörst schon zu den ganz nichtsnutzigen Leuten, die es als selbstverständlich ansehen, wenn sie mit dem Gelde anderer Leute rechnen.«
»Ich bitte dich –«
»Still! Hast du nicht mit dem Gelde anderer Leute ein Lotterleben geführt? Hast du nicht – Doch was helfen jetzt Vorwürfe!«
»Das denke ich mir schon lange,« lachte Fritz und sah dann gleichmütig zu, wie Otto hastig zu essen begann.
Er war bald fertig damit, bezahlte seine Zeche und erhob sich. »Du kannst später zur Paulanerkirche gehen,« sagte er. »Ich komme gegen drei Uhr hin.«
Fritz sah dem eilig Davongehenden zornig nach. »Wie einen Schuhputzer behandelt er mich!« murrte er.
Schon vor drei Uhr aber stand er vor der Paulanerkirche und wartete voll fieberhafter Ungeduld auf Ottos Erscheinen, allein es wurde vier Uhr, ehe dieser auftauchte. Schon dämmerig war es, denn der Nebel lag fast auf der Erde.
Fritz wußte beim ersten Blick in das Gesicht seines Stiefbruders, daß dessen Bemühungen erfolglos gewesen waren. Er wagte keine Frage, er sah Otto nur angstvoll an.
»Vierhundert Kronen habe ich jetzt beisammen,« war die Antwort auf diesen Blick.
»Also achthundert Kronen ist dein gerühmter guter Ruf doch nicht wert!«
Otto Falk erwiderte auf diese Frechheit mit keinem Wort. »Jetzt gehst du nach Hause. In einer Stunde ist der Händler bei dir,« sagte er kalt. »Ich komme mit ihm zu dir.«
Fritz wollte auffahren.
Ein Blick Ottos brachte ihn zum Schweigen. Ohne Gruß verschwand er im Nebel.
Sein Bruder wendete sich der inneren Stadt zu. Der Bekannte, der ihm die letzterhaltenen zweihundertfünfzig Kronen verschafft, hatte ihm die Adresse eines Geldverleihers gegeben, der zuweilen so viel Gemüt in sich entdeckte, auch solchen Leuten Geld zu borgen, die, wie zum Beispiel ein Buchhandlungsgehilfe, kein großes Einkommen haben und auch keine anderweitige Deckung geben können.
Otto fand den Mann nicht daheim, wartete eine Stunde lang auf sein Kommen, traf ihn dann bei schlechter Laune und mußte unverrichteter Dinge gehen.
Von Fritz hörte er, daß der Händler schon fortgegangen sei und alles in allem nur neunzig Kronen dagelassen habe.
Otto sank auf einen Stuhl und starrte wortlos vor sich hin.
»Geh doch zur Schubert!« sagte Fritz. »Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig.«
Otto antwortete lange nichts. Dann erhob er sich und setzte seinen Hut wieder auf. »Es bleibt mir in der Tat nur noch dieser letzte Ausweg. Aber ich fürchte, auch dieser Gang wird umsonst sein.«
»Es handelt sich doch nur noch um dreihundert Kronen. Die Kleinigkeit, die dann noch fehlt, wirst ja du selbst dazulegen können.«
»Nur noch um dreihundert Kronen!« wiederholte Otto bitter. »Ich habe es bis heute nicht gewußt, daß es für einen ehrlichen Menschen so furchtbar schwierig ist, Schulden zu machen,« setzte er hinzu.
Dann ging er langsam aus dem Zimmer.
Auch Fritz brach auf, schloß ab und folgte ihm.
Das Zimmer, das Fritz bei einer alten Witwe gemietet hatte, war vom Gang aus zu erreichen. Er hatte es so einzurichten gewußt, daß niemand das Kommen und Gehen des Händlers bemerkt hatte.
Kurz vor halb sechs Uhr kam Otto bei Frau Schubert an, die im fünften Stadtbezirk wohnte.
Sein Stiefbruder betrat dicht hinter ihm das Haus, kam aber bald zurück und wartete an der nächsten Straßenecke auf ihn.
Otto blieb etwa eine Viertelstunde aus, dann kam auch er, sichtlich sehr erregt, zurück.
»Wieder nichts?« rief sein Stiefbruder ihm entgegen.
Otto antwortete nicht. Rasch und schwer atmend ging er weiter.
Fritz blieb dicht neben ihm. »Hat sie dich abgewiesen?« fragte er.
»Daß sie so armselig wohnt!«
»Kennst du denn ihre Wohnung?«
»Ich bin dir nachgegangen. Ich wollte dir noch etwas sagen, habe dich aber nicht mehr erreicht, sah dich nur noch durch den Hof gehen. Also sie gibt nichts her?«
»Nein. Sie wurde sehr zornig.«
»Was jetzt? Diese Frau war meine letzte Hoffnung.«
»Die meine noch nicht. Gerade, als sie mich abgewiesen hatte, ist mir eingefallen, daß ich zu meinem Firmpaten gehen kann. Freilich, wenn der auch nicht hilft, dann –«
»Dann kann ich mich morgen erschießen. Meinen Revolver habe ich schon zu mir gesteckt. Ich brauche also deswegen nicht einmal mehr in meine Wohnung zu gehen.«
Fritz war es jetzt sicherlich ernst mit dieser Rede. Sein Aussehen und das Beben seiner Stimme bewiesen dies. »Es wird doch nicht zu einem Bruch mit deiner Braut kommen?« fragte er bedrückt.
Der andere schüttelte den Kopf. »Frau Schubert versprach mir, über die Sache zu schweigen.« Dann fuhr er ziemlich ruhig fort: »Erwart mich um neun Uhr im Kaffeehaus neben dem Theater an der Wien. Ich gehe jetzt zu meinem Paten und dann Anna entgegen. Nachher komme ich zu dir.«
Fritz wollte ihm die Hand reichen.
Otto sah sie nicht, oder wollte sie nicht sehen.
So gingen sie ohne Gruß auseinander.
1. Eines der weitläufigsten alten Zinsgebäude Wiens.
Zweites Kapitel.
Die vollen, ernsten Glockenklänge vom Turm der Stephanskirche kündeten die siebente Abendstunde an. Einige Minuten später traten aus einem. Hause der Kärntnerstraße etliche junge Mädchen. Sie alle hatten es sehr eilig. Es waren Schneiderinnen, die im »Salon Irene« täglich acht Stunden lang hübsche Toiletten für – andere machten und froh waren, wenn die abendliche Freiheit anbrach. Daher ihre Eile. Sofort waren sie im Gedränge verschwunden.
Eine der jungen Arbeiterinnen, die etwas später das Haus verließ, eine hübsche, bescheiden und doch sehr nett gekleidete Brünette, war vor dem Tore stehen geblieben. Nach rechts und nach links schaute sie sich um, aber der, der sie fast allabendlich hier erwartete, war heute noch nicht da.
Anna Lindner trat wieder in den Hausflur zurück und wartete. Sie mußte über sich selbst lächeln, über die Ungeduld, mit der sie heute ihren Arbeitsgenossinnen nachgeeilt war, was sie sonst doch nie tat, denn ihr Verlobter konnte ja im besten Falle erst zehn Minuten nach sieben Uhr zur Stelle sein. So lange brauchte er mindestens, um von seiner Buchhandlung bis zu ihrem Geschäftshause zu kommen.
Aber zuweilen verspätete er sich auch. Dann wartete sie, wie jetzt, im Hausflur auf ihn, denn in der gerade um diese Zeit sehr belebten Straße könnte sie ihn verfehlen, wenn sie ihm entgegengehen würde.
Eine Viertelstunde verging. Das Mädchen wurde ungeduldig. Gerade heute hätte Otto pünktlich sein sollen. Sie wollten doch in der Rotenturmstraße bei einem Ausverkauf einige Wäschestücke für ihre künftige Wirtschaft kaufen. Wenn Otto nun nicht bald kam, wurde jenes Geschäft geschlossen.
Er kam nicht.
Als es schon nahezu halb acht Uhr war, ging Anna ein bißchen geärgert und ein bißchen beunruhigt nach Hause. Gerade auf den heutigen Abend hatte sie sich so gefreut.
Zu ihrer ziemlich am äußeren Ende des fünften Stadtbezirks gelegenen Wohnung brauchte sie fast drei Viertelstunden. Sie legte diesen Weg früh und abends zu Fuße zurück, was bei ihrem sitzenden Berufe geradezu eine Notwendigkeit für sie war. Ihr Mittagessen nahm sie in einem bescheidenen Gasthause ein, das in der Nähe ihres Geschäfts lag. So ersparte sie mittags den weiten Heimweg und gewann eine Arbeitsstunde mehr, für die sie selbstverständlich besonders entlohnt wurde.
Es war alles sehr genau eingeteilt im Leben dieser kleinen Schneiderin, in diesem so einförmigen und so bescheidenen Leben, darin es so viele Plage und so viele Entbehrungen gab. Freilich auch viele Freuden, denn Anna Lindner war eine große Lebenskünstlerin. Sie verstand es, sich Freude zu machen. Jeder schöne Tag war ihr schon eine solche, und mußte sie durch Regen und Sturm, dann freute sie sich schon im voraus auf ihr warmes Plätzchen im Geschäft oder im Heim ihrer alten Tante, bei der sie, die Waise, schon mehrere Jahre lebte.
Auch über die feinen Toiletten, bei deren Anfertigung sie mit tätig war, freute sie sich; sie hatte eben ein Interesse an allem Schönen, das an sie herantrat.
Und wie glücklich wurde sie durch ihre Liebe, durch dieses herzliche, innige Verhältnis zu ihrem Verlobten gemacht! Sie kannte ihn schon ein ganzes Jahr. Seit dem Sommer war sie seine verlobte Braut und schwamm schier im Glück.
Freilich ein Schatten lag doch darauf. Tante Therese war nicht ganz einverstanden mit dieser Brautschaft. Otto Falk hatte ja noch keine sichere Anstellung. Sonst hatte sie nichts gegen ihn einzuwenden.
Und Anna selbst? Nun, die hatte überhaupt nichts gegen ihn einzuwenden, die liebte ihn eben und war bereit, bis an ihr seliges Ende ihre Nadel zu gebrauchen, wenn sie nur Ottos Frau werden konnte.
Gerade heute sehnte sie sich so sehr nach ihm und mußte nun den weiten Weg allein machen. Die Augen wollten ihr naß werden.
Aber sie bezwang sich. »Er hat halt eine Abhaltung gehabt,« dachte sie bei sich und schritt tapfer aus.
An diesem Augenblick tauchte aus der dahinhastenden Menge der Leute Otto vor ihr auf, bemerkte sie aber noch nicht.
An ihr stieg ein Schrecken auf. Wie blaß er war! An düsteres Sinnen verloren starrte er vor sich hin und sah das Nächste nicht, denn soeben stieß er wie ein Blinder an einen der Vorübergehenden an.
Ein ärgerlicher Ausruf des Mannes brachte ihn zu sich. Er fuhr sich über die Augen und murmelte mechanisch eine Entschuldigung.
Das waren die Vorgänge weniger Sekunden. Dann stand Anna dicht vor ihrem Verlobten und sagte, ihre Hand auf seinen Arm legend, besorgt: »Aber Otto! Was ist dir nur, und woher kommst du jetzt erst? Ich hab' nimmer gemeint, daß ich dich heut noch sehen würde.«
Sonst sah er so glücklich aus, wenn er ihrer ansichtig wurde. Heute seufzte er, drückte ihre Hand lange und fest, zog ihren Arm in den seinen und machte kehrt.
»Grüß dich Gott!« sagte er wie sonst, aber seine Stimme hatte keinen Klang, sein Auge keinen Glanz.
An Annas Herzen wuchs die Sorge. »Du kommst spät,« sagte sie gepreßt.
Er nickte und erwiderte: »Ich hab' schon gefürchtet, ich verfehle dich.«
»Was er nur hat?« dachte sie. Laut fragte sie: »Woher kommst du denn?«
Sie erhielt nicht sogleich eine Antwort darauf. Endlich sagte er: »Einen Geschäftsgang hab' ich gehabt.«
»Und nicht gut ist dir,« bemerkte sie, verstohlen sein Gesicht betrachtend, das ihr heute merkwürdig verändert, so spitz, so verfallen vorkam.
»Stimmt. Es ist mir ziemlich übel,« gab er zu. »Schon seit Mittag befinde ich mich körperlich recht unwohl. Du mußt es mir ja ansehen.«
Das Wort »körperlich« hatte er besonders betont. Seiner Begleiterin war das aufgefallen. Eine eigentümliche Scheu hielt sie aber davon ab, weitere Fragen zu stellen. Sie sagte nur: »Es wird dir gut tun, wenn du bei uns zu Hause eine Tasse heißen Tee trinkst. Es schüttelt dich ja förmlich.«
Ganz bestimmt hatte er Fieber. Auch übelgelaunt war er. »Es wäre mir lieber, wenn wir in ein Kaffeehaus gingen,« meinte er kurz und heftig, um gleich danach hinzuzusetzen: »Weißt du, ich bin heute sehr reizbar. Man hat schon solche Tage, da bin ich lieber mit dir allein. Geh, komm hier herein. Da ist's gemütlich.«
»Gemütlich!« dachte Anna, hinter ihm in das Kaffeehaus tretend. »Heute wird es kaum gemütlich werden!«
Ein paar Minuten später saßen sie in einer Ecke, und jedes hatte eine Tasse Tee vor sich.
Otto stürzte die heiße Flüssigkeit gierig hinunter, Anna trank in kleinen Schlucken, denn sie wurde immer besorgter, seit sie sein Gesicht in heller Beleuchtung sah. Es sah aus, wie das Gesicht eines Menschen aussehen kann, der erst kürzlich etwas Aufregendes erlebt hat, etwas, dessen er noch nicht Herr geworden ist.
Jetzt setzte er die geleerte Schale klirrend vor sich hin. Er konnte sie offenbar in den zitternden Händen nicht halten.
»Jetzt sprich, Otto! Was ist geschehen? So wie heute hab' ich dich noch nicht gesehen.«
Da neigte er sich ihr entgegen, streckte ihr die Hand hin, und sein Gesicht glättete sich, seine Augen verloren die Düsterkeit. »Die Hauptsache ist, daß du mich immer gern hast,« sagte er, und sein hübscher Mund zuckte.
Jetzt fiel alle Angst von ihr ab. Sie lächelte und flüsterte zärtlich: »Aber Otto, wie kannst du denn daran zweifeln? Selbstverständlich hab' ich dich immer gern. Ich wüßt' gar nicht, wie ich es anfangen sollt', dich nicht gern zu haben. Denk' ich doch schier den ganzen Tag nur an dich und an die Zeit, in der wir immer beisammen sein werden. Und wenn die Tant' Resi unsere Hochzeit auch hinausgeschoben hat, einmal werden wir einander ja doch heiraten, und bis dahin mußt halt du auch Geduld haben.«
»Freilich, bis dahin muß ich auch Geduld haben,« entgegnete er bitter, »denn sie hat das Geld und kann Bedingungen machen, die sich so ein armer Teufel, wie ich einer bin, eben gefallen lassen muß.«
»Otto!«
»Ja, ja, ich bin schon wieder ruhig. Erlaube mir nur, es lächerlich zu finden, daß so eine alte Frau, die es längst scheu vergessen hat, was Liebe ist, wegen der viertausend Kronen, die sie dir versprochen hat – du hast sie allerdings noch mit keinem Auge gesehen, diese versprochenen viertausend Kronen –, daß also so eine alte Frau es sich herausnimmt, zu bestimmen, wann zwei Leute, die sich gern haben, miteinander glücklich sein dürfen.«
»Aber hat sie denn nicht recht, bei deinem kleinen Einkommen und meinem noch viel kleineren Verdienst, um unsere Zukunft besorgt Zu sein? Sie meint es ja nur gut mit uns.«
»Gut meint sie es? Und mit uns? Nein, Anna, mit mir meint sie es ganz gewiß nicht gut. Glaubst du, ich spüre all die kleinen und großen Bosheiten nicht, mit denen sie dich und mich zum Auseinandergehen bringen will? Sie hat mir's ja doch mehr als einmal angedeutet, daß ich dich noch einmal unglücklich machen werde. Nun, sie hat vielleicht recht!«
»Otto! – Aber nein, heute bist du nicht für deine Reden verantwortlich. Du bist ganz einfach krank. Deine Hand ist ja eiskalt, und schon deine ganze Laune sagt, daß dir etwas fehlt. Es ist halt ein verlorener Abend. Nicht der erste ist es, und es wird nicht der letzte sein, den du uns durch solch eine Stimmung verdirbst. Ach, wie hab' ich mich gerade auf den heutigen Abend gefreut! Meine ganzen Ersparnisse hab' ich mitgenommen – siebenundvierzig Kronen. Ein Dutzend Handtücher habe ich mir kaufen wollen, solche mit Einfassung, weißt du? Und zwei Tischtücher und ein Dutzend Servietten. Dazu hätte es gerade gelangt. Ich hab' mir alles schon ausgerechnet, wie ich heut mittag auf einen Sprung in der Rotenturinstraße gewesen bin. Ich hätt' ja da gleich alles kaufen können, aber ich hab' mir's so schön vorgestellt, daß du dabei sein sollst. Na, da kann man halt nichts machen. Werden wir also die Freud' ein andermal haben.«
Wenn sie auf ihr Geplauder eine Antwort erwartet hatte, dann hatte sie sich geirrt. Ihr Verlobter war wieder in finsteres Nachdenken versunken und fuhr erst aus seinem Sinnen empor, als sie aufhörte zu sprechen.
»Ja, ja, freilich gehen wir später einmal miteinander einkaufen,« erwiderte er zerstreut und stürzte ein Glas Wasser hinunter.
In Annas Augen stiegen Tränen auf. Allein sie war ein tapferes Mädchen und faßte sich gewaltsam. In der Überzeugung, daß heute nichts mehr zu ändern sei, forderte sie Otto auf, die Zeche zu bezahlen und mit ihr wenigstens bis zu ihrem Hause zu gehen.
Er war dazu bereit. Nach wenigen Minuten gingen sie wieder die nebligen Straßen weiter.
Otto zog Annas Arm an sich und sagte allerlei Liebes und Zärtliches. Ja, er forderte sie sogar auf, noch einen Umweg mit ihm zu machen, und so kam sie fast eine Stunde später als sonst vor dem Hause an, in dem sie mit ihrer Tante wohnte.
Da nahm Otto Falk rasch Abschied, und Anna betrat den nur spärlich erleuchteten Flur.
»Warum er es nur jetzt plötzlich so eilig gehabt hat?« dachte das Mädchen »Er hat wirklich Launen. Damit wenigstens hat die Tante recht.«
»Grüß Gott, Fräul'n Anna!«
Die kleine, rundliche Hausmeisterin hatte es gesagt. Sie war aus dem kurzen Gang aufgetaucht, in den die Treppe mündete.
»Guten Abend, Frau Grübl! Na, wie geht's denn Ihrem Tonerl? Hustet sie immer noch so stark?«
»Dank der Nachfragt! Besser geht's ihr. Der Tee, den uns die Frau Schubert angeraten hat, ist halt doch gut.«
»Ei freilich. Die Tant' ist ja ein halber Doktor!« lachte Anna.
»Und eine ganze Einsiedlerin. Ich hielt's nicht aus, von früh bis abends so ganz allein zu sein. Aber freilich, wir einfachen Leut' sind ihr halt nicht gut genug.«
Das kam einigermaßen bissig heraus.
Anna hob unwillkürlich den Kopf und entgegnete kühl: »Da irren Sie sich. Die Frauen hier im Hause sind der Tante keineswegs zu einfach. Sie ist nur gern für sich. Gute Nacht, Frau Grübl!«
Die kleine, dicke Frau schaute ihr mit einem lauernden Blick nach. »Was hat sie nur damit sagen wollen?« murmelte sie. »Und wie hochmütig sie plötzlich dareingeschaut hat!«
Dann schickte sich Frau Grübl an, mit ihrer Laterne und dem Kohleneimer nach dem Keller zu gehen.
Anna war schon im Hof verschwunden. Die Dunkelheit, die allabendlich hier herrschte, falls nicht das klare Mondlicht dem einzigen armseligen Laternlein bei seinem Geschäfte half, war heute noch vertieft durch den dichten Nebel, der schon seit Stunden über der Stadt lag.
Anna sah nach ihrer Wohnung hin. »Warum hat sie nur heute kein Licht?« murmelte sie. »Oder hat sie die Laden schon geschlossen? Das tut sie doch sonst erst vor dem Schlafengehen.«
Vor der Tür der ebenerdigen Wohnung blieb sie stehen und schob den Schlüssel in das Schloß, das sie bei ihrem Gehen und Kommen stets selber zu sperren und zu öffnen pflegte.
Aber heute konnte sie letzteres nicht tun, denn es steckte von innen der Schlüssel. Die Tante hatte also vergessen, ihn abzuziehen.
Anna ging wieder hinaus auf den Hof zum nächsten der Zimmerfenster und pochte daran. Dabei gewahrte sie den zarten Schein des Lämpchens, das ihre Tante allezeit vor einem Marienbild brennen ließ.
Die hölzernen Fensterladen waren also nicht geschlossen, sonst hätte man das Licht, das in dem roten Glaslämpchen brannte, nicht sehen können.
Anna lauschte. Nichts regte sich.
Wieder pochte sie an das Fenster. »Ich hätte nicht so spät kommen sollen,« dachte sie. »Über dem langen Warten wird sie eingeschlafen sein.«
Mit diesem Selbstvorwurf ging Anna wieder zur Tür, sicher erwartend, daß ihr zweites, sehr starkes Pochen die alte Frau geweckt haben müsse. Aber noch immer rührte sich nichts.
Jetzt legte die schon ungeduldig Wartende, ohne sich dabei etwas Besonderes zu denken, die Hand auf die Klinke.
»Ah!« rief sie unwillkürlich aus, denn die Klinke hatte dem Druck nachgegeben, und die Tür wich zurück.
Anna trat zuerst in die Küche, fand sofort die Zündholzschachtel, die Zugleich mit einem Leuchter stets auf dem Speiseschrank stand, und zündete die Kerze an.
»Grüß Gott, Tanterl!« rief sie durch die offenstehende Tür in das Zimmer hinein.
Keine Antwort.
Jetzt wurde ihr nun doch bang zumute. Sie war schon im Begriffe gewesen, die Tür, die in den Hof hinausführte, wieder zu schließen, aber sie ließ es jetzt sein.
Zuerst zögernd, dann seltsam hastig machte sie, den Leuchter in der Hand, die wenigen Schritte zum Zimmer hin und leuchtete hinein.
Fin nächsten Augenblick gellte ein wilder Schrei durch die nächtliche Stille. Anna, wirr vor Entsetzen, taumelte bis an die Wand der schmalen Küche zurück.
Drittes Kapitel.
»Was war denn das?« ruft die Schustersfrau, die auch eine Hofwohnung hat und eben dabei ist, die Betten zu machen. Sie wirft das Kopfkissen hin und hastet in den Hof hinaus. Dort trifft sie mit der Grübl zusammen, die mit dem Kohleneimer und ihrer Laterne aus dem Keller herauskommt.
»Haben Sie's auch gehört?«
»Freilich hab' ich's gehört.«
»Da ist was gescheh'n.«
»Bei der Schubert war's.«
Die beiden Frauen laufen auf die offenstehende Tür der Schubertschen Wohnung zu.
In den oberen Stockwerken werden die Fenster aufgerissen, überall kommen Köpfe zum Vorschein, ängstliche Fragen werden heruntergerufen.
Dann rennen Leute die Treppe herunter, und eine Minute später ist der Hof voll von Menschen.
Der pensionierte Feldwebel Dengler vom zweiten Stock hat seine Pfeife noch in der Hand, die hübsche kokette Frau Wichl, die die große Eckwohnung hat, ist mit ihrem Dienstmädchen heruntergerannt; sie sieht jetzt gar nicht hübsch aus, denn sie hat schon ihre falschen Zähne abgelegt, und ihre Frisur ist nicht wiederzuerkennen.
Alles redet und flüstert und drängt zur Tür hin, hinter der sich offenbar etwas Schreckliches zugetragen hat.
Der Feldwebel und der Schuster betreten zuerst die Wohnung der alten Frau Schubert. Ersterer nimmt der ganz erstarrten Anna das Licht aus der Hand und leuchtet damit ins Zimmer hinein.
»Tun S' die zwei Weiber hinaus,« sagt er dann zum Schuster, »und es soll sofort jemand zum Kommissariat laufen. Da ist ein Mord geschehen.«