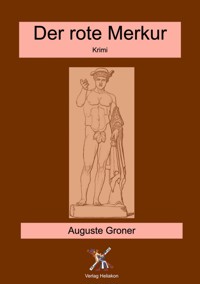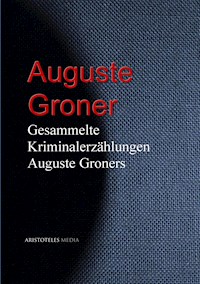1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dort, wo das französische Departement Finistère1 tatsächlich schon bald zu Ende ist, liegt im Bezirke Quimper die kleine, uralte Stadt Concarneau. Sie ist von großem malerischen Reiz, der nicht nur auf den grauen Befestigungsmauern, den gewundenen Straßen und den altväterischen Häusern liegt, sondern der auch von dir zerklüfteten Küste ausgeht, auf welcher ein gut Teil der romantischen Geschichte des mittelalterlichen Frankreichs sich abgespielt hat. Ziemlich im Hintergrunde der Bai de la Forest gelegen und fast allseitig von Wasser umspült, nährt sich die gute Stadt vom Sardellenfang und von ihrem — Reiz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Am Verlobungstage.
Kriminalroman
von
Auguste Groner
1903
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383838913
Erstes Kapitel.
Dort, wo das französische Departement Finistère1 tatsächlich schon bald zu Ende ist, liegt im Bezirke Quimper die kleine, uralte Stadt Concarneau. Sie ist von großem malerischen Reiz, der nicht nur auf den grauen Befestigungsmauern, den gewundenen Straßen und den altväterischen Häusern liegt, sondern der auch von dir zerklüfteten Küste ausgeht, auf welcher ein gut Teil der romantischen Geschichte des mittelalterlichen Frankreichs sich abgespielt hat. Ziemlich im Hintergrunde der Bai de la Forest gelegen und fast allseitig von Wasser umspült, nährt sich die gute Stadt vom Sardellenfang und von ihrem — Reiz. Zumeist jedoch, wenigstens in der Neuzeit, von ihrem Reiz, der jährlich Hunderte von Künstlern anzieht, so daß Concarneau mit Recht für eine der am meisten besuchten Malerkolonien gilt.
Aus aller Herren Ländern kommen sie hin, die malbeflissenen Männlein und Weiblein, um mit mehr oder weniger großem Geschick die unnachahmliche Durchsichtigkeit der Wogen und die ebenso unnachahmlichen Tinten der Lust, die sich über diesem interessanten Erdzipfel mit zuweilen ganz unbeschreiblich schönen Dunstgebilden schmückt, nachzuahmen.
Und nicht nur vor jeder pittoresken Felspartie und jeder alten Mauer, die sich zwischen Concarneau und dem ihm benachbarten Fischerdörfchen Pont-Aven erhebt, haben schon Staffeleien gestanden, auch draußen im Meere, auf den kleinen Glenainseln, wird der Pinsel fleißig gehandhabt, werden in allen Sprachen der Welt Kunstgespräche geführt, gleiten entzückte, suchende, abschätzende Augen über die nur zuweilen lächelnde, meist aber großartig ernste Natur.
Kurzum Concarneau gehört den Malern!
An einem Februartag des Jahres 1884 gingen Jan Frit, ein junger Antwerpener Künstler, und ein etwa vierzigjähriger, eleganter Herr langsam die Hafenstraße entlang.
Es war ein ungemein stürmischer Tag. Die schweren Wolkenmassen lagerten fast auf dem Meere, das, jetzt glanzlos und düster, unter tollem Lärm gegen den Kai anschlug und die Schiffe, welche gut verankert im kleinen Hafen lagen, einen hüpfenden, fast lächerlichen Tanz ausführen ließ. Ein feiner Sprühregen, der schon seit Stunden niederging und alles triefen machte, begann soeben, sich in einen richtigen Guß zu verwandeln.
»Nun, Herr König, haben Sie noch nicht genug Feuchtigkeit an und um sich?« fragte Jan Frit lächelnd, indem er den Kragen seines Überrocks aufschlug.
»Lassen Sie mich nur noch ein bißchen den für mich so seltenen Anblick genießen,« bat König. »Man hatte recht, als man mir sagte, daß Concarneau unter allen Umständen prächtige Stimmung hat.«
»Es ist tatsächlich so,« gab der Niederländer zu. »Trotzdem jedoch freue ich mich auf ein Glas Burgunder bei Papa Briac.«
Eine Weile noch genoß der andere das interessante Schauspiel, welches die aufgeregte See bot, die sich das alte Städtchen holen zu wollen schien, dann bogen die beiden Herren in ein krummes Gäßchen ein, woselbst Papa Briac eine gemütliche Weinstube hielt, in welcher das Künstlervolk sich besonders gern zusammenfand.
»Sie werden mich heute mit le Jeune bekannt machen?« fragte König
»Und mit Fleury und der hübschen Miß Kildonan, einem reisenden Weibe,« setzte der junge Maler hinzu.
»Das ist die Dame, deren ›Klippenküste bei Sturm‹ in Paris so großen Anklang fand? Das Bild hat auch mir imponiert.«
»Dieselbe. Hoffentlich wird die niedliche Miß Ihnen nicht weniger gefallen als ihr Bild.«
»Werde ich auch ihr Atelier sehen können?«
»Atelier? — Wenn Sie ihr Kämmerchen so nennen wollen — warum denn nicht? Die kleine Kildonan, die eine so große Künstlerin ist, lebt nämlich in ziemlicher Dürftigkeit.«
»O!«
»Ja. Die Kritik« — Jan Frit verbeugte sich bei diesen Worten gegen seinen Begleiter — »ist natürlich einstimmig für sie, aber das Publikum kauft ihre Bilder nicht. Die Kildonan hat eben einen richtigen schottischen Hartkopf, sie macht dem Geschmack derer, die kaufen könnten, nicht das geringste Zugeständnis. Und die meisten verstehen ihre allerdings ein wenig eigenartige Kunst nicht«
Jan Frit wollte noch allerlei über die von ihm vermutlich nach zwei Richtungen hin verehrte Kollegin sagen, aber da wurden seine Gedanken plötzlich von ihr abgelenkt.
Eine alte, ein wenig absonderlich aussehende Dame kam eilig aus einem Hause. Sie war sichtlich bekümmert und dachte in ihrem Kummer nicht daran, das alte Seidenkleid, das um ihre hagere Gestalt hing und das von einem einst prächtig gewesenen, jetzt fast schon schäbig wirkenden Samtmantel teilweise bedeckt war, aufzunehmen, sondern sie zog die Schleppe achtlos hinter sich her.
»Aber Madame Malachow — in diesem Wetter gehen Sie auf die Straße«?« redete Frit die Frau an, indem er höflich den Hut vor ihr abnahm.
Frau Malachows welkes Gesicht erhellte sich ein wenig, als sie Frit erkannte. Sie reichte ihm die Hand. »Ich muß zum Doktor,« sagte sie seufzend, »Iwan geht es heute ziemlich schlecht.«
»Das Wetter — das abscheuliche Wetter! Heute geht es keinem Menschen gut,« suchte Frit Frau Malachow zu trösten. »Aber ich will selbst den Doktor holen. Gehen Sie nur wieder hinauf. — Ich kann Sie natürlich hier nicht stehen lassen,« wendete er sich ohne jede Verlegenheit an König, »Sie gehen am besten mit Frau Malachow. Im Atelier Iwans finden wir uns wieder.«
Damit war der ausnahmsweise sehr lebhafte Niederländer schon fort.
So blieb denn König nichts anderes übrig, als der alten Dame, die ihn mit freundlicher Geste dazu einlud, zu folgen.
»Nur wenn das Atelier, in welchem ich Herrn Frit erwarten soll, tatsächlich ein Raum ist, in welchem ich niemand störe, nehme ich Ihre Erlaubnis an, gnädige Frau,« sagte König zu seiner Führerin.
»Mein Sohn wird gar nicht wissen, daß er einen Gast hat. Kommen Sie also ruhig mit, mein Herr.«
In der ersten und einzigen Etage des Hauses angelangt, führte Frau Malachow ihren Gast in einen großen, hellen Raum, dessen Ausstattung bewies, daß er ernster Arbeit gewidmet war. »Wollen Sie es sich hier bequem machen!« sagte sie mit der eigenartigen Aussprache der Russen, nickte ihm freundlich zu und verließ das Atelier
König sah sofort, daß er sich hier nicht langweilen würde, fand überhaupt, daß er in diesem guten Concarneau aus einer Anregung in die andere fiel. Natürlich war er darüber vergnügt und gab sich diesem Vergnügtsein mit vollem Behagen hin.
Daß in diesem Atelier nicht nur ein tüchtiger Mann sich eifrig seiner edlen Kunst hingab, was eine größere Anzahl vollendeter und begonnener Bilder bewies, sondern daß auch sorgende Frauenhände da walteten, konnte man aus der fast peinlichen Sauberkeit erkennen, welche hier überall herrschte und welche durch etliche Kleinigkeiten, die sozusagen über den hübschen Raum hingestreut worden waren, anmutig gemacht wurde. Gestickte Kissen und Teppiche, die reichlich vorhanden waren, nahmen dem sonst einfach eingerichteten Raum alle Kahlheit, und einige hübsch gestellte Gruppen verschiedener Pflanzen verliehen ihm eine große Freundlichkeit.
Ein Umstand jedoch befremdete den berühmten Kunstkritiker. Es gab da keine farbenbesetzte Palette, keine nassen Pinsel und kein Bild auf der Staffelei, vor welcher König jetzt nachdenklich stand, nachdem er mit Freude und Bewunderung und auch mit einem gewissen grüblerischen Staunen die vorhandenen fertigen Kunstwerke betrachtet hatte. Der Künstler, welcher all dies geschaffen, war wohl ernstlich krank, der hatte wohl schon seit längerer Zeit den Pinsel aus der Hand gelegt.
»Wie schade, wenn es für immer wäre!« dachte König und ließ sich soeben in dem Sessel nieder, der vor der leeren Staffelei stand, als eine wohlklingende Stimme sagte: »Entschuldigen Sie, mein Herr, daß wir Sie so lange allein ließen.«
König hatte sich sofort wieder erhoben und verneigte sich vor der jungen Dame, welche auf ihn zu ging.
»Mein Fräulein,« sagte er, »gestatten Sie mir, mich Ihnen vorzustellen, ehe ich Ihnen meinen Dank für den Genuß ausspreche, den ich hier im Atelier Ihres lieben Kranken gefunden habe.«
Sie lächelte und schüttelte das Haupt, indem sie in ihrer hübschen fremdklingenden Weise fortfuhr: »Das ist unnötig, Herr König. Jan Frit, der soeben mit dem Doktor gekommen ist, hat Frau Malachow und mir bereits gesagt, wen wir im Hause haben. Da bin ich denn sogleich gegangen, Sie im Namen Iwans — ich bin seine Braut — zu begrüßen; es tut mir wohl, daß Sie, der große, der unbestechliche Kunstkritiker, von ›Genuß‹ sprachen.«
Das junge Mädchen streckte König beide Hände entgegen, und er beeilte sich, diese trotz mancher Arbeitsspuren schönen Hände kameradschaftlich zu schütteln, denn die junge Dame flößte ihm große Sympathie ein.
Sie waren bald in ein Gespräch vertieft, im Verlaufe dessen sie erfuhr, daß Doktor Hans König ständiger Mitarbeiter einer großen österreichischen Zeitung sei, daß er einen vierzehntägigen Urlaub erhalten habe, um verschiedene Kunstausstellungen zu besichtigen, daß ein Pariser Bekannter ihm geraten habe, nach Concarneau zu gehen, und daß er, wiewohl höchst befriedigt von diesem Ausflug, dennoch schon mit merkbarer Sehnsucht an seine Vaterstadt Wien denke, denn dort sollte — man schrieb jetzt den 27. Februar — am 3. März seine Verlobung gefeiert werden.
Er hatte recht launig seine Reise geschildert und hatte auch mit seinem Glücksgefühl nicht zurückgehalten, und das tat ihm jetzt leid, denn er bemerkte soeben, daß seiner Zuhörerin schöne Augen voll Tränen standen.
»Ich bin roh,« sagte er reuig. »Ich habe Ihnen weh getan. Ich vergaß, daß Ihr eigenes bräutliches Glück getrübt ist. Verzeihen Sie mir. Hoffentlich ist die Krankheit Ihres Verlobten nicht derart, daß sie zu ernster Besorgnis Anlaß gibt?«
Er erschrak über die Wirkung seiner Worte. Das Mädchen war in bitteres Weinen ausgebrochen.
»Mein Fräulein —« sagte er, »ich bitte —«
Da nahm sie sich zusammen und sagte leise: »Iwan ist so schwer krank, daß wir das Schlimmste fürchten müssen.« — Und plötzlich fuhr sie sehr lebhaft fort: »Deshalb freut es mich so innig, daß Sie, dessen Ruf auch hier bekannt ist, an seinen Werken Gefallen finden.«
»So großes Gefallen, mein Fräulein, daß ich mich sehr darüber wundere, Ihren Verlobten, der ein ganz bedeutender Künstler ist, noch in keiner Ausstellung vertreten gesehen zu haben, und daß ich mich schäme, eingestehen zu müssen, daß mir sein Name bis vor einer Stunde durchaus fremd war.«
Er hatte sich bei seiner lebhaften Entgegnung unwillkürlich erhoben, und auch die junge Dame war aufgestanden. Er sah sie verwundert an. Sie benahm sich aber auch so, daß sie Verwunderung erregen mußte.
Ihre Augen, die seltsam aufgeblitzt hatten, waren jetzt hartnäckig auf den Boden gerichtet, ihre Wangen wechselten wieder und wieder die Farbe, und sie schien ihre Zähne nur deshalb in die Unterlippe zu graben, um sich so selber am Reden zu verhindern.
Endlich redete sie aber doch, machte eine Bemerkung und ging sonderbarerweise auf ein weitab liegendes Thema über. »O, ich kenne Wien auch! War schon mehrmals dort.« Und dann fragte sie: »Sie besuchen vermutlich jede bedeutende Kunstausstellung?« Dabei sah sie ihm wieder voll, ihm schien es sogar lauernd, ins Gesicht.
Natürlich mußte er bejahen. Sie aber verfolgte diesen Gegenstand nicht weiter, was ihn auch wieder befremdete.
Es entstand eine Pause der Verlegenheit, die König schließlich damit beendete, daß er abermals an eines der Bilder, die an der Wand hingen, herantrat und dessen Vorzüge in streng sachlicher Art zu beleuchten begann, wobei sie ihm mit Interesse zuhörte.
»Auf eines bin ich noch nicht gekommen,« beendete König nachsinnend seine Kritik, »darauf nämlich, wer auf Iwan Malachow, der heute wie ein neuer Stern für mich aufgeht, Einfluß genommen hat. Ich kenne nämlich diese Art, den Pinsel zu führen, diese besondere Art der durchsichtigen Untermalung schon. Sie ist wohl von ein und demselben Meister auf mehrere seiner Schüler übergegangen, und ich habe diese Art zu malen schon irgendwo anders gesehen.«
»Und Sie finden sie gut, diese Art zu malen?« Des Mädchens Gesicht hatte wieder den scharf forschenden Ausdruck von vorhin.
»Ganz meisterhaft!« sagte König. »Wo kann ich sie denn nur schon gesehen haben?«
»Iwan verkauft seine Bilder alle nach Amerika,« sagte, auch wieder recht unvermittelt, die junge Dame und griff — merkwürdigerweise zitterte ihre Hand dabei — nach einem Medizinschächtelchen, das auf dem Tische lag, neben welchem sie stand. In der Tat — ihre Hand zitterte, denn das runde Schächtelchen entglitt ihr und rollte ein gutes Stück über den Boden.
König wollte es aufheben, ging deshalb dem Schächtelchen nach und griff danach; da rollte es noch ein Stückchen weiter, unter eine Etagere, auf deren Fächern volle Mappen lagen.
»Bitte, lassen Sie doch die Schachtel, sie ist leer.«
»Mich dünkt, daß ich hier vor einer Art Schatzkammer stehe,« sagte König, und seine Augen konnten sich dabei von einem Bildchen nicht trennen, das auf einer der Mappen lag. Schließlich langte er danach.
»Ah — das ist ja prächtig, ganz prächtig!« rief er, sich in den Anblick des Bildchens versenkend, geradezu begeistert aus. »O, bitte, lassen Sie mich mehr von den intimen Arbeiten Ihres Verlobten sehen! In seinen Skizzen, in seinen Entwürfen lernt man ja eigentlich einen Künstler am genauesten kennen.«
»Sie interessieren sich also sehr für Iwan?« fragte des Malers Verlobte.
»Ich möchte der Welt von ihm erzählen,« sagte König ernst. »Über solch eminente Begabung, über solch herrliches Können muß man doch reden.«
Die junge Dame atmete tief auf. »Sie wollten das? Sie wollten das wirklich, Herr Doktor?« rief sie erregt, und ihre Augen flammten dabei in düsterem Feuer. »Sie wollen Iwans Namen bekannt machen? O ja. Tun Sie das. Es ist nur Gerechtigkeit, wenn Sie ihm zu dem Ruhm verhelfen, den er so sehr verdient. Und jetzt, mein Herr, jetzt sollen Sie sein intimstes Arbeiten kennen lernen, sollen Sie sehen, wie das entsteht, das ihm bisher nicht allzuviel Geld und — gar keine Ehre eintrug.«
»Es ist beides unbegreiflich,« sagte König, während er zusah, wie sie fieberhaft schnell den einzigen großen Tisch, der sich im Atelier befand, von allem, das darauf lag, befreite, um eine der Skizzenmappen darauf zu legen.
Und wieder leuchtete es in ihren Augen auf, während sie leidenschaftlich bewegt rief: »Wie froh bin ich, daß Sie gekommen sind! Sie, der Sie uns längst kein Fremder mehr sind, Sie sollen es wenigstens wissen, wie viel er kann — nein, wie viel er gekonnt hat!« schluchzte sie plötzlich auf und schlug die Hände vors Gesicht.
König verlor dieser sprunghaften Erregtheit gegenüber ein wenig seine Fassung. Er sagte dem Mädchen wohl wieder etliche Trostesworte, hielt selber jedoch von deren Wirkung nicht viel.
Die junge Dame aber besaß eine elastische Natur, sie hatte sich schon wieder in der Gewalt. Ihm freundlich zulächelnd meinte sie: »Es ist erbärmlich, daß man nicht stärker sein kann. Mein bißchen Kraft gebe ich eben an Iwans Krankenbett aus. Da muß ich heiter und sorglos scheinen, da lachen seine Mutter und ich und reden vergnügt von einer Zukunft, in welcher er sicher nicht mehr ist, so — als ob er darin die Hauptperson wäre. Das reibt auf, mein Herr — das kostet uns fast alle Kraft, und dazu kommt noch, daß Frau Malachow und ich zur Verstellung nicht geschickt sind, und ich fürchte, Iwan merkt schon, daß unsere Heiterkeit nichts als eine Komödie der Liebe ist, denn seit etlichen Tagen ist es mir, als ob er Mißtrauen hege.«
König schüttelte den Kopf. »Wie immer es sei, liebes Fräulein, Ihr armer Kranker wird so oder so sich dieser schönen, großen Liebe erfreuen. Weshalb aber sind Sie denn so hoffnungslos, da Ihr Bräutigam selber — aus Ihrer Rede darf ich es schließen — an seine Genesung glaubt?«
»Er ist ein Lungenkranker.«
»O — ich verstehe.«
»Er hält sich überhaupt erst für ›ein wenig‹ leidend, seit er die Palette nicht mehr halten kann.«
»Wie traurig! — Und auch wieder — wie gut!«
»Im November rief uns sein bester Freund, Jan Frit, hierher. Iwan war sehr überrascht, als wir kamen. Er glaubte es jedoch, daß seine Mutter eines argen Katarrhs halber hierher gekommen sei, und freute sich, daß ich sie nicht allein hatte reisen lassen. Sonst legte er ihrem und meinem Kommen keine Bedeutung bei.«
»Er war damals schon ernstlich krank?«
»Ernstlich, und er überarbeitete sich auch noch dazu, wiewohl er kaum mehr eine Stunde lang vor dem riesigen Rahmen sitzen konnte.«
»Er arbeitete damals an einem großen Bilde?«
Über des Mädchens Gesicht huschte eine grelle Röte.
»An einem figurenreichen historischen Gemälde,« antwortete sie mit ebenso unverkennbarem als auch unverständlichem Trotz.
»Was stellte es vor?« fragte König, der interessiert die Skizzen betrachtete.
Sie mußte die Frage nicht gehört haben. Sie zog die graue Blende, die ohnehin die eine Seite des Fensters nur streifte, ganz zurück.
Es war das eine ganz überflüssige Arbeit. Es war wohl auch nur eine Scheinarbeit.
»Und was ist’s jetzt mit dem Bilde? Hat er es vollenden können?« fragte König.
»Ja, und dann ist er zusammengebrochen!«
Sie hatte es durch geschlossene Zähne gesagt, und König, der daraufhin über einen allerliebsten Gassenjungen hinwegsah, dessen jedenfalls zum Sprechen ähnliches Abbild er in der Hand hielt, bemerkte, daß ihre Hände sich geballt hatten.
Er wiederholte daraufhin seine unbeantwortet gebliebene Frage nach dem Verbleib jenes riesigen historischen Bildes nicht mehr, denn er konnte es sich jetzt denken, daß ihr diese Frage aus irgend einem Grunde Pein bereite.
Er war auch sehr bald so gefesselt von dem hohen Reiz, welchen die meist nur ganz flüchtig hingeworfenen Entwürfe und Studien Iwan Malachows auf ihn ausübten, daß er fast seine Umgebung, ja selbst die Anwesenheit der jungen Dame vergaß.
Mappe um Mappe reichte sie ihm hin — ein zerstreutes »Danke« — dann war er wieder in konzentriertes Schauen versunken. Es beleidigte sie nicht, daß er über seinem Tun ihrer gar nicht mehr achtete — o nein, sie freute sich sogar innig über dieses Vergessensein, denn es bewies ihr, daß der in der ganzen Kunstwelt bekannte und hochgeachtete, weil unbestechliche Kritiker solch tiefes Interesse für die Schöpfungen eines ihr unsäglich teuren Menschen zeigte.
Und stolz, überaus stolz war sie auf Iwans Können, denn nur weil dieses auf einer ganz ungewöhnlichen Stufe stand, konnte Doktor Königs Bewunderung davon so gefesselt sein. Blatt um Blatt der reichhaltigen Sammlung wanderte an des Gastes Augen vorüber, und immer anerkennender, ja begeisterter klangen seine kurzen, zutreffenden kritischen Bemerkungen.
Da geschah etwas Seltsames.
Er war eben zu einem Blatte gelangt, welches leichte Bleistiftzeichnungen aufwies; sie stellten nichts dar als gekrümmte Finger. Gekrümmte Finger an der hageren, aderreichen Hand eines alten Mannes. So mußte die Hand eines Mannes sein, der all sein Leben lang schwer gearbeitet hat. Solch eine Hand weist derlei kleine Mißbildungen auf, solch überstark gewordene Knöchel, solch charakteristische Hautfalten an den Beugestellen der Finger, so deformierte Nägel. Es war also die Hand eines hageren alten Mannes aus den schwer arbeitenden Volksschichten. Sie wiederholte sich mehr als ein Dutzend Mal auf dem großen Blatte, und es war immer nur eine rechte Hand, und sie hielt die Finger eingezogen.
Es waren lauter Studien gekrümmter Finger. An jeder dieser Hände waren die Finger anders gekrümmt, und unter einer derselben befand sich ein Strich. Dieser Strich war von einem Pinsel gezogen worden, der blaue Ölfarbe enthalten hatte.
Vielleicht war der Strich nur zufällig dahin gekommen, vielleicht bedeutete er aber auch, daß der Maler die darüber befindliche Skizze benützt habe. Wiewohl dieses Blatt fraglos für die anatomischen Kenntnisse und die außerordentliche Gewissenhaftigkeit Malachows ein beredtes Zeugnis ablegte, interessierte doch Doktor König sich nicht in höherem Grade dafür, als dies ohnehin schon in Bezug auf die anderen Skizzen der Fall war.
Ganz plötzlich aber sollte sein ganz besonderes Interesse gerade für dieses Blatt geweckt werden, denn es geschah, wie schon gesagt, Seltsames.
Noch hielt er das Blatt, darauf diese eigenartige Handstudie sich befand, und wollte soeben noch einen letzten Blick auf die blau unterstrichene Skizze werfen — sie stellte die hageren Finger so dar, als grüben sie sich in wildem Schmerz in die innere Handfläche — da griff eine andere Hand nach dem weißen Blatt und entriß es ihm förmlich — ja, sie entriß es ihm. Man konnte die sehr unschickliche Eile, mit der das junge Mädchen ihm das Blatt nahm, nicht anders bezeichnen.
Er schaute denn auch höchlich verwundert auf die junge Dame, welche bislang entschieden feine Lebensformen gezeigt hatte.
Er meinte, sie müsse rot geworden sein, aber nein — ganz im Gegenteil, sie war sehr bleich, und hohe Bestürzung war aus ihren Zügen und etwas wie Trotz in ihren Augen zu lesen.
Und jetzt schämte sie sich auch ihres Benehmens.
Jetzt stieg helle Röte in ihr Gesicht, und indem sich ihre Züge glätteten, ihre Augen wieder freundlich wurden, sagte sie im Tone der Verlegenheit: »Entschuldigen Sie meine ganz unpassende Raschheit. Ich meinte — ich glaubte — —«
Was sie meinte und glaubte, das erfuhr Doktor König nicht, hatte jedoch das unangenehme Gefühl, daß sie ihn hatte belügen wollen.
Sie wurde jetzt ungemein gesprächig. Wollte sie vielleicht den unangenehmen Eindruck, welchen ihr Tun naturgemäß hatte hervorbringen müssen, verwischen und vergessen machen?
Sie wurde ihrem Besucher jetzt ein geistreicher, anmutiger Cicerone durch die vor ihm liegende Skizzenmappe, aber das ganze jetzige, liebenswürdige Gebaren nützte ihr nichts, denn König, dem sie nun wieder selber sehr interessant geworden war, beobachtete sie unauffällig und gewahrte recht gut, wie unruhig ihre Augen jedes neuaufgeschlagene Blatt überflogen und wie sichtlich erleichtert sie aufatmete, als er das letzte, das sich in dieser Mappe befand, zu den anderen legte.
Es geschah auch, was er erwartet hatte. Sie legte ihm keine andere Mappe mehr vor, und die Handskizzen, die sie hinter sich auf einen Diwan geworfen hatte, schob sie jetzt in eine Lade.
»Ich soll sie also gewiß nicht noch einmal zu Gesicht bekommen,« dachte König und schüttelte leicht den Kopf dazu.
Aber zu einer Aussprache über die gehabten Eindrücke fühlte er sich selbstverständlich verpflichtet, und sie fiel glänzend ans, auch fügte er hinzu, daß er es als seine Pflicht erachte, den Namen dessen, der solch Geniales geschaffen, dem Dunkel zu entreißen.
Darob erglühte die Braut des so ehrend Anerkannten abermals in heller Freude und Dankbarkeit und bat König, daß er zum Andenken an die Stunde, in welcher er ihren Bräutigam in seinen Werken wenigstens kennen gelernt, das Bildchen annehme, das ihm zuerst aufgefallen war.
»Aber ich bitte Sie, mein Fräulein,« lachte König, »es bedarf keines Andenkens, gar eines so wertvollen nicht, damit ich diese Stunde nicht vergesse.«
Er hatte ein wenig anzüglich gesprochen, und sie hatte ihn verstanden, denn bittere Verlegenheit spiegelte sich in ihrem Gesicht.
»Sie müssen mich entschuldigen,« sagte sie und ballte dabei die Hände. »O — es läßt sich leicht schöner Gleichmut bewahren, wenn man niemals mit der Schlechtigkeit zusammengekommen ist. Aber ich weiß, wie bitteres Unrecht einem geschehen kann, der Anerkennung und Ehre verdient. Mein Iwan — du lieber Gott, wie haben die angesehensten Kritiker seine Werke als zu dem Besten, das je gottbegnadete Künstler geschaffen, gezählt — und er hat es still lesen müssen und hat geweint, weil — —«
Immer erregter war sie geworden, nun hielt sie plötzlich im Reden inne. Sie war jetzt ganz verwirrt; vielleicht über des Doktors Blick verwirrt, der sie ziemlich deutlich fragte, ob sie wohl bei klaren Sinnen sei.
Und wieder kam ein rascher Übergang bei ihr. Als sie merkte, daß er an ihrer Vernunft zweifle, war sie nicht aufgebracht und nicht beleidigt — o nein, ganz sanft reichte sie ihm das Bildchen hin, bezüglich dessen Annahme er sich noch immer nicht entschieden hatte, und bat herzlich: »Sie nehmen es mit! O ja! Sie nehmen es mit. Denken Sie immerhin als an eine Unglückliche an mich, aber kränken Sie mich nicht, indem Sie dieses kleine Andenken nicht annehmen.«
»Dürfen Sie denn auch frei darüber verfügen?« fragte König freundlich.
»O, wenn Sie wüßten, wie gern es Ihnen Iwan geben würde. Er ist Ihnen ja so viel — —«
Was hatte sie nur sagen wollen? — »Dank schuldig?« Es paßte nicht leicht etwas anderes zum Anfang ihres Satzes.
Der Kritiker begann das seltsame Mädchen ernstlich zu bemitleiden. »Ihr Verlobter kennt mich ja gar nicht,« sagte er, um sie dadurch wieder zur Wirklichkeit zurückzubringen.
Sie senkte den Kopf und murmelte: »Nein, nein — er kennt Sie nicht!«
Dabei hielt sie ihm noch immer das Bildchen hin, und da nahm er es denn, sich vorbehaltend, es zurückzugeben, falls — nun falls die junge Dame, die sich so exaltiert benommen und mehrmals widersprochen hatte, wirklich unzurechnungsfähig sein sollte, also keine eigene Willensäußerung haben durfte.
Sein Vorhaben nicht ahnend, sagte sie innig: »Sie gaben mir mit Ihrem Versprechen mehr, als Sie ahnen. Sie gaben mir damit die Hoffnung, daß ein Sterbender — denn das ist Iwan — noch ein paar glückliche Stunden haben wird. Iwan ist nämlich sehr, sehr ehrgeizig, und sieht er sich einmal durch Sie, Herr Doktor, in der Presse geehrt, so weiß ich ganz genau, daß es ihm eine große Freude und Genugtuung —«
»Nun, habe ich zu viel gesagt? Ist Doktor König nicht der liebenswürdigste Europäer, der Ihnen — natürlich Iwan ausgenommen — je vorgekommen ist?«
Mit diesen Scherzworten eintretend, störte Jan Frit das Alleinsein und die ein wenig unbehaglich gewordene Situation, in welcher sich die beiden befanden.
»Gewiß, Doktor König ist ein prächtiger Herr,« gab das Mädchen lächelnd zu, fuhr jedoch sogleich ängstlich fort: »Sie kommen von Iwan! Wie finden Sie ihn, und was sagt der Arzt?«
Jan Frit gab sich ein sorgloses Ansehen. »Ich habe Iwan recht heiter gesehen, und der Doktor — nun, der meint, wie wir alle, daß der März überwunden werden wird, und daß damit alles gewonnen ist.«
Er schnellte, während er dies alles in gleichgültigem Tone vorbrachte, ein Stäubchen, welches nicht da war, vom Ärmel seines Rockes, als sei die besprochene Sache eines ungeteilten Gedankens gar nicht wert.
Die junge Dame lächelte wehmütig und streckte ihm die Hand hin. »Sie sind ein guter Mensch, Jan, aber Sie vergessen, daß Iwans Mutter und ich schon seit Monaten dieselbe Rolle spielen, die Sie jetzt durchführen wollen, daß wir also jede ihrer Nüancen kennen, und man uns damit nicht betrügen kann. Sie finden also, daß es Iwan recht schlecht geht, und Doktor Lenoir findet dasselbe.«
»Was immer kommen wird, lassen Sie mich Ihnen ein Bruder sein,« würgte Jan Frit heraus.
Da wurde sie kalkweiß und ging, alle geselligen Formen vergessend, mit langsamen, schweren Schritten aus dem Gemach.
Wenige Minuten später befanden sich die beiden Männer wieder auf der Straße. Das Wetter hatte sich insofern noch verschlechtert, da jetzt der Wind zum Sturme geworden war.
Die zwei waren also recht froh, als sie bei Papa Briac einen warmen, trockenen Winkel fanden.
Jetzt erst konnten sie über die Eindrücke der letzten anderthalb Stunden reden, und Königs erste Frage war: »Ist die junge Dame geistig völlig normal?«
Frit schaute ihn überrascht an. »Ohne jeden Zweifel. Sie ist vollkommen Herrin ihres Denkens,« war seine in sehr bestimmtem Tone gegebene Antwort.
»Sie haben viel mit ihr verkehrt?«
»Täglich, meist stundenlang, und sie ist seit November hier.«
»Und haben nie eine Störung bemerkt?« sagte König gedankenvoll. »Das ist sonderbar.«
Jan Frit lachte laut auf. »Ich finde nichts Sonderbares darin, wenn ein Mensch normal ist.«
König gab darauf keine Antwort, aber er stellte eine andere Frage, eine Frage, die er heute schon einmal gestellt hatte, ohne eine Antwort darauf zu erhalten.
»Was ist denn mit dem großen Bilde geschehen, daran Malachow noch im November gemalt hat?«
»Ein großes Bild? Davon weiß ich nichts.«
»Ein historisches Bild.«
»Keine Spur. Ich war täglich bei ihm. Er hat ja überhaupt niemals viel gemalt. War wohl immer zu kränklich dazu. Einige kleine Bilder, das ist alles. Wir haben es niemals begriffen, wozu er so fleißig skizzierte und darin wirklich ein einfach großartiges Können bewies, wenn er doch nie etwas Bedeutendes ausführen konnte oder wollte.«
Doktor König hatte die Speisekarte zur Hand genommen. Das Thema interessierte ihn wohl nicht mehr.
Am Abend desselben Tages begleitete Jan Frit den Doktor zum Bahnhof. König dankte ihm herzlich für die Liebenswürdigkeit, mit welcher er ihm Ciceronedienste in Concarneau geleistet hatte, dann führ der Zug aus der sehr bescheidenen Halle, und das stimmungsvolle Küstenstädtchen tauchte in Nacht und Nebel unter.
König, der ein Coupé für sich hatte, konnte ungestört die Eindrücke der letzten Tage an sich vorüberziehen lassen. Die mancherlei Bilder, die er gründlich gesehen, die mancherlei Menschen, die er oberflächlich kennen gelernt hatte — sie stellten sich, bald diese, bald jene, seinem Gedächtnis vor. Malachows Braut sah er wie leibhaftig vor sich. Wie leidenschaftlich sie Iwan liebte! Wie leidenschaftlich sie überhaupt war! Aber sonst normal? — König glaubte nicht recht daran.
Und Doktor Hans König schlief ein, erwachte wieder, sah Frankreichs Fluren wie im Fluge vorüberziehen, wechselte da und dort den Wagen und kam am 2. März bei anbrechender Dunkelheit in der niederösterreichischen Station Amstetten an, woselbst der Schnellzug, in welchem er sich befand, schon von den Passagieren eines aus dem Ennstal eingetroffenen Zuges erwartet wurde. Während das nicht übermäßig interessante Schauspiel des Aus- und Einsteigens vor sich ging, wanderten des schon ein wenig fahrtmüden Doktors Augen über das wenige, das in Amstetten überhaupt zu sehen ist, und das jetzt noch durch die Dämmerung verschleiert wurde.
König sah demnach wirklich nicht viel und darunter nichts Bemerkenswertes.
Eben als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, langte ein Bauer nach seinem Sack, den er auf die Erde gestellt hatte. Unwillkürlich folgten Königs Augen der etwas schwerfälligen Bewegung des alten Mannes, der übrigens sofort seinen Augen entschwand, denn schon hatte der Zug seine normale Fahrtgeschwindigkeit gewonnen.
Hätte der arme Doktor ahnen können, welch furchtbare Folgen dieses ja in Wahrheit so harmlose zuletzt Geschaute für ihn haben würde, er hätte gewiß sein ganzes Leben nie mehr alte Bauern, die hagere Finger krümmen, angeschaut.
Aber es kann ja keiner in die Zukunft sehen, und das ist gut — das ist meist sogar sehr gut. Dieses Mal aber — nun, vielleicht war es auch dieses Mal gut.
Seelenruhig zündete sich Doktor König soeben eine Zigarre an, es war sogar eine geschmuggelte, und begann über das für ihn höchst angenehme Ereignis seiner morgen bevorstehenden Verlobung nachzudenken. Er hatte ja all diese Tage her voll Innigkeit an seine Lena gedacht, hatte ihr, da sie nun einmal Vergnügen daran fand, täglich ein halbes Dutzend Ansichtskarten geschickt und außerdem unzählige Male ihrer gedacht — jetzt aber, jetzt sehnte er sich noch weit mehr nach dem lieblichen jungen Geschöpf, das mit so viel Zärtlichkeit an ihm hing, das sich ihm morgen verloben und ihm bald — ah, das wird er schon geschickt betreiben — ihm sogar sehr bald ihre schöne, weiche, warme Hand fürs ganze Leben reichen wird.
»Schöne, weiche, warme Hand« — das hätte er nicht denken sollen!
Denn es brachte ihm den Gegensatz davon in Erinnerung: jene Hand, die er vor kurzem gesehen hatte, diese hagere, faltige, von rauher Arbeit deformierte alte Männerhand, die vorhin mit gekrümmten Fingern nach dem Sack gegriffen hatte.
Und diese gekrümmten Finger erinnerten ihn wieder an andere, die ein unbekannter großer Künstler in leichten Strichen auf ein Blatt Papier gebannt hatte, ein Künstler — Doktor Königs Gedanken wanderten unglücklicherweise immer weiter — ein Künstler, der eine so ganz eigentümlich charakteristische Pinselführung, der eine so ganz besonders durchsichtige Art zu untermalen hatte.
Doktor Hans König erhebt sich ganz plötzlich und schaut mit dem angestrengten Blick, mit dem man in weite, weite Fernen zu schauen pflegt, auf den seinen Augen ja sehr nahen roten Samtsitz des Coupés, in welchem er seine Reise vollendet.
Aber König sieht den Sitz gar nicht, er sieht vor seinen geistigen Augen etwas ganz anderes, und dabei benimmt er sich ein wenig seltsam.
Es gibt etwas, das man Reflexbewegung nennt. Solch eine Reflexbewegung findet jetzt in den Muskeln von Doktor Königs rechter Hand statt. Ihr Besitzer weiß vermutlich gar nichts davon. Dessen Gedanken sind wahrscheinlich ganz anderswo als bei seiner rechten Hand, deren wohlgepflegte Nägel sich in die feine, weiche Haut der inneren Handfläche bohren.
Dabei stößt er einen leisen Pfiff aus, wie jemand, dem etwas ihm vorher Unbegreifliches plötzlich klar geworden ist.
Zweites Kapitel.
Doktor Haus König kam gegen elf Uhr Nachts in seiner Wiener Wohnung an, einem reizend gelegenen Gartenpavillon im neunzehnten Stadtbezirke.
Die Frau, welche ihn schon seit längerer Zeit bediente, und welche ihr bescheidenes Logis in einem der nächsten Häuser hatte, erwartete ihn, geschäftig fragend, ob er denn gut gefahren sei und ob er wohl auch schon gegessen habe; auf alle Fälle habe sie Tee, Eier und Schinken hergerichtet.
Aber er hatte schon auf dem Bahnhofe gespeist, stellte die appetitlich servierten Eßwaren dem alten Weiblein zur Verfügung, verabschiedete sie und ging zu Bett, um die sich merklich machende Reisemüdigkeit gründlich auszuschlafen. Aber der Schlaf wollte lange nicht kommen, und als er sich endlich doch einstellte, kam der Traum mit ihm — ein sehr lebhafter Traum, aus welchem König plötzlich erwachte. Er fand nicht sogleich zur Wirklichkeit zurück, er mußte sich erst eine gute Weile besinnen. Dann setzte er sich mit einem Ruck aufrecht und sagte laut und mit großer Bestimmtheit: »Jan Frit hat recht, das Mädchen denkt vollkommen normal.«
Das sagte der Doktor ganz vernehmlich, und dann wartete er gar nicht mehr auf den Schlaf — er wußte ja, daß der in der heutigen Nacht doch nicht mehr zu ihm kommen werde.
Stunde um Stunde schlich in schier unerträglicher Langsamkeit hin. Endlich aber dämmerte es doch. Königs Verlobungstag brach an. Aber wessen der Doktor merkwürdigerweise nur ganz flüchtig gedachte, das war — seine Braut.
Und er liebte sie doch so herzlich, seine hübsche, zarte Lena, er nahm sich allen Ernstes vor, sie recht, so recht glücklich zu machen. Und trotzdem hatte er jetzt, von einer quälenden Ungeduld getrieben, kaum einen Gedanken für sie.
Es war noch nicht acht Uhr Morgens, als er schon auf seinem Rade saß und nach dem ersten Bezirk fuhr.
Das Künstlerhaus war sein Ziel. Er war da wohl bekannt.
»Ah, der Herr Doktor sind schon zurück! Und in aller Früh geb’n S’ uns schon die Ehr’!« Mit diesen Worten empfing ihn der Diener, der das Vestibül reinigte, stellte schnell den Besen in eine Ecke und wollte König seines kurzen Mantels entledigen.
Dieser jedoch wehrte ihn freundlich ab und ging eiligst in die Ausstellungsräume, welche für den allgemeinen Besuch noch unzugänglich waren, denn noch hingen nicht alle Bilder, noch waren nicht alle für die morgen zu eröffnende Frühjahrsausstellung angenommenen Skulpturen an den für sie bestimmten Plätzen untergebracht. Ganze Wagenladungen von Topfpflanzen und Teppichen harrten noch geschickter Hände, welche sie an passenden Stellen unterbringen sollten.
Ganze Berge von Kisten verschiedensten Formates waren noch zu umgehen, wenn man von einem der Säle in den anderen gelangen wollte, und recht unharmonisch war auch der Lärm, welcher derzeit in den sonst so vornehm stillen Räumen herrschte, denn da wurde an allen Ecken und Enden noch genagelt und gehämmert, riefen die Arbeiter einander dies und jenes zu, und gaben die gestrengen Mitglieder der Hängekommission ihre Anweisungen und Befehle.
Durch all diesen Wirrwarr und Lärm schlängelte sich der Kritiker, bis er in einem der großen Seitensäle anhielt.
Da war es bereits säuberlich und still. Lang, sehr lange blieb König, welcher jede Begleitung abgelehnt hatte, in diesem Saale, und als er endlich ging, geschah es im Zustande großer Zerstreutheit. Er bemerkte nicht, daß einer der Herren von der Hängekommission, ein berühmter Maler, ihn gegrüßt hatte, ihm die Hand entgegenstreckte, er hörte auch den Gruß des Dieners nicht, der ihm die Tür öffnete, und er vergaß sogar sein Rad, das er dem Hausdiener in Verwahrung gegeben hatte. In Gedanken versunken ging er nach seiner Redaktion. Er fand erst einen einzigen seiner Kollegen vor. Diesem sagte er, daß er gestern nacht angekommen sei, daß er den heutigen Tag zur Ordnung etlicher Privatangelegenheiten benützen müsse, da er Abends seine Verlobung feiern wolle, morgen werde jedoch das Blatt den die Eröffnung der Kunstausstellung betreffenden Artikel ganz bestimmt bringen können.
Danach betrat Doktor König einen Blumenladen, der seine prächtige Auslage gegen die Ringstraße zu hatte, kaufte einen herrlichen Strauß blaßroter Rosen, winkte einen Fiaker herbei und fuhr nach Hause, woselbst er rasch Toilette machte.
Eine halbe Stunde, nachdem er seine Wohnung wieder verlassen hatte, hielt sein Fiaker, ein echter Wiener Schnellfahrer, vor einer ziemlich tief in einem herrlichen Garten gelegenen Villa in Hietzing. Es war ein sehr geräumiges Landhaus, und es war im gemütlichen Stile längst vergangener Zeiten gebaut, Zeiten, in denen man mit Licht und Luft und mit dem Raum noch nicht zu sparen gewohnt war.
Königs künftiger Schwiegervater, der Kommerzienrat Ludwig v. Mühlheim, ein reicher Seidenwarenfabrikant, hatte dieses überaus vornehme Landhaus schon seit etwa dreißig Jahren in Besitz. Es sah heute schon recht altväterisch aus, aber gerade das war Mühlheim lieb. Er hütete sich, irgend welche einschneidende Veränderungen in diesem, ihm von vielen mißgönnten Besitz vorzunehmen, denn andernfalls hätte das uralte Wappen, welches angenehm auffallend über dem breiten Tore angebracht war, lächerlich gewirkt, so aber gehörte es eben zu dem Hause, wie der großartig angelegte Park mit seinen Baumriesen, seiner Eremitage, seinen steifen Sandsteinfiguren und Felsengrotten dazu gehörten, die nicht nur auf das ehrwürdige Alter dieses Besitzes, sondern auch auf dessen vornehme Zeit hindeuteten.
Der Kommerzienrat v. Mühlheim war ein wenig eitel. Er war kein gewöhnlicher Geldprotz. Er wollte nur das durch seine Tüchtigkeit und viel Glück sehr bedeutend gewordene Vermögen in angenehmer Art genießen und zur »Gesellschaft« gerechnet werden. Zu ersterem war ihm eine einigermaßen glänzende Häuslichkeit und zu letzterem war ihm das Bekanntsein mit angesehenen Menschen nötig.
Als seine Töchter heranwuchsen, hatte er eine Zeitlang daran gedacht, durch sie mit dem alten Adel in Berührung zu kommen, aber diesen Gedanken hatte er, nachdem er sich etliche adelige Freier näher betrachtet hatte, bald fallen lassen. Seine älteste Tochter Edwine und sein herziges Naturkind Lena waren ihm denn doch viel zu lieb, um sie Männern zu geben, die um die Töchter warben, aber das Geld meinten. Wirklich vornehme, nicht nur ihrem Namen nach vornehme Bewerber waren eben im Hause des ehemaligen Fabrikanten nicht erschienen.
Mit dieser Art, sich in die »Gesellschaft« einzuführen, war es also nichts.
Da fiel es dem wackeren Kommerzienrat ein, daß es ja auch einen »Geistesadel« gäbe. Er fing an, sich mit Künstlern bekannt zu machen, und da er seit jeher viel Geschmack in seiner Lebensführung bewiesen hatte und somit auch den Künsten gegenüber kein Fremder war, gelang es ihm bald, einen Bekanntenkreis zu gewinnen, welcher ihm nicht nur viel Vergnügen, sondern auch Ehre einbrachte. Sein gemütliches und elegantes Heim war schließlich ein gern besuchter Sammelplatz so mancher geworden, welche in der Kunstwelt bedeutende Rollen spielten.
Unter denen, die gern, sogar sehr gern in Mühlheims Hause verkehrten, befand sich auch König.
Daß dieser nicht nur eine glänzende Anstellung, sondern auch ein recht beträchtliches Vermögen besaß, war Mühlheim sehr recht, denn so brauchte er ihm, da der Doktor sich um Lenas Herz und Hand zu bewerben begann, nicht zu mißtrauen und brauchte der wachsenden Liebe seines Kindes kein Hindernis in den Weg zu legen, ja konnte mit Befriedigung des Doktors Aussprache entgegensehen. Diese war knapp vor Königs Reise erfolgt, und heute abend sollte die Verlobung im Kreise der Intimen des Hauses gefeiert werden.
Als der Wagen Königs vor dem prächtigen Gittertor der Villa hielt, tauchten an einem Fenster derselben ein paar blonde Köpfe auf.
»Da ist er ja, der Heißersehnte!« rief der Inhaber des einen, ein etwa sechzehnjähriger Bursche, dem der Übermut aus den blitzenden blauen Augen schaute.
Das hübsche Mädchen an seiner Seite war rot geworden.
»Geniere dich nur nicht. Eile ihm doch entgegen,« meinte der Junge, die Schwester zärtlich anstoßend.
»Laß das sein, Erich,« unterbrach ihn in ruhiger, aber doch bestimmter Weise sein Hofmeister, der auch ans Fenster getreten war, um den jungen Herrn ohne viele Umstände aus dem Salon zu führen.
Erich Mühlheim ließ es sich ohne weiteres gefallen, schon deshalb, weil er, wie er zu behaupten pflegte, für Rührszenen keine Schwäche besaß — dann aber wohl auch, weil »dieser Herr Braun« nun einmal bezüglich seiner ja doch der Herr »über Leben und Tod« war. Übrigens verging Erich nicht gerade in Furcht vor seinem Präzeptor, denn im Hinausgehen schrie er noch ein paarmal, wiewohl Braun ihm lachend den Mund zuhielt: »Auf den Flügeln der Liebe! Auf den Flügeln der Liebe!«
Lena aber eilte nicht hinunter, sie schaute leuchtenden Auges dem geliebten Manne entgegen und nickte ihm, der heraufgrüßte, zu.
Da legte sich ein Arm um ihre Schultern. Edwine, Lenas ältere Schwester, war es, die ihr jetzt liebevoll in die Augen sah. »Bist du sehr glücklich?« fragte sie lächelnd.
Lena nickte nur, dann schloß sie plötzlich ihre Arme um Edwine und preßte sie leidenschaftlich an sich, während sie ihr zuflüsterte: »So glücklich, daß ich mir’s — neben dir — gar nicht verzeihen kann.«
Edwine machte sich sanft frei. Ruhig schaute sie in der Schwester Augen, und sanft lächelnd entgegnete sie: »Laß dich’s nicht kränken, daß ich für meine Person mit dieser Seite des Lebens fertig bin.«
»Du wirst wirklich nie einen anderen lieben?«
»Nie!« war die feste Antwort. Dann ging Edwine aus dem Zimmer.
Von draußen her wurden rasche Schritte hörbar. Der schmerzliche Zug, der soeben noch auf Lenas lieblichem Gesichte gelegen, schmolz wie Schnee im Sonnenschein. Jetzt tat sich die Tür auf — im nächsten Augenblick hielt König, der jetzt alles andere vergessen hatte, die Geliebte in den Armen. Und er sagte, der sonst so Beredte, nichts als ein paarmal, tief aufatmend: »Mein Glück! Du mein süßes, herziges Glück!«
Ein Viertelstündchen gönnte man den beiden, dann kamen die Familienmitglieder eines nach dem anderen herein, um König zu begrüßen, und bald vereinte ein gemütliches Frühstück die fröhlich Plaudernden, denen König verschiedenes von seiner Reise erzählen mußte.
Plötzlich schwieg er und brach ein wenig unvermittelt die Schilderung seiner Fahrt von Paris nach Concarneau ab. Und es war doch gar nichts Unangenehmes vorgefallen. Es war nur ein Eilbrief an den Kommerzienrat gekommen, in welchem einer der für heute abend geladenen Gäste die angenommene Einladung nicht etwa rückgängig machte, sondern nur bat, um eine Stunde später kommen zu dürfen, da er eine unabweisbare Abhaltung habe.
Selbiger Gast — er hieß Viktor Colmar — hätte auch ganz fortbleiben können; den beiden Liebenden war er gleichgültig, und Edwine — um deren Gunst dieser Herr sich leidenschaftlich bewarb — war ihm geradezu abgeneigt.
Dieser Brief also konnte an Königs schlechter Laune keine Schuld haben.
Der Kommerzienrat, der kein Freund schlechter Launen und stockender Gespräche war, fand rasch neue Themata und war schließlich, weil es nun einmal wie ein kalter Hauch über der kleinen Tafelrunde lag, froh darüber, daß sein künftiger Schwiegersohn durch seine Berufspflichten gezwungen war, bald wieder zur Stadt zurück: zukehren. König mußte nicht nur noch einmal die Ausstellung besuchen, er mußte Nachmittags auch noch sein Referat schreiben, das er sonst wohl erst Abends seinem Blatte zuzustellen pflegte, das aber heute schon früher fertig sein mußte, da König ja heute abend anderes zu tun hatte, als an Kunstkritiken zu denken.
Gegen zwölf Uhr verabschiedete sich König denn auch und fuhr nach der Ausstellung, die um ein Uhr eröffnet werden sollte. Er langte eine halbe Stunde früher dort an und begab sich sogleich in die Ausstellungsräume,woselbst jetzt schon alles an Ort und Stelle gebracht und jede Spur der fieberhaften Tätigkeit, welche vor Stunden da noch geherrscht hatte, völlig verwischt war. Noch war dem Publikum der Zutritt nicht freigegeben worden, dennoch aber herrschte schon ziemlich viel Bewegung in den verschiedenen Sälen, denn es waren nicht nur die Berichterstatter der Zeitungen, sondern auch viele Künstler anwesend, welche den intimen Genuß, den nun einmal der Eröffnungstag bietet, haben wollten. Man konnte die Maler plaudernd, die Journalisten Notizen machend, da und dort beisammenstehen oder von Bild zu Bild gehen sehen.
Auch König war jetzt nur Kritiker. Er schaute, notierte, plauderte über seine Reise und sprach sich über dieses und jenes Kunstwerk aus. Daß seine Augen dabei jemand suchten, der nicht kam, bemerkte keiner. —
Nachdem die Eröffnungsfeierlichkeit vorüber war, schrieb König im Vestibül auf eine Visitenkarte wenige Zeilen. Sie lauteten: »Ich muß Sie unbedingt heute noch sprechen. Bin bis sechs Uhr zu Hause.«
Die mit Umschlag versehene Karte übergab er einem Dienstmann mit dem Auftrage, den Brief sofort zu besorgen. Darauf nahm er einen Fiaker, der auch sein Rad mitnahm, und fuhr nach Hause.
Er schloß seine Wohnung hastig auf, brachte das Rad an dem gewohnten Platz im Gange unter und begab sich in sein Arbeitszimmer.
Er war allein. Frau Winter hatte um diese Zeit im Hause nichts zu tun. Sie hatte seinen Reisekoffer schon entleert und dessen Inhalt in den betreffenden Kästen verwahrt. Die verschiedenen Kleinigkeiten, welche König unterwegs erworben hatte, kleine Plastiken, Photographien u. s. w., hatte sie auf seinen Schreibtisch gelegt. Er schob sie, als er sich an ihm niederließ, ein wenig ungeduldig zur Seite und begann sein Referat zu schreiben. Bald war er ganz und gar in seine verantwortungsvolle Arbeit vertieft.
Als er mit seinem Bericht zu Ende war, schlug die hohe englische Standuhr, welche neben dem Schreibtische stand, fünf Uhr.
Der Doktor schüttelte den Kopf, blickte auf seinen Chronometer und schüttelte abermals den Kopf.
»Na, auch gut!« sagte er eigentümlich harten Tones, legte sich noch ein Blatt Papier zurecht und schrieb weiter. Als es halb Sechs schlug, faltete er den großen, eng beschriebenen Bogen zusammen. Gerade, als er dies tat, ging das Gartenpförtchen. König schaute nicht auf, er steckte den zuletzt geschriebenen Artikel ein wenig hastig in einen schon adressierten Umschlag, faltete dann auch die anderen beschriebenen Bogen zusammen und schob sie zu dem ersten.
Indessen ging jemand durch den Garten und die Treppe herauf. Es klopfte an. König schrieb noch immer. »Herein!« rief er und legte die Feder hin.
Es war ein junger Mensch, der da über die Schwelle trat.
»Ah, Sie sind es!« sagte der Doktor. Er war sichtlich enttäuscht. Der junge Mann war ein Abgesandter seines Bankiers und brachte ihm eine größere Summe baren Geldes, das König während seiner Reise gekündigt hatte. Die zwei kannten sich flüchtig. Der Bankbeamte erkundigte sich danach, wie es dem Herrn Doktor während seines Fortseins ergangen sei, und teilte ihm mit, daß auch er und zwar heute noch im Interesse seines Chefs eine längere Reise antreten werde.
Der junge Mann, der vermutlich noch nicht viele Reisen gemacht hatte, wäre gern ein bißchen weitschweifig geworden, aber er bemerkte, daß Doktor König nervös sei. Er mußte wohl jemand erwarten, denn er sah des öfteren nach der Straße hinüber, und dazwischen griff er, während er zerstreute Bemerkungen machte, bald nach diesem, bald nach jenem der kleinen Päckchen, welche auf dem Schreibtische lagen. Sein Besucher stand denn auch bald auf, um sich zu empfehlen.
Eben als er sich erhob, hatte der Doktor den Umschlag von einem der Päckchen geöffnet. Das Kuvert umschloß ein in zarten Tönen gemaltes Frauenbildnis. Es war in einen flachen Malachitrahmen eingefügt. Einen Augenblick lang schaut der Doktor auf das Bild, da klirrt wieder die eiserne Gittertür draußen, Königs Blick fliegt hinaus.
»Sie bekommen Besuch,« sagt der junge Beamte.
»Ja, ich bekomme Besuch,« sagt auch König, schiebt das Bildchen wieder in den Umschlag und legt es auf den Schreibtisch, schüttelt den Kopf, hebt das Bildchen wieder auf, schlägt es in eine Zeitung ein und schiebt es zwischen einen Stoß Bücher, welche auf dem Rande des Schreibtisches liegen, dann wünscht er freundlich, aber auch merkbar zerstreut dem Besucher eine glückliche Reise und geleitet ihn bis zur Tür.
Von dorther wirft der junge Beamte unwillkürlich noch einen Blick auf das überbrachte Geld, das offen auf dem Schreibtische liegt.
Draußen begegnet er dem neuen Besucher. Dieser ist ein elegant gekleideter, noch jüngerer Mann. Er scheint recht wohlgelaunt zu sein, seine Miene verrät es und das Liedchen, das er summt.
Als die zwei aneinander vorübergehen, grüßen sie sich stumm.
Der junge Beamte vergewissert sich noch einmal, ob er die eben erhaltene Quittung auch gut verwahrt habe, und geht danach, auch in recht vergnügter Stimmung, die Straße hinunter. Sie mündet in die Döblinger Hauptstraße. Gerade an der Ecke baumelt ein Barbierbecken an einer langen Stange, da fällt es dem jungen Menschen ein, daß er sich vor seiner Abreise noch rasieren lassen müsse, und so betritt er den Laden. Es tut ihm nichts, daß er, da eben andere Kunden bedient werden, etwas warten muß. Endlich kommt auch er daran. Just eine halbe Stunde hat das Warten gedauert. Die Zunge des wackeren Bartscherers ist bedeutend flinker, als es seine Hände sind, das merkt sein neuester Kunde jetzt auch an sich.
Endlich aber wird doch auch er fertig. Er hat schon gezahlt und zieht die Handschuhe an, wobei er gelangweilt auf die Straße hinaussieht.
Da geht soeben ein Herr an dem Laden vorüber — es ist derselbe, dem er vorhin im Hause Königs begegnet ist.
»Merkwürdig,« denkt der junge Bankbeamte, »wie verdrossen der jetzt dreinschaut, und war doch vor einer Stunde noch so lustig!«
Fünf Stunden später fuhr der junge Mensch, welcher diese Wahrnehmung gemacht hatte, in die weite Welt hinein, in der er irgendwo, auf Wochen hinaus, für seine Firma zu tun hatte.
Und etwa auch fünf Stunden später endete das Verlobungsfest bei dem Kommerzienrat v. Mühlheim. Es war diesem nicht recht gewesen, daß sein künftiger Schwiegersohn sich nicht einmal heute ganz frei hatte machen können, anderseits glaubte er es ihm ohne weiteres, daß er, ehe die Drucklegung des Morgenblattes begonnen hatte, also vor zwölf Uhr Nachts, noch einmal in die Redaktion müsse.
Lena war sogar ein bißchen gekränkt ob seines zeitlichen Gehens, aber sie kämpfte tapfer gegen ihre Verstimmung an, und als König in dem augenblicklich leeren Wintergarten von ihr Abschied nahm, sagte er: »Möchtest du lieber, daß ich niemals Wichtiges zu tun habe?«
Da schaute sie ihn voll ernster Liebe an und entgegnete: »Nein, nein. Wie es ist, ist es gut, und wie du bist, so sollst du immer sein — denn gerade so muß ich dich lieben.«
»Herz, liebes Herz!« — Er drückte einen Kuß auf ihre weiße Stirn, dann fragte er lächelnd: »So wirst du niemals eifersüchtig auf meinen Beruf sein?«
»Niemals werde ich eifersüchtig sein. — Deinen Beruf achte ich, und die Kunst — die liebe ja auch ich. Eines anderen Weibes wegen wirst du dich aber nie zum Lügen und Betrügen erniedrigen. Ich werde keine Ursache haben, mich deshalb zu grämen — und das nennt ihr ja Eifersucht. Aber du gehst — solltest du nicht wenigstens mir sagen, was dir heute Peinliches begegnet ist? Denn es ist dir Peinliches begegnet. Ich — wir alle fühlten es.«
»Später wirst du es erfahren. Ich kann jetzt noch nicht davon reden.«
Noch ein paar liebe Worte, dann ging der Doktor.
Leuna sah ihm nach, bis sich die Tür hinter ihm schloß. Das Herz war ihr schwer, sie wußte nicht weshalb. Sie trat an das große Fenster, von welchem aus man zu dem Tore hinüberschauen konnte. Dieses Fenster war von vielfach verzweigten Schlingpflanzen ziemlich dicht verhangen. Lena schob etliche der schwankenden Zweige zurück und schaute hinunter — es bewegte sich soeben eine Gruppe von Herren auf dem breiten Kiesweg dem Tore zu. Ob ihr Bräutigam darunter war, konnte die junge Dame nicht erkennen. Sie spürte, daß ihre Augen voll Tränen standen. Ehe sie diese noch weggewischt hatte, waren die Herren schon auf die Straße hinausgetreten. Jetzt konnte man ihre Gestalten überhaupt nur noch undeutlich unterscheiden, denn nun befand sich zwischen ihnen und der Villa das hohe Eisengitter und die freilich noch kahlen Sträucher, welche innerhalb desselben gepflanzt waren.
Lena sah nur noch, daß etliche Wagen rasch hintereinander wegfuhren.
Von der ihr selber unbegründet erscheinenden Angst befallen, wandte sie sich seufzend in den großen Raum zurück — da stand Edwine vor ihr.
Erschrocken schaute ihr diese in die trüben Augen.
»Aber Liebste! Was ist dir denn?« fragte sie besorgt. »Ist denn das die Miene einer glücklichen Braut? Und die bist du ja doch!«
»O ja — die bin ich!« begann Lena, und ihre Augen leuchteten auf. »Wie sollte ich denn nicht sehr, sehr glücklich sein! — Aber — weißt du, es gibt kein ungetrübtes Glück. Und wenn auch gar keine Ursache da ist, es zu trüben, dann grübelt man doch darüber nach, wie lange wohl solch ein großes Glück währen kann.«
»Das hast du getan?«
Lena nickte, dann gingen die Schwestern Hand in Hand aus dem Saale.
Eine Weile wirtschafteten die Dienstleute noch in den Gesellschaftsräumen herum, dann erlosch in der Villa ein Licht nach dem anderen, und bald herrschte tiefe Stille da, wo noch vor Stunden froher Festeslärm zu hören gewesen war.
Als sich Edwine von der Zofe das Haar auflösen ließ, zeigte ihr der Spiegel ein recht blasses Gesicht.
Und noch etwas zeigte er ihr: die mitleidige Miene des Mädchens, welches hinter ihr stand.
»Warum machen Sie denn ein so trübseliges Gesicht, Lisi?« fragte Edwine freundlich.
»Ich habe den ganzen Abend an weniger Glückliche denken müssen.«
»An Sie selber also?«
»Und an Sie, mein liebes gnädiges Fräulein,« brach Lisi los, die ebensosehr die Vertraute als die Dienerin der Schwestern war.
»Auch an mich! Da taten Sie recht, Lisi,« sagte trüb lächelnd Edwine, »denn ich habe gar keine Aussicht, je eine glückliche Braut zu werden, während Sie dieses Glück vor sich haben und nur ein bißchen darauf warten müssen.«
»Vier Jahre noch, Fräulein! So lange wird es dauern bis Braun eine feste Anstellung erhält.«
»Ich wollte vier Ewigkeiten darauf warten.«
»Was alles kann da noch dazwischen kommen!« seufzte Lisi.