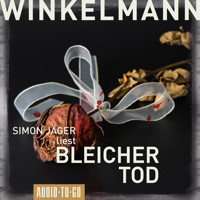Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
""Hilf mir ... der Hinkende" Das sind die letzten Worte der jungen Kommissarin Manuela Sperling. An dem Tag, an dem Henry Conroy aus dem Urlaub zurückkehrt, verschwindet seine neue Partnerin spurlos. Wie es scheint, hat sie in seiner Abwesenheit unerlaubt Ermittlungen im äußerst brutalen, gut organisierten Bereich des Menschenhandels angestellt und dabei ein Phantom aufgeschreckt, das hinter vorgehaltener Hand "Der Hinkende" genannt wird. Niemand hat ihn je gesehen, alle fürchten sie vor ihm und er scheint der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Henry beginnt einen verzweifelten Wettlauf um das Leben von Manuela Sperling und muss feststellen, dass er seinem Gegner nicht gewachsen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Der Schlot
Thriller
Impressum
Text Copyright©2016 Andreas Winkelmann
Alle Rechte vorbehalten.
Cover Copyright©2016 Nina Winkelmann
Alle Rechte vorbehalten
www.andreaswinkelmann.com
Buch
„Hilf mir ... der Hinkende“
Das sind die letzten Worte der jungen Kommissarin Manuela Sperling.
An dem Tag, an dem Henry Conroy aus dem Urlaub zurückkehrt, verschwindet seine neue Partnerin spurlos. Wie es scheint, hat sie in seiner Abwesenheit unerlaubt Ermittlungen im äußerst brutalen, gut organisierten Bereich des Menschenhandels angestellt und dabei ein Phantom aufgeschreckt, das hinter vorgehaltener Hand „Der Hinkende“ genannt wird. Niemand hat ihn je gesehen, alle fürchten sie vor ihm und er scheint der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Henry beginnt einen verzweifelten Wettlauf um das Leben von Manuela Sperling und muss feststellen, dass er seinem Gegner nicht gewachsen ist.
Autor
Andreas Winkelmann, Jahrgang 1968, ist einer der erfolgreichsten deutschen Thriller-Autoren. Seine Werke wurden in bis zu dreizehn Sprachen übersetzt. Er lebt auf einem einsamen alten Hof am Waldesrand nahe Bremen. Bisher erschienen sind:
Der Gesang des Scherenschleifers
Tief im Wald und unter der Erde
Hänschen Klein
Blinder Instinkt
Bleicher Tod
Höllental
Wassermanns Zorn
Deathbook
Die Zucht
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Buch
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
Teil 8
Teil 9
Teil 10
Teil 11
Teil 12
Teil 13
Teil 1
Kamera läuft.
„Komm jetzt, sei ein hübsches Mädchen für den Herrn Doktor. Sei ein Model, so wie im Fernsehen. Das hast du dir doch immer gewünscht, nicht wahr?"
Elizaveta Radu, die von ihren Eltern kurz Eliza genannt wurde, stand mit dem Rücken zur Kamera. Wie eine zweite Haut schmiegte sich ein rotes, schulterfreies Abendkleid an ihren schlanken Körper. Kastanienbraunes Haar fiel in weichen Locken auf ihre schmalen Schultern, das helle Licht eines Scheinwerfers verlieh der bronzenen Tönung ihrer Haut einen seidenen Glanz. Im Hintergrund lag ihr Schatten schräg an der weiß gestrichenen Kellerwand. Die Arme an die Seiten gepresst verharrte sie still, ihr Brustkorb hob und senkte sich unter raschen Atemzügen.
"Du bist doch eine Schönheit. Zeig es mir!"
Ihre Hände schlossen sich zu Fäusten, öffneten sich wieder, sie winkelte die Arme an, so als wolle sie Schwung holen, dann drehte sie sich in einer langsamen, eckigen Bewegung zur Kamera.
Ihr Gesicht war eine starre Maske. Weit aufgerissen die ausdrucksstarken braunen Augen, unnatürlich lang die Wimpern, Kajal und Eyeliner unterstrichen die Form und vergrößerten sie optisch. Die Lippen zitterten unter einer Schicht von rotem Lippenstift. Goldfarbene Kreolen zierten ihre Ohrläppchen und warfen Lichtreflexe.
Für einen Moment schien sie nicht zu wissen, was sie tun sollte. Ihr Blick zuckte unstet hin und her, so als suche sie jemanden, der ihr helfen würde.
"Wir haben es doch besprochen. Jetzt mach schon!"
Bei den ersten Sätzen hatte die Stimme noch weich, fast fürsorglich geklungen, doch den letzten Worten fehlte jegliche Emotion. Sie waren hart und fordernd und duldeten keinen Wiederspruch.
Elizaveta bewegte sich. Was ein lasziver Hüftschwung werden sollte, geriet zu einer roboterhaften Bewegung ohne jede Anmut. Sie trat einen Schritt auf die Kamera zu, hob die langen Arme über den Kopf, führte die Handrücken zusammen und versuchte sich in einer schlangenhaften Bewegung.
Auch diese misslang. Plötzlich schluchzte sie laut auf, die Arme fielen herunter, sie begann, am ganzen Körper zu zittern und ihr hübsches Gesicht zerfloss zu einer hässlichen Maske.
"Ich kann das nicht", stotterte sie schluchzend. Tränen rannen ihre Wangen hinab.
Hinter der Kamera erklang ein genervtes Seufzen.
„Es ist für den Herrn Doktor, du weißt, wie gern er dich mag, nicht wahr?“
„Ja, ich weiß … aber vor der Kamera … ich kann das nicht.“
„Hör auf zu heulen. Du bist hässlich, wenn du heulst.“
Sie presste die Lippen zusammen, bemühte sich um Selbstbeherrschung, doch die Fassade hielt nur für ein paar Sekunden - und als sie brach, brach sich ein wahrer Sturzbach aus Tränen seine Bahn. Sie schlug die Hände vors Gesicht.
Die Kamera wich keinen Millimeter.
Ein Schatten wanderte über die weiße Wand hinter dem Mädchen. Zuerst war er klein, viel kleiner als ihr eigener, veränderte sich aber rasch und wuchs zu einem Riesen heran. Schließlich trat die Person, zu der der Schatten gehörte, ins Bild und aus dem Riesen wurde ebenso schnell wieder ein Zwerg. Er stand hinter dem viel größeren Mädchen und wurde von ihm verdeckt. Die Kamera sah nur Arme, Schultern und Beine, alles in Schwarz gekleidet. Elizaveta erstarrte, ihr Schluchzen verstummte, und das Öffnen des Reißverschlusses am Rücken ihres Kleides klang unnatürlich laut.
„Zieh es aus“, flüsterte er ihr ins Ohr und verschwand mit einem schnellen Schritt nach links aus dem Bild.
Sie ließ die Arme sinken. Mit unbeholfenen Bewegungen schälte sie sich aus dem Kleid, und als sie nur noch rote Spitzenunterwäsche trug, offenbarte die Kamera einen dünnen, jugendlichen Körper ohne nennenswerte weibliche Kurven. Sie verschränkte die Arme vor dem Bauch, verkrampfte die Hände ineinander und sah fragend nach links.
„Nein. Nicht zu mir, schau in die Kamera!“
Die Kamera zoomte heran und der Focus lag nun auf ihrem Gesicht und Hals. Die große Nähe zeigte bislang verborgene Details wie ein kreisrundes Muttermal an ihrem Hals, eine feine silberne Kette darum, eine gut verheilte kleine Narbe über ihrem linken Jochbein. Auf ihren braunen Augen lagen kleine Seen aus Tränen, die Abflüsse zogen eine Spur über ihre kindlich gerundeten Wangen.
Ein metallenes Geräusch erklang, Ketten surrten durch Ösen, der Kopf des Mädchens zuckte hin und her.
„Nein … bitte, nicht“, sagte sie leise. Aber da war kein Aufbegehren in ihrer Stimme, kein großes Entsetzen. Es klang, als hätte sie diese Prozedur schon dutzende Male über sich ergehen lassen.
„Komm schon, du weißt doch, der Herr Doktor mag gefesselte Mädchen.“
Als die Kamera in die alte Position zurück zoomte, stand Elizaveta Radu breitbeinig und mit weit ausgestreckten Armen da. Um ihre schmalen Handgelenke lagen silberne Metallringe, an denen dünne Ketten befestigt waren.
Erneut trat der Mann ins Bild. Mit dem Rücken zur Kamera fummelte er an dem Mädchen herum, und einen Moment später fiel der rote BH zu Boden. Dann wich er einen Schritt zur Seite und ließ die Kamera dabei zusehen, wie er mit einem roten Stift etwas auf den nackten Oberkörper des Mädchens malte.
Als er fertig war, gewährte er der Kamera freien Blick.
In dicken roten Strichen hatte er ein Ypsilon auf ihre Haut gemalt. Das untere Ende begann einen fingerbreit über dem Slip, der gerade Strich verlief über ihren Nabel, das Sternum und zwischen ihren Brüsten hindurch. Darüber teilte er sich und endete jeweils auf dem rechten und linken Schlüsselbein.
Der Mann sah in die Kamera.
Sein Gesicht war eine furchterregende Totenmaske. Tiefschwarze Ringe auf weißem Untergrund umrahmten die Augen, darum lag ein Kreis aus roter Farbe in der Form von Blütenblättern. Die Nasenspitze und der Nasenrücken leuchteten rot. Auf der Stirn prangte ein rotes, verkehrt herum stehendes Herz, darüber drei blaue Punkte. Kurze schwarze Striche auf den weißen Lippen ließen diese wie zugenäht aussehen, und zwei schwungvolle Linien zogen sich von den Mundwinkeln bis zu den Ohren.
Er hielt ein ungewöhnlich großes Messer in seiner rechten Hand. Während er in die Kamera sprach, ließ er die Klinge am nackten Körper des Mädchens nach oben wandern und folgte dabei den Linien des Ypsilon.
„Sieh genau hin, Doktor“, sagte er. „Dieser Schnitt ist ein Kunstwerk, und niemand beherrscht ihn besser als ich. Der Stahl meines Messers ist scharf wie ein Skalpell, er schneidet durch Haut wie durch Butter. Das willst du doch nicht verpassen, nicht wahr? Und? Was meinst du? Wie würde deiner Frau ein solches Kunstwerk stehen? Wie würde dir ein Blick in ihr Inneres gefallen? Wenn du das nicht herausfinden willst, solltest du deine Meinung noch einmal überdenken, Doktor."
Kamera aus.
Zigarettenqualm und Atem vermischten sich in der kalten Luft zu geisterhaften Nebelwolken. Auf der langen Zufahrt zu dem brachliegenden Industriegelände hörte Mladen Krasic den Wagen lange, bevor er ihn sah. Hastig zog er noch zweimal an der Zigarette, warf sie dann zu Boden und trat mit dem Hacken darauf. Er streckte seine Finger aus und betrachtete seine Hände. Sie zitterten. Er musste seine gewohnte Ruhe wiederfinden. Schließlich war es nicht seine Schuld, wie die Dinge gelaufen waren.
Der Wagen kam näher. Auf dem schlechten Weg voller Schlaglöcher tanzten die Scheinwerfer auf und ab. Schleier feiner Wassertröpfchen zogen durch die Lichtkanäle. Ein Dreckswetter nahe am Gefrierpunkt, den ganzen Tag schon. Feuchtigkeit und Kälte drangen durch die Kleidung in den Körper, und Krasic spürte seine Verletzungen heute besonders stark. Die mehrfach gebrochenen Knochen in der linken Hand, die nur schlecht verheilt waren, sendeten immer wieder feine Stiche aus. Der versteifte Wirbel im unteren Rücken erschwerte das Aufstehen und Hinsetzen. Diesen ganzen Quatsch hatten ihm die Ärzte damals nach dem Krieg prophezeit, aber er hatte nur über sie gelacht. An Tagen wie diesem bereute er so einiges, und als wäre seine Laune nicht schon schlecht genug, hatte ihn vor einer halben Stunde ein unerwarteter Anruf erreicht. Er wünschte sich, er wäre nicht rangegangen, auch wenn das nichts geändert hätte. Da stand er nun in feuchter Kälte und Dunkelheit, kam sich vor wie ein Lakai und ärgerte sich über sich selbst. Aber für falschen Stolz war nicht der richtige Zeitpunkt.
Der Besuch, den er erwartete, war ein Mythos. Manche behaupteten sogar, ein Dämon. Mladen war ihm in all den Jahren nie persönlich begegnet, hatte aber natürlich von ihm gehört – so wie alle in der Branche. Mladen glaubte nicht an die Geistergeschichten, die sich um Den Hinkenden rankten, aber alle anderen Geschichten glaubte er, und die jagten ihm eine Heidenangst ein.
Der Wagen bog zwischen den beiden verbogenen Stahlpfosten ein und hielt auf ihn zu. Die Scheinwerfer erfassten und blendeten ihn, doch der Fahrer hielt es nicht für nötig, abzublenden. Knirschend zermahlten die Reifen den Schotter. Aufreizend langsam rollte der Wagen bis auf wenige Meter an Krasic heran. Er wich keinen Zentimeter zurück. Hier und heute durfte er keine Schwäche zeigen. Bevor sich die Türen öffneten, steckte er seine Hände in die Taschen seiner Hose. Sie zitterten noch immer.
Der Motor verstummte, die Scheinwerfer leuchteten jedoch weiter. Die Fahrertür schwang auf. Weil er immer noch geblendet war, konnte Krasic den Fahrer kaum erkennen. Er schickte ein letztes Stoßgebet zum Himmel.
Jemand trat aus dem Scheinwerferlicht auf ihn zu, und als er ihn erkannte, legte sich die Nervosität des alten Mannes augenblicklich. Er hatte das personifizierte Böse erwartet, sah sich aber nun dessen rechter Hand gegenüber. Gewiss, auch dies kein Mann, den man gern zu Gast hatte, aber eben ein Mann, den er kannte und einschätzen konnte.
Man nannte ihn den Scout, seinen richtigen Namen kannte Krasic nicht. Der Scout war dafür da, Wege zu finden, wo andere keine sahen. Er trug einen langen schwarzen Wollmantel, dazu einen passenden Schal, Jeans und blanke Lederschuhe. Er war schlank und groß, hatte dichtes braunes Haar, in das hohe Geheimratsecken hineinstießen, die wie Teufelshörner wirkten. Seine Augen waren von unergründlichem Blau. Das kleine Lächeln in seinen Mundwinkeln erreichte diese Augen nicht. Niemals. Sein Gesicht war schmal, vielleicht sogar ein wenig ausgezehrt, und er trug einen gepflegten Vollbart, der bereits grau zu werden begann. Er war vierzig, höchstens fünfundvierzig Jahre alt.
Sie schüttelten sich die Hände.
„Ich hoffe, du stehst noch nicht allzu lange in der Kälte, mein alter Freund“, sagte der Scout mit warmer, einschmeichelnder Stimme. „Du hättest drinnen warten sollen.“
„Für einen guten Freund stehe ich stundenlang in bitterer Kälte“, antwortete Krasic. „Schön, dich zu sehen. Komm rein und wärm dich an meinem Feuer.“
In dem großen Raum, den Krasic überschwänglich als Salon bezeichnete, gab es eine Bar, ausgestattet mit guten Weinen und teurem Whiskey. Er bot seinem Gast einen Drink an. Der nickte und sah sich um.
„Geschmackvoll eingerichtet“, sagte er. „Der äußere Zustand lässt etwas anderes vermuten.“
Der Alte goss zwei Finger breit Whiskey in die Gläser.
„Ach, weißt du, wenn ich in meinem Alter nicht wüsste, dass der Schein oft trügt, dann hätte mich das Leben nichts gelehrt.“
Er ging auf seinen Gast zu und reichte ihm ein Glas.
„Wollen wir uns nicht setzen?“
Der Scout bedanke sich, ließ sich in einem der ledernen Clubsessel nieder und streckte die langen Beine aus. Sie saßen sich unweit des Kaminofens gegenüber, angenehme Wärme strömte ihnen entgegen. Träge loderten die Flammen hinter der Glasscheibe.
„Das Alter macht weise, meinst du nicht?“, sagte der Scout.
„Ich weiß nicht, sag du es mir.“
„Das kann ich nicht, du hast mir ein paar Jahrzehnte voraus. Ich respektiere deinen Vorsprung an Erfahrung.“
„Tja ...“, Krasic, der vor vier Monaten sechzig geworden war, überlegte einen Moment, „ ... es lässt einen Mann zumindest nachdenken, bevor er handelt. Das war in der Jugend anders.“
Der Scout wandte sich vom Kaminofen ab und lächelte. Die Flammen spiegelten sich in seinen blauen Augen, und Krasic hatte tatsächlich den Eindruck, es seien nur Spiegelflächen mit nichts dahinter. Keine Emotionen, keine Angst, kein Mitleid.
„Dann hast du sicher darüber nachgedacht, warum ich heute hier bin.“
Krasic hob sein Glas, prostete seinem Gast zu und trank. Er brauchte diesen Moment, um sich eine Antwort zu überlegen. Zudem brauchte er die Wärme des Alkohols in seinem Inneren. In diesem alten Gebäude konnte er so viel heizen wie er wollte, es wurde nie richtig warm. Aber daran lag es nicht allein. Die innere Kälte schien ihn seit dem Anruf nicht loslassen zu wollen.
„Ich hatte ja kaum Zeit zum Nachdenken. Du hast sehr spät angerufen.“
„Es hat sich so ergeben, tut mir leid. Ich hoffe, dich nicht bei etwas Wichtigem gestört zu haben Aber wie ich sehe, bist du allein.“
„Bin ich meistens. Und nein, du hast mich nicht gestört. Ist irgendwo etwas schiefgelaufen?“
Im Kamin zerplatzte laut ein Holzstück. Krasic zuckte ein wenig zusammen. Hatte sein Gast es bemerkt? Er wusste, dem Mann entging nichts, er witterte Angst wie ein scharfer Hund. Krasic, der sein Leben lang gegen Männer bestanden hatte, die größer, schneller und stärker gewesen waren als er, fühlte sich schwach in dessen Gegenwart. Körperlich war er ihm überlegen, trotz der zwanzig Jahre Altersunterschied, immerhin prügelte er noch jeden Tag eine Stunde auf den Sandsack ein. Aber das Körperliche spielte hier keine Rolle. Der Scout dachte zu schnell für ihn und fragte zu kompliziert, ständig musste man befürchten, in eine verbale Falle zu laufen. Außerdem gab es im Hintergrund diesen Einen, der wie ein böser Dämon über dem Scout schwebte.
„Schiefgelaufen ... Ja, so kann man es nennen. Andere nennen es eine Katastrophe, aber so weit will ich nicht gehen, noch nicht“, sagte sein Gast, schwenkte dabei sein Whiskeyglas und betrachtete die bernsteinfarbene Flüssigkeit.
„Unser Informant im Knast sagt, es gibt Fotos, und die wurden der Polizei zugespielt. Kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert?“
Krasic schüttelte den Kopf.
„Die Polizei, eine ganz bestimmte Polizistin, wird alles auf den Kopf stellen. Sie wird nicht lockerlassen, tief graben und vielleicht Dinge finden, die besser unentdeckt blieben."
"Hör zu, du kennst mich, ich bin seit zwanzig Jahren im Geschäft. Nie ist auch nur der Schatten eines Verdachts auf mich gefallen.“
Für einen Moment füllte das Prasseln des Feuers die Stille. Plötzlich war es Krasic hier am Ofen viel zu heiß. Er spürte Schweiß auf seiner Stirn und unter den Armen. Wieder ein Zeichen von Schwäche.
„Wir haben deine Arbeit und deine Loyalität immer geschätzt. Aber wir kennen auch deine Schwächen. Mitunter schaffst du es nicht, die notwendige Distanz zu wahren. Darüber haben wir immer hinweggesehen.“
„Ich weiß nicht, was ...“
Der Scout brachte Mladen Krasic mit einer Handbewegung zum Schweigen.
„Wir wissen, dass du hier mit jemandem zusammenlebst. Ist es eines unserer Mädchen?“
„Ja, aber sie ist entstellt. Die fasst kein Mann je wieder an.“
„Auch das wissen wir, deshalb lassen wir dich gewähren. In ruhigen Zeiten kann sich jeder von uns einen kleinen Makel leisten. Aber die ruhigen Zeiten sind vorbei. Wir stellen uns auf einen Sturm von ungeahntem Ausmaß ein - und das solltest du auch tun.“
„Was schlägst du vor?“, fragte Mladen Krasic.
Der Scout seufzte theatralisch, so als koste es ihn große Überwindung, zu sagen, was er zu sagen hatte.
„Die Telefone werden getauscht, die Computer werden ausgetauscht, wir wechseln die Server. Alle Geldtransfers laufen ab sofort über neue Konten. Die Fahrzeuge werden getauscht. Die Pathfinder sind bereits informiert und brechen jede weitere Lieferung ab. Bis wir etwas anderes sagen, liegt das Geschäft auf Eis. Die Polizei soll einem Phantom nachjagen."
Der Alte stöhnte auf. "Wir hatten schon früher stürmische Zeiten und haben sie ausgehalten. Wir können doch nicht das ganze Geschäft brach liegen lassen.“
„Das können und müssen wir. Möglicherweise führt durch die Fotos eine Spur zu Dem Hinkenden – und das muss unter allen Umständen verhindert werden. Es betrifft vier Mädchen. Die müssen verschwinden."
Der Scout beugte sich vor und stellte sein Glas auf dem kleinen Holztisch ab. Sein Blick wurde stechend.
"Und damit sind wir schon bei dem Grund meines Besuches. Wie lange ist es her, dass du die Anlage benutzt hast?“
"Über ein Jahr, aber ... hör zu ... ich will das nicht mehr. Das hatte ich schon gesagt."
"Und wir habe deinen Wunsch respektiert und andere Möglichkeiten geschaffen. Doch jetzt haben wir eine außergewöhnliche Situation, und wir erwarten von dir, dass du unsere Entscheidung akzeptierst."
„Wann soll es losgehen?“
"Schon morgen."
Krasic stöhnte auf. "Morgen? Ich weiß nicht ... vielleicht funktioniert die Anlage nicht auf Anhieb."
„Um unserer Freundschaft willen, bitte ich nicht noch einmal. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten“, sagte er und zog sein Handy hervor. „Ich rufe Ihn an, störe Ihn am späten Abend, sage Ihm, dass du dich weigerst, und ich weiß, Er wird sehr enttäuscht sein. Obwohl Er diese Aufgaben nicht mehr oft selbst übernimmt, kommt Er vielleicht zu dir und erledigt einen Testlauf mit dir. Oder du machst es selbst, noch heute Nacht. Es ist deine Entscheidung.“
In der folgenden Pause starrten sie sich an.
Schließlich nickte Krasic. „Also gut.“
"Fein. Weiterhin brauche ich zwei deiner Leute. Die sollen sich um diese bestimmte Polizistin kümmern. Sie ist wahrscheinlich im Besitz der Fotos. Wenn wir schnell handeln, können wir das Schlimmste vielleicht noch abwenden."
"Eine Polizistin? Bist du dir sicher?"
"Mir ist das Risiko bewusst, doch in diesem Fall geht es nicht anders.“
„Um wen handelt es sich?“
Der Scout griff unter seine Jacke und holte ein Foto hervor. Krasic betrachtete es. Darauf war eine hübsche junge Frau zu sehen, kaum älter als das Mädchen, mit dem der Alte seit einigen Monaten zusammenlebte. Sie stieg aus einem blauen VW Golf und blickte direkt in die Kamera.
„Ihr Name ist Manuela Sperling. Sie ist neu bei der Polizei, ein Greenhorn. Deine Leute sollten keine Probleme mit ihr haben. Er will, dass sie spurlos verschwindet. Er will, dass sie sich auflöst wie Rauch in der Luft.“
Manuela Sperling schob die Vase mit den Tulpen von rechts nach links und wieder zurück, arrangierte einzelne Blumen neu und räumte anschließend den Schreibtisch auf. Die Willkommenskarte stellte sie aufrecht auf die blütenweiße Schreibunterlage. Ein Smiley griente sie von der Vorderseite der Karte an.
Morgen begann für Manuelas Chef nach einer Pause von fünf Monaten der erste Arbeitstag, und Manuela freute sich darauf, endlich wieder mit Henry Conroy arbeiten zu können. Sie hatten sich zwischendurch privat getroffen, aber nicht allzu oft, denn Henry hatte eine mehrwöchige Kur an der Nordsee absolviert und war danach mit seiner einzigen Tochter Lea in den Urlaub nach Kenia geflogen. Die beiden hatten sich zuvor auseinander gelebt, viel gestritten, aber der letzte Fall hatte sie auf grausame Weise wieder zusammengeführt, und seitdem versuchten die beiden einen Neuanfang. Wie es aussah, würde es klappen. Henry war ein Dickkopf, und der Apfel war nicht weit vom Stamm gefallen, also gestaltete es sich nicht immer einfach, aber Manuela war sich sicher, dass alles gut werden würde. Was sie dazu beitragen konnte, trug sie gerne bei.
Hier im Präsidium war in der Zeit nichts Dramatisches passiert, Dienst nach Vorschrift sozusagen – zumindest offiziell. Was Manuela inoffiziell getrieben hatte, hatte sie niemandem gesagt, auch Henry nicht. Sie würde ihren Job verlieren, wenn die Jungs vom LKA erfuhren, dass sie weiterhin Fragen stellte in einem Fall, der sie nichts anging.
Diese Gedanken brachten Manuela zu dem, was in ihrer großen braunen Lederhandtasche steckte. Viel war es nicht, und dennoch wog es schwer. Allein kam sie mit ihrer Schnüffelei - so hatte ihr kleiner Bruder Timmy es genannt, der als Einziger ahnte, was sie tat - nicht weiter, das wusste Manuela. Schon mehrfach hatte sie sich vorgenommen, Henry einzuweihen, es aber immer wieder hinausgeschoben, um seine Auszeit nicht zu belasten. Aber sobald er wieder im Dienst war, würde sie es ihm sagen. Okay, vielleicht nicht sofort, aber in ein oder zwei Tagen, sobald er sich eingearbeitet und sie eine Möglichkeit gefunden hatte, das Thema anzusprechen. Innerlich brannte Manuela darauf, mit ihm darüber zu sprechen, konnte es kaum noch abwarten, hatte aber auch Angst. Es bestand die Möglichkeit, dass Henry von all dem nichts hören wollte.
Manuela holte den Schnellhefter hervor, schlug ihn auf und betrachtete die Fotos. Das hatte sie in den letzten Tagen häufig getan, und jedes Mal war ihr Blick angezogen worden von der schemenhaften Gestalt im Hintergrund, die kaum noch zu erkennen war. Das Gesicht! Irgendwas stimmte mit dem Gesicht nicht. Entweder trug die Gestalt eine Maske oder sie war tatsächlich das, was man hinter vorgehaltener Hand über sie sagte: Ein Dämon.
Ein klapperndes Geräusch auf dem Gang schreckte Manuela aus ihren Gedanken. Nur einen Moment später schob sich ein merkwürdiges Gebilde vor die Milchglasscheibe der Tür, ein missgestaltetes Etwas. In einem Anfall von Panik schlug Manuela den Hefter zu und ließ ihn verschwinden.
Mit einem Scheppern flog die Tür auf.
Rückwärts zog eine Reinigungskraft ihren mit Utensilien beladenen Wagen in den Raum. Sie erschrak, als sie Manuela bemerkte.
„Jesus!“, stieß sie aus und presste sich eine Hand auf den üppigen Busen. „Ich dachte, hier wäre niemand.“
„Ich bin auch schon weg“, sagte Manuela und packte ihre Ledertasche. „Aber lassen Sie bitte die Blumen dort stehen, ja? Und die Karte auch.“
Die Reinigungskraft lächelte.
„Blumen für den Kollegen? Wie schön.“ Wie sie es sagte, hatte es etwas Anzügliches.
„Nur ein kollegiales Geschenk.“
„Na klar, Süße.“
Die Reinigungskraft zwinkerte Manuela zu, als sie sich zwischen Türrahmen und Putzwagen hindurch quetschte. Wieder war es ein anzügliches Zwinkern, aber Manuela freute sich trotzdem darüber. Sie wollte gar nicht abstreiten, dass sie sich zu Henry hingezogen fühlte, und wenn er sein eigenes Leben wieder ins Lot gerückt hatte, nun ja, wer konnte schon sagen, was passieren würde.
Diese Gedanken beflügelten sie ein wenig und trugen sie leichten Schrittes aus dem Präsidium. Für einen Moment vergaß sie sogar die Last, die sie seit Wochen mit sich herumtrug.
Auf der Fahrt vom Präsidium zur Pension Rieger, in der sie für die Übergangszeit ein günstiges Zimmer mit Frühstück und Bad auf dem Gang gemietet hatte, huschten die Bilder der Stadt an ihr vorbei. Sie sah Menschen hinter hell erleuchteten Scheiben in Bars und Restaurants. Sah sie miteinander sprechen und lachen und dachte an das kalte, stille Zimmer mit dem viel zu großen Bett, das am Ende der Fahrt auf sie wartete.
Kurzentschlossen lenkte Manuela ihren Golf auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants. Sie musste ohnehin noch etwas essen, warum sollte sie das nicht unter Menschen tun. Dabei vergaß sie zu blinken, überraschte mit ihrer spontanen Aktion einen anderen Autofahrer, der prompt auf die Hupe stieg und ein wahres Konzert lostrat. Dagegen waren die Tiraden des wütenden Fahrradfahrers, den sie beinahe aus dem Sattel holte, noch leise.
Im Restaurant war es warm, es roch nach Pommes und Fett, und die meisten Plätze waren besetzt. Sie bestellte einen großen Burger mit Pommes und eine Cola, fand einen freien Platz am Fenster und balancierte ihr Tablett an den Tisch. Inmitten fremder Menschen, die keine Notiz von ihr nahmen, fühlte Manuela sich zugehörig und auf eine beruhigende Weise beschützt. Sie hasste Einsamkeit, konnte nicht allzu lang allein sein, und Schweigen ertrug sie noch schlechter als Zahnschmerzen. Lieber arbeitete sie vierzehn Stunden am Tag, als allein vor dem Fernseher zu hocken oder die Welt über die Filter von Facebook, WhatsApp und Konsorten nur aus der Entfernung wahrzunehmen.
Das ungesunde Essen schmeckte. Manuela entspannte sich und stopfte es zufrieden in sich hinein. Nach jeder Pommes leckte sie sich Salz und Fett von den Fingern. Auf einem Flatscreen unter der Decke hopste irgendeine Popsängerin in Unterwäsche durch die Karibik. Den Ton konnte Manuela wegen der Lautstärke der Gespräche nicht hören.
Zufällig fiel ihr Blick aus dem Fenster zu ihrem Wagen, der in der zehn Meter entfernten Parkbucht neben einem riesigen gelben Pick-up parkte. Jemand, den sie in der Dunkelheit und aufgrund der Entfernung nur als schwarzen Umriss erkennen konnte, schlich zwischen den Reihen geparkter Autos hindurch. Augenscheinlich gelangweilt interessierte er sich plötzlich für ihren alten Golf. Er blieb stehen, beugte sich vor, schirmte mit einer Hand seine Augen ab und warf durch die hintere Scheibe einen Blick hinein.
Manuela erstarrte mit einem Finger im Mund.
Ihre Dienstwaffe lag im Handschuhfach. Wenn dieser Typ ihren Wagen aufbrach und die Waffe klaute, würde sie Schwierigkeiten bekommen.
Noch tat er jedoch nichts dergleichen. Stattdessen ging er um den Wagen herum. Was sollte das? Ihr alter Golf war mit Abstand der schäbigste Wagen zwischen all den anderen. Manuela seufzte und stand auf. Adieu, du schönes Abendessen. In dem Moment sprangen bei dem gelben Pick-up alle Lichter an und die Warnblinkanlage gab ein kurzes Zucken von sich. Der Besitzer hatte den Wagen per Fernbedienung entriegelt und näherte sich dem Ungetüm. Der Mann, der sich für Manuelas Golf interessierte, verschwand eilig.
In Ruhe weiteressen konnte sie dennoch nicht mehr. Manuela nahm den Burger mit hinaus und aß ihn während der Fahrt. Sie dachte über den merkwürdigen Vorfall nach. In der zur Schau gestellten Langeweile des Fremden war eine gewisse Zielstrebigkeit zu erkennen gewesen und die hatte ihn direkt zu ihrem Wagen geführt.
Zufall? Absicht?
Wie auch immer, es konnte nicht schaden, aufmerksam zu sein. Vielleicht hatte sie längst mehr losgetreten, als sie ahnte.
Manuela erreichte die ruhige Wohnstraße, in der die Pension Rieger lag, und parkte ihren Golf am Straßenrand. Zuallererst nahm sie die Waffe aus dem Handschuhfach und steckte sie ins Achselholster. Dabei bemerkte sie im Rückspiegel Scheinwerfer, die sich langsam von hinten näherten.
Aufmerksam beobachtete Manuela den heranrollenden Wagen.
Ihr Herz schlug schneller.
Der Wagen rollte einige Meter hinter ihr am Randstein aus. Die Scheinwerfer blendeten Manuela im Rückspiegel. Sollte sie aussteigen? Immerhin war sie eine bewaffnete Polizistin. Was konnte schon passieren?
Manuela tastete auf dem Beifahrersitz nach ihrem Handy. Sie hatte es dort abgelegt, aber während der Fahrt war es zur anderen Seite gerutscht. Einen Moment ließ sie dabei den Wagen aus den Augen, und als sie wieder aufsah, war er noch weiter herangerollt.
Jemand schlug gegen die Scheibe der Beifahrertür.
Manuela erschrak, das Handy flog in den Fußraum, sie griff zur Dienstwaffe.
"Frau Sperling, hallo!"
Es war ihre Vermieterin, Marianne Rieger. Die alte Dame sah sie fröhlich lächelnd an.
Manuela ließ die Scheibe herunter.
"Das Taxi hat mich von dem Rot-Kreuz-Treffen nach Hause gefahren", begann Marianne Rieger. "Warum sitzen Sie hier so allein in der Dunkelheit?"
"Ich wollte gerade aussteigen … verflucht, wo ist denn nur mein Handy?"
Sie tastete im Fußraum herum, fand das Telefon, schloss das Fenster und stieg aus. Ihr Herz schlug Kapriolen.
"Sie sehen ja aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Hab’ ich Sie erschreckt, Kindchen? Das tut mir leid, das wollte ich nicht."
Marianne Rieger kicherte mädchenhaft, und Manuela roch deutlich den Alkohol in ihrem Atem. Die alte Dame wankte sogar ein wenig.
"Wir haben Jubiläum gefeiert", erklärte sie. "Ich bin seit fünfundzwanzig Jahren ehrenamtlich tätig. Sie wissen schon, bei den Blutspenden Essen zubereiten und so."
"Herzlichen Glückwunsch", sagte Manuela. "Wie es aussieht, war das ja eine prächtige Party. Kommen Sie, haken Sie sich ein, nicht das Sie noch stürzen."
Frau Rieger nahm das Angebot an und ließ sich von Manuela stützen.
Sie rülpste leise.
"Oh je, oh je, Entschuldigung, ich vertrage Sekt eigentlich nicht, aber heute musste es einfach sein."
Manuela mochte die alte Dame, die vor vielen Jahren ihren Mann verloren hatte und sich dennoch nicht zurückzog, sondern lebte. Ihre drei Söhne waren über die ganze Bundesrepublik verteilt und besuchten sie so gut wie nie, aber die alte Dame machte das Beste aus den vielen leer stehenden Zimmern in ihrem Haus. Sie vermietete sie an Monteure, Handlungsreisende und eben an Manuela, die eigentlich nur ein paar Wochen hatte bleiben wollen. Jetzt war es bereits ein halbes Jahr und sie hatte sich noch immer nicht nach einer Wohnung umgesehen. Man musste kein Psychologe sein um zu wissen, warum. Manuela hatte sich noch nicht entschieden, ob sie wirklich auf Dauer hierbleiben wollte. Irgendwie hing alles von Henry ab, und der ließ auf sich warten.
"Und Sie, Kindchen?", fragte Frau Rieger. „Haben Sie auch gefeiert?"
"Nein, ich habe gearbeitet."
"Ach, immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sie sind jung, Sie müssen feiern. Und vor allem brauchen Sie einen Mann. Sie sehen doch ganz passabel aus, das muss doch klappen. Einsamkeit tut niemanden gut."
"Ich bin nicht einsam", verteidigte Manuela sich. Dabei klang sie wie jemand, der eine Wahrheit verleugnete, die längst im Herzen angekommen war.
Frau Rieger stocherte mit dem Haustürschlüssel in der Dunkelheit herum und traf immer wieder daneben.
"Kommen Sie, ich mach das." Manuela nahm ihr den Schlüssel ab und schloss auf.
"Danke, Kindchen … und jetzt trinken wir beiden Hübschen noch einen Sherry zusammen. Keine Widerrede. So jung kommen wir nie wieder zusammen.
Und wer weiß, wie lange wir noch leben."
Am nächsten Tag machte sich Manuela Sperling mit Verspätung auf den Weg nach Gotenburg um an der Einsatzbesprechung teilzunehmen. Über Nacht war der angekündigte Sturm hereingezogen, der zunächst frühlingshaft warme Temperaturen bringen sollte, bevor auf seiner Rückseite der Winter noch einmal Einzug hielt. Heftige Windböen zerrten am Wagen, und als Manuela in ein Waldgebiet fuhr, behielt sie argwöhnisch die hohen Fichten im Auge – sie bogen sich bedenklich.
Manuela brummte der Schädel. Aus einem Glas Sherry waren gestern Abend vier geworden, sie hatte zuvor noch nie Sherry getrunken und wusste erst jetzt, wie schlecht sie ihn vertrug. Sie war kaum aus dem Bett gekommen und hatte sich selbst nach der Dusche noch gefühlt, als bekäme sie eine Grippe. Marianne Rieger hingegen war in der Früh beim Frühstück hellwach und fröhlich gewesen. Mit einem Liedchen auf den Lippen hatte sie Kaffee, Brötchen und Marmelade serviert. Manuela hatte sich an diesen Frühstücksservice gewöhnt, er war ein unschätzbarer Vorteil ihrer derzeitigen Wohnsituation, und sie würde ihn vermissen, sollte sie sich eine eigene Wohnung suchen.
Sie war allein im Frühstücksraum gewesen, die zwei Monteure, die zur Zeit die anderen Zimmer der Pension bewohnten, waren längst aufgebrochen. So hatte Manuela in Ruhe und ohne die Schmatz- und Schlürfgeräusche anderer nachdenken können. Die Sache gestern Abend vor dem Schnellrestaurant ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Möglicherweise hatte sie mit ihrer Schnüffelei Leute aufgeschreckt, mit denen sie allein nicht fertig werden würde. Auch wenn sie ihn nicht gleich am ersten Tag damit belasten wollte, würde sie Henry heute darauf ansprechen.
Ihr Start war zwar ein wenig holperig gewesen, sie hatten die eine oder andere Auseinandersetzung gehabt, waren letztlich aber doch ganz gut miteinander ausgekommen, hatten sich sogar gegenseitig befeuert und damit die Ermittlungen im Darkowiak-Fall vorangebracht. Manuela rechnete es Henry hoch an, dass er damals ihrem Instinkt vertraut hatte. Mitunter benahm er sich zwar wie ein Arschloch, konnte richtig gemein sein und jedes Wort, das Manuela sagte, auf die Goldwaage legen, aber sie mochte seinen trockenen, zynischen Humor, seine ruhige, besonnene Art und vor allem seine Augen. Immer wieder verunsicherte er sie mit seinem intensiven Blick. Sie verstand ihn besser, seitdem sie vom Tod seiner Frau erfahren hatte. So ein Trauma durfte natürlich keine Ausrede für dauerhaft schlechtes Benehmen sein, aber es erklärte es ein Stück weit.
Manuela drosselte das Tempo und lenkte ihren VW Golf durch eine scharfe Linkskurve. Die dicken Stämme der Fichten und Lärchen standen gefährlich nahe am Straßenrand. Der Sturm wehte gelblich verfärbte Nadeln auf den Asphalt, zusammen mit der Feuchtigkeit des letzten Regenschauers ergaben sie einen schmierigen Belag.
Als sie durch die Kurve war, sah Manuela gelbe Blinklichter.
In vielleicht hundert Metern Entfernung stand ein PKW schräg am Fahrbahnrand. Er blockierte die halbe Straße. Die Vorderräder befanden sich bereits auf dem Bankett, die Hinterräder noch auf dem Asphalt. Die Motorhaube war geöffnet, eine Person beugte sich über den Motor.
„Wie kann man so halten?“, schimpfte Manuela laut, bremste, schaltete ebenfalls das Warnblinklicht ein und brachte den Golf wenige Meter hinter dem havarierten Wagen zum Stehen. Sie stieß die Tür auf und stieg aus. Sofort zerzauste der Wind ihr Haar.
„Kann ich helfen?“, rief sie.
Die Person kam hinter der Motorhaube hervor. Ein mittelgroßer, rundlicher Mann mit Halbglatze und verzweifeltem Gesichtsausdruck.
„Er will nicht mehr“, antwortete er, warf die Hände hoch und ließ sie wieder sinken. „Er war doch gerade erst in der Werkstatt, ich verstehe das nicht.“
Bei dem Wagen handelte es sich um einen uralten Skoda Oktavia. An den Kanten der Radkästen nagte der Rost. Die Reifen waren abgefahren. Streng genommen durfte die Kiste schon allein deswegen nicht mehr bewegt werden.
„Das ist aber gefährlich, wie Sie hier auf der Straße stehen“, sagte Manuela. „Wenn man aus der Kurve kommt, kann man gerade noch bremsen.“
Der Mann sah sie verständnislos an.
„Wenn ich nicht pünktlich bin, verliere ich meinen Job“, sagte er und sah dabei aus wie ein getretener Hund.
„Was hat er denn?“, fragte Manuela und warf einen Blick in den Motorraum. Sie hatte keine Ahnung von Motoren, aber das war bei den meisten Männern nicht anders, und die warfen auch alle erst einmal einen fachmännischen Blick unter die Haube.
„Ich weiß nicht, ist einfach ausgegangen.“
Der Mann roch unangenehm. Eine Mischung aus Schweiß und billigem Deo. Seine Kleidung war nicht besonders sauber.
„Ich kann Sie mitnehmen“, bot Manuela an, hoffte aber gleichzeitig, er würde ihr Angebot ablehnen.
„Wirklich? Das ist nett, aber ich würde es gern noch einmal versuchen. Würden Sie sich reinsetzen und die Zündung betätigen, während ich am Vergaser drehe?“
„Klar, kein Problem.“
Manuela stieg in den Skoda. Darin roch es noch schlimmer. Der Aschenbecher quoll über, leere Süßigkeitenverpackungen lagen herum, am Spiegel baumelte ein hoffnungslos überfordertes Duftbäumchen mit längst verpufftem Vanillearoma.
„Jetzt“, rief der Mann.
Sie betätigte die Zündung. Irgendwas schnarrte mechanisch, aber der Motor sprang nicht an.
„Noch einmal.“
Das Ergebnis war dasselbe.
Genervt warf Manuela einen Blick in den Rückspiegel – und traute ihren Augen nicht.
Sie sprang aus dem Skoda.
„Hey, was machen Sie da!“
Die linke hintere Tür ihres Golfs war geöffnet, jemand beugte sich in den Wagen. Als er Manuela hörte, kam er daraus hervor und richtete sich auf. Hinter ihr wurde die Motorhaube zugeschlagen. Manuela fuhr herum. Der Dicke sah jetzt keineswegs mehr verzweifelt aus. Die beiden Männer nährten sich ihr von rechts und links und nahmen sie in die Zange.
Der zweite Mann war deutlich größer. Er hatte breite Schultern und einen betont selbstbewussten Gang. Er trug Jeans, braune Stiefel und eine enge, braune Lederjacke. Sein Haar war voll und schwarz. Ein gut aussehender Typ mit schmierigem Lächeln.
Den Griff zur Waffe konnte Manuela sich sparen – die lag im Handschuhfach, wie immer. Es war einfach zu unbequem, sie beim Fahren zu tragen.
„Was soll das?“, fragte sie in scharfem Tonfall. „Ich bin Polizistin und würde Ihnen raten ....“
„Wissen wir doch, Süße, brauchst deswegen nicht so einen Aufriss machen.“
Das war eine Falle, die Typen hatten ihr absichtlich aufgelauert. Manuela wog ihre Chancen ab. Rechts und links die Angreifer, im Rücken der Skoda blieb ihr nur die Flucht geradeaus in den Wald hinein. Aber schon nach wenigen Metern begann dichtes Unterholz, zudem bog der Sturm die langen Stämme der Fichten hin und her.
Sie winkelte die Arme in hüfthohe an, die Handflächen nach außen. Es war wichtig zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet war.
„Können Sie mir sagen, was das soll?“
Jetzt waren die Männer soweit heran, dass ihr praktisch jeder Fluchtweg abgeschnitten war.
„Wir sind auf der Suche“, sagte der Große. „Und ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du hast, was wir suchen.“
„Ich verstehe nicht ... was soll ich haben? Hören Sie, ich helfe Ihnen gern, es ist nicht notwendig, Gewalt anzuwenden.“
„Wer sagt denn etwas von Gewalt? Sehen wir etwa so aus, als wären wir gewalttätig?“
Der kleine Dicke stieß ein schepperndes Lachen aus. Sein Bauch hüpfte auf und ab.
„Süße, du gibst uns einfach, was wir wollen, dann passiert auch niemandem etwas. Es sei denn, mein Freund hier hat Lust auf eine schnelle Nummer auf deinem Rücksitz.“
Wieder lachte der Dicke.
„Apropos Rücksitz. Macht es dir etwas aus, uns zu zeigen, was du hinten im Wagen hast?“
Manuela sah von einem zum anderen. Sie hatte keine Ahnung, was die beiden von ihr wollten.
„Da ist nichts, aber wenn Sie wollen, schauen Sie nach.“
„Na klar machen wir das, Süße, deswegen sind wir ja hier. Mein Freund hier passt auf dich auf und ich sehe noch einmal nach. Du hast mich ja leider unterbrochen.“
Der Dicke zog ein Messer hervor und ließ es mit einem metallenen Geräusch aufschnappen. Automatisch wurde Manuelas Blick von der mehr als zehn Zentimeter langen Klinge angezogen.
„Aber reiz ihn nicht, er ist so schnell erregbar“, sagte der Gutaussehende, lächelte, wandte sich ab und ging zu ihrem Wagen zurück.
Manuela behielt den Dicken mit seinem Messer im Blickfeld. Hinter ihr wurde zuerst eine Tür zugeworfen und dann die Kofferraumklappe geöffnet. Es klapperte und schepperte, und ihr fiel ein, dass sie noch immer ihren halben Hausstand im Kofferraum mit sich herumfuhr.
„Scheiße!“, rief der Gutaussehende. „Wo sind sie?“
Er kam mit schnellen Schritten zurück, baute sich vor ihr auf und zeigte drohend mit dem Finger auf Manuela.
„Du sagst mir auf der Stelle, wo sie sind.“
„Ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden.“
Der Schlag kam schnell, sie sah ihn kaum. Die flache Hand klatschte ihr ins Gesicht, ihr Kopf flog herum, sie stolperte nach hinten gegen den Oktavia und auf ihrer linken Gesichtshälfte brannte Schmerz. Tränen schossen ihr in die Augen. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch keine Backpfeife bekommen, nicht einmal von ihrem Vater.
„Verarsch mich nicht, sonst werde ich wirklich sauer.“ Das freundliche Lächeln des Gutaussehenden war verschwunden, und plötzlich sah er auch gar nicht mehr so gut aus.
„Los, schlitz sie auf!“, sagte er.
Das war Manuelas Startsignal!
Da keiner der beiden mit einem Angriff rechnete, hatte sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Der Gutaussehende stand vor ihr, sozusagen in perfekter Position. Manuela holte aus und trat ihm zwischen die Beine. Sie hatte keine Zeit, sich mit dessen Reaktion zu beschäftigen, denn der Dicke kam mit dem Messer seitlich heran. Manuela ließ sich fallen, der Hieb mit dem Messer ging über sie hinweg. Sie trat dem Dicken gegen das Schienbein und sprang dann gegen den Gutaussehenden, der vor ihr kniete und sich die Hoden hielt. Sie prallte gegen ihn, trat sich von ihm los und lief.
„Hey!“, rief der Dicke hinter ihr. Es klang, als sei sie eine Spielverderberin.
Manuela flüchtete über die Straße in den Wald hinein. Der Boden war dort weich und voller Fallen. Von oben fielen dünne Zweige und Nadeln auf sie herab. Manuela sprang über ein paar Äste hinweg, schlug Haken zwischen den Bäumen und zwang sich, sich nicht umzudrehen. Ihr Vorsprung war dafür nicht groß genug.
Sie verfluchte sich dafür, die Dienstwaffe im Handschuhfach deponiert zu haben.
In der Innentasche ihrer Jacke steckte ihr Handy. Sie konnte aber nicht gleichzeitig durch den Wald rennen, Hindernissen ausweichen und telefonieren. Erst musste sie von diesen beiden Typen fortkommen. Vielleicht würde sie irgendwo ein sicheres Versteck finden.
Bereits nach wenigen Metern wurde das Unterholz dichter, das Licht diffuser, die Hindernisse zahlreicher. Manuela drosselte das Tempo. Um sie herum toste der Sturm. Das Rauschen in den Wipfeln war zu laut, sie konnte nicht hören, ob die beiden ihr folgten. Obwohl sie wusste, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, blieb sie stehen und sah sich um.
Den Schuss hörte sie kaum, spürte aber das Projektil irgendwo in ihrer Nähe vorbei zischen und sah die Rinde eines Baumes neben sich abplatzen.
Manuela schrie auf und lief weiter.
Sie hatte nicht gesehen, wer von den beiden geschossen hatte, aber wenn es kein Versehen gewesen war, hatte er auf ihren Kopf gezielt.
Manuelas Herz raste, ihre Atmung überschlug sich beinahe.
Bleib ruhig, bleib ruhig ...
Aus vollem Lauf stieß sie mit der Schulter gegen einen Baum, taumelte nach links, streifte einen weiteren Stamm, schrie auf und ging zu Boden. Etwas stach ihr schmerzhaft in die linke Handfläche, mit der sie sich am Boden abstützte.
„Nein ... weiter ...“, stieß sie aus, krabbelte vorwärts und versuchte gleichzeitig auf die Beine zu kommen. Am nächsten Stamm zog sie sich empor, warf einen schnellen Blick zurück, meinte, den Dicken durch den Wald stapfen zu sehen und rannte weiter.
Sie war allein, niemand würde ihr helfen. Ihre einzige Chance war, schneller zu sein als die beiden. Manuela war eine ausdauernde, trainierte Läuferin, sie konnte es schaffen. Sie durfte nur nicht panisch werden.
Lauf etwas langsamer, dafür aber ruhig und konzentriert. Schlag Haken, damit sie dich nicht treffen.
Die guten Ratschläge brachten die Konzentration zurück, die Panik legte sich. Manuela konzentrierte sich auf die jeweils nächsten Meter, sprang über Äste und umgestürzte Stämme und wich Bäumen aus. In ihrem Nacken kribbelte es, jeden Moment erwartete sie den Einschlag einer Kugel in ihrem Rücken.
Je länger sie lief, desto einfacher wurde es. Sie fand einen Weg durch das Unterholz, vielleicht einen Wildwechsel, vielleicht existierte er auch nur in ihrem Kopf, egal, wichtig war nur, dass sie nicht wieder stürzte. Sie würde einfach immer weiter laufen, egal wohin. Irgendwann würden die beiden aufgeben, dann konnte sie Hilfe rufen.
Sie würde nicht in diesem verdammten Wald sterben!
Den Gedanken kaum zu Ende gedacht, krachte es über ihr, als habe der Blitz eingeschlagen.
Unablässig surrten die Reifen über Asphalt. Die Luft in dem Kleinbus war stickig von den Ausdünstungen der Insassen. Es roch nach Schweiß und Angst.
Zusammen mit Elizaveta Radu befanden sich drei weitere Mädchen in dem Kleinbus. Die platinblonde Greta, mit der Elizaveta die vergangenen sechs Wochen zusammen in dem Club gearbeitet hatte, sowie Natascha und Vanessa, die sie noch aus der Zeit im Rotfuchs kannte.
Greta war etwas naiv, offenherzig und redselig. Sie hatte kurzes Haar und eine Schulmädchenfigur mit kleinem Hintern und kleinen Brüsten. Sie war nicht schön, aber niedlich und hatte jede Menge Stammkunden. Greta sagte Sätze wie: „Mit dem war es gar nicht so schlecht“, „Der war echt süß“ oder „Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er mich heiratet“.
Elizaveta vermutete, dass Greta wirklich noch daran glaubte, jemand würde sie aus dieser Lage heraus heiraten. Dieses Pretty-Woman-Märchen, von dem alle Mädchen träumten. Sie selbst hatte diese Hoffnung längst aufgegeben. Es war nicht so, dass sie nicht auch gern träumte, und anfangs hatte sie oft von einem edlen Ritter geträumt, aber dann hatte sie die Art von Männern kennen gelernt, die Geld dafür bezahlten, um mit Frauen Sex zu haben – oder besser, um ihre Abartigkeiten ausleben zu können. Keiner von denen war auch nur im Ansatz edel. Die wollten ficken, manchmal quälen und ficken, aber vor allem wollten sie danach aufstehen, weggehen und nichts mehr zu tun haben mit dem Menschen, der zu dem Körper gehörte, den sie gerade benutzt hatten.
Greta war eingeschlafen, ihr Kopf ruhte an Elizavetas Schulter. Manchmal zuckte sie leicht, ansonsten schlief sie aber schon eine Weile tief und fest. Das wunderte Elizaveta, da sie seit zwei Tagen Gretas kleines Geheimnis kannte. Wie konnte sie so ruhig sein? Fragte sie sich nicht, was der hektische Aufbruch mitten in der Nacht zu bedeuten hatte?
Da der Scout ihnen zu Beginn der Fahrt das Sprechen verboten hatte, und alle sich daran hielten, hatte Elizaveta viel Zeit zum Nachdenken. Diese Fahrt, das seltsame Video, dass der grauenhaft geschminkte Mann von ihr gemacht hatte - irgendwas Merkwürdiges passierte hier, und sie ahnte, dass es für sie alle nicht gut ausgehen würde. Immer wieder wurde sie deswegen wehmütig und versank in Erinnerungen.
Die alten Leute in dem Heim fehlten ihr. Sie sehnte sich zurück nach dem geordneten Tagesablauf, nach der friedlichen Ruhe und der ehrlichen Arbeit. Dort hatte niemand sie gezwungen, einen anderen Namen anzunehmen. Dort durfte sie Elizaveta sein. Das war der Name, den ihre Eltern ihr gegeben hatten, der Name, mit dem sie aufgewachsen war. Ihre Oma hatte sie stets nur Eliza genannt, und sie hatte den Klang geliebt. Ein anhebender, fröhlicher Klang, der zu blauem Himmel und Sonnenschein passte. Es war der Name ihrer Kleinmädchenvergangenheit.
Als Nutte hieß sie Susanna. Mama Gardiola, die auf dem Beifahrersitz saß und sie begleitete, hatte ihn für sie ausgesucht, weil er angeblich erhaben und geheimnisvoll klang. Genau so, wie die Männer es sich wünschten. Mama Gardiola wusste genau, was Männer wollten. Das fing bei der Farbe der Fingernägel an und ging über die Unterwäsche bis hin zum Namen. Dazwischen gab es hunderte Nuancen, über die Mama Gardiola sich Gedanken machte. Einmal hatte sie einen ganzen Tag lang mit den Mädchen das Stöhnen geübt. Perfekt vortäuschen zu können, dass es ihnen gefiel, was ein Mann mit ihnen machte, und sei der Typ noch so fett, hässlich oder pervers, war laut Mama Gardiola das wichtigste Rüstzeug. Die Männer sollten vergessen, dass sie für den Sex bezahlten, sie sollten denken und fühlen, es geschehe um ihrer selbst willen. Elizaveta war noch immer nicht gut darin. Sie klang mechanisch und bewegte sich ebenso. Mama Gardiola hatte ihr schon angedroht, sie abermals trainieren zu lassen.
Geld verdienen hatte für Mamaola, wie Mama Gardiola von den Mädchen kurz genannt wurde, oberste Priorität. Sie machte sich ständig über allerlei Dinge Sorgen. Sie betete oft, denn sie fürchtete sich vor der Apokalypse und der ewigen Wiederkehr nach ihrem Tod, aber wenn ein Mädchen nichts einbrachte, das stand über allem.
Elizaveta hatte große Angst davor, wieder trainiert zu werden.
Fuhr der Scout sie zu einem der berüchtigten Trainingslager?
Niemand hatte gesagt, wohin die Reise ging. Solche überstürzten Ausflüge waren nicht ungewöhnlich. Oft wurden in anderen Clubs kurzfristig Frauen gebraucht, und dann wurden sie eben durch Nacht und Nebel kutschiert. Aber das waren immer kurze Fahrten, höchstens eine Stunde.
Sie bogen von einer asphaltierten Landstraße auf einen Schotterweg ab. Nach den ersten Schlaglöchern erwachte Greta. Sie blinzelte, wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und richtete sich auf.
„Wo sind wir?“
„Psst“, machte Elizaveta. Ein schneller Blick zum Innenspiegel. Der Scout hatte sie gehört und erwiderte ihren Blick.
Er hatte blaue Augen, traurige blaue Augen. Sie schienen immer ein wenig feucht zu sein, so als habe er vor kurzem geweint, und wenn er sich unbeobachtet fühlte, war sein Blick in die Ferne gerichtet, als würde er etwas suchen. Außerdem waren seine Augen blutunterlaufen, was wahrscheinlich von Drogen herrührte.
Er hatte ein schmales Gesicht mit eng anliegenden kleinen Ohren. Nur Menschen mit großen Ohren werden alt, hatte Elizavetas Oma oft gesagt, deshalb war dem Scout sicher kein langes Leben beschert. Sein Haar war braun und dicht, aber mit Geheimratsecken, die sich weit auf den Kopf hinaufzogen. Er trug einen gepflegten Vollbart, der am Kinn grau zu werden begann. Seine Lippen waren schmal. Eigentlich hatte er ein hübsches Gesicht, fand Elizaveta. Wenn da nicht die Augen gewesen wären.
Der Scout bog von dem breiten Schotterweg auf einen schmaleren ab. Der war sogar noch schlechter. Er versuchte nicht mehr, den Schlaglöchern auszuweichen, sondern fuhr in Schrittgeschwindigkeit einfach hindurch. Elizavetas Zähne schlugen aufeinander. Greta hielt sich an ihr fest und sie sich an ihr. Es war ein gutes Gefühl, jemanden in der Nähe zu haben, selbst wenn es nur die naive Greta war.
Bald konnten sie eine Fabrik sehen. Eine riesige Halle aus Blech und mehrere kleine Gebäude. Der Bus rollte durch ein offen stehendes Tor. Dahinter lag ein großer Hof. Wie kleine Inseln ragte dunkler Schotter zwischen großen Pfützen auf. Elizaveta sah Sand- und Schotterberge auf der linken Seite, darüber so etwas wie Förderbänder, von denen schwarze Lappen wie nekrotische Zungen herabhingen. Sie sah mehrere Kipper, alles war alt und verrostet und sicher schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Am backsteinernen Giebel des großen Gebäudes in der Mitte hing schief ein verwittertes Schild. Mehr als das Wort „Ziegelei“ konnte Elizaveta nicht entziffern.
Der Bus hielt. Die Köpfe der Mädchen zuckten wie die nervöser Hühner. Alle waren aufgeregt, trotzdem fiel kein einziges Wort.
Mamaola, die vorn neben dem Scout saß, drehte sich zu ihnen um. Sie hatte Schweißflecke unter den Achseln.
„Ihr bleibt solange sitzen, bis der Scout sagt, ihr dürft aussteigen.“
Der hockte reglos auf dem Fahrersitz. Den Blick starr geradeaus gerichtet beobachtet er den Hof und das Gebäude.
Durch einen schmalen Spalt zwischen Sitz und Fenster konnte Elizaveta seinem Blick folgen. Sie sah, wie die Tür unter dem verwitterten Ziegeleischild aufging. Ein alter Mann trat heraus. Er war klein und kräftig, hatte eine Glatze und trug eine wattierte, hüftkurze Jacke, Jeans und schwarze Stiefel. An einer kurzen Leine führte er einen Schäferhund. Der Hund stemmte sich in die Leine, seine Rute stand ebenso aufrecht wie die Ohren.
Der Mann hob kurz die Hand zu einem vagen Gruß.
Der Scout blieb reglos sitzen, so als ginge ihn das alles nichts an. Über den Innenspiegel konnte Elizaveta sehen, wie dessen Blick aus schmalen Augen von links nach rechts und wieder zurück über den Hof schwenkte. Schließlich nahm er etwas aus dem seitlichen Ablagefach der Tür, steckte es unter seine Jacke und stieg aus.
Man hätte meinen können, sobald er aus dem Bus war, ginge das Getuschel los, doch es blieb still, beinahe so, als hielten alle den Atem an. Elizaveta krampfte ihre Hand um Gretas.
Der Scout traf sich mit dem kahlköpfigen Mann auf halber Strecke zwischen Bus und Haus. Der Hund schnüffelte, verhielt sich aber ansonsten ruhig. Die beiden Männer wechselten ein paar Worte miteinander.
„Mir ist schlecht von dieser Buckelpiste“, sagte Greta plötzlich
Alle Köpfe flogen in ihre Richtung.
„Ihr sollt still sein“, fauchte Mamaola. „Wenn ihr nicht pariert, wird das ein ganz beschissener Tag für uns alle.“
Mamaola konnte nett sein, wenn sie wollte, und es hatte schon Tage gegeben, da hatte Elizaveta sich an ihrer Schulter ausweinen dürfen. Aber sie hatte zwei Seiten. Die andere Seite war kalt, berechnend und ohne Mitgefühl. Die andere Seite hatte ihre eigene Stimme, so wie jetzt. Es war eher ein Zischen als Sprechen.
Elizaveta legte Greta einen Finger auf die Lippen und schüttelte den Kopf. Greta war blass und hatte dunkle Ringe unter den Augen. Sie sah wirklich nicht gut aus.
Der Scout drehte sich zum Wagen um und gab Mamaola ein Zeichen. Sofort stieg sie aus dem Bus auf und öffnete die hintere Schiebetür.
„Na los, Mädchen, aussteigen. Los, los!“
Zuerst stiegen die beiden Mädchen von der vorderen Bank aus, dann wurde ein Sitz umgeklappt und Greta und Elizaveta konnten von der hinteren Bank krabbeln. Elizaveta spürte, wie unbeweglich ihre Muskeln nach der langen Fahrt waren. Sie sprang aus dem Bus, bemühte sich dabei, nicht in eine Pfütze zu treten, und sah auf.
Vor ihr ragte ein gewaltiger Schornstein in den Himmel.
Blinzelnd öffnete Manuela die Augen. Warmes Blut lief ihr übers Gesicht. Sie lag flach am Boden, um sie herum nur Äste und Nadeln. Schwerfällig begriff sie, was geschehen war. Eine vom Sturm abgebrochene Baumkrone war heruntergestürzt und hatte sie unter sich begraben. Allzu lange konnte sie jedoch nicht bewusstlos gewesen sein, sonst wären ihre Verfolger längst da.
Manuela versuchte, sich mit beiden Armen hochzudrücken, doch gleißender Schmerz schoss von ihrem linken Unterarm ausgehend durch den ganzen Körper. Sie schrie auf, sackte zusammen und sah Sterne.
Nein, nicht wieder bewusstlos werden, komm, reiß dich zusammen, wenn du überleben willst, dann reiß dich gefälligst zusammen!
Vorsichtig richtete sie sich auf. Die Äste in ihrem Rücken ließen ihr nur wenige Zentimeter Spielraum. Manuela schob sich zwischen den Ästen hindurch nach vorn, ihr linker Arm tat bei jeder noch so kleinen Bewegung höllisch weh. Es fühlte sich an, als würden da drinnen die beiden Enden des gebrochenen Knochens aneinander reiben. Die Schmerzen trieben ihr den Schweiß aus allen Poren. Sie biss die Zähne zusammen und kämpfte. Blut lief ihr über die linke Gesichtshälfte, sodass sie nur mit dem rechten Auge etwas sehen konnte.
Irgendwie schaffte sie es, dem Wirrwarr aus Ästen und Nadeln zu entkommen. Als sie schon glaubte, sich befreit zu haben, blieb sie mit den Schürsenkeln des rechten Schuhs irgendwo hängen. Manuela zog und riss und plötzlich war sie frei. Leider blieb ihr Schuh im Geäst hängen.
Sie ließ ihn dort, robbte auf dem Bauch ein paar Meter von der abgebrochenen Baumkrone fort und sah zurück. Aus dieser Position wirkte sie gewaltig. Einige der dicken Äste staken im Waldboden, darunter war ein Hohlraum von vielleicht zwanzig Zentimeter Höhe - ohne diesen Hohlraum wäre sie von der Krone erschlagen worden. Sie hatte einmal mehr Glück im Unglück gehabt, aber die Gefahr war noch nicht vorüber.
Die beiden Typen folgten ihr sicher noch. Manuela hatte ihre Gesichter gesehen, sie konnten es sich nicht leisten, sie entkommen lassen.
Manuela presste sich den gebrochenen linken Arm angewinkelt gegen den Bauch und kam mühsam auf die Beine. Mit dem Handrücken der rechten Hand wischte sie sich das Blut aus dem Auge.
Wohin?
Der Wald sah in alle Richtungen gleich aus.
Egal. Es war nur wichtig, ein Versteck zu finden. Von dort aus würde sie Henry oder Jens anrufen, aber dafür musste sie sich erst einmal vor den beiden Angreifern in Sicherheit bringen.
Manuela wollte laufen, doch es war kaum mehr als ein Stolpern. Die Muskulatur in ihren Beinen fühlte sich weich an, wie Wackelpudding. Nach ein paar Schritten wurde es etwas besser, aber wirklich schnell kam sie nicht voran. Ihr Kopf fühlte sich merkwürdig betäubt an, so als hätte sie zu viel getrunken. Die Ränder ihres Sichtfelds waren unscharf, irgendwie ausgefranst, zudem zuckten heftige Stiche hinter ihrer Stirn, die gleichzeitig Blitze über ihre Pupillen warfen.
Manuela versuchte, das alles zu ignorieren und stolperte weiter. Auf den ersten zwanzig Metern musste sie sich an beinahe jedem Baum abstützen. Sie kam nur langsam voran. Die Richtung war ihr egal, nur weg. Tief im Wald war das Unterholz dicht und es war schummrig, ihre Verfolger konnten genauso schlecht sehen wie sie. Wenn sie sich leise bewegte, hatte sie eine Chance.
Allerdings spürte Manuela, dass ihre Kraft nicht weit reichen würde.
Ein Versteck, sie musste ein sicheres Versteck finden.
Elf Uhr Dreißig.
Henry Conroy warf einen Blick über den Parkplatz. Vom Sturm getriebenes Laub tanzte über die Dächer und Motorhauben der Fahrzeuge. Auf der gegenüberliegenden Seite beugte sich halbhoher Silbereschen-Ahorn den böigen Angriffen, weiß gerändertes Laub blitzte auf wie das Licht hunderter schwacher Taschenlampen. So einen starken Februarsturm hatte die Region lange nicht mehr erlebt, vor allem nicht mit so milden Temperaturen. Viele Straßen waren wegen umgestürzter Bäume gesperrt, die meisten Bahnverbindungen unterbrochen. Ab morgen, so hieß es, kehre der Winter zurück. Die Temperatur würde über Nacht von zehn Grad plus auf drei Grad minus fallen.
Henry wartete auf Manuela.
Pünktlichkeit war nicht ihre Stärke, oder besser, sie kam oft auf die letzte Minute und dann in großer Eile, aber nach dem Überraschungsgeschenk auf seinem Schreibtisch war Henry davon ausgegangen, dass Manuela rechtzeitig vor der Dienstbesprechung hier sein würde, um ein paar private Worte mit ihm zu wechseln, bevor der Berufsalltag sie wieder völlig vereinnahmte. Über die Blumen und die Karte auf seinem Schreibtisch hatte Henry sich wirklich gefreut. Besonders die Worte, die Manuela in die Karte mit dem großen Smiley auf der Vorderseite geschrieben hatte, hatten Henry berührt.
Der Arsch der Welt hat zumindest zwei Backen, und wenn eine fehlt, ist alles Scheiße.
Henry wusste, wie Manuela über Gotenburg, das nahe an der tschechischen Grenze lag, dachte. Für sie war es der Arsch der Welt, und genau genommen passte ein so quirliger Mensch wie Manuela hier nicht her. Gotenburg war eine Stadt für Menschen mit großem Ruhebedürfnis. Sie war ja auch nicht freiwillig hierher gekommen, sondern nach dem Wassermann-Fall mehr oder weniger strafversetzt worden. Und trotz anfänglicher Schwierigkeiten hatten sie sich zusammengerauft und den Darkowiak-Fall gemeinsam gelöst. Nein, das stimmte nicht ganz; eigentlich war es Manuelas Verdienst gewesen. Henry verdankte ihr viel, und er fühlte sich zu ihr hingezogen. Deswegen hatte ihn die Bemerkung mit den beiden Backen berührt – auch wenn es natürlich wenig schmeichelhaft ausgedrückt war. Aber er kannte ihre freche Art ja schon.
Ein Auto rollte auf den hinteren Parkplatz der Dienststelle, der für Mitarbeiter reserviert war. Es war aber nicht Manuela Sperling, sondern sein Partner Jens Jagoda. Er sah aus wie immer. Solariumbraun, energiegeladen, merkwürdig. Jagoda war kaum größer als Eins Siebzig, aber Dank seines Krafttrainings beinahe genauso breit. Sein eigenwilliger Kleidungsstil – er steckte seine Poloshirts in den Hosenbund – ließ ihn zudem noch gedrungener wirken. Er hatte eine Glatze und ein Gorillalächeln – zumindest hatte Manuela es so genannt.
Henry ging ihm entgegen.
„Hey, da ist er ja, der alte Kämpfer. Braungebrannt und ausgeruht.“
Sie umarmten sich, und für Henrys Geschmack dauerte das Schulterklopfen einen Moment zu lange. Hatte Jagoda ihn etwa wirklich vermisst?
„Du siehst tatsächlich um Jahre jünger aus“, sagte Jagoda, nachdem sie sich voneinander getrennt hatten. „Dabei hast du immer behauptet, Urlaub würde dich stressen.“
„Tja, so kann man sich täuschen. Aber ich bin auch froh, jetzt endlich wieder arbeiten zu dürfen. Was liegt denn an?“
Jens zuckte mit den Schultern. „Der übliche Kleinkram, du kennst das ja. Manuela sagte gestern noch, sie würde bald einen öffentlichen Aufruf starten, damit irgendein Arsch ein aufregendes Verbrechen begeht.“
„Klingt ganz nach ihr. Wo ist sie eigentlich?“
„Die müsste doch eigentlich schon hier sein. Zu mir hat sie gesagt, sie wolle dich mit Pauken und Trompeten empfangen.“
„Na ja, zumindest hatte ich Blumen im Büro, und ich denke, die sind nicht von dir.“
„Worauf du wetten kannst. Soweit sind wir noch nicht.“
Henrys Mobiltelefon klingelte.
Er holte es rasch hervor und warf einen Blick aufs Display.
Manuela krallte ihre Hände in den nassen Waldboden, suchte nach Halt, nach einer Wurzel, irgendwas. Das Gelände war steil, sie kam nur noch auf allen Vieren voran. Ihr Herz wummerte in der Brust, ihr gebrochener linker Unterarm schmerzte bei jedem Schritt. Schweiß, vermischt mit Blut, lief ihr von der Stirn, immer wieder musste sie ihn sich aus den Augen wischen.
Sie fand eine aus dem Boden ragende Wurzel, wollte sich daran ein Stück emporziehen, doch ihre Arme begannen zu zittern, ihr Griff ließ nach, sie sank zu Boden.
Sie konnte nicht mehr, ihre Kraft war aufgebraucht. Seitdem die herabstürzende Baumkrone sie getroffen hatte, war sie mindestens eine weitere halbe Stunde durch den Wald gehetzt - eine Zeitspanne, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam. Der gebrochene Arm behinderte sie, schlimmer noch war aber ihr Kopf. Sie konnte kaum einen klaren Gedanken fassen, zudem war ihr schwindelig und immer wieder wurde ihr übel. Dann musste sie Pausen einlegen, so wie jetzt. Über das Pochen ihres Herzens und das Rauschen des Blutes in ihren Ohren hinweg lauschte sie nach den Geräuschen ihrer Verfolger.
Leider war der Wald voller Geräusche. Der Sturm schien an Stärke zugenommen zu haben. Über ihr wogten und rauschten die Baumkronen, immer wieder brachen kleinere Äste ab und fielen zu Boden, begleitet von einem andauernden Nadelregen.
Die beiden könnten sich ihr bis auf wenige Schritte nähern und sie würde es nicht bemerken. Aber noch hatten sie sie nicht gefunden. Wahrscheinlich hatten sie ihre Spur verloren oder waren schlicht zu faul, ihr durch den Wald zu folgen. Vielleicht hatten sie die Baumkrone herabstürzen sehen und Angst bekommen.
Aber darauf durfte sie sich nicht verlassen. Sie musste ein Versteck finden, von wo aus sie telefonieren konnte.
Manuela richtete sich auf und sah sich um.
Nicht weit voraus erhob sich eine Felsformation. Geschichtete, von Moos bewachsene Platten, die in der grün-braunen Umgebung fast unsichtbar waren.