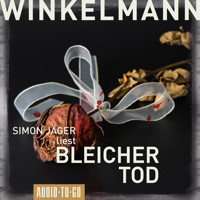Buch
Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehn ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr …
Der junge Anwalt Sebastian Schneider führt ein glückliches, zufriedenes Leben: Mit seinen Eltern Anna und Edgar lebt er auf dem Schneiderhof, einem einsam, aber idyllisch gelegenen Hannoveraner-Gestüt, auf dessen Stille und Abgeschiedenheit sich Sebastian nach einem langen Tag in der Stadt jedes Mal von Neuem freut. In der altehrwürdigen Kanzlei, in der er nach dem Studium eine Stelle gefunden hat, betraut man ihn zunehmend mit wichtigen Aufgaben. Und selbst als auf dem Weg in die Stadt ein anderes Auto seinen Wagen rammt, scheint dies wie eine Fügung des Schicksals. Denn wie hätte Sebastian sonst die junge, außerordentlich hübsche Saskia kennengelernt?
Doch dann bekommt er eines Tages einen seltsamen Brief: Auf einem Blatt Papier steht die erste Strophe des Liedes »Hänschen klein«, darunter das innige Versprechen einer Frau, dass sie und ihr Hans bald wieder vereint sein werden. Sebastian glaubt zuerst an einen Irrtum, auch wenn das Schreiben an ihn adressiert ist. Er ahnt nicht, dass er einen Liebesbrief in den Händen hält, der sein Leben zerstören wird: den Brief einer Mutter, die – totgeschwiegen, totgeglaubt, dem Wahnsinn verfallen – auf der Jagd nach ihrem Sohn ist. Und bereit, für ihn über mehr als eine Leiche zu gehen …
Autor
Andreas Winkelmann, geb. im Dezember 1968, entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für das Schreiben unheimlicher Geschichten. Als Berufener hielt er es in keinem Job lange aus, war unter anderem Soldat, Sportlehrer und Taxifahrer, blieb jedoch nur dem Schreiben treu. »Der menschliche Verstand erschafft die Hölle auf Erden, und dort kenne ich mich aus«, beschreibt er seine Faszination für das Genre des Bösen. Er lebt heute mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldesrand nahe Bremen.
Von Andreas Winkelmann sind im Goldmann Verlag
außerdem lieferbar:
Andreas Winkelmann
Hänschen klein
Thriller
Goldmann
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2010 by Andreas Winkelmann
Copyright © dieser Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Th · Herstellung: Str. / MK
ISBN 978-3-641-04447-3V005
www.goldmann-verlag.de
Alles fließt.
Aber nur, wer den Fluss beherrscht, herrscht über Leben und Tod.
Prolog
Die Ruhe in der Straße war trügerisch, das wusste er. Mochte der Alltag sich auch wie frisch gefallener Schnee über den grauenhaften Vorfall gelegt haben, so war er doch keineswegs vergessen. Weder von ihm selbst noch von den Nachbarn, und das ließen sie ihn jeden Tag aufs Neue spüren. Sie mieden den Kontakt, brachten kaum noch den notwendigen Gruß hervor oder wandten sich sogar ab, wenn er abends heimkam. Und er sah Mitleid in ihren Blicken. Armes Schwein, sagten diese Blicke, er kann ja nichts dafür, was soll er machen, schließlich ist sie seine Frau. Ihr Mitleid machte ihn krank, brannte sogar noch verzehrender in seinem Innern als der Hass, der immer wieder offen zutage trat und seine ehemals guten Nachbarn, vielleicht sogar Freunde, in argwöhnische, gemeine Menschen verwandelt hatte.
Zwei Tage nach dem Vorfall hatte jemand in großen roten Lettern »Hexe« auf ihr Garagentor geschmiert. Die zu dick aufgetragene Farbe war von den Buchstaben hinabgelaufen, ganz so, als würden sie bluten. Er hatte das gesamte Tor daraufhin rot lackiert, und auch wenn das böse Wort nun nicht mehr zu lesen war, war dieses rote Tor in einer langen Reihe grauer Tore ein weithin sichtbarer Makel, ein Kainsmal, das sie brandmarkte und zu Aussätzigen machte, auch wenn sie es nicht auf ihrer Haut tragen mussten. Er wandte den Blick ab, als er an der Garage vorbeirollte. Selbst im Dunkeln leuchtete diese Blutfarbe. Er mochte nicht mehr dahinter parken, selbst wenn er am Morgen Eis kratzen musste.
Dabei hatte er gefleht und gebettelt, sich bei allen in der Straße, selbst bei denen, die nicht betroffen gewesen waren und nichts mitbekommen hatten, entschuldigt. Er hatte ein unverhältnismäßig hohes Schmerzensgeld an die Baumanns gezahlt, hatte ihr Geheul und Geschrei mit harter Währung verstummen lassen, hatte ihnen eine Erklärung geliefert, die auch noch schlüssig geklungen hatte.
Schlüssig? Zumindest in seinen Ohren war das anfangs so gewesen, aber seitdem hatte sich vieles verändert. Doch er weigerte sich hartnäckig, nach einer anderen, wahrlich grausameren Ursache zu forschen. Besser nicht an der Oberfläche kratzen, besser keine Fragen stellen, deren Antworten man sowieso nicht hören wollte. Was man nicht aussprach, war auch nicht. Also blieb es bei der einen, alles entschuldigenden Feststellung: Ellie war schwanger!
Mit verheulten, aufgequollenen Augen, zitternder Stimme und einem angetrockneten Rest Tomatensoße vom Mittagessen im Mundwinkel hatte sie es ihm gestanden. Schwanger! Die Entschuldigung für alles. Für ihre Reizbarkeit, für ihre Stimmungsschwankungen, für ihre mitunter unkontrollierbare Fresssucht.
Schwanger!
Peter Brock versuchte sich zu freuen. Jedes Mal, wenn er das Haus betrat und seine schwangere Frau begrüßte, versuchte er es, doch immer wieder wurde seine Freude getrübt durch die Erinnerung an den entsetzlichen Vorfall. Da halfen auch tausendfach wiederholte, beruhigende Worte nicht. Natürlich, Schwangere taten verrückte Sachen, aßen mitternächtlich saure Gurken mit Ketchup, ekelten sich plötzlich vor ihrem Lieblingsgericht und so weiter, das wusste jeder. Aber was seine Ellie getan hatte, taten Schwangere nicht. Davon hatte er noch nie gehört.
Verflucht! Es war so verflucht schwer, diese Gedanken aus seinem Kopf zu bekommen.
Um sich abzulenken tastete Peter Brock in der Dunkelheit des Wagens nach dem kleinen, eckigen Gegenstand auf dem Beifahrersitz. Er brachte Ellie jetzt häufiger Geschenke mit, vor allem, wenn es mal wieder so spät wurde wie heute. Ellie forderte viel mehr Zeit, als er ihr geben konnte – oder vielleicht geben wollte? Die Arbeit lief gut, er verkaufte mehr Lexikonbände als jeder andere Außendienstmitarbeiter der Firma. Er hätte es sich leisten können, wenigstens an zwei Abenden in der Woche früh heimzukehren. Aber sie war so reizbar geworden und brüllte herum, was sie früher nie getan hatte. Gestern hatte er erstmalig wirklich Angst vor ihr gehabt. Angst vor seiner eigenen Frau! Unvorstellbar. Und doch war es so. Immer wieder verwandelte sie sich in einen völlig anderen Menschen als die Ellie, die er damals in der Drogerie kennengelernt hatte. Der Beutel mit Teelichtern war gerissen, er hatte ihr beim Aufsammeln geholfen. So anmutig war sie gewesen, so schüchtern, hatte ihm kaum in die Augen schauen können.
Vielleicht, und darin ruhte momentan seine ganze Hoffnung, würde er nach der Geburt seine Ellie wiederbekommen. Mit ihren veränderten weiblichen Formen würde er leben können; mein Gott, er würde jedes zusätzliche Pfund lieben, solange darin nur seine schüchterne, scheue Ellie lebte. Und bis dahin … nun, ihre Schwester kam an zwei Tagen in der Woche, sah nach dem Rechten, half bei der Hausarbeit, versuchte, Ellie aufzumuntern. Peter war ihr dankbar dafür. Er war nicht sonderlich gut in solchen Dingen. Lieber brachte er von Zeit zu Zeit Geschenke mit.
Für Schmuck, Parfum oder ein besonderes Kleidungsstück hatte Ellie nichts übrig, aber sie freute sich über jede Kleinigkeit, die mit dem ungeborenen Kind zu tun hatte. In dem Karton auf dem Beifahrersitz – seine Hand ruhte immer noch darauf – befand sich eine Spieluhr aus Blech, die zur Melodie von Hänschen klein einen bunten Blechjungen mit Rucksack und Wanderstab in die Welt hinausziehen ließ. Er hatte sie heute früh in einem Antiquitätenladen entdeckt, dessen Besitzer er von den Vorzügen seiner hochwertig ausgestatteten Lexikonreihe überzeugen wollte. Stattdessen hatte der Rentner mit dem asthmatischen Husten ihm ein nach allen Regeln der Verkaufskunst geführtes Gespräch aufgezwungen, als er die Figur nur kurz in die Hand genommen hatte, um die Wartezeit zu überbrücken, bis die einzige Kundin den Laden verlassen hatte. Schließlich war es nicht mehr um Lexika gegangen und auch nicht um die Frage, ob er den Spieljungen kaufen würde oder nicht, sondern nur noch um den Preis. Der Alte war ein Fuchs, Peter bei Weitem überlegen. Er konnte sich eigentlich nur zugutehalten, den Preis um die Hälfte gedrückt zu haben. Immerhin! Außerdem hätte der Alte sich nicht so anstrengen müssen, er hätte sowieso gekauft. Es war zwar ein kitschiges Spielzeug, aber Ellie würde es gefallen, und er stellte sich vor, wie sie seinem Sohn jeden Abend vor dem Einschlafen dieses Lied vorspielte.
Mit diesem Bild vor Augen ließ er den Wagen vor seinem Grundstück ausrollen. Als er ausstieg, schlug ihm kalte Luft entgegen, sein Atem erschien als dunstiger Nebel vor seinem Gesicht. Über dem Haus stand der Vollmond. Peter Brock blieb stehen und legte den Kopf in den Nacken. Ein paar Atemzüge lang genoss er den Anblick der wie poliert glitzernden Sterne, die Kälte auf seinen Wangen und die beruhigende Stille der Siedlung. Die anderen Häuser waren durch die fünfzehn nebeneinander aufgereihten Fertiggaragen von seinem Grundstück getrennt. Es lag am Ende der Straße, dahinter begannen offene Felder und bewaldete Hügel. Als Peter es gekauft hatte, war es das beste und ruhigste Haus in der Siedlung gewesen, nun war es das einsamste. Es bestand ein himmelweiter Unterschied zwischen Einsamkeit und Ruhe, das lernte er gerade auf grausame Art. Die Lichter, die da und dort in den Häusern noch brannten, schienen nach dem Vorfall unerreichbar weit entfernt, so als gehörten sie nicht mehr zu ihrer Welt. Sie würden hier wegziehen müssen. Die Leute würden niemals vergessen. Für ihr Kind, das noch nicht geboren war und keine Schuld trug, würden sie diese gerade erst erschaffene Heimat verlassen müssen. Peter seufzte, ging zur Haustür, schloss auf und trat ein.
Wie immer hatte Ellie das schwache Licht im Flur für ihn brennen lassen, und wie immer würde er sie zu dieser Zeit schlafend vor dem Fernsehgerät finden, die leere Verpackung einer Tafel Schokolade auf dem Tisch, vielleicht ein bräunlicher Rest in ihrem Mundwinkel. Peter zog die Schuhe aus. Mit der Spieluhr in der Hand ging er in die Küche. Dort floss das schummrige Licht der Dunstabzugshaube über Herd und Arbeitsplatte. Auch das wie immer. Trotzdem verharrte er. Etwas stimmte nicht! Die gedämpften Geräusche des Fernsehers, die ihn sonst um diese Zeit erwarteten, fehlten. Es war still im Haus, ungewohnt still.
Auf Socken schlich er zum Wohnzimmer. Jedes Knacken seiner Fußgelenke erschien ihm erschreckend laut. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen, nur die kleine Lampe auf dem Fensterbrett brannte. Ellie war nicht da. Ihre Wolldecke lag unangetastet auf der Couch, die Heizung lief nicht, der Raum war kalt. Peter konnte sich an keinen Abend erinnern, an dem er das Wohnzimmer in diesem leblosen Zustand vorgefunden hatte. Es war der einzige Raum des Hauses, in dem sie sich zu dieser Zeit aufhielten.
Wo steckte Ellie?
War sie schon zu Bett gegangen? Das wäre ungewöhnlich, sie ging niemals ohne ihn zu Bett. Aber ungewöhnliche Verhaltensweisen waren neuerdings ja ihre Spezialität. Und wo sollte sie sonst sein?
Peter ging in den Flur zurück, verharrte vor der Treppe und lauschte. Kein Geräusch. Er stieg hinauf. Peter war alles andere als ein Schwergewicht, doch als er die erste Stufe betrat, knarrte das Holz sofort. Das schwache Licht aus dem Flur reichte bis zur Mitte der Treppe, dahinter lag undurchdringliche Dunkelheit. Aber Peter sah ohnehin nicht hinauf. Er achtete darauf, wohin er seine Füße setzte, verzog bei jedem Knarren das Gesicht. Auf der obersten Stufe angekommen, streckte er die Hand aus, um Licht zu machen. Seine Finger berührten den Schalter, doch er kam nicht mehr dazu, ihn umzulegen. Er sah den Schatten kaum, der sich aus der Tür zum künftigen Kinderzimmer löste, spürte aber die Bewegung, spürte etwas auf sich zukommen, das die Luft verdrängte.
Bevor er reagieren konnte, traf ihn das Bügeleisen an der Stirn. Der Schlag war wuchtig, die chromüberzogene Spitze drang tief in die Schädeldecke ein. Peter Brock gab ein unmenschliches Geräusch von sich, taumelte zurück, stürzte die Treppe hinunter und blieb auf dem gefliesten Boden des Flures liegen. Die verpackte Spieluhr polterte
Drei Jahre später
Aus dem Dunkel näherten sich grausige Geräusche. Obwohl sie zunächst weit entfernt und leise waren, schrak das Kind doch wegen ihnen aus dem Schlaf. Es schlug die Augen auf, hielt den Atem an und lauschte. Zunächst war da nur das hastige, harte Wummern seines Herzens, das Rauschen des Blutes in seinen Ohren; dann schwollen jene Geräusche, die es aus dem Schlaf geschreckt hatten, schnell von Neuem an, wurden infernalisch. Und es war kein Traum, die Geräusche waren real. Ein hohes Sirren in der Luft, weiter entfernt dumpfes, hohles Flattern. Plötzlich zerriss die nächtliche Schwärze, starkes, blendend helles Licht zuckte draußen vor dem Fenster hin und her, sprang dann unvermittelt durchs Glas und verdampfte die Dunkelheit.
Mit weit aufgerissenen Augen lag das Kind in seinem Bettchen; die Knie angezogen, dicht an die kalte, feuchte Wand gedrängt. Sein Atem ging stoßweise, es fürchtete sich vor den Lichtfingern, die den winzigen Raum durchzuckten, das Bett aber nicht erreichten.
Wo blieb Mama? Warum kam sie nicht?
Die Geräusche schwollen noch lauter an, wurden intensiver, ließen die Holzwände der Hütte erzittern. Das hohle Flattern trieb Luft in wellenartigen Schüben in den Körper des Kindes. Es spürte den Druck bis tief in die Lungen. Seine Angst wurde zur Panik, und doch fand der Junge die Kraft, die Decke beiseitezustrampeln und die nackten Füße vor das Bett zu setzen. Den alten zerfledderten Teddy fest umklammernd stand er vor seinem Bett und begann zu weinen und nach seiner Mama zu rufen. Doch statt ihrer Stimme ertönte eine andere. Seltsam verzerrt und ungeheuer laut, noch lauter als die anderen Geräusche da draußen vor der Hütte.
Ein Riese! Ein Riese war durch den Wald gekommen, hatte die Bäume niedergewalzt und mit seinem Feueratem das Laub in Brand gesteckt. Der Riese aus der Geschichte, die Mama ihm vorgelesen hatte. Eine böse Gestalt, die Kinder raubte, um sie in jenes ferne Land zu bringen, in dem die grausame Königin Urgade herrschte. Sie fraß die Kinder, um selbst ewig jung zu bleiben.
Unsicher tapste der Junge zum Fenster. Er wollte sehen, wie seine starke, mutige Mama den Riesen in die Flucht trieb. Geblendet von dem grellen Licht kniff er die Augen zusammen, sein nackter Fuß stieß gegen ein Spielzeug. Es kippte um, der empfindliche Mechanismus wurde ausgelöst. Doch das Toben vor der Hütte war zu laut, als dass der Junge die Melodie hätte hören können.
Plötzlich verschwand das Licht. Von einer Sekunde auf die andere war es wieder dunkel im Zimmer. Den Teddy noch immer fest umklammernd, ging der Junge zum Fenster und zerrte am Vorhang. Im selben Moment flog die Tür auf. Mama stürzte in den Raum, packte das Kind bei den Schultern und riss es vom Fenster weg. Sie schrie, doch ihre Worte gingen unter in dem Höllenlärm. Und dann griff der Riese durch das Fenster. Glas zerplatzte, ein Scherbenregen sprühte in den Raum, stach der Mutter in den Rücken. Etwas rollte zwischen ihren Füßen hindurch. Eine Nebelkralle stieg vom Teppich auf, füllte rasend schnell das kleine Zimmer aus. Der Junge bekam keine Luft mehr, riss den Mund weit auf, doch nur flüssiges Feuer drang in seinen Rachen ein und verbrannte seine Lunge. Die kräftigen Arme seiner Mama hielten ihn fest, sie wollte mit ihm zur Tür laufen, sank auf halbem Weg in die Knie, ließ ihn jedoch nicht los. Zusammen kippten sie auf den Teppich, auf dem noch die Spielsteine vom Nachmittag verstreut lagen. Mamas Lippen waren dicht an seinem Ohr.
»Niemand nimmt dich mir weg!«, rief sie. »Ich werde dich finden, überall!«
Teil IGegenwart
Montag
»Herr Trotzek, das Gericht hat mich zu Ihrem Verteidiger bestellt. Sind Sie darüber informiert worden?«
Seitdem Sebastian Schneider den quadratischen, gelb getünchten Raum betreten hatte, hatte Trotzek ihn nicht aus den Augen gelassen. Der kleine breitschultrige Mann mit dem kahl rasierten Schädel saß regungslos auf seinem Stuhl, lediglich seine Augen verrieten Aufmerksamkeit. Sie wirkten hellwach, waren flink, folgten jeder seiner Bewegungen, taxierten ihn. Schon nach wenigen Minuten spürte Sebastian Schweißtropfen seine Wirbelsäule hinabrinnen. Merkwürdig! Der Besprechungsraum war doch kühl. Lag es an der ungewohnten Situation oder an diesem kleinen Mann? Würde er ohne sein Hintergrundwissen genauso auf ihn reagieren? Menschen definieren sich durch ihre Taten, gerade in der Wahrnehmung anderer. Unbeschriebene Blätter sind weiß, unschuldig, rein. Trotzeks Blatt war beschrieben und triefte vor Blut. Sebastian konnte also gar nicht anders, als eine gewisse Furcht zu empfinden. Vor seinem geistigen Auge tauchten Fotos auf. Auch die Aufnahme der Tatwaffe. Wie konnte ein so kleiner Mann einen so schweren Hammer schwingen?
Trotzek nickte schwerfällig, sagte aber nichts.
Sebastian wusste, dass er sich besser hinsetzen sollte, um eine persönliche Beziehung zu seinem Klienten herzustellen. Proxemik, die Lehre der kleinräumigen Verhaltensweisen, sagt, dass die persönliche Distanz zwischen fünfundvierzig und hundertzwanzig Zentimetern liegt. Das Studium war noch nicht lange her, er wusste all diese Dinge, aber wollte er überhaupt eine persönliche Beziehung zu diesem Mann? Dieser eine Schritt auf den am Boden verschraubten Tisch zu erschien ihm wie der Schritt in eine Welt, in die er nicht gehörte und aus der es keine Wiederkehr gab. Trotzdem würde er diesen Schritt wohl gehen müssen. Vor ihm saß sein Klient, sein Chef wollte es so, er hatte gar keine Wahl. Also erfasste Sebastian die Lehne, zog den Stuhl etwas vom Tisch weg (die Spanne ging bis hundertzwanzig Zentimeter, warum sie nicht ausnutzen!) und setzte sich. Zusätzlich legte er seinen schwarzen Koffer auf den Tisch – eine kleine Barriere zwischen Trotzek und ihm, kein wirklicher Schutz, aber immerhin.
Die Akte Trotzek lag im Koffer, also hatte Sebastian nichts, worin er herumblättern konnte. Er musste sein Gegenüber ansehen, ihm in die Augen blicken, in diese kleinen, hellblauen, rot geränderten, nervösen Dinger. Unsympathische Augen. Nein, verdammt, das waren Vorurteile! Er musste seine Vorurteile in den Griff bekommen, sonst konnte er es gleich sein lassen. Vor ihm saß ein Klient, kein Mörder.
»Sie wollen keinen Verteidiger, richtig?«, versuchte Sebastian es auf die ehrliche Tour.
Trotzek schüttelte den Kopf.
»Nein.«
Das erste Wort zwischen ihnen. Ein negatives Wort, ein Wort wie ein hoher Zaun. Sebastian verfluchte sich innerlich, missachtete er doch die Spielregeln einer erfolgreichen Kommunikation.
»Warum nicht?«, setzte er nach, um zu retten, was noch zu retten war. Seinen kleinen Koffertrick hätte er sich sparen können. Trotzek schien viel mehr daran gelegen, Barrieren aufzubauen, als ihm selbst. Der kleine Mann unterstrich dies noch durch seine leise gestellte Frage: »Was wollen Sie?«
Sie starrten sich an. Trotzeks Augen huschten nicht mehr umher, waren jetzt nur noch auf ihn gerichtet. Die Stimme des Mannes wollte nicht zu dem Körper passen. Sie klang wie die eines großen Kerls, der über einen riesigen Resonanzraum verfügte. Vielleicht lag es aber auch nur an dem osteuropäischen Akzent.
»Ich will Ihnen helfen.«
Trotzek schüttelte behäbig den Kopf. »Man zwingt Sie.«
»Das sehen Sie falsch. Das Gericht hat mich zwar zu Ihrem Pflichtverteidiger bestellt, ich hätte aber ebenso gut ablehnen können.«
Und das war eine Lüge, wie sie dreister nicht sein konnte. Seine Kanzlei, Oltmanns, Steyer und Riedelsberger, hatte einen Anwalt zu stellen, und es war Oltmanns’ Wille, dass Sebastian diesen Fall übernahm. Man schlug dem alten Fuchs keinen Wunsch ab, nicht, wenn man soeben sein Studium beendet hatte und in einer der besten Kanzleien der Stadt Karriere machen wollte. Und immerhin hatte Oltmanns ihn damals gewarnt. Sie können sich bei uns auf Arbeits- und Vertragsrecht spezialisieren, aber wenn ich es will, dann vertreten Sie Ted Bundy oder noch schlimmeren Abschaum, und zwar mit hundertfünfzig Prozent Einsatz. Vor ihm saß kein Massenmörder wie Bundy, aber der Unterschied war doch rein mathematischer Natur, oder? Die Schwelle war übertreten, der Weg dahinter eben und voller Verlockungen.
Trotzek sah ihn noch intensiver an als vorher, senkte dann aber den Blick und betrachtete seine Handschellen.
»Wie wollen Sie mir helfen?«
Sein Sie schien Sebastians gesamte Kompetenz in Frage zu stellen.
»Da gibt es viele Möglichkeiten.«
»Mord bleibt Mord.«
Innerlich stimmte Sebastian ihm sofort zu, aber das Gesetz sah es etwas differenzierter. Er lehnte sich vor und nahm endlich den Koffer vom Tisch.
»Mord ist nicht gleich Mord. Wir können auf Totschlag plädieren, auf Unzurechnungsfähigkeit … Es gibt immer Möglichkeiten. Natürlich bleibt es ein Verbrechen, für das Sie in Vollzug müssen, aber der Unterschied kann durchaus zehn Jahre betragen. Das sollten Sie bedenken, bevor Sie meine Hilfe ablehnen.«
Während er sprach, rückte Sebastian sogar näher an den Tisch heran und damit auch näher an die untere Grenze der persönlichen Distanz, kaum noch zu unterscheiden von dem intimen Bereich. Erstaunlich, wie leicht es ihm fiel, nachdem das Gespräch jetzt erst einmal eröffnet war. Kommunikation war eben doch das mächtigste Schwert der Zivilisation.
Trotzek schüttelte kaum merklich den Kopf, starrte ihn aus seinen rot geränderten Augen an. Da war er wieder, dieser intensive, unangenehme Blick.
»Er hat es verdient.«
»Das ist für das Urteil nicht relevant. Die Frage ist …«
»Sie verstehen das nicht«, unterbrach Trotzek ihn. »Er hat es verdammt noch mal verdient, in der Hölle zu schmoren, und ich werde mich nicht rausreden.«
Trotzek hatte die Stimme erhoben und die kurze Kette zwischen seinen Handgelenken straff gespannt. Sebastian zog sich zurück, warf einen schnellen Blick zu dem kleinen Fenster in der Tür, durch das der Vollzugsbeamte sie eigentlich beobachten sollte – es gerade jetzt aber nicht tat.
»Aber er war doch Ihr Vater.«
Die Kette entspannte sich, Trotzeks Hände sanken auf die Tischplatte. Er presste die Lippen zu blutleeren Strichen zusammen und nickte schwerfällig.
»Ja, er war mein Vater. Und darum können Sie mir nicht helfen. Lassen Sie mich in Ruhe.«
Im Dorf sagten die Leute Da oben, wenn sie den Schneiderhof meinten, und Die da oben, wenn sie über die Schneiders sprachen. Das lag zum einen an der geografischen Lage und Entfernung – von Bentlage führte die schmale Straße über vier Kilometer stetig aufwärts und überwand dabei einen Höhenunterschied von dreihundertsiebzig Metern -, zum anderen aber auch an der zurückgezogenen Art und Weise, in der die Bewohner zu leben pflegten. Sie waren keine Eremiten, beschäftigten ab und an auch Hilfskräfte aus dem Ort, aber sie waren Eigenbrötler, verdienten Geld mit der Aufzucht und dem Verkauf von Hannoveranern, wovon in dieser Gegend kaum jemand etwas verstand, und das reichte für viele, um immer wieder Gerüchte in die Welt zu setzen. Inzest, Satanskult, Orgien – die Klatschmäuler hatten aus dem Vollen geschöpft. Es war wie überall auf der Welt, wenn dumme Menschen auf Spekulationen angewiesen waren.
Während der Schulzeit hatte es Tage gegeben, an denen Sebastian Schneider darunter gelitten hatte (Kinder waren grausamer als Erwachsene, wenn es darum ging, mit Worten zu Felde zu ziehen), heute interessierte es ihn nicht mehr. Menschen gewöhnten sich an alles. Außerdem spürte er mit jedem Tag, an dem er zwischen dieser Welt und jener in der dreißig Kilometer entfernten Stadt pendelte, die Bindung zum Hof enger werden. Eigentlich hatte er genau das Gegenteil erwartet.
Es war achtzehn Uhr vorbei, als die weißen Zäune hinter der letzten Kurve auftauchten. Sie begleiteten die Straße ein Stück weit, flossen mit den sanften Hügeln dahin, tauchten in Täler ab, um sich bald wieder aus ihnen zu erheben. Durch einen Windbruch, Überbleibsel des letzten großen Herbststurms, sah Sebastian die drei jungen Stuten auf der Weide nahe dem Hof stehen. Sie grasten mit gesenkten Köpfen, ihr Fell schimmerte wie Bronze und Kupfer. Links erhob sich das Wohnhaus auf der Kuppe des Hügels. Die tief stehende Sonne ließ die roten Klinker glühen wie heiße Kohlen. Wo die Straße durch den Zaun hindurchführte, ragten rechts und links drei Meter hohe, massive Holzpfähle auf, verbunden durch ein halbrundes Holzschild, auf dem Schneiderhof stand, umgeben von zwei Hufeisen. Sebastian fuhr darunter hindurch und parkte seinen Volvo neben den Land Rover seiner Eltern in dem offenen Schuppen.
Wie jeden Abend kam Taifun ihn als Erster begrüßen. Sebastian kraulte dem Schäferhundrüden die Brust und ließ sich die Hand abschlecken. Auf dem Weg zum Haus winkte er seinem Vater zu, der auf dem alten Deutz saß und Mist zur Sammelstelle fuhr. Für eine andere Begrüßung war die Entfernung zu groß und das alte Ungetüm, von dem sein Vater sich niemals trennen würde, zu laut. Kaum hatte er die Haustür geöffnet, strömte ihm der Geruch des Abendessens entgegen. Es duftete nach Muskatnuss und Basilikum. Sebastian stellte seinen Koffer auf der Treppe ab, die ins Obergeschoss führte, und bemerkte einen Brief auf der vierten Stufe, seiner Poststufe, ignorierte ihn aber.
Mutter rumorte in der Küche. Er ging zu ihr und begrüßte sie.
»Du siehst müde aus. Gab’s Ärger im Büro?«
»Ärger? Nein, Ärger gab es nicht. War aber trotzdem ein anstrengender Tag.«
Seine Mutter küsste seine Stirn, wofür er sich zu ihr hinabbeugen musste. Seit seinem vierzehnten Lebensjahr war er größer als sie.
»Mach dich ein wenig frisch, und erzähl uns beim Abendessen davon. In fünfzehn Minuten ist es fertig.«
»Soll ich Edgar rufen?«
»Nicht nötig. Er kommt sicher gleich rein.«
Sebastian nickte und verließ die Küche. Seine Wohnung lag im Obergeschoss des Hauses. Für sich allein hatte er ebenso viele Zimmer zur Verfügung wie seine Eltern, wovon drei aber mit abgedeckten Möbeln zugestellt waren. Er nahm den Koffer, ließ den Brief erneut unbeachtet und ging hinauf. Im Bad spritzte er sich minutenlang kaltes Wasser ins Gesicht. Seine Haut war gerötet und taub, als er sich danach im Spiegel betrachtete. Genauso gerötet wie seine Augen. Sie erinnerten ihn an Trotzek. Nach dem kurzen Gespräch hatte er zwei Aspirin nehmen müssen, und davon wirkten seine Augen stets, als hätte er getrunken.
Edgar saß bereits am Tisch, als Sebastian wenig später in Jeans und T-Shirt die Küche betrat. Sein Vater roch nach Stallmist und dem Dieselgestank des alten Deutz. Selbst der Duft des gerösteten Käses aus der großen Auflaufform, die Anna auf dem Tisch abstellte, kam gegen diese Mischung nicht an. Sebastian nahm zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, öffnete sie und gab eine seinem Vater.
»Du hast Ärger im Büro?«
Edgars weißes Haar stand zu Berge, eine Rasur war mehr als überfällig.
Sebastian schüttelte den Kopf. Für Anna bedeutete jede Abweichung von der normalen Routine Ärger. Was kaum verwunderlich war nach vierzig Jahren auf dem Hof, einer Insel der Ruhe in einer zunehmend hektischen Welt.
»Keinen Ärger, aber einen neuen Fall.«
»Was Besonderes?«
Sebastian schob eine Gabel Auflauf in seinen Mund, kaute darauf herum und ließ sich Zeit. Ein zähes Stück Fleisch, auf dem er fünfzigmal hätte herumkauen können, wäre ihm in diesem Moment lieber gewesen.
»Kann man sagen, ja. Mein erster Mordfall.«
Annas Gabel sackte auf den Teller, sie starrte ihn an. Diese Reaktion hatte Sebastian erwartet und den beiden deshalb im Vorfeld nichts von Trotzek erzählt. Er hätte es auch jetzt noch gern für sich behalten, hätte dafür aber mit ihrer lieb gewonnenen Tradition, in diesem Haus über alles zu sprechen, brechen müssen. Das war ihm Trotzek nun auch nicht wert.
»Du musst einen Mörder verteidigen?!«, fragte Anna schrill. »Du wolltest dich doch auf Vertragsrecht spezialisieren, was ist denn daraus geworden?«
»Ich kann es mir nicht aussuchen, dafür bin ich zu kurz in der Kanzlei. Oltmanns will, dass ich diesen Fall übernehme.«
»Was hat er getan?«, fragte Edgar.
»Seinen Vater getötet.«
Sebastian hätte noch anfügen können, wie Trotzek seinen Vater getötet hatte. Er hätte von dem Hammer und dem übel zugerichteten Körper erzählen können, den er auf den viel zu genauen, viel zu detailreichen Tatortfotos gesehen hatte. Er ließ es. Sein Magen rebellierte, wenn er nur daran dachte.
»Du hättest auf dem Hof bleiben sollen«, sagte Anna und schüttelte den Kopf.
Ihr immer noch kräftiges, silbergraues Haar fiel ihr in die Stirn. So konnte Sebastian ihre Augen nicht sehen, was aber auch nicht nötig war, wusste er doch um den missbilligenden Ausdruck darin. Wäre es damals nach ihr gegangen, hätte er Agrarwissenschaften studiert, den Hof übernommen und die gut laufende, einträgliche Hannoveranerzucht noch ausgebaut. Aber dann wäre er niemals hier weggekommen.
Er ging auf ihren Vorwurf nicht ein, dieses Thema hatten sie zu oft durchgekaut.
»Warum hat er seinen Vater getötet?«, wollte Edgar wissen.
»Ich weiß es nicht.«
»Er muss doch einen Grund gehabt haben.«
»Den hatte er bestimmt, aber er spricht nicht darüber, verweigert jede Aussage. Er will ja nicht mal einen Anwalt. Das Gericht hat unsere Kanzlei dafür bestellt.«
»Aber warum ausgerechnet dich?«, warf Anna ein.
»Es ist mein Beruf. Ich kann es mir nicht aussuchen.«
Edgar stocherte in seinem Essen herum. Ohne aufzublicken sagte er: »Wenn ohnehin feststeht, dass er schuldig ist, wozu braucht er dann einen Anwalt? Sollen sie ihn doch ins Gefängnis stecken.«
»Auch ein Mörder hat das Recht auf eine Verteidigung.«
»Vatermörder«, verbesserte Edgar ihn, »und so ein Recht taugt nichts.«
Sebastian schluckte eine Erwiderung mit der nächsten Gabel runter. Auch wenn sein Vater kein genereller Verfechter der Todesstrafe war, würde er sie wohl in manchen Fällen trotzdem befürworten. Hätte Trotzek zum Beispiel eine Frau getötet, sie vorher vielleicht noch vergewaltigt, wäre für Edgar der Tod die einzig angemessene Strafe gewesen. Sebastian fürchtete schon jetzt den Tag, an dem er einen solchen Fall übernehmen müsste.
Eine Weile aßen sie schweigend. Erst als die Teller leer waren, sagte Anna: »Auf der Treppe liegt übrigens Post für dich.«
»Ich hab’s gesehen.«
»Ein violetter Umschlag.« Anna lächelte verschmitzt. »Zu meiner Zeit benutzten nur Verliebte solche Umschläge.«
Das war Sebastian gar nicht aufgefallen. Ein violetter Umschlag? Zurzeit gab es in seinem Leben niemanden, der Grund hätte, solche Umschläge zu benutzen. Er stand auf, ging zur Treppe und holte den Brief. »Ohne Absender«, sagte er und setzte sich wieder an den Tisch.
Sein Name und seine Adresse waren mit einer Schreibmaschine getippt, die Klappe zusätzlich mit Tesafilm verklebt. Die ungewöhnliche Farbe des Umschlags rief Erinnerungen in ihm wach. Insa hatte Briefumschläge in zarten Pastelltönen benutzt, sie zusätzlich aber noch einparfümiert. An diesem Brief roch nichts, außerdem würde Insa ihm sowieso nicht mehr schreiben. Ihr letztes gemeinsames Jahr an der Uni war nicht ihr bestes gewesen.
Unter den neugierigen Augen seiner Mutter öffnete Sebastian mit einem Messer den Umschlag. Ein einziges, in der Mitte gefaltetes, ebenfalls violettes Blatt befand sich darin. Er nahm es heraus, faltete es auseinander und las die wenigen Worte.
Hänschen klein ging allein
in die weite Welt hinein.
Stock und Hut stehn ihm gut,
ist ganz wohlgemut.
Aber Mutter weinet sehr,
hat ja nun kein Hänschen mehr.
Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick,
kehr nur bald zurück.
Lieber Hans,
Viel Zeit ist vergangen.
Keinen weiteren Tag habe ich mehr zu
verschwenden.
Was ich tue, tue ich für uns, ich bin mir
sicher, dass du es eines Tages verstehen
wirst. Nicht sofort, das erwarte ich nicht,
aber denke bitte immer daran, dass ich es
aus Liebe tue.
Kein Name, keine Unterschrift. Nichts weiter als Worte, die keinen Sinn ergaben. Den oberen Abschnitt kannte Sebastian. Wer war nicht in der Schule mit diesem blöden Liedtext gequält worden, wer hatte nicht in endlosen Musikstunden die Tonfolge auf der Blockflöte üben müssen? Aber was sollte der Quatsch? Er nahm noch einmal den Umschlag zur Hand. Nein, keine Verwechslung, der Brief war eindeutig an ihn adressiert.
»Was steht drin?«, fragte Anna.
»Lies selbst.«
Er reichte ihr den Brief über den Tisch. Sie zögerte einen Augenblick, bevor sie das Blatt Papier entgegennahm. Ihr Lächeln erfror schon bei den ersten Worten. Sebastian entging der Schatten nicht, der sich über ihr Gesicht legte. Sie sah zu ihm auf, dann zu Edgar hinüber, der ebenfalls neugierig geworden war. Eine Eigenschaft, die ihm eigentlich fremd war.
»Was soll denn das bedeuten?«, fragte Anna.
»Ich habe keine Ahnung.«
Der Brief wanderte zu Edgar. Er las ihn schnell und ohne sichtbare Regung.
»Merkwürdig, aber eindeutig nicht für dich.«
»Wieso? Mein Name steht auf dem Umschlag.«
»Aber hier steht Lieber Hans. Du heißt nicht Hans, oder? Also muss es sich um eine Verwechslung handeln.«
Dienstag
Die Luft war klar.
Nur in flachen Tälern zwischen den weitläufigen Tannenwäldern hielten sich letzte Reste von Nebel, schon jetzt den Sonnenstrahlen hilflos ausgeliefert. Die Farbe des Himmels lag irgendwo zwischen Weiß und Blau; eine milchige Melange, typisch für den frühen Morgen eines klaren Tages im erwachenden Sommer. Weit voraus, in einer Entfernung, in der alles miteinander verschmolz, weidete auf freier Fläche Dammwild in sicherer Entfernung zum Wald. Mit einer sanften Brise wehte würziger Geruch aus dem Wald herüber. Der Geruch verrottender Blätter und Nadeln aus dem vergangenen Herbst. Vier oder fünf Wochen noch, dann würde dieser feuchte, erdige Geruch dem des Sommers gewichen sein. An den Nachmittagen war die Sonne schon seit einigen Tagen sehr kräftig, der Wald begann zu trocknen. Diesen beinahe unmerklichen Übergang vom Frühling zum Sommer mochte er besonders gern. Es war eine Zeit des Wechsels, des Erneuerns.
Sebastian Schneider stützte sich auf den Rand des Sattels, beugte sich nach vorn und tätschelte den kräftigen Hals des Wallachs. Falco drehte den Kopf und blickte ihn aus seinen dunklen Augen an. Sebastian meinte, darin Freude über den ungewöhnlichen Ausritt erkennen zu können, wahrscheinlich projizierte er jedoch nur seine Empfindungen auf das Pferd. Ganz sicher aber vermissten sowohl Falco als auch er die gemeinsamen Ausritte durch die Wälder, die sie früher mit großer Regelmäßigkeit unternommen hatten. Seit er das Studium beendet hatte, fraß der neue Job den größten Teil seiner Zeit.
»Das wird ein schöner Tag. Was meinst du, alter Junge?«
Falco stimmte wortlos zu.
In gemächlichem Trab ließen sie den Hof weit hinter sich. Sebastian – zwei Stunden, bevor der Wecker geklingelt hätte, von einem rasenden Traum-Trotzek aus dem Schlaf gerissen – versuchte den vor ihm liegenden Tag zu verdrängen. Er konzentrierte sich auf das Pferd unter sich, passte sich dessen Rhythmus an und ließ sich vom Geruch, der Wärme und den Geräuschen des Tieres gefangennehmen.
Sie näherten sich dem Waldrand. Die langen Stämme der Kiefern glänzten im Sonnenlicht. Ein ausgetretener Pfad führte zu einer Art Eingang, den Sebastian vor Jahren mit Axt und Säge selbst geschaffen hatte. Er führte in einen weitläufigen Nadelwald, und wie die meisten Wälder rings um den Hof war auch er im Besitz seiner Eltern. Das Unterholz war undurchsichtig; seit dem Holzeinschlag vor drei Jahren hatte sich dank des vermehrten Lichteinfalls giftiger Holunder, amerikanische Traubenkirsche und Brombeere durchgesetzt. Hoch oben befand sich das löchrige Dach aus Kiefern, Fichten und Douglasien. Eine eigentümliche, sehr dichte Atmosphäre erfüllte den Wald. Die Strahlen der Sonne, durch das Nadeldach gefiltert und zu einzelnen, scharf umrissenen Lanzen gebündelt, wirkten wie Fremdkörper. Sie sprenkelten den Waldboden mit zuckenden, wandernden Lichtpunkten.
Ein Geräusch im Unterholz schreckte Falco auf. Er schnaubte laut. Sebastian brachte ihn zum Stehen und sah sich um. Ein Hase flüchtete in wildem Zickzackkurs und verschwand zwischen den Brombeerranken. Ohne dass Falco wirklich geführt werden musste, folgte er dem ausgetretenen Pfad durch eine lang gezogene Senke, erklomm den gegenüberliegenden Hügel und erreichte alsbald das Ufer des Sees. Auf der anderen Seite des großen, in der Form eines angebissenen Apfels geschaffenen Sees begann Land, das nicht mehr seinen Eltern gehörte. Nach Westen hin stieg das Gelände steil zu einem felsigen Hochplateau an, dem Adlerrücken. Weiß schimmernder Kalkstein blitzte hier und dort auf.
Dunkel und undurchdringlich lag der See in der morgendlichen Stille. Plötzlich aufgeregtes Geschnatter von Stockenten. Auf der Ostseite des Sees stob ein Pärchen wild mit den kurzen Flügeln schlagend aufs offene Wasser davon. Es war Brutzeit. Sie verließen ihre Jungen nur, wenn sie gezwungen wurden.
Falcos Ohren zitterten, seine Nüstern blähten sich auf. Irgendetwas machte auch ihn nervös. Sebastian richtete sich im Sattel auf, kniff die Augen zusammen und spähte zu der Stelle, von der die Enten geflüchtet waren. Bewegte sich da etwas am Waldrand? Ein Schatten zwischen den Bäumen?
Wahrscheinlich Wild. Die Tiere kamen oft zum Trinken an den See.
Ein paar Minuten noch genoss Sebastian die Stille, dann führte er Falco an und ritt zurück zum Hof. In der Stadt, dieser anderen, weit entfernten Welt, wartete ein Mörder auf ihn.
Nachdem er sich zuerst um Falco gekümmert und dann selbst geduscht und gefrühstückt hatte, machte Sebastian sich auf den Weg ins Büro. Die Fahrt dauerte fünfundvierzig Minuten, und das war entschieden zu lange, um den Fall Trotzek die ganze Zeit erfolgreich aus seinen Gedanken verdrängen zu können. Während er sich durch den morgendlichen Berufsverkehr quälte, war sein Kopf voller grausiger Tatortfotos, pathologischer Berichte und polizeilicher Protokolle.
Den weißen Wagen sah er deshalb zu spät.
Meine Ampel ist grün! Verdammt, Scheiße, ich habe Vorfahrt!
Trotzek war mit einem Schlag verschwunden. Wie eine Rakete schoss der andere Wagen auf die Kreuzung. Noch ehe es passierte, wusste Sebastian, dass es passieren würde. Er klammerte sich ans Lenkrad, trat das Bremspedal durch bis zum Bodenblech, atmete scharf ein – und dann kniff er die Augen zu wie ein kleiner Junge, der glaubt, damit der Gefahr entgehen zu können.
Jämmerliches Schreien gequälter Reifen.
Der plötzliche Ruck war enorm. Unglaubliche Kräfte pressten Sebastian in den Sicherheitsgurt. Augenblicklich schoss der Airbag heraus und drückte ihn in den Sitz zurück. Blech zerriss. Glas explodierte. Grauenvolle Geräusche. Sebastian wartete auf den Schmerz, auf den spitzen Gegenstand, der ihm in die Bauchdecke fuhr, auf den schweren Klotz, der seine Beine zermalmte.
Plötzlich war es vorbei. Jegliche Bewegung erstarrte.
Ineinander verkeilt blockierten die Wagen die Kreuzung. Ein zänkisches Paar, das nicht voneinander lassen konnte, eingehüllt in intensive Stille. Die Welt hielt den Atem an und wartete ab, ob es weitergehen konnte.
Dann hörte Sebastian, die Lider immer noch fest zusammengepresst, zischend Wasserdampf aus dem Motorblock entweichen, und kapierte, dass er den Unfall überstanden hatte. Er öffnete die Augen. Gleichzeitig stieg ihm alarmierender Geruch in die Nase. Benzin! Der Wagen würde explodieren! Eine geborstene Benzinleitung, der heiße Motor … hastig löste er den Sicherheitsgurt, stieß den jetzt schlaffen Airbag beiseite – und fiel aus dem Wagen, weil jemand im selben Moment die Tür öffnete. Dieser Jemand griff nach ihm, als er neben seinem Wagen zu Boden ging.
»Der Tank … Benzin … wir müssen weg, schnell!«
»Ruhig, bleiben Sie ruhig, hier läuft kein Benzin aus.«
Sebastian stützte sich auf den ausgestreckten Arm und ließ sich hochziehen.
»Sind Sie okay?«
»Ich … ich hab ihn nicht kommen sehen.«
»Beruhigen Sie sich. Sind Sie verletzt?«
Sebastian sah an sich herunter. Kein Blut, keine stechenden Schmerzen, nur ein Taubheitsgefühl, das aus den Beinen langsam in seinen Körper kroch.
»Ich hab ihn wirklich nicht gesehen.«
»Sie trifft keine Schuld, das kann ich bezeugen. Die ist wie’ne Wahnsinnige bei Rot auf die Kreuzung gerast. Muss wohl lebensmüde sein, die blöde Kuh.«
Erst jetzt sah Sebastian den Mann, der ihn noch immer am Ellenbogen stützte. Ein großer bärtiger Mann in der Kleidung eines Bauarbeiters. Sebastian sah sich um. Überall Menschen, die Kreuzung war voller Gaffer. Da vorn, der andere Wagen, der andere Wagen, großer Gott …!
Ein kleiner weißer Japaner, in der Mitte eingeknickt, wo sich die Schnauze seines schweren Volvo hineingebohrt hatte. Ein paar Leute standen herum, starrten ins Wageninnere, jemand versuchte, die Beifahrertür zu öffnen. Durch den aufsteigenden Wasserdampf des defekten Kühlers hindurch konnte Sebastian in den Wagen sehen. Ihm zugewandt war das Gesicht einer Frau, schwarzes Haar, geschlossene Augen, abgeknickter Hals. Blut, das ganze Gesicht verschmiert, Blut an der zerborstenen Seitenscheibe, überall Blut. Ein totes Gesicht.
Sein Magen verkrampfte sich, das Frühstück kam in ihm hoch. Das Taubheitsgefühl erfasste plötzlich seinen ganzen Körper, die Beine wollten sein Gewicht nicht mehr tragen, er taumelte gegen seinen Wagen, klammerte sich mit der rechten Hand an die geöffnete Tür.
»He, he, he!«
Der Bauarbeiter griff ihm unter die Achseln.
»Ist wohl doch besser, Sie setzen sich erst mal.«
Widerstandslos ließ sich Sebastian von seinem Wagen wegführen. Weg von dem toten Gesicht, nur weg, nicht noch mal hinsehen. Die Menschenmasse teilte sich vor ihnen. Tuscheln, Raunen, Blicke, laute Einsatzsirenen. In seinem Kopf geriet alles durcheinander. Der Bauarbeiter führte ihn zu einem Ampelmast, drückte ihn zu Boden, lehnte ihn mit dem Rücken dagegen. Sebastian presste sich die Hände vors Gesicht. Es nützte nichts. Das Bild hatte sich eingebrannt. Ein totes Gesicht.
Sebastian wurde nicht bewusstlos, kam aber trotzdem erst in der Notaufnahme des Krankenhauses wieder zu sich. Der Notarzt, die Sanitäter, die Fahrt im Rettungswagen, angeschnallt auf einer Trage, all das bekam er zwar mit, aber es fand keinen Zugang in seinen Kopf, blieb außen vor, so als ginge es ihn überhaupt nichts an.
Nachdem ihm eine Ärztin ein Beruhigungsmittel gespritzt und er eine halbe Stunde geruht hatte, setzten die logischen Vorgänge innerhalb des Gehirns wieder ein. Der komfortable Zustand des Losgelöstseins von der Welt verabschiedete sich. Leider. Er ließ eine weitere Untersuchung über sich ergehen. Außer einem sich langsam einfärbenden Abdruck des Sicherheitsgurtes über seiner Brust hatte er keine Verletzungen davongetragen. Nachdem das Beruhigungsmittel den anfänglichen Schock vertrieben hatte, konnte er das Krankenhaus mit ärztlichem Segen verlassen. Er rief seine Eltern an und bat sie, ihn abzuholen. Selbst wenn sie sich beeilten, was sie ohne Zweifel tun würden, benötigten sie mindestens eine Stunde. Eine Stunde Wartezeit in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Vortrefflich viel Zeit für Vorwürfe.
Sie trifft keine Schuld, hatte der Bauarbeiter gesagt. Trotzdem: Wäre sein Kopf nicht voller Trotzek gewesen, hätte er seinen Wagen vielleicht etwas schneller zum Stehen gebracht und damit Schlimmeres verhindert.
Hätte, wäre, könnte!
Die Frau am Steuer des Kleinwagens war nicht tot, das hatte ihm der Sanitäter im Rettungswagen bereits gesagt. Darüber hinaus wusste Sebastian aber rein gar nichts. Wie schwer waren ihre Verletzungen? War sie in der Notaufnahme vielleicht doch noch verstorben?
Sebastian sprang auf, verließ die Sitzecke vor der Notaufnahme und postierte sich gut sichtbar auf dem Korridor. Es dauerte nicht lange, bis leises Quietschen von Gummisohlen auf dem Korridor jemanden ankündigte. Eine Schwester kam ihm entgegen. Eine dicke ältere Frau mit freundlichem Gesicht. Er hatte sie vorhin, während er untersucht worden war, schon beobachtet. Sie schien die Einzige zu sein, die bei der Hektik in der Notaufnahme noch Zeit für ein Lächeln fand. Sebastian nahm seinen Mut zusammen und trat ihr entgegen, versperrte den Gang.
»Sie sind noch da?«, fragte die Schwester.
»Ja, ich … ich wollte noch … können Sie …«
Ihre dicken Augenbrauen senkten sich über der Nasenwurzel zusammen.
»Ja?«
»Ich … diese Frau, mit der ich den Unfall hatte, wissen Sie, wie es ihr geht?«
Die Augenbrauen entspannten sich. Die Schwester trat einen Schritt vor und tätschelte seinen Oberarm.
»Frau Eschenbach ist außer Gefahr. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Machen Sie sich keine Sorgen, in ein paar Tagen geht es ihr wieder besser. Wir kümmern uns hier um sie.«
»Wirklich?«
»Aber natürlich.«
Sie hakte sich bei ihm unter und führte ihn in Richtung Ausgang. Sebastian ließ es mit sich geschehen. Mit diesen wenigen Sätzen schaffte die Schwester, was das Beruhigungsmittel nicht geschafft hatte. Jetzt konnte er das Krankenhaus wirklich verlassen.
Mechthild Kreiling starrte auf die Einstichstellen in ihrem Unterarm. Sie waren von kundiger Hand gesetzt worden und hatten kaum Verfärbungen hinterlassen. Trotzdem störte sie sich daran. Sie hatte Spritzen nie gemocht, auch keine Ärzte. Mit Ziegenmilch und viel frischer Luft war sie auch ohne die Quacksalber in weißen Kitteln achtundachtzig Jahre alt geworden. Darauf war sie ausgesprochen stolz. Umso mehr ängstigte und ärgerte sie ihr jetziger Zustand. Seit dem bösen Sturz vor einer Woche – oder lag es schon länger zurück? – hielt eine merkwürdige Schwäche sie von ihren gewohnten Tätigkeiten ab. Draußen wucherte das Kraut, die Rosen mussten geschnitten und gedüngt werden, die Ziege versorgt … es gab so viel zu tun, aber sie fand nicht die Kraft, aus dem Rollstuhl aufzustehen.
Trotz allem habe ich riesiges Glück gehabt. Das darf ich nicht vergessen. Wenn Else nicht an genau dem Tag vorbeigekommen wäre, würde ich heute noch hinter dem Haus im Garten liegen, vielleicht wäre ich sogar längst tot.
Was gab es doch für Zufälle im Leben! Zehn Jahre war es nun schon her, seitdem Konrad an Leberkrebs verstorben war, zehn Jahre allein in dem kleinen Haus am Ende der Straße. Allein und einsam. In den letzten Jahren hatte sich viel geändert. Die Alten waren verstorben oder ins Altenheim gesteckt, die Häuser an junge Familien verkauft worden. Von denen kannte sie niemanden, und die interessierten sich sowieso nur für sich selbst. Nein, seit Konrads Tod war es wahrlich nicht einfacher geworden. Und darum war es ja nahezu unglaublich, wie das Schicksal sich just zum richtigen Zeitpunkt gewendet hatte. Da hatte über Nacht eine Wurzel eine der alten Waschbetonplatten auf dem Gartenweg hinterm Haus angehoben, sie stolperte über die blöde Kante, stürzte schlimm und konnte wegen der Schmerzen in der Hüfte und im Rücken nicht aufstehen. Und noch bevor sie weitab der anderen Häuser vergeblich um Hilfe schreien konnte, stand plötzlich Else da. Wie ein Fels in der Brandung.
Mechthild hatte vieles von dem, was Else ihr erzählt hatte, nicht verstanden, aber das spielte ja keine Rolle. Else war mit ihrem Mann, einem Arzt, vor vielen Jahren in die Schweiz ausgewandert. Ihr Mann war unlängst viel zu jung verstorben, und Else war in die alte Heimat zurückgekehrt, um ihren Cousin zu besuchen, der unten im Ort lebte. Und dieser Cousin hatte ihr wohl erzählt, dass Mechthild darüber nachdachte, ihr Haus zu verkaufen. Sie war vorbeigekommen, um sich zu erkundigen, und nun blieb sie und wohnte sozusagen zur Probe, bis es Mechthild wieder besser ging.
Woher wusste der Cousin nur davon? Tatsächlich dachte Mechthild seit ein paar Monaten darüber nach, aber hatte sie das jemandem erzählt? Dem Postboten vielleicht? Sie wusste es nicht mehr. Überhaupt vergaß sie in der letzten Zeit so viel. Ob das an den Medikamenten lag? Medikamente hatten Nebenwirkungen, das wusste jeder. Aber Else sagte, die Spritzen seien notwendig, damit sich der angeschwollene Knöchel nicht entzündete und die Prellung in der Hüfte zurückging. In ihrem Alter musste man mit solchen Verletzungen vorsichtig sein.
Else war ja eine so liebe Frau! Darum machte es Mechthild auch gar nichts aus, sie bei sich wohnen zu lassen. Die Alternative wäre schließlich das Krankenhaus, und für eine Frau wie sie, die die Quacksalber in weißen Kitteln, die ihren Mann trotz Studium und arroganten Auftretens nicht hatten retten können, nicht ausstehen konnte, war das ein entsetzlicher Gedanke.
Sie konnte sich wirklich glücklich schätzen!
Die schweren Schritte auf der Treppe rissen Mechthild aus ihren Gedanken. Else kam mit der Spritze, alle drei Stunden kam sie damit. Vielleicht sollten sie mal eine Pause machen? Sie war ja so vergesslich geworden, und ständig schweiften ihre Gedanken ab.
Die Tür zum Schlafzimmer wurde geöffnet. Elses riesiger Körper füllte den Rahmen aus.
»Na, Frau Kreiling, schauen Sie ein bisschen aus dem Fenster? Es ist ein wunderbarer Tag heute, nicht wahr?«
»Ja, ein wunderbarer Tag, und ich würde so furchtbar gern hinaus in den Garten gehen. Das Unkraut wuchert schon zwischen den Rosenstöcken.«
»Vielleicht morgen, Frau Kreiling. Ihr Knöchel ist noch immer nicht in Ordnung, der Sturz war wirklich schlimm. Wir wollen doch keine Komplikationen, nicht wahr?«
Während der letzten Worte hob sie eine Spritze gegen das einfallende Licht und spritzte ein wenig von dem Medikament in die Luft. Feuchtigkeit traf Mechthild Kreilings Wange, ihre Lider zuckten.
»So, dann halten Sie schön still, damit es nicht wehtut.«
Mechthild spürte die Nadel kaum, dafür aber die Flüssigkeit, die in ihre Blutbahn gedrückt wurde. Sie meinte sogar, sie auf ihrem Weg zum Herzen verfolgen zu können, meinte zu spüren, wie sie sich von dort aus in ihrem Kopf breitmachte und sich wie ein Schleier um ihre Gedanken legte. Ihre Lider begannen zu flattern, sie fühlte sich müde, nur noch müde …
»Wie geht es Fiodora … bekommt sie ihr Futter … regelmäßig ihr Futter?«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Kreiling, ich kümmere mich um Ihre Ziege. Jetzt ist Zeit für Ihr Mittagsschläfchen.«
Die große Frau hob die alte Dame aus dem Rollstuhl, trug sie zum Bett hinüber und legte sie darauf ab. Nachdem sie sie zugedeckt hatte, trat sie ans Fenster. Von der gelblichen Gardine geschützt, spähte sie hinaus. Die nächsten Häuser standen nicht weit entfernt, und irgendwo jenseits der Hügel, die sich sanft hinter diesen Häusern erhoben, lag der Schneiderhof.
Anna Schneider saß tief über den Schreibtisch gebeugt im Büro ihres Mannes. Die Lampe mit dem grünen Schirm warf einen zerfließenden Lichtschein auf die große Platte aus Eichenholz, eine kleine, leuchtende Insel in einem Meer aus stiller Dunkelheit. Anna trug ihre Lesebrille. Vor ihr lag ein schwarzer Aktenordner. Er war alt und abgestoßen, die Deckel verbogen. Dieser Ordner hatte niemals sauber und ordentlich in einem Regal gestanden. Seit mehr als zwanzig Jahren lag er unter alten Leinen versteckt in einem Karton, der Karton ebenfalls versteckt in einer Nische auf dem Dachboden. Dort hätte er alle Zeiten überdauern sollen, denn was er enthielt, hatten Edgar und sie versucht, dem Vergessen zu überantworten. Dass ihr dies jedoch niemals würde gelingen können, hatte Anna verstanden, als sie den Karton, ohne suchen zu müssen, auf Anhieb gefunden hatte.
Die Papiere waren allesamt vorhanden. Vergilbt zwar, und manche von ihnen fühlten sich bereits an wie brüchiges Pergament, doch die Worte darauf hatten sich in den letzten zwei Jahrzehnten nicht geändert. Anna fuhr mit dem Zeigefinger über eine ihrer Unterschriften. Als sie diesen Stift geführt hatte, war sie dreißig Jahre jung gewesen. Daneben hatte sich Edgar verewigt. Schon damals hatte seine Unterschrift viel mehr Raum eingenommen als ihre. So viel Zeit war so unglaublich schnell vergangen, trotzdem stellte Anna nun fest, dass nichts vergessen war. Verdrängt, verschüttet, eingestaubt, ja, natürlich, aber nicht vergessen. Dieser Moment war wie eine Zeitreise. Wie beim Betrachten eines Films konnte sie verschiedene Szenen vor ihrem geistigen Auge sehen. Es war ein langer und harter Kampf gewesen, den sie ohne Edgar weder durchgestanden noch gewonnen hätte.
Die Tür zum Büro wurde geöffnet.
Anna klappte rasch den Deckel des Ordners zu und richtete sich auf. Mit dem Lichtschimmer der kleinen Stehlampe auf dem Flur erschien ihr Mann im Türrahmen. Noch ehe er den Raum betrat, roch sie sein Rasierwasser und den feinen Limonenduft des Duschgels. Sein weißes Haar war noch feucht und darum eine Nuance dunkler als sonst. Er trug Bademantel und Hausschuhe.
»Was machst du hier?«, fragte er.
»Schließ die Tür«, sagte Anna leise.
Edgar drückte sie sacht und geräuschlos ins Schloss, dann kam er zum Schreibtisch. Er beugte sich hinunter und küsste ihr Haar in der Nähe des Scheitels. Anna spürte die Wärme der Dusche. Sie legte ihren Kopf an seine Hüfte.
»Schläft Sebastian?«
»Ich denke schon. Ich habe eben nichts mehr gehört. Er war ja auch ziemlich erschöpft, und wenn so ein Schock erst mal nachlässt, schläft man wie ein Murmeltier im Winter.«
»Ich bin so froh, dass ihm bei dem Unfall nichts passiert ist.«
»Ich auch, und er wohl am allermeisten. Aber warum sitzt du hier? Und was siehst du dir an?«
Anna beließ ihre Hände noch auf dem Ordnerdeckel.
»Während der Fahrt ins Krankenhaus ist mir so viel durch den Kopf gegangen. Ich musste immer wieder daran denken, wie schnell ein Leben enden kann … und auch, dass wir beide nicht mehr alle Zeit der Welt haben. Weißt du, man lebt und arbeitet so vor sich hin, schaut kaum einmal nach rechts oder links und merkt gar nicht, wie der Sand im oberen Teil der Uhr immer weniger wird. Irgendwann ist man dann völlig überrascht, wenn man nach unten rutscht. Vielleicht ist so ein Unfall auch dazu gut, um mal wieder innezuhalten, nachzudenken und eventuell alte Entscheidungen zu überdenken.«
Edgar runzelte die Stirn und sah seine Frau verständnislos an. Dann jedoch klärten sich seine Gesichtszüge – bevor sich erneut ein Schatten darüberlegte.
»Anna, was siehst du dir an?«
Weil der Klang seiner Stimme unmissverständlich war, nahm Anna ihre Hände von dem Aktenordner. »Erinnerst du dich noch?«
Ein Flüstern wie der Flügelschlag eines Nachtfalters.
Edgar musste nur einen kurzen Blick darauf werfen, um zu erkennen, um was für einen Ordner es sich handelte. Er seufzte vernehmlich. »Natürlich erinnere ich mich. Aber was soll das? Hatten wir nicht abgesprochen, dass er für alle Zeiten in seinem Versteck bleibt?«
»Ich weiß … ich weiß.«
Anna rutschte zur Seite und bedeutete Edgar, er möge sich neben sie setzen. Der Schreibtischstuhl sank unter ihrer beider Gewicht tief ein. Edgar legte seinen Arm um ihre Schulter. »Warum hast du ihn hervorgeholt? Wegen des Unfalls?«
»Auch, ja. Aber nicht nur.«
»Und warum noch?«
Anna öffnete eine Schublade, hob ein Paket Druckerpapier an und zog den zerknitterten, notdürftig geglätteten Brief hervor. Sie legte ihn neben den Ordner. »Deshalb.«
Edgar seufzte noch lauter und schüttelte den Kopf. »Ich hab es mir schon gedacht. Warum hast du ihn nicht einfach im Mülleimer gelassen? Warum machst du dich verrückt wegen einer dummen Verwechslung?«
Sie sah ihn an. »Und wenn es keine ist?«
»Es ist eine!«
»Ich meine ja nur …«
»Nein, Anna!«
Edgar stand ruckartig auf, ging zum Fenster und sah hinaus in die Dunkelheit. »Allein schon die letztendliche Konsequenz deiner Befürchtungen müsste dir sagen, dass es unmöglich ist. Es ist nichts weiter als eine dumme Verwechslung. Irgendjemand bei der Post öffnet Briefe, liest sie und steckt sie wieder zurück. Dabei ist ihm ein Fehler unterlaufen.«
Er kam zum Schreibtisch zurück, stützte sich mit den Händen ab, sah sie an.»Eine andere Erklärung gibt es nicht. Was du dir zusammenreimst, kann nicht sein.«
»Aber diese Liedstrophe … und diese Worte, sie klingen wie eine Drohung. Was, wenn man uns damals belogen hat?«
Edgar schnappte sich den Brief, hielt ihn unter die Lampe und las. Dann schüttelte er den Kopf, knüllte den lila Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb.
Donnerstag
Blutroter, giftiger Nebel steigt vom Boden auf, hüllt ihn ein, frisst sich durch seine Haut in den Körper. Er presst die Lippen fest aufeinander, hält die Luft an. Nur nicht atmen, nicht atmen, denn sobald dieses rote Gift in deinen Mund eindringt, bist du verloren. Du darfst auf keinen Fall atmen! Und doch reißt er den Mund auf und saugt die ätzende rote Substanz ein, als sei sie reine, klare Bergluft. Der Schmerz kommt sofort, ist enorm und unerträglich. Seine Lunge verkrampft sich, ist plötzlich nicht mehr in der Lage, seinen Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Weit reißt er den Mund auf, ringt und kämpft, röchelt und krepiert …
Keuchend und grunzend kam Sebastian zu sich. Seine Hand schnellte zum Nachtschränkchen, ein geübter Griff, der Aerosol-Inhalator stand an seinem Platz, immer. Er presste sich das Munstück gegen die Lippen, sprühte und atmete das krampflösende Medikament ein. Augenblicklich brachte es ihm Linderung. Tief Luft holend sank er in die Kissen zurück, schloss die Augen, horchte in sich hinein und stellte fest, dass alles wieder in Ordnung war. Als er die Augen öffnete, sah er schwaches graues Licht durchs Fenster hereindämmern. Der Morgen war nicht mehr weit entfernt. Ein Blick auf die lumineszierenden Ziffern und Zeiger des Weckers bestätigte dies. Fast fünf.
Verdammter Mist, schon wieder!
Verschwitzt in seinem Bett liegend traf Sebastian eine Entscheidung, die er seit gestern vor sich her schob. Seine Annahme, die Worte der Krankenschwester würden reichen, hatte sich als Irrtum erwiesen. Das tote, blutüberströmte Gesicht der Frau war ihm bereits gestern Nacht erschienen und hatte einen Erstickungsanfall ausgelöst. Diese Anfälle kannte er, seit er denken konnte, allerdings nicht in dieser Häufigkeit. Stress, schlechte Träume, aber auch ungewohnte Situationen konnten dazu führen, dass sich die Bronchialäste seiner Lunge verkrampften. Die Ursache dieser Anfälle, die er ausschließlich nachts bekam, vermuteten die Ärzte im vegetativen Nervensystem – eine schwammige Diagnose, die eigentlich nichts erklärte. Die Ursache für die letzten beiden Anfälle lag auf der Hand, und es war denkbar einfach, sie aus dem Weg zu räumen.
Bis zum Aufstehen dachte er darüber nach, wie es sich am besten bewerkstelligen ließ. Nachdem er geduscht hatte, durchsuchte er in dem leer stehenden Zimmer neben dem Bad einige Kartons, in denen er ausgediente Fachbücher aufbewahrte, die er während des Studiums gebraucht hatte. Nach dem Frühstück lieh er sich den Land Rover seiner Eltern, fuhr in die Stadt, kaufte bei einem Floristen einen Strauß frischer bunter Sommerblumen und machte sich auf den Weg ins Krankenhaus.
Er fand schnell eine Lücke im Parkhaus, stellte den Motor ab, blieb aber noch sitzen. Bisher hatte der Morgen aus Planung und Aktivität bestanden, ohne Platz für Zweifel. Jetzt aber, kurz vor dem entscheidenden Schritt, war der Zweifel wieder da. Eine völlig Fremde, und er brachte ihr Blumen mit. Wie musste das auf sie wirken? Machte er sich damit nicht zum Idioten?
Und wenn schon, es spielte keine Rolle. Wenn er seinen ungestörten Nachtschlaf wiederhaben wollte, musste er sich davon überzeugen, dass die Frau lebte.
Also los! Sei kein Feigling!
An der Information erkundigte er sich nach dem Namen, den ihm die Schwester in der Notaufnahme genannt hatte: Eschenbach! Er bekam die Zimmernummer und fuhr mit dem Lift in die vierte Etage.
Vor der Tür mit der Nummer 478 blieb Sebastian stehen. Er atmete tief ein. Klemmte sich das in Geschenkpapier gehüllte Buch unter die Achsel, wechselte die Blumen in die linke Hand, ballte die rechte zur Faust, führte sie zur Tür und … verharrte. Starrte auf die Knöchel seiner erhobenen Hand. Sollte er wirklich? War das Ganze nicht doch eine blöde Idee? Er machte sich nicht gern zum Narren, und wenn die Frau …
Plötzlich kam ein Pfleger um die Ecke des Ganges. Sebastian kam sich ertappt vor und klopfte. Das leise Herein kam schneller, als ihm recht war.
Er öffnete die Tür und trat ein. In dem Zimmer standen zwei Betten, doch nur das eine nahe dem Fenster war belegt. Die Frau darin schaute ihn fragend an. Ihr schwarzes Haar glänzte metallen im einfallenden Sonnenlicht. Links auf ihrer Stirn klebte ein großes Pflaster. Auf dem ordentlichen Laken über ihrem Bauch lag ein aufgeklapptes Buch.
»Frau Tiegel ist heute früh entlassen worden«, sagte sie, und Sebastian begriff, dass er sie anstarrte.
»Oh … nein, ich wollte nicht … ich suche Frau Eschenbach.«
»Dann brauchen Sie nicht weitersuchen. Ich bin Frau Eschenbach. Kennen wir uns?«
Sebastian ging einen Schritt auf das Bett zu. Ihre Augen folgten ihm.
»Ja, aber nur flüchtig.«
Sie starrte ihn an. Ihre Augen waren genauso dunkel wie ihr Haar. Plötzlich schien sie zu verstehen, die Augen wurden groß, ihre Lippen öffneten sich, sie stemmte sich in eine sitzende Position.
»Nein!« Das Wort fiel geradezu aus ihrem Mund. »Sagen Sie bitte nicht, Sie sind …«
Sebastian nickte. »Doch, bin ich.«
Ihre Gesichtszüge entglitten ihr, sie schlug beide Hände vors Gesicht und stöhnte verzweifelt. »O Gott!«, hörte Sebastian sie durch den Schalldämpfer ihrer Hände sagen. »Das ist mir so peinlich.«
Sie nahm die Hände herunter und brachte ein ziemlich schiefes Lächeln zustande.
»Und Sie bringen mir auch noch Blumen mit. Ausgerechnet mir!«