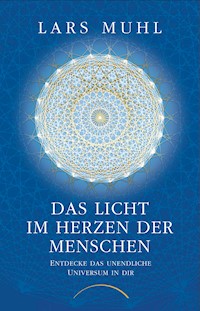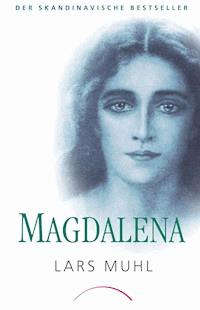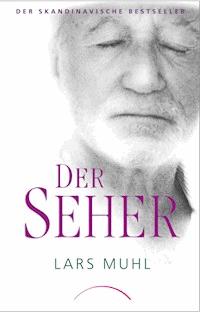
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: J. Kamphausen Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Diese Begegnung verändert Ihr Leben Der in Skandinavien erfolgreiche Musiker Lars Muhl ist für drei Jahre ans Bett gefesselt. Traurigkeit, Einsamkeit und Verzweiflung gehören in dieser Zeit zu seinem Alltag. Erst ein Telefonat mit einem Fremden bringt die Veränderung. Am Hörer: Der Seher. So beginnt der fesselnde Bericht über seine philosophische Suche und mystische Reise. Wir reisen mit Lars Muhl nach Montsegur, einem abgelegenen Bergdorf und Schloss in Südfrankreich, wo er den Seher trifft und seine spannende spirituelle Entwicklung fortsetzt. Ein herausforderndes Abenteuer nimmt seinen Lauf. Geschrieben mit außerordentlicher Energie, Aufrichtigkeit und Demut. Begleiten Sie den Autor bei seiner lebensverändernden Begegnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Übersetzt von: The Seer
Copyright © 2012 by Lars Muhl, published by Watkins Publishing UK
Titel der Originalausgabe: Seeren fra Andalusien
Copyright © 2002 by Lars Muhl, published Gilalai Aps
Lars MuhlDer Seher
Projektmanagement:
Marianne Nentwig
Übersetzung+Lektorat:
Viviane Korn
Gestaltung Umschlag/Innenteil:
Wilfried Klei
Coverfoto:
© Jan. L. Asmussen
Autorenfoto:
© Ole Bernt Frøshaug
E-Book Gesamtherstellung:
Bookwire GmbH, Frankfurt a. M.
© J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld 2016
[email protected] | www.weltinnenraum.de
ISBN Printausgabe: 978-3-95883-103-2
ISBN E-Book: 978-3-95883-104-9
1. Auflage 2016
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
DER
SEHER
LARS MUHL
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Worterklärungen
Bedeutsame Begegnung
Leben als geistige Schulung
Über den Verlag
1
Es war ein eiskalter Tag im Februar. Einer der Tage, an denen Kopenhagens Hauptbahnhof alles andere als einladend wirkt. Ich manövrierte meinen Koffer die Treppen hoch, um dem beißenden Wind, der vom Bahnsteig her blies, zu entkommen, und übersah absichtlich die Bettler und Obdachlosen, die auf Zeitungen saßen und den Vorübereilenden ihre hellblauen Sammeldosen entgegenhielten. Mein eigenes Budget war äußerst angespannt und mir war schwindelig und übel. Ich war ganz und gar nicht ich selbst. Hatte ich irgendetwas missverstanden, dass ich so sehr das Gleichgewicht verlor? Und das gerade jetzt, wo ich vor der wahrscheinlich wichtigsten Reise meines Lebens stand.
Ich trank in der Cafeteria ein Mineralwasser und fand eine Ecke, in der ich ungestört sitzen und wieder zu mir kommen konnte. Der Nachtzug nach Köln sollte erst in einigen Stunden fahren. Obwohl ich mir einbildete, schon einen großen Teil des Weges geschafft zu haben, saß ich doch da und fühlte mich wie ein hilfloser Anfänger. Vor zwei Tagen hatte ich vergebens versucht, den Reisebericht an eine große Zeitung zu verkaufen. Woher sollten die auch wissen, dass eine Zugfahrt in den Süden Spaniens heutzutage exotischer sein kann als ein Flug zum Südpol, allein schon deshalb, weil sie viel länger dauert? Im Reisebüro der dänischen Staatsbahnen wusste man das. Es war seit Jahren die erste Reise dieser Art, die sie verkauft hatten.
„Sind Sie sicher?“ fragte die Dame neugierig und voll Verwunderung, als ich die Fahrkarte reservierte.
Ich wollte ihr nicht unbedingt erklären, dass ich vor Jahren aufgehört hatte zu fliegen, musste aber lächeln angesichts des Paradoxes, dass ich mich auf eine zweitägige Zugreise nach Spanien begab, um im Grunde doch zu fliegen. Na ja, nicht mit dem Flugzeug, aber immerhin …
Der charakteristische, fettige Geruch des Tagesgerichtes – Fleisch, Soße, Rotkohl und Kartoffeln – mischte sich mit dem Gestank von zuviel Rauch und Nikotin, sodass mir übel wurde und ich mich konzentrieren musste, um mich nicht auf der Stelle zu übergeben. Obwohl es warm war und ich den Schweiß auf der Stirn spüren konnte, fror ich. Dabei zitterte ich so sehr, dass ich meine Flasche Wasser mit beiden Händen festhalten musste. Ich trank einen Schluck und versuchte, an etwas anderes zu denken.
„Sitzt da nicht Lars Muhl?“ Eine übertrieben optimistische Stimme durchschnitt den Lärm von Geschirr und Besteck. Ich blickte auf und nickte automatisch. Ein erwachsener Mann hielt mir Serviette und Kugelschreiber hin.
„Könnte ich ein Autogramm von Ihnen haben?“
Er lächelte das Mädchen an seiner Seite an, vermutlich seine Tochter. Mir wurde übel. Schweiß strömte mir über das Gesicht. Ich ergriff den Kugelschreiber und schrieb, während ich mich von der Bank erhob. Dann lief ich, so schnell ich konnte, zur Toilette.
Als ich zurückkam, waren der Mann und seine Tochter verschwunden. Es war seit Jahren das erste Autogramm, das ich geschrieben hatte. Und das gerade jetzt, wo ich das alles für immer hinter mich gebracht hatte. Am Nachbartisch saß eine Frau mittleren Alters und klammerte sich an ihr Bier. Mürrisch und missbilligend guckte sie mich durch ein blaues Auge an, und ich konnte beinahe hören, wie sie dachte: „Was zum Teufel glaubst du, wer du bist?“ Nun ja, genau das wüsste ich auch sehr gerne. Ich schloss die Augen und versuchte, mich auf meine jetzige Situation zu konzentrieren. Aber irgendwie wanderten meine Gedanken immer wieder zurück. Zurück zu jenem Tag, an dem meine Karriere als Sänger definitiv endete und meine jetzige Reise begann. Zurück zu all dem, was dem Hier und Jetzt vorausgegangen war.
Ich bin mir immer darüber im Klaren gewesen, dass eine Person mehr ist als ihre Persönlichkeit, dass der wirkliche Mensch sich irgendwo hinter all den Verteidigungslinien und Schutzmechanismen wie Titel, Karriere und Job befindet, dass, egal wie bekannt, reich und umschwärmt man ist, es in der ganzen Welt nicht genug Fans, Geld und Aufmerksamkeit gibt, um das Loch zu stopfen und den Schmerz zu betäuben, den dieser ganze Zirkus mit sich bringt. Ich wusste immer schon, dass, egal wie verschieden unsere Lebensbedingungen sind und egal wo wir uns auf der sozialen Leiter befinden, alles letzten Endes merkwürdig illusorisch erscheint, wenn man es aus der Perspektive der Ewigkeit betrachtet.
Seit meiner Kindheit kenne ich eine andere Wirklichkeit. Zwischen meinem zehnten und zwölften Lebensjahr hatte ich jeden Abend, ehe ich einschlief, fremdartige, schmerzhafte Kundalini-Erfahrungen, was dazu führte, dass ich in diesen Jahren fast nicht schlief. Da ich mit niemandem über diese Erlebnisse reden konnte, wurde ich immer introvertierter und war kaum noch in der Lage, meinen Alltag zu meistern. Situationen, in denen ich mit anderen Menschen zu tun hatte, bereiteten mir Probleme und auch in der Schule wurde ich immer schlechter. Das hinderte mich jedoch nicht daran, selbst zu lesen. Als ich fünfzehn war, erhielt ich mit der Post das Buch des Sufi-Mystikers Hazrat Inayat Khan Gayan, Vadan, Nirtan. Von wem, weiß ich nicht. Aber das Buch war eine Offenbarung und inspirierte mich, andere von Khans Büchern zu lesen. Das Problem war nur, dass alles, was ich las und studierte, irgendwie an mein Wissen von einer anderen Wirklichkeit anknüpfte und sich daher in völligem Gegensatz zu dem befand, was ich in der Schule zu lernen hatte. Als ich diese 1966 schließlich verließ, um mich in das intensive Leben eines Musikers zu stürzen, geschah es in der Hoffnung, dass dies die Wirklichkeit, die mich so verdammt einsam gemacht hatte und für die sich niemand außer mir zu interessieren schien, ein für allemal verdrängen würde.
Mein Vorhaben schien zu gelingen, bis das Schicksal die Band, in der ich spielte, 1969 für eine mehrmonatige Tournee nach Israel führte. Wir spielten für die Soldaten in den Ferienlagern der Armee, für die Studenten an den Universitäten, für die jungen Leute in Clubs und Diskotheken. Drogen waren fast obligatorisch, aber in Israel damals unglücklicherweise auch verboten. Bei einer Razzia im Hotel wurden wir mit Haschisch und Amphetaminen erwischt und mussten etwa eine Woche in dem berüchtigten Untersuchungsgefängnis in Jaffa außerhalb von Tel Aviv verbringen. Eine steinerne Pritsche zum Schlafen, kaltes Wasser zum Waschen, ein Loch in der Mitte der Zelle zum Verrichten der Notdurft und ein paar äußerst primitive Umgangsformen unter den Mitgefangenen und Gefängniswärtern weckten mich aus meinem Dornröschenschlaf.
Auf einer Runde im Gefängnishof zeigte mir ein Mithäftling die Löcher in der Erde, jedes zwei mal zwei Meter groß, in denen man die Geisteskranken, Mörder und Sexualverbrecher „verwahrte“. Dort saßen sie, jeder in seinem Loch mit einem eisernen Gitter über dem Kopf; tagsüber war es ein brennender Ofen, in der Nacht ein eisiger Kühlschrank. Jedes Mal, wenn ein Häftling vorbeiging und die unglücklichen Kreaturen bespuckte oder mit Steinen bewarf, reagierten sie mit unartikuliertem, hysterischem Geheul und infernalischem Lärm, der dadurch entstand, dass sie ihre Ketten gegen die Eisengitter schlugen. Es war schwer nachzuvollziehen, dass der amerikanische Astronaut Armstrong fast zur gleichen Zeit seinen Fuß mit den Worten: „Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit“ auf den Mond setzte. Ich für meinen Teil konnte es jedenfalls nicht verstehen. Was sollte das bedeuten? War das ein kosmischer Witz oder ein Teil der Art, wie zivilisierte Menschen den ultimativen Dualismus pflegten, der das Leben immer in schwarz und weiß, Himmel und Hölle aufteilte?
Es war, als ob alles, was während der drei Monate in Israel passierte, meinen Sinn für das Übernatürliche, den ich bis dahin verzweifelt zu verstecken versucht hatte, schärfte. Ich weiß nicht, ob es mit der uralten, historischen Umgebung und all ihren Mythen und religiösen Traditionen zu tun hatte, jedenfalls hatte ich immer wieder Visionen von einer längst vergangenen Zeit und hörte Stimmen aus einer fremden und doch vertrauten Welt. Außerdem traf ich zum ersten Mal in meinem Leben einen anderen Menschen, dem es genauso ging wie mir: Simon. Ein dreizehnjähriger jüdischer Junge, der auch von dieser anderen Wirklichkeit wusste.
Eines Tages, als ich auf unserer Terrasse zur Straße hin saß, ging er zufällig vorüber. Schon als ich ihn von weitem auf mich zukommen sah, wusste ich, wer er war. Als er die Terrasse erreicht hatte, blieb er stehen. Auch er hatte mich erkannt. Ich lud ihn zum Tee ein und von da an sahen wir uns fast täglich. Eines Tages schenkte er mir eine Kette mit einem Anhänger, den er filigran bearbeitet hatte. Es war eine Kugel mit einem Stück Zedernholz darin, an der ein spiralförmiger Kegel besfestigt war. Die Kugel symbolisierte die Erde, das kleine Stückchen Zedernholz König Salomons Tempelbaum (den Kosmischen Baum, der magische Kraft besaß) und die Spirale den ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt sowie die Verwandlung von Materie in Geist. Als ich ihn anlegte, durchströmte mich ein großes und bestätigendes JA. Es fühlte sich wie ein Segen an.
Meine Begegnung mit Simon und meine übernatürlichen Erlebnisse veranlassten mich zu glauben, dass ich nun den Ort gefunden hatte, wo ich hingehörte, und in meiner Euphorie vergaß ich die Realität um mich herum. Vielleicht ist an dem Spruch, dass eine Kette nicht stärker ist als ihr schwächstes Glied, etwas dran, denn eines Tages entdeckte ich, dass die Kette mit dem Schmuckstück weg war. Es war wie ein böses Omen. Und doch ein erneutes Erwachen. Diesmal zu der unvermeidlichen Tatsache, dass es Zeit war, nach Hause zurückzukehren. Kurz vor der Abreise hatte ich meine erste außerkörperliche Erfahrung.
Jetzt, mehr als dreißig Jahre später, saß ich in Kopenhagens Hauptbahnhof und fühlte mich auf andere Weise vom Körper losgelöst – eher fehl am Platz. Wer oder was hatte mich hierher bestellt? War es die Zeit – meine Zeit —, die endgültig dabei war, den Punkt der Ewigkeit zu erreichen, an dem sich ihre Enden verbinden und zwei Wirklichkeiten zu einer werden?
Jedes Leben ist eine Reise und meins war keine Ausnahme. Doch war ich in eine Sackgasse geraten oder näherte die Reise sich ihrem Ende? In vielerlei Hinsicht war mein Leben ein Fiasko, wenn man es aus der traditionellen Auffassung heraus betrachtete, was ein gutes Leben sei. Mehr als dreißig Jahre lang hatte ich einen ungleichen Kampf mit einer Karriere als Musiker und später als Sänger ausgefochten. Ich hatte es durchaus zu etwas gebracht, aber jedes Mal, wenn es ernst wurde, gab es etwas in mir, das in eine andere Richtung zog, weg von Öffentlichkeit und Oberflächlichkeit, von Promotion und Pflicht. Und allmählich eroberte dieses Etwas mehr und mehr meine Wirklichkeit.
Jetzt saß ich hier und betrachtete das Ganze aus der Ferne. Ich sah die Lüge, mit der ich mich selbst betrogen und die mich in einem Zustand gefangen gehalten hatte, der zuletzt unerträglich geworden war, weil er mich krank machte. Viel zu lange hatte ich geglaubt, die beiden entgegengesetzten Wege miteinander vereinen zu können: einerseits ein Teil der Musikszene zu sein, mit allem, was dazu gehört, und andererseits wie ein Mystiker ein Leben in Stille und Vertiefung zu führen. Mich einerseits in einer statischen, einspurigen, einseitig intellektuellen und ausschließlich materiell fixierten Welt zu bewegen, und gleichzeitig die andere, verborgene und völlig andersartige Wirklichkeit wiederzuentdecken und mit ihr vertraut zu werden – das war einfach unmöglich! Als ich beim Roskilde Festival 1991 im großen Zelt auf der Bühne stand, überfiel mich mitten im Song urplötzlich die Frage: „Was machst du eigentlich hier?“ Auf einmal konnte ich mich selbst von außen sehen, konnte hören, wie ich mit dem Publikum redete, wie ich mit einem heiseren „Hey, Hey, Hey“ versuchte, die Fassung wiederzugewinnen und die Verbindung zur Festival-Wirklichkeit wiederherzustellen, die sich langsam in einem Dunst von Bier und besinnungslosem Rausch auflöste. Es war absolut surreal und natürlich unmöglich; denn, wenn man erst mal mitten in einem Ritt ist, ist es zu spät, das Pferd zu wechseln. Noch am gleichen Abend entschloss ich mich, die Tournee zu beenden, und noch im gleichen Jahr verließ ich meine Heimatstadt und zog auf eine kleine Insel.
„Der Zug nach Köln, Abfahrt 18:45 Uhr, fährt in zirka dreißig Minuten auf Gleis drei ein“, verkündete eine metallische Stimme aus dem Lautsprecher.
Ich schaute auf meine Armbanduhr. Ich fühlte mich wie eine Insel im Meer der mit Dunst und essenden Menschen gefüllten Cafeteria. Es gab kaum noch einen freien Platz. Ich kaufte noch ein Mineralwasser. Schwindel und Übelkeit waren jetzt fast weg. Draußen in der Ankunftshalle hatten die Bettler sich zitternd und frierend auf die Bänke verteilt und versuchten zusammengekauert den letzten Rest Wärme zu bewahren. Die Vorübereilenden würdigten sie keines Blickes. Völlig zugeknöpft, den Blick starr nach vorn gerichtet, sah es im Großen und Ganzen so aus, als sei da sowieso niemand, der merkte, was um ihn herum geschah. Alle hatten anscheinend an sich selbst genug. Was sie wohl dachten? Wohin sie wohl unterwegs waren? Und was war mit mir? Hatte ich nicht genug an mir selbst? Hatte sich meine Fähigkeit, mich in sozialen Zusammenhängen zu bewegen, verbessert, seit ich mich auf eine Insel zurückgezogen hatte? Wohl kaum. Aber ich hatte es getan, weil ich es tun musste.
Wie oft hatte ich schon Menschen getroffen, die sich wünschten, wohlhabend genug zu sein, um sich ins ländliche Idyll zurückziehen und sich selbst zu verwirklichen. Aber so war es ja gar nicht. Ich war nicht wohlhabend. Im Gegenteil. Der materielle Verzicht, den der Zusammenbruch meiner Karriere verursacht hatte, würde den meisten Menschen in einem Wohlfahrtsstaat Alpträume verursachen. Der Prozess, den ich durchgemacht hatte, war eine widersinnige Mischung aus existenzieller Demontage und mentalem Zusammenbruch.
Als ich mich auf der Insel eingelebt hatte, fing ich an zu schreiben, was ich als natürlichen Bestandteil meiner Aufgabe, in meinem Leben aufzuräumen, verstand. Nach und nach begann ich zu verstehen, dass die Sprache ein wichtiger Teil meiner Verwandlung war, und nach der Veröffentlichung meines ersten Buches folgten weitere. Ich war so fasziniert von den ersten taoistischen und buddhistischen Schriften, dass ich mich weiteren umfangreichen, vergleichenden Studien der Religion, der christlichen Mystiker, des Sufismus, verschiedener okkulter Richtungen und der christlichen Ketzerbewegungen zuwandte. Zuletzt hatte ich ein Selbststudium in Aramäisch begonnen, der Sprache, die Yeshua (Jesus) vermutlich gesprochen hat. Tägliche Phasen der Stille und Meditation vergrößerten den Abstand zu meinem früheren Leben immer mehr. Aber irgendetwas in mir hielt selbstgefällig an dem letzten, kleinen, verhärteten Rest dessen, was noch von meiner kunterbunten Karriere im Showgeschäft übrig war, fest.
Bis zu dem Tag, an dem die Umstände mir halfen, endlich den Entschluss zu fassen, vor dem ich ständig zurückgewichen war. Während der Aufnahme von „Mandolina“, das, wie sich später herausstellte, mein letztes Album sein sollte, teilte das Plattenlabel mir mit, dass man nach der Fusion mit einer multinationalen Gesellschaft beschlossen hatte, die Zusammenarbeit zu beenden (ehe sie richtig angefangen hatte), aus Gründen, die ich nie erfahren habe. Das bedeutete, dass der Vertrag, den wir gerade abgeschlossen hatten und der die Aufnahme einer weiteren Platte beinhaltete, gekündigt wurde. Das Label akzeptierte nur widerstrebend, dass ich das, was ich gerade tat, beenden wollte. Die viele Arbeit, die ich bereits investiert hatte, war zwar nicht völlig umsonst gewesen, dennoch wurde die Platte auf jeden Fall unvollendet veröffentlicht. Es war in vielerlei Hinsicht sehr frustrierend.
Die Branche war mir nicht mehr wohlgesonnen. Die kommerziellen Erwartungen an meine Songs waren nicht erfüllt worden und von einem Tag auf den anderen stand ich ohne die Einnahmen da, von denen ich hätte leben sollen.
War das alles Ironie des Schicksals oder die Folge des Versuchs einer immer kommerzieller werdenden Branche, das Plattengeschäft von den letzten fremdartigen Elementen zu säubern? Ich musste an ein Gespräch zwischen zwei Direktoren der Musikbranche denken, dass ich einmal zufällig mit angehört hatte, in dem der eine trocken bemerkte, dass abgesehen von den Künstlern das Musikbusiness eigentlich kein schlechter Arbeitsplatz sei.
Ein umfassender Teil meines Lebens schien vorüber zu sein. Es passierte einfach so, wie mit einem Fingerschnippsen. Erst später verstand ich, dass es einem lange nicht verziehen wird, wenn man sich dem Rampenlicht entzieht, da es ja nun einmal das Rampenlicht ist, von dem die meisten Künstler glauben, dass sie es mehr oder weniger zum Leben brauchen. Mein Problem war jedoch, dass ich nicht dorthin gehörte. Nun begann also der rasante Abstieg. Der Abstand zwischen den Anrufen wurde immer größer und zum Schluss hörte das Telefon ganz auf zu klingeln. Und als ich herausfand, dass ich selbst auch niemanden hatte, den ich hätte anrufen können, zog ich den Stecker raus und kündigte meinen Vertrag. Ich hatte bekommen, was ich wollte. War es nicht so? Auch wenn es bedeutete, dass meine ökonomische Situation sich von einem Tag auf den anderen vom Erträglichen ins beinahe Unterträgliche entwickelte, so hatte ich vielleicht doch endlich den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab. Vielleicht war ich endlich dabei einzusehen, dass es an der Zeit war, mich um mein wirkliches Selbst zu kümmern. Verstand ich endlich, dass das Leben zu kurz war, um es mit Belanglosigkeiten zu vergeuden?
„Der Zug nach Köln fährt in wenigen Minuten auf Gleis drei ein!“
Mir wurde schwindlig, als ich mich bückte, um meine Koffer zu nehmen. Aber als ich die Ankunftshalle durchquerte, spürte ich einen leichten, elektrischen Impuls in meiner Wirbelsäule. Es fühlte sich an, wie eine ganz feine Spannung, deren Energie sich langsam im Rest meines Körpers verbreitete und jegliche Unpässlichkeit verschwinden ließ. Ich warf zwanzig Kronen in eine Sammeldose, ehe ich hinunter zum Gleis und dem wartenden Zug entgegenging.
2
Ich hob den Koffer auf das oberste Bett. Es war mit einer verblichenen Wolldecke und einem Laken bedeckt, das sehr stark nach einem undefinierbaren, kräftigen Desinfektionsmittel roch.
Mit dem Schlafwagen der 2. Klasse zu reisen, ist nur etwas für Menschen, die mit wenig Gepäck unterwegs sind. Alle Dimensionen entspringen einem minimalistischen und asketischen Weltbild. Die Größe von Schlafplatz, Waschraum und Toilette deuten an, dass das Reisen nur ein Übergang ist, nur ein diskretes Intermezzo in einer langen Reihe von Ankunft und Abfahrt, Willkommen und Abschied, Sehnsucht und Erwartung, Küssen und Umarmungen, Tränen und Traurigkeit, die man unterwegs erlebt und die die flüchtigen Stationen einer jeden Zugreise und eines jeden Lebens kennzeichnen. Paradoxerweise ist dies auch der Beweis dafür, dass der Mensch und sein Dasein mehr als ein zufälliges Geflecht unbeständiger Eigenschaften und unvorhersehbarer Einflüsse sind.
Das Leben ist Ausdruck eines Ganzen, egal wie fragmentarisch es scheinen mag. Es dauerte viele Jahre, ehe ich das begriff. Erst als ich mein eigenes Leben als so eingeschränkt und begrenzt empfand, dass ich meinte, nicht genug Platz zum „da sein“ zu haben, erst als ich all das verloren hatte, von dem ich glaubte, es nicht entbehren und ohne es nicht leben zu können, also all das, was in Wirklichkeit das Dasein kompliziert und unmöglich macht, erst da fing ich an zu ahnen, wie großartig und unbegrenzt das Leben in all seiner Einfachheit sein konnte. Aber diese Erkenntnis war schmerzhaft.
Anzudeuten, dass es vielleicht eine andere, offenere und viel freiere Wirklichkeit gab – dass ein Ton zum Beispiel pyramidenförmig sein konnte und Vergebung schneller als das Licht —, war dasselbe wie es darauf anzulegen, auf dem Scheiterhaufen einer betäubten Zeit voller lärmendem Schweigen und herablassendem Sarkasmus verbrannt zu werden. Das sage ich Ihnen!
Das Schlafwagenabteil war voll, als der Zug mühsam anfuhr. Der Geschäftsmann im Bett gegenüber hatte unter großer Anstrengung und einem minutiös ausgearbeiteten Ritual folgend seine Abendtoilette beendet und einen blau-weiss gestreiften Pyjama angezogen. Im Bett darunter kämpfte ein korpulenter Deutscher mit seinem ebenso korpulenten Gepäck, und noch weiter unten tauschten zwei junge Kopenhagener Bierdosen und schlechte Witze aus, während ein älterer Herr im Bett unter meinem schon lautstark schnarchte. Ich ließ sachte los und schwebte in die frostklare Sternennacht hinaus, über die Schlafwagen hinweg und hinein in unbekannte Tunnel und die schwarzen Löcher fremder Universen, zurück zu dem Jahr, in dem ich hilflos im entferntesten Winkel des Labyrinths feststeckte, in der verfallenen Sackgasse meines eigenen Lebens.
Es war das Jahr, in dem ich die dunkle Seite der Seele kennenlernte. Es geschah in Form einer Reihe von Anfällen, die auf physischer Ebene bewirkten, dass ich lähmende Schmerzen im Nacken hatte; mir war übel, ich verlor alle Energie und musste oft mehrere Tage hintereinander im Bett liegen. Es war, als ob ich in einem Niemandsland zwischen bewusst und unbewusst, zwischen Wachen und Schlafen, in einem Zustand beleierner Schwere gefangen war. Eingeschlossen in einer beinahe hermetisch abgeriegelten Folterkammer, in der alles schwer und träge und zerschlagen war. Jeglicher Gedanke verschwand in einem apathischen Dämmerzustand, noch ehe er gedacht war. Schon die Vorstellung, nach einem Glas Wasser zu greifen, erschien mir als so unüberwindlich, dass ich es meistens sein ließ. Wenn ich hin und wieder zu mir kam, schaffte ich es gerade noch zu denken, dass dies die Hölle sein müsse, ehe ich wieder in bodenloser Finsternis versank. Etwas Vergleichbares hatte ich nur 1962 erlebt, als ich an meinem ersten Buch arbeitete, das entstand, während ich mich in einem ähnlichen Trancezustand befand.
Zwei Monate lang lebte ich damals in demselben Zimmer von Kaffee und Aspirin, während ich auf meiner alten Schreibmaschine vor mich hin klapperte oder bewusstlos auf einem genauso alten Sofa lag. Tag und Nacht verschwanden in einem monotonen Nebel und nur das Schreiben verwandelte ihn in eine Art Euphorie; ein unwirklicher, psychosomatischer Zustand, der nicht aufhörte, ehe der letzte Punkt im Buch gesetzt war.
Jetzt war dieser Zustand wieder da und führte dazu, dass ich während immer längerer Zeiträume nicht arbeiten konnte. Eine Reihe von Arztbesuchen, Untersuchungen in Krankenhäusern, bei verschiedenen Spezialisten und Heilpraktikern brachten kein Resultat. Einmal lag ich zwei Wochen lang fast bewusstlos im Bett und konnte nichts zu mir nehmen als Kekse und Wasser. Sogar als ich bei meinem Nachbarn umkippte und den Rest des Tages im Krankenhaus mit Sauerstoffgerät und am Tropf verbringen musste, konnte man die Ursache meines Zustandes nicht finden. Mit der Zeit verstärkte sich mein Gefühl, dass ich die Musik hinter mir lassen musste, weil sie von diesem anderen Ding in den Hintergrund gedrängt wurde. Die Krise war also total. Nach mehr als zwei Jahren in diesem Zustand wollte ich nicht mehr länger leben.
Und dann geschah, was geschehen musste. Es passiert mindestens einmal im Leben eines jeden Menschen, auch wenn man es vielleicht nicht immer wahrnimmt. Der Zustand, in dem man sich befindet, ist von solcher Art, dass man leicht im Niemandsland von Schmerz und Selbstbezogenheit verschwinden kann, dort, wo alles verloren und unbeweglich ist. Aber die Zeit war reif, weil ich reif war, denn ich sah keinen anderen Ausweg mehr und hatte keinen Ort, an den ich gehen konnte. Man bekommt ein Zeichen oder es erscheint ein Engel. In meinem Fall geschah Letzteres. Ein Engel erschien in Gestalt einer Kollegin aus der langsam wachsenden, aber immer noch kleinen und unsichtbaren Familie. Sie gab mir die Telefonnummer, die alles auf den Kopf stellen würde.
„Ruf den Seher an und lass dir helfen!“ sagte sie, ehe sie sich wieder in Luft auflöste. Ich stand einfach nur da und starrte abwechselnd auf den Zettel, den sie mir in die Hand gedrückt hatte, und das Loch in der Luft, dass der Engel hinterlassen hatte. „Nur zwischen 8 und 9 Uhr“, stand in Klammern hinter der Telefonnummer.
Der Seher ?
An dem Abend machte ich einen langen Spaziergang auf der Frederiksberg Allé, bevor ich völlig erschöpft in meinem Zimmer im Webers Hotel ins Bett ging.
In der folgenden Nacht hatte ich einen Traum. Darin gehe ich eine lange, verlassene Straße entlang. Plötzlich endet sie, ich stehe am Rand eines Abgrunds und schaue ins Universum hinaus. Die Stille wird von einem kaum hörbaren und doch unfassbar schönen, tragenden und tiefen Ton unterstrichen. Der Klang der Materie, der alles zusammenhält, ergreifend und unaussprechbar. Ich höre, wie ich Worte auf Aramäisch spreche: „Nehwey sibyanak aykana d’shmaya aph b’arab.“ Ich erinnere mich. „Dein Wille geschehe im Himmel, also auch auf Erden.“ Jetzt verstehe ich, was diese Worte in Wirklichkeit bedeuten: „Lasse geschehen auf Erden, was in den Sternen geschrieben steht. Entfalte das Licht des Universums in jedem und durch jeden von uns, in Übereinstimmung mit den universellen Gesetzen.
Als ich aufwachte, war es halb neun. Ich spürte sofort wieder dieses dumpfe, bleierne Gefühl am Rande meines Bewusstseins. Es dauerte etwas, ehe ich mich an die Ereignisse des gestrigen Tages erinnerte. Dann tauchten der Traum, der Engel und die Telefonnummer wieder auf. Benommen kam ich auf die Beine und fing an, in Jacken- und Hosentaschen zu suchen. Ich hatte kein Glück. Ich fühlte Panik in mir aufsteigen. Es war, als ob ich bereits wüsste, was ich verlieren würde, wenn ich mir diese Sache entgehen ließe. Endlich. Ich fand den Zettel in der Brusttasche meines Hemdes. Ich wählte die Nummer und hielt den Atem an. Es dauerte eine Ewigkeit. An der Reihe wechselnder Signaltöne konnte ich hören, wie mein Anruf langsam vom Hotelnetz in das der Telefongesellschaft weitergeleitet wurde. Ich wollte gerade auflegen, als die Verbindung endlich zustande kam – es war besetzt. Im Bauch die Schmetterlinge eines ganzen Lebens. Ein Blick auf die Uhr. Fast neun. Abwarten und noch einmal versuchen. Immer noch besetzt. Zehn Minuten nach neun, ich kam durch. Ich saß da und dachte, dass mein Anruf in diesem Augenblick irgendwo bei einem fremden Menschen einen Ton hinterließ und dass dieser Mensch beim Aufhören des Klingeltons beschlossen hatte, meinen Anruf nicht zu beantworten. Ich ließ es noch eine Weile klingeln und legte dann den Hörer auf.
Zurück auf der Insel verbesserte sich mein Zustand und ich fand wieder zu meinem alten Rhythmus zurück, einem Wechsel zwischen meinem Studium des Aramäischen, das mich nun völlig in Anspruch nahm, und Zeiten, in denen mir schwindelig war. Mehrere Male war ich versucht, noch einmal die Nummer anzurufen, die ich erhalten hatte, aber aus irgendeinem Grund schob ich es immer wieder hinaus.
Während ich allmählich tiefer in die aramäische Sprache eindrang, eröffnete sich mir eine ganz neue Welt. Schon 1989 hatte Edith R. Stauffer von Psychosynthesis International mir die Kopie eines aramäischen Auszuges aus dem Neuen Testament geschickt – The Khaboris Manuscript. Aus dem ging hervor, dass Aramäisch die Transpersonale Psychologie so vollkommen ausdrückt, dass die Syntax gleichzeitig das Zusammenspiel von Gedanken, Erkenntnis, Wahrnehmung, Vernunft, Urteilskraft, Gemütsstruktur, Auffassungsgabe sowie von menschlichen Haltungen und Verhaltensweisen beschreiben kann. Es unterscheidet nicht zwischen dem Mentalen, dem Physischen, dem Emotionalen und dem Geistigen oder zwischen Ursache und Wirkung. Das bedeutet, dass jedes Wort, jeder Begriff in seiner Wurzel absolut neutral ist, aber durch das Hinzufügen der Endungen „-ta” oder „-oota” aktiviert und wertbestimmt wird. Das alles war für mich eine bahnbrechende Entdeckung, die Yeshuas Worten eine neue, tiefere Kraft und Bedeutung gab, als diejenige, die ich der üblichen griechischen Übersetzung des Neuen Testamentes entnehmen konnte. Und langsam fing ich an zu verstehen, dass nicht nur die Bedeutung der Worte, sondern auch ihr Klang sowohl auf der physischen wie auch auf der geistigen Ebene eine Wirkung haben.
Damals ahnte ich noch nicht, welche Rolle diese Studien später einmal spielen würden.
In dieser Zeit, in der ich am meisten mit Leshana Aramaya beschäftigt war, hatte ich eines morgens einen so heftigen Anfall, dass ich kaum aus dem Bett kam. Aber ich wusste, dass es hieß: jetzt oder nie. Der kleine Zettel mit der Telefonnummer war mit einer Stecknadel an der Wand in meinem Arbeitszimmer befestigt. Alle Vorbehalte und alle Schmetterlinge waren verflogen, als ich den Hörer abhob und die Nummer wählte.
„Ja?“, antwortete eine wohlartikulierte, neutrale Stimme.
Ich stellte mich vor.
„Womit kann ich Ihnen helfen?“, fragte die Stimme.
„Ich hätte gerne einen Termin“, antwortete ich.
„Ich habe erst in einem halben Jahr wieder etwas frei. Was ist Ihr Problem?“
Ich erklärte meinen Zustand, so gut es ging.
„Einen Augenblick, ich will sehen, was ich tun kann!“
Es hörte sich an, als hätte er den Hörer hingelegt. Ich lauschte dem Klang der Stille, die in dem Raum am Ende der Verbindung herrschte, eine Art sanftes, weißes Rauschen, das sich ins Unendliche auszudehnen schien. Wie lange ich so dasaß, weiß ich nicht, aber plötzlich war die Stimme wieder da:
„Alles wird in Ordnung sein, bis wir uns wiedertreffen!“
Er gab mir die Adresse und legte auf.
Die Nacht
(Maske von Anne Maria Galmez, 1989 – Foto: Jan Jul)
Völlig überwältigt saß ich da, den Hörer in der Hand, bis ich ihn schließlich nach einer ganzen Weile wieder an seinen Platz legen konnte. Ich ließ die Gedanken über die Felder vor meinem Fenster schweifen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, von einem Hammer getroffen zu werden, und ich wusste, dass ich zurück ins Bett musste, bevor ich in Ohnmacht fiel. Ich konnte gerade noch denken, dass dieser Seher nur wieder einer dieser Quacksalber sei, als ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf hinüberglitt.
„Köln, in einer halben Stunde!“, rief eine Stimme draußen auf dem Gang.